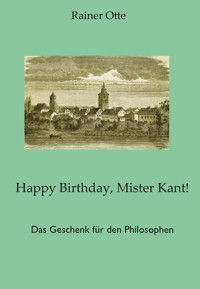Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit Äsop oder Jean de La Fontaine spuken Tiere im Kopf von Dichtern und Denkern. Im tradierten Fabelrevier sind sie mit einer recht handgreiflichen Moral unterwegs. Doch in charakteristischen philosophischen und literarischen Werken tritt uns ein ganz anderer Zoo entgegen. Dessen Tiere bevölkern komplexe geistige Ökotope. Für die schnelle Moral von der Geschicht' eignen die sich nicht. Um diese Tiere geht es hier. Überraschend, dass so grundverschiedene Autoren wie Montaigne, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Flaubert, Kafka oder Canetti im Umkreis von Tieren über grundlegende Intuitionen ihrer Werke schreiben. Psychoanalytiker der ersten Stunde wie Sigmund Freud und C. G. Jung verbinden wichtige Einsichten mit ihnen. Die Bücher eines Günter Grass beinhalten eine veritable Tierschau und Camus' Ratten warnen noch heute vor finsteren Umtrieben. Rainer Otte verbindet in seinen metazoologischen Portraits persönliche Erfahrungen, wissenschaftliche Aufklärungen, Kulturgeschichten und philosophische Reflexionen. Denken mit Tieren heißt, Intelligenz, Emotion und Intuition der Tiere ernst zu nehmen und deren philosophisches Potenzial freizulegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Otte
Also sprach der Rabe
Denken mit Tieren
© Parodos Verlag, Berlin 2017
ISBN der Print-Ausgabe: 978-3-938880-89-0
ISBN der E-Book-Ausgabe: 978-3-96024-056-3
Alle Photos © Rainer Otte
Vorwort
Seit Äsop oder Jean de La Fontaine spuken Tiere im Kopf von Dichtern und Denkern. Im tradierten Fabelrevier sind sie mit einer recht handgreiflichen Moral unterwegs. Doch in charakteristischen philosophischen und literarischen Werken tritt uns ein ganz anderer Zoo entgegen. Dessen Tiere bevölkern komplexe geistige Ökotope. Für die schnelle Moral von der Geschicht‘ eignen die sich nicht. Um diese Tiere geht es hier.
Überraschend, dass so grundverschiedene Autoren wie Leibniz, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Flaubert, Kafka oder Canetti im Umkreis von Tieren auf grundlegende Intuitionen ihrer Werke stoßen. Psychoanalytiker der ersten Stunde wie Sigmund Freud und C. G. Jung verbinden mit ihnen wichtige Einsichten. Die Bücher eines Günter Grass beinhalten eine veritable Tierschau und Camus‘ Ratten warnen noch heute vor finsteren Umtrieben.
Erfahrungen mit Tieren öffnen philosophische Gedanken und dichterische Phantasien. Manchmal entsteht gerade in diesem Biotop philosophischer Klartext. Theodor W. Adorno lernt spät doch noch zu tanzen – von einer Dogge im Traum. Aufschlussreich, wie Adorno in seinen Werken das Tier und das Glück zusammenbringt. Wir schließen uns Leibniz an und suchen das Einhorn in einer urzeitlichen Höhle im Harz. Ihm – und uns – steht plötzlich die bohrende Frage vor Augen: Tiere verschwinden, sterben aus. Kann das unser Weltbild bedrohen, ja zum Einsturz bringen?
Aber wie viel Tier steckt in unseren Reflexionen und Fabeln? Wir befreien ein Huhn aus der Legebatterie und landen in genau dem Chaos, das uns Rousseau vorausgesagt hat. Dem Verzweifelten, der des Nachts eine Stechmücke erlegen will, gesellt sich Lichtenberg mit entscheidenden Hinweisen zu. Pablo Neruda nimmt sich den Floh vor und weiß Tröstliches für die Gestochenen zu dichten. Ergreifend ist die Therapie einer Antilope gegen posttraumatische Belastungsstörungen.
Wie sähen Fabeln in unserer Zeit aus? Dieses Buch formuliert sie im Sinne von Metazoologischen Portraits. Man wundert sich, dass dieser Terminus noch in keiner Fachliteratur auftaucht. Darin verbinden sich persönliche Erfahrungen, wissenschaftliche Aufklärungen, Kulturgeschichten und philosophische Reflexionen. Enten lehren dialektisches Denken. Das Chamäleon wirft Fragen nach der intimsten Kommunikation auf. Den metaphysischen Horror werden wir, mit Samuel Becketts Hilfe, unter dem Namen Zeckenalarm deutlich zu spüren bekommen. Natürlich erkennt man sofort die anthropomorphe Schlagseite der metazoologischen Portraits. Die muss den Tieren keineswegs schlecht bekommen.
Soll das Tier heute ein zoon politikon sein und in einer Zoopolis leben? Das könnte ihm Rechte verleihen und Defizite des Tierschutzes kurieren. Aktuelle Debatten zum moralischen und juristischen Status von Tieren scheinen die Verhältnisse von Mensch und Tier neu zu bestimmen. Einige Positionen stellen beileibe keine Neuerfindung dar. Häuptling Seattle, Albert Schweitzer oder Cioran setzten Wut und Trauer über den Umgang mit Tieren in Gedankenspiele von einer gewissen Radikalität um.
Wir lernen zudem einige neu benannte Spezies kennen: Schattentiere und Schwellentiere leben nicht nur verborgen im dunklen Blätterwald. Fluchtiere und Tellertiere teilen unseren Alltag. Auch die coolen Fische werden berücksichtigt, die rezeptfrei in Wasserläufen voller Benzodiazepinen schwimmen.
Die alphabetische Ordnung der Kapitel stellt eine Hommage an das unvergleichliche Buch der imaginären Wesen von Jorge Luis Borges dar und soll die lustbetonte, kursorische Lektüre fördern. Borges sammelte Phantasietiere wie den Basilisk, den Greif, die Mandragora oder die Sphinx (Borges 1987). Unsere metazoologischen Portraits streben eine bescheidenere Flughöhe des Geistes an. Sie stöbern stärker in persönlichen Erfahrungen wie auch in der einen oder anderen Erkenntnis, die wir den Geistes-, Natur- und Kulturwissenschaften verdanken.
Fabeln vermenschlichen gnadenlos alles, wird der Kritiker gern in die Runde werfen. Auf ihre rhetorischen Mätzchen könnte man heute doch eigentlich verzichten. Wir sind es gewohnt, knallharte Wahrheiten auszusprechen und scheuen keine Desillusionierung. Umwege über kluge Rabenschnäbel oder herrschsüchtige Löwenmäuler wären reine Zeitverschwendung. Hinter jeder Eule steckt einfach irgendeine Klara oder Evelyn und hinter dem Schaf verbergen sich üblicherweise ein Günther oder Klaus-Dieter. Doch so einfach ist das auch wieder nicht. Es reicht keineswegs, bloß die korrekten Menschennamen einzusetzen, und schon hat man Klartext geredet. Fabeln tun so, als wäre in ihnen eine unverfälschte Stimme der Natur zu vernehmen. Irgendetwas bleibt uns da immer fremd, als höre man das leise Echo einer irgendwie vertrauten und doch unbekannten Stimme. Man kann sie leicht überhören, noch leichter überspielen. Wer sie einmal wahrgenommen hat, wird nicht gern auf sie verzichten wollen. Plötzlich öffnen sich unvermutete Unterwelten. Sie zaubern recht abgründige Gedanken herbei.
Der Autor hat das ausprobiert. Nach dem Parcours, der hier nachzulesen ist, hat er keinen Zweifel mehr: Natürlich sprechen Raben – wenn man ihnen richtig zuhört! Sonst krächzen sie nur. Kommen sie linguistisch erst einmal in Fahrt, ist es aus mit der gemütlichen alten Fabelzeit. Sie sind bissige Kommentatoren. Manche tendieren zu radikalen Ansichten, auch politischer Natur. Die heutigen Fabelraben sind verdammt selbstbewusst geworden. Ihre Fabelmoral kennt komplexe Gefährdungen von Mensch und Tier. Sie beschränkt sich längst nicht mehr auf den Dunstkreis allzu menschlicher Verlockungen wie Gier, List oder Verstellung. Früher war dem mit einer Prise Fabelklugheit leicht beizukommen. Inzwischen verbreiten und kommentieren Raben sogar kultur- und naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Wenn es sein muss, fügen die Gebildeteren unter ihnen (ein prächtiges Exemplar hat der Maler Spitzweg dankenswerterweise auf unserem Titel portraitiert) Literaturhinweise bei! Sie treiben sich in Jazzkneipen herum. Seit dem Jahre 1789 zetteln sie Revolutionen an. Dass die Klugschnäbel mitunter auch poetische Anwandlungen haben, war dem Autor neu. Surrealistische Träumereien liegen ihnen. Dann reden sie von der Erforschung der dunklen Bereiche des Bewusstseins. Ja, das hat durchaus etwas mit Sigmund Freud oder C. G. Jung zu tun. Raben überfordern mit ihren üppigen Spektren an Themen und Tönen leicht das menschliche Gemüt. Neugierig machte ich mich in den kalten Wintertagen, während das Gekreisch der Rabenkrähen über die verschneiten Felder am Fuße des Harzes stolperte, an das Wagnis. Denn redet erst einmal ein Rabe, so drängeln sich bald unzählige andere Tiere heran, um nie Gehörtes beizusteuern. Galileo Galilei meinte, das Buch der Natur sei in mathematischen Symbolen abgefasst. Ich hörte anderes. Eine buntere Welt tat sich auf. Beim Schreiben wurde mir reichlich Unterstützung zuteil, denn noch sind wir von Tieren umzingelt. Die Buchstaben begannen zu tanzen. Mancher Spiegel stand mit einem Male vor Augen, auch wenn man seine Selbsterkenntnis nicht allzu gern den Raben verdankt.
Also sprach der Rabe und der nicht selten überraschte Autor notierte.
A
Adornos Dogge oder: Wie das Glück zum Takt findet
Die Geheimnisse seiner Tierwelten verraten den Menschen. Was gelehrte Rede versteckt, offenbaren Rabe, Igel und Taube. Theodor W. Adorno formulierte meisterhaft und mit philosophischem Tiefgang. Wer aber würde den folgenden Gruß gerade mit ihm in Verbindung bringen? „Alles Liebe von der lieben Giraffe Gazelle mit dem Hörnchen, Gazellenhörnchen, Hörnchen. Hörnchen“ (Adorno 2003, S. 90).
Hier klingen die Worte wie aus einer anderen Welt. Von komplizierter Dialektik ist gar nicht die Rede. Nichts schraubt sich in terminologische Höhen hinauf. Zum 82. Geburtstag verleiht Adorno seiner Mutter den Ehrentitel „Urwundernilstutengreisin“ (Adorno 2003, S. 421). Er verschweigt keineswegs die schreckliche Seite des Alterns: Das Wort Greisin lässt für die Zukunft wenig Gutes erwarten. Doch die Nilstute nimmt alles auf ihren wunderbaren und zeitlosen Rücken. So darf Wahrheit taktlos daherkommen und kann doch liebevoll gesagt sein.
Tiere trotzen dem gesellschaftlichen Zwang. In ihrem Namen lässt sich nett sagen, was andernfalls im Giftschrank steht. Feine Etikette gilt für sie nicht. Niemand nimmt es ihnen übel. Stilvolle Umgangsformen schließen hingegen jeden Menschen aus, der sich nicht zu benehmen weiß. Takt ist die Eintrittskarte in die distinguierte Gesellschaft. Taktlos wird diese gegenüber jedem, der aus dem feinen Rahmen fällt (vgl.: Adorno 1982, S. 36-39).
Tiere existieren außerhalb des dialektischen Spannungsverhältnisses sozialer Umgangsformen. Das erinnert etwas an den Hofnarren. Als Einziger darf er dem König die Wahrheit sagen. Doch Tiere sind weder bei Hof noch sind sie Narren. Sie handeln und sie sind einfach da. Sie benehmen sich nicht. Gegebenenfalls werden sie trainiert und abgerichtet. Man denke an Pawlows bedingten Reflex. Doch das Gazellenhörnchen und die Nilstute eröffnen ein ganz anderes Spiel.
Märchen- und Fabeltiere oder persönlich erwählte Tiere sprechen in der gesamten Kulturgeschichte mit. Ihre Aktionsbereiche umfassen schier alles, von der intimsten Zuneigung bis zur bösartigsten Aggression. In allen Winkelzügen menschlicher Kultur haben diese Tiere sich einquartiert. Der Bär liebt die Maus, Esel sind wir alle und das Schlangengezücht gehört ausgerottet. Wer sähe es nicht gern, wenn das Schaf gegen den Wolf endlich einmal nicht den Kürzeren zieht? Gern wird mit Hilfe der Fabeltiere die Weltordnung kräftig nachgebessert.
Die Denker und ihre Fabeltiere sind aus demselben Holz geschnitzt: Tiermund tut Denkers Weltsicht kund. Tonnenschwere Begriffsgebäude oder dialektische Spitzfindigkeiten scheinen überflüssig. Philosophie geschieht im Namen der Tiere einfach – gerade weil sie nicht mit komplizierten Denkwegen vertraut sind. Auch wenn niemand diese Fiktion des Natürlichen ganz ernst nimmt, hat sie den Fabeltieren Heimatrechte in der Philosophie verschafft.
In manchem Diktum thront ein Tier wie der Schlussstein eines gotischen Bogenganges. Berühmte Tiersätze haben sich im Laufe der Zeit vielleicht stärker eingeprägt als die hinter ihnen stehende Architektonik, etwas Hegels „die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug“ (Hegel 1982, S. 28). Oder Nietzsches Gegenprogramm: „So wir nicht umkehren und werden wie die Kühe, so kommen wir nicht in das Himmelreich. Wir sollten ihnen nämlich Eins ablernen: das Wiederkäuen“ (Nietzsche 1980c, S. 334).
Die natürlichen Vorbilder der philosophischen Tiere sind in der modernen Welt zum raren Anblick geworden. Wer melkt morgens seine Kuh und schaut ihr beim Wiederkäuen zu, wer hat schon einmal eine Eule bei einbrechender Dämmerung im Wald beobachtet? Wir begegnen eher altbewährten Haustieren oder Exoten.
Giraffen gibt es auf der Foto-Safari, melancholische Nashörner im Zoo. Da schwimmen lustig die Otter im Bassin und es brummt der Bär. Pinguine sind die geborenen Clowns und Lamas sind verdammt gute Zuhörer. Menschenworte nehmen sie mit dem verständnisvollen Blick ihrer wunderschönen großen Augen auf. Darin spiegeln sich der redende Mensch und seine Welt en miniature. Der Mensch erwartet ja keine Antwort. Er fühlt sich aber wohltätig und gut, weil er sich dem einsamen Tier mit Worten der Anerkennung und des Trostes zuwendet.
Auch Alpakas haben Ohren für alles und wunderschön spiegelnde Augen.
Der Schrecken lässt nicht lange auf sich warten. Erinnern unsere Naturidyllen und Arche Noahs nicht doch an Gefängnisse? Sind darin nicht allein die unglücklichen Tiere, sondern wir selber eingesperrt? Adorno sieht, dass das Schicksal der Tiere den Menschen mehr angeht, als ihm lieb ist: „Der Tiger, der endlos in seinem Käfig auf und ab schreitet, spiegelt negativ durch sein Irresein etwas von Humanität zurück […]“ (Adorno 1982, S. 148). Das Leid der Tiere spricht zum Menschen. Es ist auch sein eigenes Leid, das er hier erkennen könnte. Vielleicht stellt sich gar die Einsicht ein, dass Humanität nicht Irresein und Eingesperrtsein bedeuten kann.
Etwas ganz anderes setzt eine Traumerfahrung in Szene: Eine Adorno wohlbekannte Dogge bittet den Denker anlässlich des 50-jährigen Schuljubiläums zum Tanz. Der Traumhund ist ein vollendeter Zweibeiner. Er hat das gewisse Etwas, das vielen Menschen abgeht und das Adorno ein lange unzugängliches Glück verspricht: „Ich überließ mich ganz der Dogge und hatte, zum Tanzen überaus unbegabt, das Gefühl, zum ersten Mal in meinem Leben tanzen zu können [...]“ (Adorno 2005, S. 70).
Solche Momente sind kostbar. Vielleicht sind sie unwiederholbar. Man kann sie als freundliche Einladung verstehen, der unerwarteten Gegenwart des Glücks im Beisein der Tiere nachzugehen. Passagen in Adornos Schriften lassen erahnen, wie leidenschaftlich er solchen Spuren gefolgt ist: „Nicht [...] ist der Gattung Mensch die Verdrängung ihrer Tierähnlichkeit gelungen, dass sie diese nicht jäh wiedererkennen könnte und dabei von Glück überflutet wird […]“ (Adorno 1980, S. 182).
Angstschweiß
Auf einmal ist sie da, diese Angst, dass das zahme Tier alles vergisst. Dass ihm plötzlich, in einem unheilvollen Moment, wieder einfällt, dass es eigentlich ein wildes Tier war und insgeheim noch ist. Nimmt es die alte Fährte wieder auf? Ist das so unberechenbare Programm doch nicht ganz gelöscht?
Diese schwarze Furcht wittert hinter jeder allzu heftigen Bewegung des Tieres schon das unheilvolle Zeichen blutrünstiger Aggression. Das abgrundtiefe Gefühl würgt im Magen. Im Kopf entsteht das Schreckensbild: Keine Einsicht, kein Zureden werde einen dieser rasenden Anfälle stoppen können.
Vielleicht nur der Tod? Man liest das in der Zeitung, dass ein Hund nach einer fatalen Bissattacke gegen Menschen eingeschläfert wurde. Auch den gerade erst wieder eingewanderten Wolf, der morgens durch Wohnsiedlungen streift und sich auffällig verhält, schützt das Gesetz nicht immer vor dem Abschuss.
Man muss wohl bisweilen in solche Abgründe sehen, um die Tiere nicht zu übersehen. Nie werden sie dem Spiegelbild unserer zahmen Erwartungen ganz entsprechen können. Umso abgrundtiefer stellt sich die Frage: Wann sind die Tiere in unserer domestizierten Welt eigentlich Tiere?
Ans Sterben Gehen
Der alte Hund schleppte sich in die düsterste Ecke. Alle Menschen, die zu seiner Welt gehörten, sollten weggehen. Niemand durfte bei ihm sein. Jeden, der ihm zu nahe kam, knurrte er mit letzter Kraft an und fletschte die Zähne. Nie hatte er das zuvor jemals getan. Jetzt ging er weg. Er machte Schluss. Keiner sollte ihm folgen. Wenige Stunden später war er tot, schmerzverzerrt sein letztes Gesicht.
Hatten Generationen von Philosophen nicht das Bewusstsein, dass man sterben müsse, für den Menschen reserviert? Platon hat es mit dem Seufzer verbunden, dass im Tode die unsterbliche Seele endlich ihrer körperlichen Fesseln ledig würde. Christliche Denker haben diese Melodie gern übernommen. Durch die abendländische Philosophiegeschichte hallt die Versicherung, allein der Mensch wisse um seine Endlichkeit. Tiere seien in einem Hier und Jetzt gefangen, das solche düsteren Vorblicke eben nicht zulasse.
Für Heidegger offenbarte sich im Tode die zeitliche Verfasstheit des menschlichen Daseins. Das „Sein zum Tode“ verstand er als ein „Vorlaufen“, den Tod selbst als radikale Vereinzelung, in der „jedes Mitsein mit Anderen versagt“ (Heidegger 1977, S. 263).
Nun könnte jemand, der den Tritt ins philosophische Fettnäpfchen nicht scheut, durchaus fragen, ob Heideggers Worte nicht geradezu das Verhalten unseres sterbenden Hundes beschreiben. Sentenzen anderer Denker ließen sich hier zugesellen, etwa von Helmuth Plessner, dem Mitbegründer der modernen philosophischen Anthropologie: „Der Tod will gestorben, nicht gelebt sein. Er tritt an das Leben heran, das sich natürlicherweise ihm zuneigt und doch von ihm überwältigt werden muss, damit es stirbt“ (Plessner 1928/1975, S. 149). Wäre es unsinnig, auch diese Sätze zur Beschreibung des sterbendes Hundes zu benutzen?
Niemand weiß, was der sterbende Hund empfindet. Gibt es da so etwas wie Gefühle, Ahnungen, gar Gedanken, die denen der Menschen in irgendeiner Weise ähnlich oder vergleichbar sind? Das Dilemma, diese Frage eben nicht beantworten zu können, ist auch der Kommunikation unter Menschen nicht fremd. Trotz aller Sprache und größter Vertrautheit stellt der Tod die radikalste Vereinzelung vor Augen und kann Worte ins Leere laufen lassen.
Die traumatisierte Antilope
Auf einem medizinischen Symposion berichtete ein Psychotherapeut von seinen Ferienzeiten in einem arabischen Bürgerkriegsgebiet. Er kümmerte sich um Trauma-Opfer, deren Sprache er kaum sprach. Sie hatten sich in einer leblosen Starre abgekapselt. Worte erreichten sie kaum, Erklärungen nie. Wie nichtssagend klingt, angesichts der Wortlosigkeit ihres Leidens, unsere Rede von posttraumatischen Belastungsstörungen.
Ein Tier und seine Geschichte half dem Therapeuten und seinen stummen Patienten: Ein Löwe verfolgte eine Antilope. Sie schlug Haken und tat alles, um doch noch zu entkommen. Zunächst gewann sie kleine Vorsprünge, mit der Zeit war sie aber restlos erschöpft. Da verfiel sie in eine Starre, als trete der Tod vor dem Tode ein. Der Löwe hatte nun leichtes Spiel.
In letzter Sekunde gelang es der Antilope, doch noch zu entkommen. Der Gefahr entronnen, sprang sie beim Laufen immer wieder hoch, als setze sie zum Flug durch die Luft an. Die gelähmte Energie brach sich stürmisch Bahn zu neuem Leben. Wer sollte da nicht an überwältigende Lebensfreude denken?
Als inneres Bild war diese Antilope therapeutisch von großer Bedeutung. Sie konnte helfen, als Worte längst nichts mehr ausrichteten.
Im archetypischen Tierpark
Carl Gustav Jung hatte bis 1900 regelmäßig Tagebuch geführt. In den Jahren seiner Karriere an der Seite Sigmund Freuds kam er ohne Tagebücher aus. Als die Liaison mit Freuds Wiener Psychoanalyse zerbrach und einen zutiefst verstörten Jung zurückließ, legt er Notizbücher an. Die Stunde einer umfassenden Selbstanalyse schlug. Sie führte Carl Gustav Jung auf die Fährte von Tieren. Er entdeckte einen inneren Zoo im Unbewussten, dessen Einwohner frei und wild herumliefen.
1914 will Jung erkunden, wie sich Träume und Imaginationen in der Psychoanalyse nutzen lassen – und zwar ganz anders, als es die Psychoanalyse Freuds lehrt. Er notiert eifrig eigene Träume und Phantasien. Beim Schreiben leitet ihn die Erfahrung einer fließenden Kreativität. Nun fragt er sich: Wer ist eigentlich der Autor, wenn sich Seite um Seite mit Aufschrieben füllt? Der Schreiber hat sie weder geplant noch erwartet. Carl Gustav Jung erlebt sich eher als einen Zeugen. Am Ende des Manuskripts seines berühmten Werkes Wandlungen und Symbole der Libido notiert Jung, er wolle selber nur allzu gern wissen, was er da wie im Rausch geschrieben habe.
Alles verändert sich, als Jung 1914 beginnt, am Zürisee wie ein Kind zu spielen. Am Ufer baut er mit Steinen und Stöckchen kleine Dörfer. Im Arbeitszimmer hilft ihm urplötzlich eine imaginäre Partnerin aus der Klemme. Eine weibliche Stimme meldet sich. Sie beginnt, Jungs Sprachmetaphern zu kommentieren. Dann meldet sich eine männliche Figur. Philemon nennt ihn Jung. Jetzt überstürzen sich die inneren Ereignisse. Jung trägt alles fieberhaft in das Rote Buch ein. Zeichnungen kommen aufs Papier. Worte stehen in fremdartigen Lettern da. Aus uralten Zeiten scheinen sie ins Jetzt gesprungen zu sein.
Was bedeutet das alles? „Das, was Philemon sagte, schuf eine ‚Ägyptisch-Gnostische-Hellenische Stimmung‘ mit einer deutlichen gnostischen Einfärbung, weil er wirklich ein Heide war“, berichtet Jungs Biographin Deirdre Bair mit dessen eigenen Worten (Bair 2003, S. 416). Philemon schwebt als alter Mann mit Flügeln und Stierhörnern im Raum. Seine Federn gleichen denen des toten Eisvogels, den Jung am Ufer des Sees kurz zuvor gefunden hatte. Ist der Tod des Vogels das letzte Wort oder ist er das erste Wort? Der leblose Körper des seltenen Vogels wird zum Wendepunkt in Jungs Selbsterforschung.
Der Vogel ist nicht umsonst gestorben; da ist sich Jung sicher. Im Aufstieg zu höherem Leben werfe man Hüllen ab. Was hat ein zufällig aufgefundener Eisvogel am See mit seinem komplexen seelischen Geschehen zu tun? Jung weiß es nicht. Aber dass alles miteinander zusammenhängt, steht für ihn außer Frage. Später wird er von „Synchronizität“ sprechen, wenn in völlig entkoppelten Bereichen etwas geschieht, das einem einzigen, übergreifenden Sinn zugehört. Jungs Kritiker beklagen einen Rückfall in magisches Denken. Noch einen Schritt weiter geht Ernst Bloch; er wittert in Jungs Psychologie ein „Neudiluvium“, als feiere die Steinzeit fröhliche Auferstehung und das Primitive werde als Garant wahrer menschlicher Selbsterkenntnis vermarktet (Bloch 1977, S. 455).
In seiner Analytischen Psychologie präsentiert Jung eine veritable Tierschau. Das menschliche Selbst – oder Teile davon – tritt nicht selten in Tiergestalt auf. Diese Tiersymbole sind ein archetypisches Erbe der Menschheit. Sie tauchen besonders in bedeutungsvollen Situationen aus dem Unbewussten auf: „,Pferd‘ ist ein in Mythologie und Folklore weit verbreiteter Archetypus“, erklärt Jung im Rahmen der Analyse einer Patientin (Jung 1958, S. 169). Ihr träumte, ihre Mutter hätte sich des Nachts im menschenleeren Salon erhängt. Danach entstand furchtbarer Lärm. Ein scheues Pferd galoppierte durch die Wohnung, sprang aus dem Fenster und blieb vier Stockwerke tiefer zerschmettert liegen.
Das Tier vertrete, fügt Jung an, „die nicht-menschliche Psyche, das Untermenschliche, Animalische, somit das unbewusst Psychische; darum sind Pferde folkloristisch hellsichtig und hellhörig und sprechen bisweilen. Als tragende Tiere haben sie nächste Beziehung zum Mutterarchetypus [….].“ Dies führt Jung 1931 auf einem Kongress der Allgemeinen Ärztlichen Gesellschaft für Psychotherapie in Dresden aus. Der Traumsymbolik gibt er die Deutung, dass das Pferd ein „Äquivalent der ‚Mutter‘ sei und dabei eine Tendenz sichtbar mache, sich auf „bloß animalisches, körperliches Leben“ zu beziehen. Eben dieses „animalische Leben zerstört sich selbst“ (Jung 1958, S. 169 f.).
Jung will seine ärztlichen Kollegen darauf vorbereiten, reiches Tierleben im unbewussten Archetypenzoo ihrer Patienten aufzufinden. Dessen Bedeutung schienen sie generell zu übersehen. Drachen, Esel, Hahn und Henne, Hund und Hündin, Löwe, Pfau, Pferd, Pelikan, Rabe, Schlange, Skorpion, Stier, Wolf und Wal (den Jung zum Fisch erklärt): Was haben sie in den Tiefen der menschlichen Psyche verloren? Wie schaffen es gerade Tiere, die dem modernen Menschen kaum leibhaftig bekannt sind, in seiner Seele einen unerschütterlichen Platz zu behaupten? Selbst Drachen, reinste Sagenwesen, mischen sich in Jungs muntere biologisch-psychologische Schar.
Tiere agieren jenseits von Gut und Böse. Sie tun das mit instinktiver Sicherheit. Manch unsicherer Mensch wird das staunend beneiden. Tiere wissen, was sie wollen. Sie sind wie geschaffen, sich in ihrer arteigenen Umwelt anzueignen, was sie brauchen. Tiere spielen aber ebenso in komplexeren menschlichen Welten mit. Die Schmusekatze genießt ihren schnurrenden Luxushimmel in der Menschenwelt. Die Idylle der guten Katze trügt. Der Maus fügt sie im nächsten Moment schlimmste Qualen zu. Den geschundenen kleinen Köper lässt sie, verwöhnt von raffinierten Kreationen aus der Büchse, achtlos liegen.
Für Menschen entsteht aus all dem eine abgrundtiefe Diskrepanz. Wie soll man Zärtlichkeit und Grausamkeit der Katze zusammendenken? Die Frage verrät, dass die Katze unwiderruflich in der humanen Moralliga mitspielt. Mit deren Kriterien wird sie bewertet, selbst wenn menschliche Moral für Tiere ein völlig artfremdes Terrain darstellt.
Archetypische Tiersymbole stellen für Carl Gustav Jung unbewusste Niederschläge zeitloser Lebensdramen dar. Sie umgreifen den animalischen Untergrund des Menschen und die Welt seiner Kultur und Moral. „Die Tiergestalt zeigt nämlich an, dass die in Frage kommenden Inhalte und Funktionen sich noch im außermenschlichen Bereiche, d. h. in einem Jenseits des menschlichen Bewusstseins befinden, und daher einerseits am Dämonisch-Übermenschlichen, andererseits am Tierisch-Untermenschlichen teilhaben“ (Jung 1972, S. 116 f.). Das sorgt für Spannungen, manchmal aber auch für ungeheure Verheißungen.
Beide sind integraler Bestandteil der Jung'schen Analytischen Psychologie. Tröstlich ist seine Versicherung, dass die Tiere den Menschen nicht im Regen stehenlassen: „Häufig begegnen wir im Märchen dem Motiv der hilfreichen Tiere. Diese benehmen sich menschlich, sprechen menschliche Sprache und zeigen eine Klugheit und ein Wissen, welches demjenigen des Menschen sogar überlegen ist. In diesem Fall kann man wohl mit Berechtigung sagen, dass der Archetypus des Geistes durch eine Tiergestalt ausgedrückt werde“ (Jung 1972, S. 117 f.).
Das schönste Symbol für die befreiende Wandlung des Menschen sieht Jung in den Vögeln – was immer auch deren mythologische Abkömmlinge einschließt. Seit den frühesten Tagen des Schamanismus sind sie Symbol des Aufstieges und der Überwindung erdenschwerer Begrenzungen. Als Taube schwebt der heilige Geist, aber auch die befreiende Liebe. Schlangen, Drachen und andere mythische Monstren erscheinen hingegen eher als Wächter. Postiert vor dunklen Höhlen, Seen oder problematisch gewordenen Paradiesen symbolisieren sie Hindernisse und Durchgänge, Übergänge, Aufbrüche und Wandlungen. Persönliche Konfliktsituationen sind ihr Lieblingspsychotop.
In einem unbewussten Tierbild steckt eine unausgesprochene Weltanschauung. Man kann sie bewusst machen und dadurch wird sie sich verändern. Die Entfaltung des Menschen führt durch eine Reihe von Metamorphosen. In seiner „Individuation“ sind Tiere die archetypischen Begleiter – ungeachtet der Frage, ob viele Arten vom Aussterben bedroht oder nur noch in Büchern zu bewundern sind. In unserem kollektiven Unbewussten, lautet Jungs feste Überzeugung, seien Tiersymbole die unverlierbaren Residuen aus der Ahnenreihe des Menschen (vgl.: Jung 1958 a, S. 176).
B
Das Wasser kräuselt sich plötzlich. Schaut uns ein Auge an? Zu wem gehört das?
Der Blick: Immanuel Kant im Land der Tauben und der Schwalben
Jeden Frühling wartete der alte Immanuel Kant sehnsüchtig auf die Rückkehr der Grasmücke aus ihrem Winterquartier. Er liebte den Gesang dieser Vögel und machte sich Sorgen, wenn sie sich nach einem langen Winter verzögerten (vgl. Wasianski 1980, S. 266 f.). Der Gebrechliche wagte sich in Spazierfahrten aufs Land und hörte begeistert dem Gesang der Vögel zu. Alle erkannte er an ihrer Melodie. Jeden Sänger nannte er beim Namen. Welche unendliche Faszination der Gesang der Vögel hatte! Einmal traf Kant ein folgenschwerer Blick. Ehrengott Andreas Christoph Wasianski, der Freund und aufopferungsvolle Helfer seiner letzten Lebensjahre, berichtete: „Eine [...] Art von ernster Lieblichkeit strahlte aus seinem Gesichte, als er mit innigem Entzücken erzählte: wie er einst eine Schwalbe in seinen Händen gehabt, ihr ins Auge gesehen habe, und wie ihm dabei so gewesen wäre, als hätte er in den Himmel gesehen“ (Wasianski 1980, S. 293).Was hatte Kant gesehen? Sein Blick konnte nichts feststellen, was auf sichere Begriffe zu bringen war. Der Himmel im dunklen Auge der Schwalbe ließ sich nicht beobachten, geschweige denn fixieren. Kant legte die Angelegenheit keineswegs zu den Akten. Er kam darauf zurück. Vögel flogen in lichte Höhen auf. Der Philosoph mochte ihnen folgen und stieß an Grenzen. In der Kritik der reinen Vernunft führte nicht der Blick der Schwalbe, sondern das Aufsteigen einer Taube in lichte Sphären: „Die leichte Taube, indem sie im freien Fluge die Luft teilt, deren Widerstand sie fühlt, könnte die Vorstellung fassen, dass es ihr im luftleeren Raum noch viel besser gelingen werde. Eben so verließ Plato die Sinnenwelt, weil sie dem Verstande so enge Schranken setzt, und wagte sich jenseits derselben, auf den Flügeln der Ideen, in den leeren Raum des reinen Verstandes“ (Kant 1974, S. 51).
Kants inneres Auge folgt der Taube voller Faszination. In der immer dünneren Luft wird sie irgendwann weder fliegen noch atmen können. Sie bringt sich durch falsche Vorstellungen in Gefahr. Die Kritik der reinen Vernunft setzt ihrem Fluge Grenzen – wie auch jeder metaphysischen Spekulation. Kant will die Taube davor bewahren, verständlichen, aber täuschenden Verlockungen hinterherzusegeln. Die Welt bleibt ihnen als Widerstand erhalten, das rettet sie vor dem luftleeren Raum. Kein überschwänglicher Gedankenflug erreicht wirklich den Himmel. Könnte es der Blick? Die Sätze aus der Kritik der praktischen Vernunft sind berühmt: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir. Beide darf ich nicht als in Dunkelheiten verhüllt, oder im Überschwenglichen, außer meinem Gesichtskreise, suchen und bloß vermuten; ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewusstsein meiner Existenz“ (Kant 1974a, S. 300).
Ein Schwärmer wollte Kant ebenso wenig sein wie ein Prophet. Hochtrabende Worte schienen ihm so sinnlos wie eingeschmuggelte Glaubensbekenntnisse. Er pries das Glück, eine Schwalbe in der Hand getragen zu haben. In ihrem Blick hatte er etwas gesehen, das er nie vergessen konnte. Sein Denken hielt es fern allen Überschwangs lebendig.
Der Blick von Barbizon
Im Dickicht, gleich hinter meinem Rücken, knacken Zweige. Belauert mich jemand heimlich?
Dann ist es wieder still. Aber das schürt noch mehr Verdacht.
Sofort ist mein genüsslicher Spaziergang beendet und ich bin in einem anderen Spiel. Ist einer hinter mir her? Muss ich mich schützen? Jemand, den ich nicht sehe, sieht mich.
„Der Blick des Anderen verbirgt seine Augen“, schreibt Sartre in einer berühmten Passage seines Hauptwerkes Das Sein und das Nichts (Sartre 1985, S. 344). Der andere fixiert mich, während für mich unsichtbar bleibt, was er im Schilde führt. Er hat mich ertappt und ich tappe im Dunklen. Unter dem Diktat dieses Beobachters wird man vorsichtig. Er stiehlt mir meine Welt und gibt sich mir nie ganz zu erkennen (vgl.: Sartre, a.a.O., S. 341 und 349). Offen beobachtet zu werden ist ein Risiko; heimlich beobachtet zu werden ist eine Gefahr.
In den Wäldern zwischen Barbizon und Fontainebleau an einem Morgen im Mai: Ich streife durch den lichten Wald mit den eingestreuten Felsen, der schon die Maler der Schule von Barbizon begeistert hat. Weitab von jeder menschlichen Siedlung bricht plötzlich ein wilder Schäferhund aus dem Gebüsch. Mitten auf dem Weg hält er in einiger Distanz kurz inne. Er streckt den Kopf knurrend vor und zieht die Schultern leicht ein. Dann stürzt er auf mich zu. Irgendeine gute Intuition muss mir die Ruhe einflössen, die das Tier in letzter Sekunde umstimmt. Abrupt hält der Hund gut einen Meter vor mir. Unentschlossen beobachtet er mich. In mir greift das erleichterte Gefühl Platz, dass ich für diesen Moment aus dem Schneider bin.
Woher ich das weiß? Ich weiß es nicht! Ich setze meinen Weg so ruhig wie möglich fort. Alles, was ich tue, kann eine gute oder eine fatale Bedeutung für den Hund haben. Ich glaube zu spüren, wie ich mich bewegen muss. Der Hund beginnt, mich in wechselnden Radien zu umkreisen. Er folgt mir auf seine Weise. Manchmal sehe ich ihn nahe bei mir, aber nicht immer. Nach einigen Minuten kommt er immer näher. Er scheint Kontakt aufzunehmen. Irgendwoher meldet sich die merkwürdige Gewissheit, dass ich nicht sein auserkorenes Opfer bin. Ab und zu halte ich kurz an. Dann kommt er näher. Zuletzt streicht er um meine Beine. Zum Schluss folgt er mir so nah, als ginge er an einer unsichtbaren Leine.
Merkwürdige Zufälle führten mich zu dieser Zeit für einige Tage in ein nobles Hotel in Barbizon. Setzte man sich nur in die schweren Sessel der Eingangshalle, eilte gleich jemand herbei und entfachte ein Holzfeuer im Kamin. Mit nicht minder großem Eifer, war zu mutmaßen, würde mein verlauster neuer Freund von ihnen aus der großbürgerlich-adligen Welt entfernt werden.