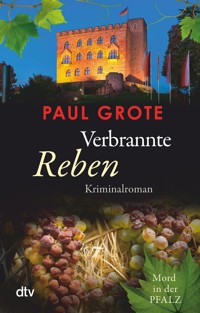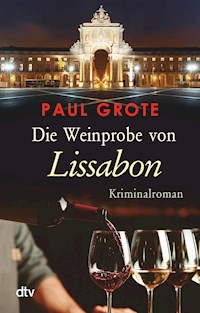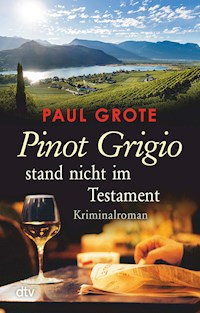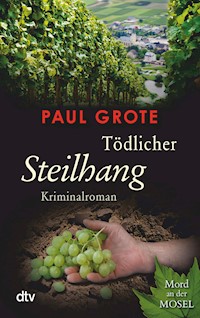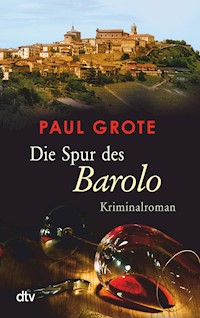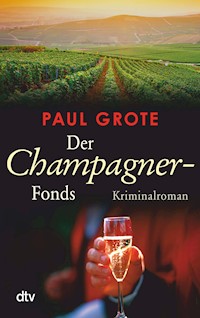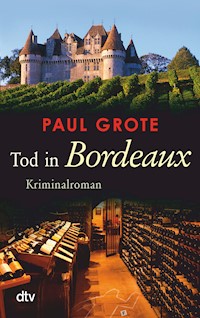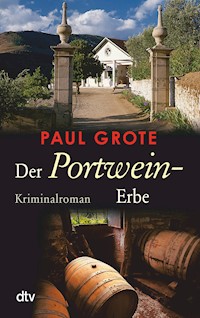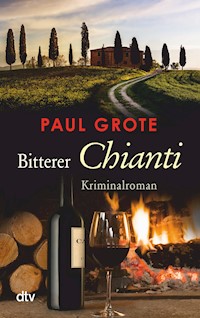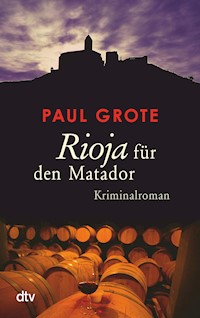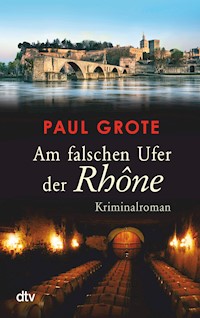
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Krimi
- Serie: Europäische-Weinkrimi-Reihe
- Sprache: Deutsch
Unfall – oder Mord? Côtes-du-Rhône und Châteauneuf-du-Pape: zwei Weinbaugebiete, links und rechts der Rhône. Zwei Brüder, Winzer am jeweils anderen Ufer der Rhône. Als einer der beiden stirbt, geht man zunächst von einem Unfall aus. Aber Simone Latroye, Praktikantin auf dem Weingut des toten Winzers, hat Zweifel. Sie bittet ihren Patenonkel Martin Bongers, heute Winzer in Bordeaux, um Hilfe. Der ehemalige Frankfurter Weinhändler kommt sofort. Er weiß, wozu Ehrgeiz, Neid und Habsucht einen Menschen treiben können ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Paul Grote
Am falschen Ufer der Rhône
Kriminalroman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Je größer die Beute, desto größer die Gier.
Kapitel 1
Mit sicherer Hand griff sie ins Weinlaub, fasste den wilden Trieb direkt am Stock, brach ihn ab und ließ ihn fallen. Die Triebe waren kurz, sie hatten gerade mal das Fünf-Blatt-Stadium erreicht, waren zart und ließen sich leicht brechen, ohne größere Verletzungen im Holz zu hinterlassen, die dem Weinstock schadeten. Beim Winterschnitt hatten sie die Bogrute auf acht oder zehn Augen gekürzt, und aus diesen Augen oder Knospen sprossen jetzt die neuen Triebe in saftigem Grün. Eine zweite Fruchtrute blieb stehen, wurde auf zwei Augen gekürzt, sie würde im nächsten Jahr die Trauben tragen. Guyot-Methode nannte man diese Technik, bei der die Fruchtrute an den untersten Draht des Drahtrahmens gebunden wurde. Simone Latroye hatte den Winterschnitt zum zweiten Mal in Folge mit Martin hinter sich gebracht, sie erinnerte sich gut, wie sie tagelang der Februarkälte getrotzt hatten, die Schere in der Hand, die ihr beinahe aus den klammen, blau gefrorenen Fingern gefallen war. Trotzdem hatte es ihr Spaß gemacht.
Zugesehen hatte Simone bei diesen Arbeiten schon immer; es war, als wäre sie zwischen diesen Weinstöcken, die sie jetzt umgaben, aufgewachsen. Manchmal, wenn sie hier im Weinberg oberhalb des Hauses unterwegs war, glaubte sie, jeden einzelnen dieser Weinstöcke zu kennen, die ihr Vater zusammen mit Martin gepflanzt hatte. Hier war sie als Kind herumgekrabbelt und hatte ihren Vater von der Arbeit abgehalten, was er sich gern hatte gefallen lassen. Hier war sie ihm heute noch immer nah, hier vermisste sie ihn besonders schmerzlich, auch wenn er bereits seit dreizehn Jahren tot war.
Seit dem frühen Morgen hatte sie sich langsam, aber stetig durch die Rebzeilen gearbeitet, bis auf eine kurze Mittagspause. Wieder griff sie zielsicher ins Laub und brach den nächsten Doppeltrieb, manche ließen sich beinahe abstreifen, so zart waren sie, besonders die Kümmertriebe unten am Stamm. Als langweilig empfand sie diese Arbeit keineswegs. Ab Mitte April war sie mindestens einmal täglich durch ihre Weinberge gelaufen, nur darauf wartend, dass die Augen am Stock sich öffneten und die ersten Blätter sich hervorwagten. Jetzt würde es sich auch zeigen, ob sie beim Winterschnitt Fehler gemacht hatte. Eine Rebzeile hatte Martin ihr überlassen, er hatte ihren Schnitt nicht einmal kontrolliert, sie ganz allein war für das Ergebnis verantwortlich.
Ich habe den richtigen Zeitpunkt zum Ausbrechen gewählt, sagte sich Simone, richtete sich auf und bog den Rücken durch. Begann man zu früh, erwischte man nicht alle Beiaugen, dann wuchsen neue Triebe nach, und man musste die Arbeit wiederholen. Ging man zu spät durch, waren die Triebe länger als zehn Zentimeter, dann verletzte man den verholzten Stock, und später Frost drang durch die Wunde ein. Aber damit rechnete niemand mehr in diesem Jahr. Vorsichtshalber hatte sie Martin gestern angerufen. Sie hatte ihm den Zustand der Weinstöcke beschrieben, ihm mitgeteilt, dass sie heute mit dem Ausbrechen beginnen würde, und sich seine Zustimmung dafür geholt. Schließlich war er der Chef, mochte er auch ihr Patenonkel sein.
Eines Tages würde sie das Weingut erben. Außer ihr kam niemand infrage, auf gar keinen Fall ihr Bruder Daniel. Martin und Charlotte hatten keine eigenen Kinder. Doch sie würden es sicher nicht Greenpeace vermachen.
Heute noch wollte Martin aus Deutschland zurückkommen, ab morgen würden sie hier gemeinsam arbeiten. Sie freute sich darauf, sie freute sich auch auf ihre Gespräche, die sie bei diesen Arbeiten führten, obwohl ihr Martin zurzeit auf die Nerven ging. Er ließ nicht locker, ritt ständig auf demselben Thema herum: Sie solle auch anderswo arbeiten, Erfahrungen sammeln, wenn schon nicht im Ausland – in Italien oder Spanien, es müsse ja nicht Deutschland sein –, dann doch bitte wenigstens in einem der vielen anderen französischen Weinbaugebiete.
Simone sah hinüber zum Haus von Charlottes Eltern. Madame Lisette und Monsieur Jérôme waren schon damals so etwas wie Großeltern für sie geworden, denn die leiblichen Großeltern hatte sie so gut wie nie gesehen, und nach dem Tod ihres Vaters, als sie mit ihrer Mutter wieder nach Saint-Chinian gezogen war, hatte es mit ihrer leiblichen Großmutter dauernd Streit gegeben. Ständig hatte sie an ihr herumgemeckert, aber Simones Bruder, der war der König gewesen, der wurde für jeden Blödsinn gelobt, sogar für die Abiturprüfung, die er nur mit Ach und Krach geschafft hatte. Dass sie das Abitur mit Auszeichnung bestanden hatte, war als Selbstverständlichkeit hingenommen worden. Sie ärgerte sich noch immer darüber. Als Ausgleich hatten ihr Madame Lisette und Monsieur Jérôme ein wundervolles Geschenk gemacht: Sie hatten ihr den Führerschein bezahlt. Heute Abend würde sie jedoch nicht hinübergehen, heute wollte sie hören, wie es Martin auf der Reise ergangen war.
Seit einem Jahr verkauften sie nicht nur den Merlot, einen Garagenwein, den ihr Vater damals kreiert hatte, sondern produzierten auch eine Cuvée. Martin hatte zu experimentieren begonnen und drei Hektar mit Cabernet Franc bestockt, hinzu kamen die drei Hektar Cabernet Sauvignon, die Charlottes Eltern gehörten. Sie konnte die Rebanlagen von hier aus sehen und mittlerweile sogar die drei Rebsorten am Blatt unterscheiden. Merlot reifte zuerst, dann war Cabernet Franc an der Reihe, zuletzt der Cabernet Sauvignon. Sie bearbeiteten insgesamt neun Hektar, somit hielt sich der Stress in Grenzen, es waren neun Tage Arbeit zu je zehn Stunden. Man hätte auch Helfer mit dem Ausbrechen beauftragen können, aber Martin legte Wert auf den Augenschein, nur so wusste er, wie sich ihr Weinberg entwickelte.
Simone bückte sich, sie hatte einen Trieb am Stamm übersehen. Das alles interessierte ihre Mutter Caroline sehr wenig, nein, ganz und gar nicht. Nach dem Tod ihres Mannes war sie mit den Kindern nach Saint-Chinian zurückgegangen und wieder bei ihrer Mutter eingezogen. Und dann hatte sie diesen Mann kennengelernt, Jean-Antoine! Geschieden, in leitender Position bei einer Großkellerei, der es auf Absatz und nicht auf Qualität ankam, eigenes Haus mit Garten und Gärtner in Narbonne, zwei Söhne, prétentieux, eingebildete Schnösel – was auch ihr Onkel Jean-Claude fand, der in Narbonne als Professor lehrte. Für die beiden Schnösel war Simone mit ihrem Hang zur Landwirtschaft das »Bauernmädchen«, la paysanne, wie sie sie hämisch nannten.
Auch wenn die finanziellen Sorgen mit der neuen Ehe ihrer Mutter ein Ende hatten und Jean-Antoine es auf seine Art vielleicht gut meinte, konnte Simone ihn weder leiden noch riechen. Er roch schlecht, unangenehm, sie hielt es in seiner Nähe nicht aus, besonders schlimm war es, wenn er sie ansprach. Wie nur konnte ihre Mutter seine Küsse ertragen?
Simone reckte sich, steckte dabei ihr bis auf den Rücken reichendes blondes Haar im Nacken wieder zusammen und schätzte die Strecke ab, die sie in der letzten halben Stunde geschafft hatte. Sie war zufrieden. Sie kam sehr schnell voran heute, darauf war sie stolz. Einen Hektar wollte sie geschafft haben, und Martin würde sie dafür loben. Er schimpfte nie, jedenfalls nicht mit ihr, erklärte alles mit einer Engelsgeduld, die er bei Charlotte manchmal vermissen ließ, obwohl ihn sonst selten etwas aus der Ruhe brachte.
Sie sah einen Weinstock, der sich nicht gut entwickelte, er war zurückgeblieben. Ein Jahr würde er noch durchalten, sie sollten ihn möglichst rasch ersetzen, doch dafür war es jetzt zu spät. Das war das Schöne bei dieser Arbeit. Simone lächelte vor sich hin. Man konnte seinen Gedanken nachhängen, irgendwann waren zwar die Arme und Hände müde, das Kreuz schmerzte, der Nacken wurde hart, aber der Kopf blieb frei, und niemand nervte sie hier.
Da meldete sich ihr Smartphone, das in der Seitentasche ihrer grünen Arbeitshose steckte. Sie griff danach, schaute aufs Display und musste zugeben, dass ihr letzter Gedanke falsch gewesen war. Mit so einem Gerät in der Tasche konnte man überall genervt werden. Noch dazu war es die Telefonnummer ihrer Mutter. Simone zögerte. Sollte sie das Gespräch annehmen? Schicksalsergeben drückte sie die Taste.
»Ja?«
»Hallo, mein Liebling.«
Es war tatsächlich ihre Mutter. Liebling? Das war doch ihr Bruder … Was mochte sie von ihr wollen?
»Wie geht es dir?«
»Gut, danke.«
»Wo bist du?«
»Im Weinberg.«
»Was machst du gerade?«
»Ausbrechen, Wasserschosse, Doppeltriebe …«
Was sollte diese Frage? Es interessierte sie doch überhaupt nicht. Die schwierigen Aufbaujahre hatte Caroline in schlechtester Erinnerung. Heute wollte sie allerdings nicht mehr wahrhaben, wie sehr der Tod ihres Mannes sie aus der Bahn geworfen hatte.
»Geht es gut voran?«
»Ja.« Simone musste sich zwingen, einigermaßen verbindlich zu klingen. »Es geht gut voran, und es macht Spaß.«
»Das freut mich zu hören. Und mit Martin und Charlotte läuft alles gut?«
»Bestens. Nun sag schon, weshalb rufst du an?«
»Ich wollte dir sagen, dass wir für drei Wochen in die Ferien fahren, mit Jean-Antoine …«
»Klar. Und – nehmt ihr Daniel mit?«
»Das geht leider nicht, dein Bruder hat eine neue Position im Unternehmen, er wird Assistent der Geschäftsleitung.« Der Stolz in der Stimme war deutlich zu hören. »Er muss sich auf die neue Position vorbereiten.«
Karrieregeil – das war Daniel. Er hatte sich schon immer zu wichtig genommen. Protektion, das war alles, worauf er zählen konnte, Protektion durch den Stiefvater. Sonst stellte er nicht viel auf die Beine.
»Wir hatten überlegt, dich mitzunehmen …«
Oh Gott, bloß nicht! Weshalb sagte sie das? Drei Wochen mit den beiden würde sie nicht überleben.
»… aber du bist ja immer so beschäftigt. Ich hoffe, du kommst uns nach dem Urlaub mal wieder besuchen.«
»Aber gewiss doch, maman.« Sie würde höchstens einen Tag opfern, aus Anstand, am Geburtstag. »Dann wünsche ich euch ganz schöne Ferien. Wo geht’s hin?« Simone fragte es lediglich der Höflichkeit halber.
»Nach Florida, Fort Lauderdale und Key West. Du weißt doch, Jean-Antoine ist ein großer Hemingway-Fan.«
Nicht nur das. Wie Hemingway trank ihr Stiefvater auch zu viel. »Wusstest du, dass es im Hemingway-Haus von Katzen wimmelt? Bist du nicht gegen Katzen allergisch?« Unter dieser Allergie litt Caroline erst, seit sie mit Jean-Antoine zusammen war. Simone sagte es im Ton tiefer Besorgnis, aber innerlich ein wenig gehässig, sie hatte sich die letzte Bemerkung einfach nicht verkneifen können.
Bevor ihre Mutter weiter nachfragen konnte, verabschiedete sich Simone. »Maman, ich muss hier weitermachen, ich muss heute fertig werden. Auf jeden Fall wünsche ich euch schöne Ferien!
Die rote Taste auf dem Smartphone war ihr äußerst lieb, und sie steckte das Gerät wieder in die Tasche. Sie hatten im Englischunterricht Hemingway gelesen, und das mit den Katzen hatte sie irgendwo aufgeschnappt. Sie wusste, dass ihre Mutter jetzt mit Jean-Antoine eine Debatte beginnen würde. Schadenfreude war eigentlich nicht Simones Ding, aber nach all den Jahren, in denen ihre neue Familie ihr einen fremden Lebensstil aufgezwungen hatte, tat sie irgendwie gut.
Obwohl sie schneller weiterarbeitete als zuvor, kamen die unliebsamen Erinnerungen gnadenlos zurück. Jean-Antoine hatte sich damals sofort in die Rolle des Familienoberhauptes gedrängt. Sie war es nicht gewohnt, auf Befehle, die als Ratschläge getarnt waren, zu reagieren – und sie hatte zugemacht, sich verschlossen, abgekapselt. Wieso ihre Mutter diesen Mann hatte akzeptieren können, war ihr schleierhaft. Er war das absolute Gegenteil ihres Vaters. Hatte das Geld sie überzeugt? War ihr Leben dadurch leichter geworden? Martin meinte immer, dass viel Geld schlimmer sei als Dynamit. Oder war es Jean-Antoines herrisches Wesen und dass er ihrer Mutter die Entscheidungen abnahm? Nach dem ersten gemeinsamen Wochenende hatte auch Daniel vor ihm den Diener gemacht, er fand ihn »große Klasse«, bewunderte ihn und machte sich mit seinen Söhnen gemein. Die drei Jungen zusammen waren ätzend. Daniel bekam auch gleich für die Zeit nach dem Studium einen Job in der Großkellerei versprochen. Und jetzt arbeitete er unter seinem Stiefvater, machte den Rücken krumm und redete ihm nach dem Mund. Dass sie, seine Schwester, jeden Respekt vor ihm verloren hatte, interessierte ihn einen Dreck.
Nach dem zweiten gemeinsamen Wochenende war zum ersten Mal die Rede davon gewesen, zusammen in ein Haus zu ziehen. Eine Woche später war Simone nach Saint-Émilion getrampt, war verschwunden, ohne ein Wort zu sagen. Abends hatte sie vor ihrem ehemaligen Elternhaus gestanden, das inzwischen Charlotte und Martin gehörte, vor jener Tür, deren Knarren sie so gut kannte. Nur Martin war zu Hause gewesen. Sie war ihm verzweifelt um den Hals gefallen, hatte sich bei ihm ausgeweint und geschworen, nie wieder fortzugehen. Fast auf Knien hatte sie Martin angebettelt, bleiben zu dürfen. Doch ebenso wie Lisette und Jérôme, die später herübergekommen waren, vertrat er die Ansicht, sie müsse zurück zu ihrer Mutter. Betreten hatten die drei zu ihren Klagen geschwiegen. Schließlich hatte Martin ihre Mutter angerufen und ihr mitgeteilt, dass Simone bleiben wolle und er damit einverstanden sei. Aber ihre Mutter war es nicht. Sie hatte sogar mit der Polizei gedroht. Simone musste zurück nach Saint-Chinian.
Drei Jahre Gefangenschaft hatte sie durchgestanden. Nachdem sie die Schule mit Bravour beendet hatte, war sie sofort wieder in Saint-Émilion aufgekreuzt. Hier war sie zu Hause. Zwei Jahre lang hatte sie eine Ausbildung zur Weinbautechnikerin gemacht, und seit zwei Jahren arbeitete sie nun mit Martin und Charlotte zusammen. Martins Frau kümmerte sich hauptsächlich ums Büro, wenn sie nicht auf politischen Kongressen weilte, mit Politikern stritt oder für NGOs auf Reisen ging. Es war kaum vorstellbar, dass sie in Paris mal Staatssekretärin gewesen war, im Kostüm oder im Hosenanzug, und der Sozialistischen Partei angehört hatte, deren gesamte Führung sie für korrupt hielt.
Zwei Rebzeilen fehlten noch. Bei der vorletzten hingen die Spanndrähte durch, die sie wieder richtete, wobei die unangenehmen Erinnerungen verblassten. Die schönen Erinnerungen blieben an diesem lauen Nachmittag, der einen herrlichen Sommer versprach. Die Tage waren lang, aber auch sie gingen zu Ende, die Sonne sank, das Licht wurde weich, es schmeichelte dem Weinlaub, glitt vorüber, legte sich sanft auf die Blätter und die Bäume, die Martin in den Weinberg gesetzt hatte. Sogar die Pyramiden aus grauem Feldstein, die er errichtet hatte, um die Monotonie der Monokultur aufzubrechen und das Leben in den Weinberg zurückzuholen, glühten in der Sonne des Nachmittags.
Simone griff nach der Wasserflasche und trank genussvoll. Was für ein Glück, dass ich hier bin, sagte sie sich. Hier war sie zu Hause, sie wollte nicht weg von hier. Sie hatte den richtigen Beruf gewählt, und sowohl Martin als auch Charlotte hatten ihr versichert, dass sie das Weingut eines Tages übernehmen werde. Aber sie würde es nicht geschenkt nehmen, sie würde es sich erarbeiten. Allein deshalb musste sie hierbleiben und konnte sich keine Ausreißer erlauben, wie Martin es ihr nahegelegt hatte. Was sollte sie auch an der Rhône? Bei irgendwelchen fremden Leuten auf einem Weingut hospitieren, das sie nichts anging? Was sollte sie dort lernen, was sie sich nicht auch hier aneignen konnte? Hier kannte sie jeden Stock, jeden Stein, sie spürte das Wetter Tage vorher. Die Reben, das waren ihre Freunde, Merlot, Cabernet Sauvignon und neuerdings auch Cabernet Franc. Das waren schon drei Rebsorten, mit denen sich experimentieren ließ. Aber alle um sie herum predigten, wie wichtig es sei, den Horizont zu erweitern, dass sie Erfahrungen machen müsse, mit Weinbergen wie mit Menschen und so weiter … Und sie? Sie fürchtete sich vor dem Alleinsein. Das war es, wovor sie Angst hatte, denn das kannte sie. Die Jahre in Narbonne waren schrecklich gewesen: die Mutter mit dem neuen Mann, die drei idiotischen Jungs, alle superpotent, gegen die hatte sie keine Chance gehabt.
Da hörte sie ein Geräusch, zwar nur leise, aber sie kannte es. Ein Wagen war vorgefahren. Das musste Martin sein. Am liebsten wäre sie gleich zum Haus gelaufen, aber nein, sie wollte mit diesem Hektar fertig sein. Ab morgen würde Martin mitmachen und Monsieur Jérôme auch, und dann mussten sie dringend mit dem Mulchen beginnen. Gräser und Kräuter zwischen den Reben waren kräftig gewachsen, und was sie herausgebrochen hatten, musste in den Boden eingearbeitet werden. Wegen des Traktors hatte sie längst mit dem Nachbarn gesprochen, sie teilten sich die Maschine, alles war vorbereitet, sie war hier unabkömmlich …
Kapitel 2
Der Kies knirschte unter den Reifen. Martin Bongers war das Geräusch vertraut wie kaum ein anderes, er hatte es vor zwanzig Jahren zum ersten Mal gehört, damals, als Gaston den Kies hatte aufschütten lassen, um die Zufahrt zum Haus und zur Kellerei zu befestigen. Zuerst hatte Martin das Geräusch selten wahrgenommen, vielleicht einmal im Monat, wenn er zu Besuch gekommen war, später dann täglich, während der Weinlese, bei der er Gaston geholfen hatte. In den Wintermonaten waren die Intervalle länger gewesen, bis er schließlich ganz hierher übergesiedelt war, nachdem er mit Charlotte das Weingut gekauft hatte. Während der Lese, er erinnerte sich, klang ihm nichts anderes als dieses Knirschen in den Ohren (außer dem Lärm der Maschine zum Entrappen der Trauben), denn der Kies reichte von der Straße bis zum Haus und weiter zur Garage, wohin sie die Trauben brachten. Obwohl er den Weinkeller inzwischen um mehr als die Hälfte des ursprünglichen Grundrisses erweitert und unterkellern hatte lassen, nannten alle die Kelterhalle und das Lager für seine Barriques weiterhin die Garage. Hier hatten sie angefangen, da war das Wohnhaus noch eine Baustelle gewesen. Und Gaston hatte noch gelebt.
Martin glaubte nicht an Gespenster. Er glaubte vielmehr, dass der Geist eines Menschen gegenwärtig sein konnte, an einem Ort, den der Verstorbene zu einem wesentlichen Teil geprägt hatte. Manche nannten es das Fluidum eines Ortes, für andere wieder war es der Spiritus Loci, der Geist des Hauses. In den ersten Jahren nach Gastons Tod war es Martin oft schwergefallen, in den Räumen zu leben, die von seinem Freund und dessen Frau geschaffen worden waren. Bei einigem hatte Martin mitreden können, seine Vorschläge beim Bau des Hauses waren beachtet und umgesetzt worden, selbstverständlich auch, was die Anlage des Gärkellers betraf. Gaston hatte damals zu eng gedacht, zu klein, er hatte für den Moment geplant, nicht die Zukunft in sein Kalkül einbezogen und seine Möglichkeiten unterschätzt.
Martin ärgerte sich, dass er schon wieder an Gaston dachte, genau in diesem Moment, hier in der Zufahrt zu seinem Haus. Also war es noch immer nicht sein Haus? War das überhaupt wichtig? Während der Fahrt von Frankfurt nach Saint-Émilion hatte er sich nur Gedanken darüber gemacht, wann er endlich wieder einmal mit Charlotte Ferien machen und Simone dazu bewegen konnte, bei Didier Lamarc in Châteauneuf-du-Pape für ein Jahr – oder zumindest ein halbes – zu hospitieren. Der Winzer war ihm aus seinen Zeiten als Weinhändler in guter Erinnerung.
Charlotte erwartete ihn in der Haustür, herabgebeugt, damit sie ihn durchs Wagenfenster sehen konnte. Sie lächelte, oh, wie er dieses Lächeln liebte. Es hatte ihm gefehlt.
»Wenn du nicht aussteigst, muss ich mich zu dir setzen.« Mit diesen Worten öffnete sie die Beifahrertür und ließ sich auf den Sitz fallen, ungeachtet der dort ausgebreiteten Papiere. Sie umarmte ihn: »Es ist gut, wenn du mal weg bist. Es ist aber auch schön, wenn du wieder da bist.«
»Wenn’s anders wäre, müssten wir uns Sorgen machen.«
»Die kannst du dir machen. Sorge ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber Simone will nicht gehen. Ich hab’s versucht, mit Engelszungen geredet …«
»Das habe ich erwartet.« Martins Bewegung der Hand zum Kopf, um sich ratlos daran zu kratzen, kam angesichts Simones Starrköpfigkeit häufiger vor. Simone hatte auch vor seiner Reise jedes Gespräch verweigert. Wenn seine Patentochter etwas nicht wollte, blieb sie so stur wie einst ihr Vater.
»Ich habe sie bearbeitet, aber nicht überzeugen können«, bedauerte Charlotte. »Ich dachte, dass du zu viel Druck machst. Aber nein, und überreden lässt sie sich schon gar nicht. Ich glaube, sie weiß gar nicht genau, weshalb sie nicht will, doch das ist ihr egal. Wir können nur an ihre Einsicht appellieren.«
Martin würde sich damit nicht zufrieden geben. Es wäre gegen seine Überzeugung. Simone trug das Herz nicht unbedingt auf der Zunge, auch darin ähnelte sie ihrem Vater Gaston.
Im Haus läutete das Telefon, Charlotte machte sich aus der Umarmung frei und lief hinein. Martin sah ihr und ihren fliegenden Haaren nach. Das tat er gern, seit dem Tag, als er sie kennengelernt hatte, hier in diesem Haus, in der Küche, am Tag von Gastons Beerdigung. Ihr Geburtshaus stand weiter oben, auf der Anhöhe, es war das mit dem schönsten Garten in der Umgebung. Martin stieg schwerfällig aus, lediglich eine Pause hatte er sich auf der mehr als tausend Kilometer langen Strecke gegönnt. Er blickte hinüber zum Haus seiner Schwiegereltern, er ging gern hinauf, abends, nach der Arbeit, und plauderte mit Madame Lisette über ihren neuen Kräutergarten und über Hildegard von Bingen, deren Schriften sie kürzlich für sich entdeckt hatte. Sie war bei Weitem liebenswürdiger als seine leibliche Mutter, die nicht einmal zur Hochzeit mit »seiner Französin« erschienen war. Es war ein tolles Fest gewesen, hier auf dem Land hatten sie gefeiert, bei strahlendem Sonnenschein, so wie jetzt, Mitte Mai. Der Maler Pieter Bruegel der Ältere hätte seine Freude daran gehabt und reichlich Motive gefunden.
Martin stopfte die zerknitterten Unterlagen vom Beifahrersitz in seine Aktentasche. Der Papierkram nahm immer mehr Raum ein. Er hatte geglaubt, dass sich die Schreibarbeit als Winzer gegenüber seiner früheren Tätigkeit als Weinhändler verringern würde, doch das war ein Trugschluss: Obwohl Winzer und Weinbauern ohne Zuschüsse der EU wirtschaften mussten, war der bürokratische Aufwand enorm, egal, ob es um Düngeverordnungen ging, den Spritzplan oder um die Nachweispflicht für den Einkauf und die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln – die Nachtarbeit am Schreibtisch nahm zu. Die französischen Behörden und die EU schienen sich gegenseitig mit Formularen und Verordnungen überbieten zu wollen. Aus dem Grund verzichtete Martin wie viele andere Winzer auch auf ein Ökosiegel, obwohl ihre Betriebe die Bedingungen dafür erfüllten.
Er stellte sein Reisegepäck im Flur ab, direkt unter den Fotos von Gaston und Caroline. Mit ihr war der Umgang schwierig, seit sie mit diesem Mann verheiratet war, der für Martins Weine nichts übrighatte. Unter einer Million Flaschen lief bei ihm nichts, alles darunter betrachtete er als »Kinderkram«. Dass Carolines Foto auch dort hing, störte Simone. Aber das war kein Grund, es abzuhängen. Caroline hatte das hier alles mitgeschaffen.
In der oberen Reihe hingen auch die Bilder von Daniel und Simone, in zweiter Reihe erst kamen sie, Charlotte und er selbst. Er hatte die Bilder lange nicht so ausführlich betrachtet wie heute. Normalerweise rannte er daran vorbei, und nur aufmerksame Besucher erkundigten sich nach den dort hängenden Porträts.
Martin holte die Akten aus dem Auto und brachte alles ins Büro. Charlotte lächelte ihm von ihrem Schreibtisch aus zu, den Hörer am Ohr, sie bedeutete ihm hierzubleiben, doch Martin winkte ab. Er wollte erst richtig ankommen, bevor er sich wieder dem Alltag zuwandte.
»Der Journalist«, raunte ihm Charlotte zu, »ihr habt für heute ein Interview vereinbart.«
Martin stöhnte, das hatte er vergessen oder verdrängt. Er mochte es nicht, ausgefragt zu werden und über seine Weine zu reden. Die Leute sollten probieren und dann sagen, ob sie ihnen schmeckten und ob sie bereit waren, für eine Flasche vierzig Euro zu zahlen. Was er zu sagen hatte, fand man auf seiner Homepage. Gaston hatte damals fünfzig Euro pro Flasche für seinen Garagenwein verlangt und auch bekommen, trotz des Preises war der Pechant bereits ein Jahr im Voraus ausverkauft, mehr als zwanzigtausend Flaschen. Martin hatte später die Erntemenge erhöht und den Preis gesenkt.
Sein neuer Wein, der Mémoire, war vom Handel sofort gut angenommen worden, die »Erinnerung« an seinen Freund Gaston, eine klassische Bordelaiser Cuvée. Über sie wollte der Journalist sicher nicht sprechen.
»Morgen! Morgen soll er kommen«, flüsterte Martin, heute stand ihm nicht der Sinn nach diplomatischem Gerede und Eigenlob. Und das Wenige, was es hier zu sehen gab, war seiner Meinung nach keinen Artikel wert. Bisher waren alle Interviews mit Weinjournalisten ähnlich verlaufen. Sie fragten nach den Vorfällen um Gastons Tod und wie er, Martin, zu dem Weingut gekommen war. Dreizehn Mal ist es seitdem Frühling geworden, dachte er, genauso oft hat es den Austrieb gegeben, dreizehn Mal war es Sommer und wieder Herbst geworden, der sich stets anders zeigte und nie dem des Vorjahres glich. Jedes Jahr lasen sie die Trauben zu einem anderen Zeitpunkt, mal waren fünf Lesedurchgänge nötig gewesen, im folgenden Jahr reichten vier. Immer fielen die Trauben anders aus, und im Keller waren andere Maßnahmen nötig.
»Ich habe keine Lust auf ein Interview!« Es hing ihm zum Hals heraus.
Charlotte hingegen hielt jede Erwähnung in den Gazetten für wichtig. Also würde er ihr den Gefallen tun und den Mann empfangen. Er verließ das Büro und setzte den Wagen bis vors Tor der Garage, um die übrig gebliebenen Probeflaschen ins Lager zu bringen. Er sah sich um. Simone hielt den Laden in Schuss. Doch so konsequent sie sich einbrachte, so konsequent wehrte sie sich, das Weingut, das ihren Namen trug, Domaine Latroye, zu verlassen, und sei es nur für sechs Monate. Er verstand es nicht. Wo war Simone jetzt?
»Im Weinberg – wo sollte sie sonst sein«, sagte Charlotte lachend. »Sie hat mit dem Ausbrechen begonnen, als ich noch geschlafen habe; sie will bis zum Abendessen einen Hektar geschafft haben. Bleib hier«, sagte Charlotte schnell, als sie bemerkte, dass Martin nach den Arbeitsschuhen griff. »Lass sie gewähren, sie will es sich beweisen, sie will es dir beweisen.«
»Das muss sie nicht, und das weiß sie.« Niemand kannte Simone so gut wie Martin.
»Es geht ihr auch darum klarzustellen, dass sie unabkömmlich ist, dass sie hier nicht wegkann. Andernfalls würde das Weingut zusammenbrechen.«
»Nichts bricht zusammen«, brummte Martin unwirsch, die Debatte um Simones Praktikum ging ihm auf die Nerven. Er hatte sich eine Lösung ausgedacht. Aus der linken Innentasche seiner Anzugjacke zog er einen dicken braunen Umschlag. Er blickte kurz hinein, grinste Charlotte an, die wusste, dass es sich um die Einnahmen aus den Schwarzverkäufen handelte, und legte den Umschlag ganz hinten in ein Schreibtischfach. Es war das Geld, das er als Prämie für Hilfskräfte brauchte, für all das, was bezahlt werden musste und steuerlich nicht anzurechnen war. Die Steuerbehörden wurden immer gieriger, die Verfolgung des Mittelstands immer rigoroser, während die Konzernchefs ihre Finanzminister überredet zu haben schienen, ihre Steuern auf quasi null zu senken.
»Als du weg warst«, sagte Charlotte, die Martins kleine Geschäfte billigte und selbst davon profitierte, »haben bei einigen Kollegen Hausdurchsuchungen stattgefunden. Man hat bei Betriebsprüfungen festgestellt, dass die Anzahl der gekauften Korken und Kapseln höher war als die Zahl der verkauften Flaschen. Dann haben sie die restlichen Korken und Kapseln gezählt, und jetzt sollen die Kollegen Auskunft geben, wieso es zu dieser Differenz kommt. Und sie prüfen gleichzeitig die Rechnungen der Kork- und Kapselproduzenten.«
»Bis August arbeiten wir nur für den Staat und seine Beamten.« Es war ein Thema, bei dem Martin sich gern in Rage redete. »Würden sie mit gutem Beispiel vorangehen, würde niemand meckern. Aber was leistet so ein Abgeordneter? Fürs Reden und Handhochheben kriegt er dreizehntausend Euro im Monat! Du weißt doch selbst, was du damals als Staatssekretärin verdient hast, das waren knapp siebzehntausend. Da wundert sich niemand mehr, dass die Schattenwirtschaft wächst. Wenn sie tatsächlich das Bargeld abschaffen und wir gänzlich den Banken ausgeliefert werden, werden wir eben unsere eigenen Zahlungsmittel erfinden.«
»Seit wann bist du so radikal?« Charlotte sah ihn verdutzt an. »Sonst wirfst du mir vor, ich sei extremistisch, und jetzt bist du es selbst.«
»Viertausendsechshundert sind in dem Umschlag. Das hilft uns eine Weile weiter. Simone braucht ein Auto, und der Betrieb gibt es momentan nicht her …«
»… weil du ständig in neue Weinberge investierst.«
»Es ist die einzige Möglichkeit, Steuern zu sparen.«
»Und wir sind bis über unseren Tod hinaus verschuldet. Wir werden nie schuldenfrei sein. Ein Hektar hier amortisiert sich höchstens in dreißig Jahren. Wenn uns was passiert, fällt alles an die Banken.«
»Ich würde jetzt lieber kochen.« Martin stand auf.
»Immer wenn es heikel wird, verziehst du dich in die Küche.«
»Es entspannt. Du kannst ja mitkommen …«
Während des Essens berichtete Martin von der Reise nach Deutschland und richtete besondere Grüße von Sichel aus, mit dem ihn eine lange Freundschaft verband, der hier seine Ferien verbrachte und mithalf, wie es Martin einst getan hatte. Simone stellte unendlich viele Fragen, sie wollte alles haargenau wissen und wurde dabei deutlich nervöser, wie Martin bemerkte. Er dachte auch jetzt wieder, dass sie zu gut war für diese Welt, zu weich, zu anständig. Mit dieser Spezies von Allesfressern, Allesnutzern und Allesverschmutzern auszukommen, war nicht einfach.
Bei allem, nach dem Simone sich erkundigte, war ihr das Wichtigste, dass er eine Weile blieb, möglichst lange. »Charlotte kann ja zur nächsten Messe fahren, und du bleibst hier.«
Mit ihm fühlte sie sich sicher. Ihre Mutter kannte sie nur neun Monate länger. Am Tag nach ihrer Geburt hatte er sein Patenkind auf dem Schoß gehalten. Seit sie wieder hier in dem Haus lebte, in dem sie aufgewachsen war, zeigte sie sich immer wieder verstört, wenn er verreisen musste.
»Ich glaube, es hat damit zu tun, dass du immer wieder zurück nach Deutschland musstest, und dann warst du weg. Ich fand es schwer, mich darauf einzustellen.«
Und als Charlotte und er schließlich das Weingut übernommen hatten, hatte Caroline die Kinder und die Koffer gepackt und war nach Saint-Chinian ins Languedoc verschwunden. Damals hatten sie sich noch hervorragend verstanden, doch dann hatte Caroline auf Betreiben ihrer Mutter einen Prozess wegen Betruges gegen ihn angezettelt. Dahinter stand der Anwalt des korrupten Bankiers Fleury, der die Domaine für seinen nichtsnutzigen Sohn erwerben wollte.
Schließlich signalisierte Charlotte Martin mit ihrem Blick, dass er sich nicht länger vor dem leidigen Thema Praktikum drücken konnte.
»Da du ja leider selbst keine Vorschläge machst, habe ich mir etwas ausgedacht, das dir behagen wird.«
»Du brauchst mich gar nicht so falsch anzulächeln, ich weiß genau, was jetzt kommt. Aber ich sag’s dir gleich: Ich gehe nicht!« Trotzig erwiderte Simone den Blick.
»Hör erst mal zu. Ich habe damals in Frankfurt die Weine von Didier Lamarc verkauft. Er hat sein Gut an der Rhône in Châteauneuf-du-Pape. Es ist viermal so groß wie das unsrige, vierzig Hektar oder mehr. Ich bin darauf gekommen, weil ich bei einem Weinhändler in Darmstadt die Weine gesehen habe. Sie gehören zur Spitzenklasse, und ich kannte Didier recht gut, wir haben uns bei verschiedenen Gelegenheiten getroffen. Er ist verheiratet und hat zwei oder drei Kinder, die müssten inzwischen erwachsen sein. Sein Château liegt außerhalb des Ortes, keine fünf Autominuten vom Ortskern entfernt. Nachbarn gibt es auch, soweit ich mich erinnere …«
Entnervt stöhnte Simone auf. »Warum wollt ihr mich unbedingt loswerden? Bin ich euch bei irgendwas im Weg?«
Für einen Moment hatte Martin den Eindruck, dass seine Patentochter den Tränen nahe war. Und dass sie das Gefühl hatte, abgeschoben zu werden, ließ ihn betroffen innehalten. Jetzt war sie wieder das kleine Mädchen, das er so gut kannte, und nicht die junge, selbstbewusste Frau.
»Niemand will dich loswerden oder abschieben, Simone.« Charlotte griff nach ihrer Hand, doch Simone zog sie schnell weg und verschränkte die Arme. »Wir brauchen dich hier, und du gehörst dazu. Wie kommst du auf eine solche Idee? Bitte – sag es mir, sag es uns. Wir wissen es wirklich nicht.«
Bei diesen Worten brach Simone in Tränen aus. Martin stand auf, trat hinter sie und umarmte sie. Simone ließ es geschehen, und nach einer Weile beruhigte sie sich.
»Früher, als Papa noch lebte, wohnten wir alle hier, und alles war in Ordnung. Und dann, als wir nach Saint-Chinian gezogen sind, war Oma da, verspritzte ihr Gift und funkte bei allem dazwischen. Und dann kam dieser Mann, le grand chef. Es war eine schreckliche Zeit. Aber seit ich hier bin, bei euch, bin ich glücklich, versteht ihr? Versteht ihr das wirklich? Ich werde in Ruhe gelassen, endlich, nach all den Jahren. Ich will nichts anderes, ich fühle mich wohl. Und ihr redet davon, dass ich weggehen soll. Das tut unheimlich weh.« Seufzend lehnte sie sich zurück und wischte sich mit der Hand über die Augen.
»Wir wollen dich nicht weghaben, Simone. Wir möchten, dass du mehr lernst, als du von uns lernen kannst, damit du dich später leichter behauptest. Der Weinbau wird komplizierter, der Klimawandel schreitet voran, die Konkurrenz wird härter. Um mehr zu lernen, musst du in eine andere Umgebung, musst sehen, was die anderen Winzer tun, musst ihre Beweggründe kennen und sehen, wie sie ihr Wissen umsetzen. Die Rhône und Bordeaux – dazwischen liegen Welten.«
»Wieso muss es denn die Rhône sein? Das ist so weit weg.« Simone hörte sich an, als wollte man sie mitten in der Wüste dem Verdursten aussetzen.
Auf das Argument der Entfernung war Charlotte vorbereitet. »Es sind sechs Stunden mit dem TGV von Avignon hierher. Mit dem Auto dauert es kaum kürzer.«
»Dann braucht man aber mindestens noch mal eine Stunde bis Saint-Émilion, und ihr müsstet mich abholen.«
Die Argumente wurden schwächer, fand Martin. Vielleicht drang er doch zu ihr durch, denn in Sachen Weinbau vertraute sie ihm völlig.
»Dort unten praktizieren viel mehr Winzer als hier ökologischen Weinbau – wegen des wärmeren Klimas …«
»Du predigst doch immer, dass es so etwas nicht gibt, beim Einsatz von Schwermetallen gegen Pilze.«
Martin lächelte, Simone hatte gut zugehört, sie nutzte seine Argumente gegen ihn. Er führte ein weiteres Argument ins Feld. »Die Winter werden wärmer, die Krankheiten nehmen zu. An der Rhône regnet es deutlich weniger, es ist ein anderes Wassermanagement nötig, künstliche Bewässerung zum Teil – dann die anderen Rebsorten. Dreizehn sind es statt drei, wie bei uns. Das ist eine Welt für sich. Stell dir vor, welche Geschmacksbilder sich ergeben und wie die Kollegen dort unten damit umgehen. Außerdem«, mit der Hand wehrte er Simones Aufbegehren ab, »außerdem findest du gänzlich andere Böden, völlig uneinheitlich, der Rebschnitt ist auf die Rebsorten abgestellt, ähnlich wie auch diverse Erziehungsmethoden und nicht nur das einheitliche Guyot-System wie hier. Nur aus der kreativen Zusammensetzung des Erlernten lässt sich Neues oder Besseres gestalten.«
»Hört sich sehr intelligent an. Und wie gut kennst du diesen … Wie heißt er noch?«
Die Frage klang bereits etwas kleinlaut. Martin spürte, wie Simones Widerstand nachließ. »Didier Lamarc. Er müsste in etwa so alt sein wie ich. Ein freundlicher Typ und wirklich ein Spitzenwinzer. Die Familie betreibt Weinbau seit Generationen.«
Simone gab noch nicht auf. »Der kennt mich doch gar nicht. Womöglich kann er mich nicht leiden. Und wo sollte ich wohnen? Haben die überhaupt Platz auf dem Weingut? Würden die mir was bezahlen oder mich nur ausnutzen wie alle Praktikanten?«
Wenn sie sich bereits auf praktische Fragen einließ, war viel gewonnen. »Das ist wie alles andere Verhandlungssache. Verhandeln gehört zu unserem Beruf, mit Banken, mit Kunden, mit Behörden und Lieferanten.«
»Ansonsten zahlen wir dir die Differenz zu deinem jetzigen Gehalt«, fügte Charlotte hinzu.
»Und wie komme ich da hin? Ich will es mir vorher ansehen und die Leute kennenlernen.«
Erstaunt bemerkte Simone, dass Martin aufstand und den Raum verließ. Er ging ins Büro, holte den Umschlag aus dem Schreibtisch und legte ihn vor Simone auf den Tisch. »Mach ihn auf!«
Verwirrt blickte sie ihn an, wog den Umschlag in der Hand und zog ein Bündel Geldscheine heraus, das sie verständnislos betrachtete. »Was soll ich damit?«
»Das ist für dein Auto. Damit du meines nicht mehr brauchst und uns besuchen kommen kannst.«
Mit offenem Mund starrte Simone von Martin zu Charlotte. »Ihr Lumpen, ihr wollt mich kaufen?«
»Bestechen«, sagte Charlotte mit gespieltem Ernst. »Geld öffnet alle Türen.«
Die Vorstellung vom eigenen Auto schien Simones Widerstand zu brechen, doch sie war noch nicht restlos überzeugt.
»Würdest du diesen … diesen Monsieur Lamarc anrufen, Martin?«
»Selbstverständlich.«
»Ist das wirklich ein netter Mensch? Seine Familie auch?«
»Sehr angenehme Zeitgenossen, soweit ich das beurteilen kann.«
»Kannte Papa ihn? Weiß er, was ihm zugestoßen ist? Auf Mitleid kann ich verzichten«, erwiderte sie widerborstig.
»Ich glaube nicht, dass er davon weiß.«
»Würdest du mitkommen und mit mir das Weingut anschauen?«
»Auch das.«
»Wenn es mir nicht gefällt, kann ich Nein sagen?«
»Das erwarte ich sogar von dir, alles andere hätte keinen Sinn.« Martin sah auf die Uhr. Es war noch früh am Abend. »Wenn du willst, rufe ich ihn jetzt sofort an.«
Simone stimmte zu, jedoch immer noch halbherzig. »Na gut. Vielleicht erübrigt sich die Debatte, und er will keine Praktikanten haben.«
»Freu dich nicht zu früh.« Mit diesen Worten stand Martin auf und ging ins Büro. Er hatte nicht die geringste Vorstellung, wie Lamarc reagieren würde. Das Weingut gab es noch, und den Winzer auch, er hatte ihn zuletzt vor vier Jahren auf der Vinexpo in Bordeaux getroffen. Martin überlegte, wo er die Visitenkarte abgelegt hatte. Nach einigem Suchen fand er sie, setzte sich ans Telefon und wählte.
Kurz darauf meldete sich eine Frauenstimme. »Domaine Didier Lamarc, bonjour?«
Martin stellte sich vor und erklärte, dass er gern mit Didier sprechen wolle. Er erinnerte sich daran, dass man sich geduzt hatte.
»Mit Didier wollen Sie sprechen?« Erstaunen oder Befremden schwangen in der Stimme mit.
»Ja sicher, ich bin doch richtig bei Didier Lamarc?«
Eine Pause entstand, als ob sie sich die Antwort erst zurechtlegen müsste. »Ja – aber wissen Sie es denn nicht?«
Jetzt meinte Martin, etwas wie Bitterkeit aus der Stimme herauszuhören. »Was soll ich wissen? Hat er … hat er etwa verkauft?«
»Nein, keineswegs, Didier … Didier wird seit zwei Jahren vermisst. Er verschwand im Juli, von einem Tag auf den anderen. Niemand hat seitdem jemals wieder von ihm gehört.«
Nur um seine Bestürzung zu überspielen, fragte Martin, mit wem er spreche.
»Ich bin … seine Ehefrau, ich führe jetzt das Weingut.« Die Stimme fand zu einem festen Ton zurück. »Didier hatte gerade den ersten Preis beim Concours de la St. Marc gewonnen, beim Wettbewerb für die besten Weine von Châteauneuf-du-Pape. Drei Tage später verschwand er. Seit damals gibt es nicht eine Spur von ihm.«
Kapitel 3
Bis vor wenigen Tagen hatte die Erinnerung an die Rhône irgendwo in seinem Hinterkopf geschlummert, verblichen wie Fotos, die zu lange in einem Schaukasten der Sonne ausgesetzt gewesen waren. Jetzt, als er sein Gepäck voller Zorn in den Kofferraum knallte, gewannen die Bilder wieder Konturen und Farbe. Vor zehn Jahren hatte ihn sein Vater auf eine seiner Geschäftsreisen mitgenommen, nach Châteauneuf-du-Pape, nach Tavel und Lirac, er erinnerte sich an Namen wie Gigondas und Vacqueyras, wo die Winzer die Namen ihrer Dörfer auf den Etiketten ihrer Weine nennen durften. Damals hatte er auch Alain kennengelernt, Alain Dupret. Sie waren im gleichen Alter, Alain arbeitete bereits im elterlichen Weingut in Lirac mit, in der Gewissheit, eines Tages die Weinberge zu übernehmen sowie die Kellerei weiterzuführen. Bis vor Kurzem waren Thomas’ Pläne ähnlich gewesen …
Die Reisetasche mit den persönlichen Dokumenten und seinem Diplom als Önologe kam auf den Vordersitz des Wagens. Zu jener Zeit, damals, vor zehn Jahren, hatte er sich mit dem Gedanken herumgeschlagen, Betriebswirtschaft zu studieren. Aber dann war alles anders gekommen. Beim Praktikum in der Champagne hatte das Unglück sozusagen seinen Lauf genommen, da hatte er Blut geleckt beziehungsweise Champagner, ein Teufelszeug. Er hatte immer geglaubt, dass jeder seines Glückes Schmied sei. Wenn dieser Satz seines Vaters richtig war, was war dann mit dem Unglück? Schmiedete man das auch? Das hatte ihm sein Vater verschwiegen.
Hatte er etwas Wichtiges vergessen? Thomas glaubte, an alles gedacht zu haben, und wenn nicht, so würde er Verena bitten, es ihm nachzuschicken. Die Frau seines Vaters hatte er noch vor ihm in seinem Plan eingeweiht.
Die Rhône – jetzt war sie sein Fluchtpunkt –, dabei hatte er kaum noch eine Vorstellung von diesem Fluss. Alles, was ihm in den Sinn kam, waren die bunten Schönwetterbildchen in den Prospekten und auf den Websites der Winzer. Er hatte immer geglaubt, dass die Rhône im Genfer See entsprang, doch sie kam aus einem Gletscher in den Schweizer Alpen, ähnlich wie der Rhein, nur war die Rhône längst nicht so lang. Weshalb machte er sich Gedanken darüber, wie lang der Fluss war? Es war völlig egal, und es war auch unwichtig, und jetzt, wo er versuchte, sich diesen Fluss vorzustellen, irgendein Bild entstehen zu lassen und es festzuhalten, hatte er wieder den Rhein vor Augen. Der war ihm näher, der war gegenwärtig, drei Jahre lang war er Woche für Woche montags mit der Fähre von Bingen nach Rüdesheim übergesetzt und am Freitag zurückgekehrt. Und wenn es erforderlich gewesen war, hatte er die Fähre am Abend benutzt, nur um über Nacht eine wichtige Arbeit auf dem Weingut zu erledigen, und war am nächsten Morgen – müde wie ein Hund – zurück zur Hochschule nach Geisenheim gefahren.
Ja, die Rhône war verblasst, war zu einem Wort verkümmert, ausgetrocknet, mit diesem Fluss verband sich kein Gefühl. Oder doch? Jetzt, auf dem Weg zu neuen Ufern, nahm die Rhône wieder Gestalt an. Knapp drei Kilometer soll sie von Lirac entfernt sein. Von ihrem Weingut bis zum Rhein war es dreimal so weit. Und Lirac? Alain hatte ihm einige Bilder auf sein Smartphone geschickt: Ein Dorf wie viele, ein französisches, typisch und auch wieder nicht, doch typisch wofür? Das Internet berichtete von 888 Einwohnern. Und eine winzige Kneipe soll es geben, ein Café. Die Kirche interessierte ihn weniger.
Ich muss aufhören zu denken, sagte sich Thomas, ich werde noch irrsinnig, ich muss hier weg, sonst werde ich verrückt.
Leise öffnete er das Tor und warf einen zaghaften Blick zurück auf das Haus. Sein Haus? Nein, das war es nicht mehr, obwohl ihm davon ein Drittel gehörte – auf dem Papier. Blickte ihm jemand nach? Er ärgerte sich, dass er sich das fragte, dass es ihm nicht gleichgültig war, und raste mit dem Wagen bis an den Rand der Landstraße, stieg aus und schloss das Tor, diesmal ohne auf das Haus zurückzuschauen. Nichts gab es hier, bei dem er nicht selbst Hand angelegt hatte, trotzdem wollte er es nicht sehen. Es tat ihm weh, zu gehen, Verzweiflung und Zorn wechselten sich ab. Am liebsten hätte er das Tor zugeschmissen. Was dort drinnen geschah, ging ihn nichts mehr an. Dabei wusste er, dass er sich belog. Denn außer diesem Drecksack und der falschen Schlange wohnten auch sein Vater und Verena dort. Wieso hatten ihn die beiden nicht gewarnt?
Mit quietschenden Reifen fuhr er los, sah sich nicht einmal um, warf keinen Blick mehr auf seine geliebten Weinberge, er starrte zwanghaft auf den Asphalt und fuhr durch das schlafende Dorf, das ihm so blass erschien wie der frühe Morgenhimmel, so ausgestorben wie sein Inneres.
Erst gestern Abend, nach dem Kofferpacken, hatte er es seinem Vater eröffnet. »Ich gehe nach Frankreich, morgen früh fahre ich. Es ist alles mit Alain Dupret besprochen. Du kennst das Weingut. Du hattest früher mit ihnen zu tun. Ich werde dort arbeiten, Alain braucht Hilfe, sein Vater schwächelt, wie er sagte.« Ihm stehe eine kleine möblierte Wohnung zur Verfügung. Die müsse er allerdings von seinem Gehalt bezahlen, was ihm egal war, um Geld war es ihm nie gegangen. »Dann sehen wir weiter …«
Sein Vater war bleich geworden, fassungslos hatte er ihn angestarrt. »Und wir?«, hatte er bloß gefragt. »Und wir?«
Thomas’ Achselzucken war kein Zeichen von Gleichgültigkeit, es war vielmehr sein Ausdruck seiner Hilflosigkeit, aber er konnte nicht bleiben.
»Wo willst du hin? Nicht, dass ich dich daran hindern wollte. Aber – wo willst du hin?«
»An die Rhône, zu Alain Dupret, wie ich sagte, mit ihm ist alles besprochen.«
»Ich meine das anders, nicht örtlich, vielmehr …« Sein Vater hatte gestammelt, hatte hilflos gewirkt, so ratlos, wie er ihn nie zuvor gesehen hatte. »Liegt das Weingut nicht, soweit ich mich erinnere, in Lirac?«
Die Frage hatte er nur gestellt, um etwas zu sagen.
Thomas hatte genickt, sein Gesicht so verschlossen wie in den letzten Wochen. Er wusste, was kommen würde, er kannte die Einstellung seines Vaters. Wieso er seinen Traum aufgeben würde.
»Lirac liegt am falschen Ufer der Rhône. Du solltest nach Châteauneuf-du-Pape gehen, ans linke Ufer, da sind die Weine …«
Thomas’ Blick, auch wenn er nicht böse war, hatte seinen Vater verstummen lassen. Philipp Achenbach wusste auch keinen Rat, wie er seinem Sohn in dieser Situation hätte helfen können. Die Ereignisse brachten ihr gesamtes Projekt in Gefahr, die Arbeit von Jahren stand auf der Kippe. »Setz dich mit den beiden auseinander, daran kommst du nicht vorbei. Verprügel Manuel von mir aus, aber Flucht ist keine Lösung!«
Was gab es auseinanderzusetzen, wenn man bereits gänzlich auseinandergerückt war? Kamila hatte beschlossen, sich mit seinem besten Freund, seinem ehemaligen Studiengefährten und heutigen Teilhaber ihres Weingutes, zusammenzutun, war von einem Bett ins andere gewechselt und hatte dazu nicht einmal das Haus verlassen müssen, lediglich das Stockwerk! Gleichzeitig hatte sie jedes Gespräch verweigert. »So ist es eben!« Das war ihr einziger Kommentar. »Ich liebe dich nicht mehr«, hatte sie als fadenscheinige Begründung nachgeschoben. Als wenn das helfen würde. Friss, Vogel, oder stirb. Er hätte Manuel wirklich verprügeln und Kamila rauswerfen sollen. Nichts von beidem hatte er getan, wie gelähmt war er gewesen.
Bad Dürkheim schlief noch, nicht einmal die Bäcker hatten geöffnet. Thomas entschied sich, nicht die Autobahn über Kaiserslautern zu nehmen, sondern über Straßburg und Colmar weiter nach Besançon zu fahren, schnell raus aus Deutschland.
Angefangen hatte alles vor einem halben Jahr, wie er inzwischen wusste, im letzten Herbst, als Manuel die Erbschaft gemacht hatte: zwei Millionen und ein Haus mit Garten am Tegernsee. Er, Thomas, hätte es merken können, es merken müssen. Die Unruhe hatte er gespürt, nur der Grund dafür war ihm nicht klar gewesen. Hätte Manuel nur sein verdammtes Maul gehalten – dann wäre er nie darauf gekommen, wie Kamila wirklich dachte. Hatte sie fünf lange Jahre mit ihm das Leben geteilt und wirklich nur auf diesen Augenblick gewartet? Dass Manuel aus sehr reichem Hause stammte, hatte sie von Anfang an gewusst …
Auf der A65 bis Kandel herrschte kaum Verkehr, er hatte fast das Gefühl, wie in Trance zu fahren, unwirklich zog die Landschaft an ihm vorbei, als würde die Erde unter ihm weggedreht. Sein gebrauchter Kombi machte noch gut seine hundertfünfzig.
Ihre Klagen über die Fülle der täglichen Arbeiten auf dem Weingut hatten sich gehäuft, er hatte ihre Lustlosigkeit gespürt, sich dem Diktat dieses Betriebs zu beugen, ihre Einsicht in das Notwendige hatte im Vergleich zu ihrem anfänglichen – vorgespielten? – Enthusiasmus deutlich abgenommen. Sie hatte weniger Zeit für ihn gefunden, und es war ihm nicht aufgefallen, dass sie sich an Manuel herangemacht hatte. Und er, Thomas Achenbach, war der Idiot, der Stiesel, schwer von Begriff, hatte sich darüber gefreut, dass sein bester Freund sich mit seiner Freundin so gut verstand. Bis er sie vor einer Woche im Keller überrascht hatte, im Keller …
»Als Nächste seid ihr dran«, hatte Verena noch lachend an dem Tag prophezeit, an dem sie seinen Vater geheiratet hatte. Das war vor drei Jahren gewesen. Verena war schwer in Ordnung, sie war pfiffig, das musste sie bei seinem Vater auch sein. Er hatte nicht auf sie gehört, und Kamila war ihm nie mit Heiratsplänen gekommen. Hätte ihn das stutzig machen müssen? Wie konservativ sie dachte, hatte er erst im Laufe der Zeit begriffen, katholisch und konservativ, so wie ihre gesamte Familie. Sie hatte ihm unmissverständlich klargemacht, dass ihre gemeinsame Zeit zu Ende war und sie jetzt mit Manuel zusammen sei, sie müsse ihr Herz sprechen lassen. Es sprach auf Geld an – wie Thomas einsehen musste –, es schlug mit erhöhter Frequenz.
Die Szene im Keller hatte er noch immer vor Augen: Rechts standen die neuen Barriques, links die Fuder mit dem Riesling vom letzten Jahr. Er gärte noch, ab und zu stieg ein Bläschen durchs Gärröhrchen, und in der Stille nach der grausigen Eröffnung hatte Thomas das Blubbern hören können.
Manuel hatte schweigend zu Boden gestarrt, seine Fingernägel betrachtet und gelangweilt getan, hatte dann Kamila angeblickt und sie bewundert, dass sie sich der Konfrontation stellte. Bei starken Frauen wurde Manuel schwach. Also war alles von ihr ausgegangen, er hatte sich wieder gefügt, so wie bei Alexandra. Offensichtlich hatte Manuel aus der damaligen Katastrophe nichts gelernt. Änderten sich die Menschen niemals? Lernten sie nichts dazu?
Thomas dachte darüber nach, welches Schimpfwort auf Manuel passte. Er fand keines. Waschlappen? Das war altmodisch, aber es traf den Kern. Oder das, was ich dafür halte, sagte er sich.
Von Kandel aus stellte ein Stück Landstraße die Verbindung zur Autobahn nach Straßburg her. An der Grenze stauten sich die Wagen, seit der Anschläge in Paris und Nizza wurde wieder an der Grenze kontrolliert. Sie kontrollierten immer zu spät. Hier liefen die Polizisten mit umgehängten Maschinenpistolen herum, als würden sich Terroristen zur Passkontrolle anstellen.
Hinter der Grenze atmete er auf, als wären seine Probleme zurückgeblieben, als gelänge es ihm, sich davonzustehlen. Er wich aus, klar, gleichzeitig wusste er, dass er in Gesellschaft von Manuel und Kamila, die ihm den Teppich unter den Füßen weggezogen hatten, niemals zu einer vernünftigen Entscheidung kommen würde. Es ging um sein Haus, seine Kellerei und seine Weinberge. Fünf Jahre hatte er dafür geschuftet. Nein, er würde den beiden das Weingut niemals überlassen. Sein Vater würde auch nicht mitspielen. Die beiden mussten gehen. Dann jedoch würde Manuel seine Investitionen zurückfordern, und ihn auszuzahlen, war bei ihrem Schuldenberg unmöglich. Sie würden verkaufen müssen.
Zwei Millionen hat Manuel geerbt, dachte Thomas, fast drei, als er durch Straßburg fuhr. Dagegen gab es keine Argumente. Woher hatte Kamila es gewusst? Lediglich sein Vater Philipp und er selbst hatten die Summe gekannt, sie sollten es für sich behalten, so war es abgesprochen. Dabei war die Erbschaft dieser Großtante erst der Anfang. Von seinem Vater, obwohl mit ihm zerstritten, hatte Manuel weit mehr zu erwarten. Thomas hingegen musste sich krumm machen und hatte für die nächsten zwanzig Jahre Schulden, ach, für dreißig …
Zwei Millionen waren selbst für die stärkste Liebe zu viel, wenn sie ihn denn geliebt hatte. War alles eine Farce gewesen, war Manuel schon immer Kamilas Ziel gewesen, und er hatte lediglich als Brücke fungiert? Konnte man sich selbst fünf Jahre lang etwas vormachen? Er war zu beschäftigt mit dem Aufbau ihres Weingutes gewesen, mit dem Studium und wollte das anwenden, was er gelernt hatte. Einen Weinstock wachsen und Früchte tragen zu sehen, war spannend – nein, eben nicht für jeden. So zu denken war sein Fehler gewesen. Er hatte die letzten Jahre nichts anderes gekannt als Arbeit.
Es war nicht richtig, dass er jetzt ging, aber er konnte nicht anders. Es war Mitte Mai, der Austrieb der Reben hatte vor drei Wochen eingesetzt, er hatte bereits fünf Blätter am Trieb gezählt, für Mitte Mai war das ideal. Der Weinberg war seine Domäne. Manuel hingegen fehlte die geübte Hand, ihm fehlte die Ausdauer, und Kamila hatte sich immer geziert, draußen zu arbeiten. Thomas hingegen war schnell, konnte gut allein arbeiten, ging rasch vor, geplant, seine Hand war sicher, wusste, wohin sie greifen musste. Beim Winterschnitt war er dabei, egal, bei welcher Temperatur, und auch wenn sie bezahlte Helfer einsetzten, begleitete er sie bei der Arbeit.
In Lirac würde es ähnlich sein, hoffte er. Nur die dortigen Rebsorten waren ihm ein Rätsel. Ihre Namen kannte er, jedoch nicht ihre Eigenschaften. Er hatte die Weine von dort probiert, auch die von Alain Dupret, die ihm gefallen hatten, andernfalls würde er nicht zu ihm fahren. Vielleicht würden sie Freunde werden? Er würde sich rasch eingearbeitet haben, denn wenn er wütend war, das wusste Thomas, arbeitete er doppelt so gut und doppelt so schnell. Zu Hause werden sie feststellen, wie sehr ich fehle, dachte er mit Genugtuung und schämte sich gleichzeitig für sein Selbstmitleid. Ach, es war zum Kotzen.
Es war falsch, dass er Manuel das Feld überließ. Doch der Abstand war nötig. Er brauchte eine andere Welt um sich, eine andere Landschaft, andere Weinberge, sogar eine andere Sprache, Gesichter, die er nicht kannte, Menschen, die er nie zuvor gesehen hatte und die ihn forderten, ihn auf andere Gedanken brachten, andernfalls würde er verrückt werden. Außer Alain kannte er nur dessen Vater. Von seiner Schwester Marianne hatte Alain erzählt, als sie sich auf irgendeiner Weinmesse getroffen hatten, zuletzt im März in Düsseldorf, aber da war die Katastrophe noch nicht offenkundig gewesen, zumindest nicht für ihn. Und jetzt, zwei Monate später, ließ er ein Trümmerfeld zurück. Erst wenn Manuel und Kamila für immer verschwunden wären, würde er zurückkommen, das hatte er seinem Vater gesagt, als der meinte, er müsse das alles mit Manuel ausmachen. Doch Manuel war nicht nur feige, er war schwach, ein Schwächling, schon damals, als er sich nicht einmal gegen falsche Vorwürfe hatte zur Wehr setzen können.
Langsam rollte Thomas auf die Mautstelle zu, hielt vor der Schranke, schob seine Kreditkarte falsch herum in den Schlitz, die Fahrer hinter ihm hupten, dann brachte er die Karte richtig herum hinein, die Schranke öffnete sich, und die neunspurige Fahrbahn schrumpfte wieder auf zwei Spuren zusammen. Das Schild am Straßenrand sagte ihm, dass es noch zweihundert Kilometer bis nach Lyon waren, bis nach Lirac war es noch einmal genauso weit. Es war an der Zeit, eine Pause einzulegen, an diesem strahlenden, viel zu schönen Tag, doch erst kurz vor Beaune im Burgund hielt er an einem Rasthaus.
Der Kaffee war gut, das Croissant bedeutend schmackhafter als das von ihrem Bäcker, die anderen Gäste schienen guter Stimmung, und er freute sich, ihre Sprache zu hören. Bei ihrem Klang fühlte er sich leichter, sie schoben die düsteren deutschen Worte, die er in seinem Kopf wälzte, beiseite. Französisch war nach Englisch seine zweite Fremdsprache gewesen, Frankreich war im Zusammenleben mit seinem Vater und wegen dessen Beruf als Einkäufer französischer Weine immer präsent, wie ein guter Nachbar. Und mit seinem Freund Pascal Bellier, dem sie wegen seines Übereifers bei der Polizei in Metz ständig mit Rausschmiss drohten, sprach er sowieso nur Französisch.
Von Lirac aus rufe ich ihn an, sagte sich Thomas, vielleicht kommt er ein Wochenende runter, besucht mich, mit Pascal konnte er über alles reden. Erleichtert über diese Idee fuhr er weiter. Die Tafel Schokolade auf dem Beifahrersitz reichte ganze fünf Minuten, danach war ihm schlecht, aber er musste sich auf den Verkehr konzentrieren. Lyon kam in Sicht, das Navi führte ihn über Schnellstraßen und Autobahnen um die Stadt herum und zuletzt durch sie hindurch. Dann war die Rhône da, gewaltig, eindrucksvoll, tief und breit zwängte sie sich durch ein Tal, die Autobahn wechselte vom einen aufs andere Ufer und wieder zurück. In der warmen Sonne des Nachmittags lagen die ersten Weinberge da, steil und grün und Vertrauen erweckend. Dort, wo der Wein wuchs, fühlte er sich zu Hause. Zum ersten Mal auf dieser Fahrt keimte etwas wie Neugier in ihm auf, gepaart mit der Erwartung auf Alain und die Menschen, die er in Lirac treffen würde, und die Aufgaben, die sich ihm stellen würden. Dem fühlte er sich gewachsen, im Gegensatz zu dem, was Kilometer um Kilometer weiter hinter ihm zurückblieb. Die Zweifel, die Krise zu bewältigen, schwanden nicht, aber das Licht des Südens, warm und weich gegen Abend, überzog die Hügel und Ebenen mit einem rötlichen Hauch.
Der Verkehr rollte auf der dreispurigen Strecke gemächlich dem Mittelmeer zu, nie schneller als hundertzehn Stundenkilometer, und Thomas stellte zum ersten Mal, seit er losgefahren war, das Radio an. Die Musik hob seine Laune weiter, schließlich befand er sich auf der Autoroute du Soleil und fuhr der Sonne entgegen. Vielleicht finde ich eine Lösung, dachte er, vielleicht gibt es einen Weg. Nichts lässt sich ungeschehen machen, von vorn kann man nie beginnen, aber es gibt Anfänge für etwas Neues. Nein, mein Weingut werde ich nicht aufgeben, es niemals Manuel überlassen. Der hätte nicht die Kraft, es mit Philipp zu führen, ihm täglich gegenüberzutreten und seine Auffassung vom Wein durchzusetzen. Dabei war Manuel ebenfalls Önologe, sie hatten gemeinsam studiert und zusammengewohnt.
Die beiden weißen, schräg stehenden Wolken rechts der Autobahn ließen Thomas stutzen. Wolken dieser Form standen über Kühltürmen. Und eine Minute später sah er sie tatsächlich und erinnerte sich mit Schrecken, dass zwischen Lyon und dem Mittelmeer vier Atomkraftwerke am Ufer der Rhône standen. Zwei weitere standen östlich von Lyon. In Avignon sollte es Messstationen für Radioaktivität geben, doch wenn dort die Geigerzähler tickten, war es bereits zu spät.
Hinter der Ausfahrt Montélimar-Nord kamen die vier Kühltürme von Cruas in Sicht, bedrohlich, gefährlich und noch gewaltiger als die vorherigen, ein stilles Glühen, das bei dem kleinsten technischen Defekt oder bei geringstem menschlichem Versagen in einem finalen Inferno enden würde. Tschernobyl war jüngst wieder für hundert Jahre versiegelt worden und kochte doch weiter. Philipp hatte ihn früh auf die Gegnerschaft eingeschworen, er war ein glühender Verfechter erneuerbarer Energien, für ihr innovatives Energiemanagement auf dem Weingut waren sie ausgezeichnet worden. Und hier, wo die Sonne endlos schien, wo waren die Sonnenkollektoren? Nichts, nirgends, auch keine Windräder. In jedem pfälzischen Dorf gab es mehr. Doch, bei Tricastin kamen drei oder vier in Sicht, auf der anderen Seite des Kanals, gegenüber dem AKW. Hier standen nur zwei Kühltürme. Die dazugehörigen Anlagen verschleierten mit ihrem zivilen Aussehen die lauernde Gefahr. Wollte die französische Regierung das Rhônetal verseuchen? Hier hatten bereits die Phönizier fünfhundert Jahre vor Christus die ersten Reben gepflanzt. Die Römer taten es ihnen nach, bis Tricastin unter ihrer Herrschaft eines der wichtigsten Weinbaugebiete im besetzten Gallien wurde.
Seit dreitausend Jahren waren die Völkerscharen durch dieses Tal gezogen: Ligurer, Kelten und Griechen. Hannibal soll hier in der Nähe mit seinen Elefanten die Rhône überschritten haben, Römer eroberten die gesamte Provence, dann herrschten die Goten, ihnen folgten die Franken, dann kamen Araber und Burgunder, und für vierhundert Jahre markierte die Rhône die Grenze zwischen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Sieben Päpste ließen sich nicht lumpen und mischten mit, dann prügelten sich die Habsburger hier mit den Bourbonen. Natürlich durfte Napoleon im Reigen des allgemeinen Gemetzels nicht fehlen, und zuletzt marschierten 1942 deutsche Truppen hier durch.
Ein einziger Störfall, und das Rhônetal wäre erledigt, für Touristen oder für Urlauber auf der Durchreise zum Mittelmeer. Und keine Sau würde jemals wieder eine Flasche mit der Herkunftsbezeichnung Côtes du Rhône anrühren, geschweige denn öffnen. Fünfzigtausend Hektar, das entsprach der Hälfte des deutschen Weinanbaugebietes, wären verseucht, siebentausend Weinbaubetriebe und Kellereien könnten dicht machen und die Jahresproduktion von vierhundert Millionen Liter gleich in die Rhône schütten.
Wenn ich weiter so denke, kann ich gleich umkehren, sagte Thomas sich, lieber verdränge ich das alles, so wie die Einheimischen hier, die ihre nukleare Umgebung fatalistisch hinnahmen wie die Urmenschen den Säbelzahntiger. Trotzig fuhr er weiter, insgeheim auf die Kühltürme oder Schornsteine der Anlage von Marcoule wartend, wo bis vor einigen Jahren einerseits Strom produziert und andererseits Tritium für Wasserstoffbomben hergestellt wurde. Von Protesten der Bevölkerung hatte Thomas nie gehört. Alain Dupret müsste es wissen, der schien ihm an derartigen Fragen interessiert zu sein. Aber gegen den französischen Staat aufbegehren?
»Das ist völlig zwecklos«, hatte Pascal Bellier Thomas deutlich zu verstehen gegeben. »Frankreich ist ein Klassenstaat: konservativ, zentralistisch, militaristisch und träumt von längst vergangener Grandezza.«
Von Marcoule bekam Thomas nichts zu sehen, der Fluss war zu weit entfernt, das AKW lag am jenseitigen Ufer, und er musste sich konzentrieren, denn die Autobahn teilte sich. Links ging es an Avignon vorbei nach Marseille, er hingegen hielt sich auf der Languedocienne, verließ am Péage Roquemaure die Autobahn – und zahlte die Maut. Über sein Gehalt hatte er mit Alain nicht gesprochen. Es war ihm egal, was er verdiente, auf jeden Fall würde das Geld knapp werden, er musste seine Kohle zusammenhalten, das war er gewohnt. Von zu Hause war nichts zu erwarten, er würde sich hüten, seinen Vater danach zu fragen, obwohl ihm ein Teil der Einnahmen aus den Verkäufen zustand. Wenn sein Vater eine Arbeitskraft einstellen musste, würde zuerst die davon bezahlt.
Die Beschilderung war hilfreich, und Thomas fand sofort den Wegweiser nach Lirac, wo er fünf Minuten später ankam.
Das Weingut war ein ehemaliger Bauernhof. Noch vor drei Generationen hatten Alains Vorfahren Milchwirtschaft betrieben, Schweine gehalten, Getreide und Gemüse angebaut und Wein für den Eigenbedarf produziert. Im Laufe der Jahrzehnte hatten sein Großvater und auch der Vater die Produktion umgestellt und sich spezialisiert, wie so viele ehemalige Bauern hier im Gard. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte ihnen die Landflucht geholfen, ihren Besitz zu vergrößern, sie hatten den Kleinbauern das Land abgekauft, das diese nicht mehr bearbeiten wollten.
Das eiserne, mit Stacheln besetzte Tor war offen, und im Hof stand neben einem Lieferwagen und zwei Pkw der Traktor mit dem Gebläse zum Ausbringen der Bordelaiser Brühe. Das Gerät mit seinen vier oder sechs Armen erinnerte Thomas immer an die indische Göttin Kali, den Tod verkörpernd und gleichzeitig die Kraft der Erneuerung. Auf dem Schutzblech wie auch an der Heckklappe eines der Autos entdeckte Thomas einen bekannten Aufkleber: die lachend rote Sonne und darüber das Wort Nucléaire? Darunter: Non Merci. Hier war er richtig.
Unter Kali, anders als in der indischen Mythologie, ragte nicht Shiva heraus, sondern ein Paar langer Beine in Jeans. Daneben stand eine Werkzeugkiste. Das war wie zu Hause, es war eine Umgebung, die Thomas lächeln ließ, und gleichzeitig gab ihm die Szene einen Stich.
»Bonjour, mon ami.«