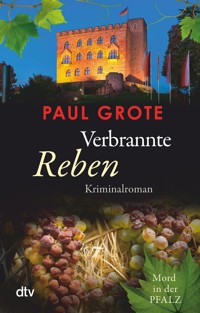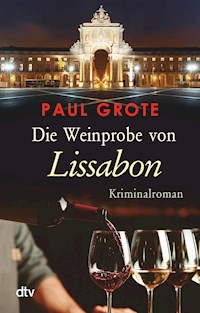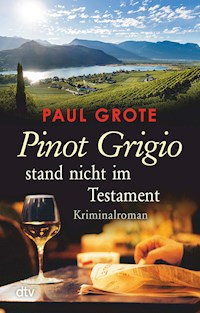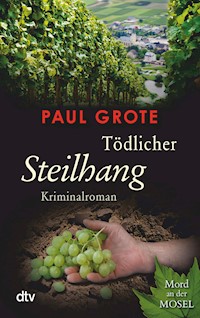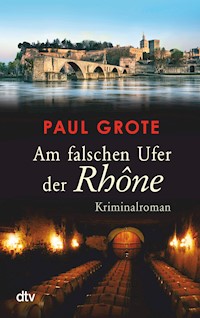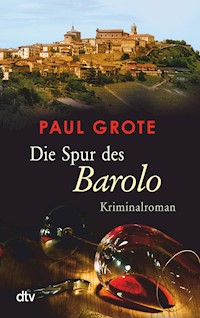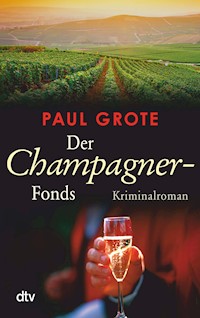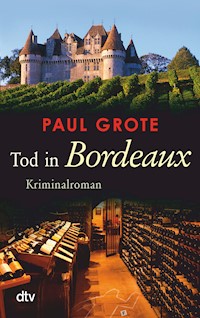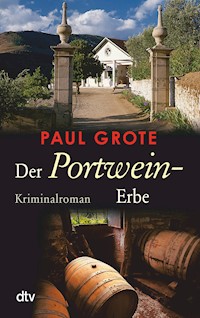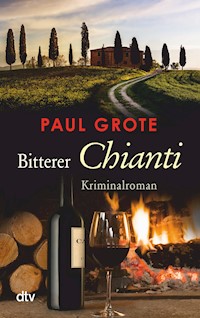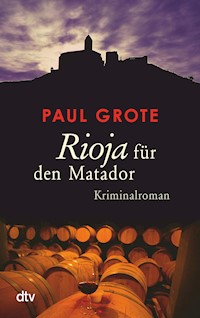Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Europäische-Weinkrimi-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein weiterer Weinkrimi Der Mensch, der Wein - und das Böse. Eine Lüge, eine zerrüttete Ehe und der tödliche Unfall der Winzerin Maria - oder war es Mord? Kein guter Start für den Urlaub am Neusiedler See. Dabei ist Carl Breitenbach, Mitglied des Stuttgarter Weinclubs, nur wegen Maria hier. Seine Frau Hanna, eine passionierte Surferin, rächt sich auf ihre Weise, und als Carl ins Visier der Polizei gerät, begreift er, dass er den Fall selbst lösen muss.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Grote
Verschwörung beim Heurigen
Kriminalroman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
© 2007 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
eBook ISBN 978-3-423-40011-4 (epub)
www.dtv.de
Inhaltsübersicht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Epilog
Danksagung
Man gewährt sich Vertrauen,
bis zu einem gewissen Grade;
man versteht sich,
vermittels Nachsicht;
man ist eins,
unter Vorbehalt.
Heinrich Mann
1
»Er ist ein Blender!«
»Wer? Wen meinen Sie?« Carl Breitenbach blickte sein Gegenüber bestürzt an, dann begriff er. »Ach so«, sagte er gedehnt, »ich dachte, Sie meinen...«, er zögerte wieder unentschlossen.
Der Fremde kicherte vor sich hin. »Den Winzer?« Er neigte abwägend den Kopf. »Nein... ich meinte natürlich den Wein.«
Carl blickte den Fremden an, dann in sein halbvolles Glas, er war sich nicht sicher, was er von ihm zu halten hatte. Ton und Gesichtsausdruck des Mannes ließen ihn zweifeln, besonders sein süffisantes Lächeln. Man hätte es als überheblich deuten können, oder als eine Art Abgeklärtheit, ein solches Urteil mit so viel Selbstverständlichkeit auszusprechen. Da war er viel vorsichtiger, schon aus Unsicherheit. In seinem Beruf konnte er sich zwar nicht um Entscheidungen drücken, aber beim Wein war er nur zu schnell bereit, sein Urteil zu revidieren. Verlegen wich er dem Blick des Fremden aus, hob das Glas an die Nase und nahm so viel wie möglich von dem fruchtigen Duft des Weins in sich auf.
Er kostete, bewegte den Wein im Mund, kaute ihn, wie er es gelernt hatte, ließ sich auf den Geschmack ein, auf Süße und Säure, die man nur schmecken konnte – und kam zum selben Ergebnis. Dieser Chardonnay war ein Blender. Und Carl sagte, ohne sich anbiedern zu wollen: »Gewiss, ein Blender. Nur komisch«, er hielt kurz inne, »dass ich nicht gleich darauf gekommen bin.«
»Wäre ein schlechter Blender, wenn man ihm sofort auf die Schliche käme«, erklärte ihm der Fremde, »so ein Wein hätte den Namen nicht verdient. Auch ein negatives Prädikat muss man sich erarbeiten. Blender muss man machen können. Das schafft nur ein fähiger Winzer – oder Önologe.« Jetzt schnüffelte der Fremde seinerseits am Glas, zuerst mit dem linken und dann mit dem rechten Nasenloch.
Carl nickte mehrmals, als müsse er seinen eigenen Eindruck bestätigen, er runzelte die Stirn. »Sie meinten doch den Winzer, ist es nicht so?«
Sein Gegenüber lachte. »Beantwortet sich diese Frage nicht von selbst?«
Da war wieder diese Sicherheit in der Stimme des anderen, die Carl zuvor bereits verunsichert hatte, die aber nicht aufgesetzt schien. Es verwirrte ihn immer aufs Neue, mit welcher Selbstverständlichkeit, ja, Nonchalance war als Begriff eigentlich besser, mit welcher Lässigkeit andere Leute, ob vom Fach oder nicht, Urteile über Wein abgaben. Carls Neugier dem Mann gegenüber war geweckt.
Er mochte Anfang vierzig sein, im dunklen, lockigen Haar zeigten sich erste graue Strähnen. Er hatte ein schmales, sympathisches Gesicht und blaue Augen, die er hinter einer kleinen, kreisrunden Brille verbarg. Er trug Jeans, ein helles Hemd und ein zerknittertes Leinensakko. Wie der Einkäufer eines Weinimporteurs sah er nicht aus, beileibe nicht wie ein Sommelier, schon eher wie ein Weinhändler; unter denen traf man die merkwürdigsten Typen. Viele waren Quereinsteiger, hatten weder eine Lehre im Weinbau noch ein Studium als Agronom hinter sich. Es waren ehemalige Ingenieure, Lehrer und Polizisten – sogar einen Mathematiker hatten sie zu Hause unter den Weinhändlern in Stuttgart.
Der Unbekannte unterbrach Carls Überlegungen. »Glauben Sie, dass ein korrekter Winzer, einer, dem seine Weine wichtig sind, einen Blender produziert?«, fragte er leise, um nicht die Aufmerksamkeit der Herren vom Nebentisch zu erregen.
Klar, die Frage war rhetorisch gemeint: Wem an seinem Beruf etwas lag, und das sollte man bei den Winzern, die heute im Schloss versammelt waren, voraussetzen, der übte seinen Beruf mit Hingabe aus. So jemand wollte ernst genommen werden, war stolz auf das, was er tat. Carl erinnerte sich an einen aufgeschnappten Satz: Es bedarf schon eines Dichters, um einen großen Wein zu machen! Bauern waren das, Bauern-Dichter.
»Hinter einem Blender steht eine Absicht«, fuhr der Fremde fort und schien nicht im Geringsten verstimmt. »So ein Wein gelingt einem nicht durch Zufall. Da will einer seine Kunden sozusagen an der Nase herumführen, im wahrsten Sinne des Wortes.«
Das war eine harte Unterstellung, die Carl als ziemlich gewagt empfand. Das mochte auf jemanden zutreffen, dem lediglich etwas an Verkaufszahlen lag, am Einkommen, am Prestige – aber nichts am Wein, weder an den Stöcken noch am Weinberg selbst, nichts an der Arbeit, die er lieber andere machen ließ, auf jemanden, der es nicht genoss, durch die Rebzeilen zu gehen und sich zu freuen, dass im Mai wie immer der Austrieb begann – diese Selbstverständlichkeit und gleichzeitig ein Wunder. So jemandem lag auch nichts an den Menschen, denen er mit seinem Wein Freude machte.
Carl schaute verlegen ins Glas, er schwenkte es, damit der Wein sein Aroma entfalten konnte, und hielt die Nase darüber. »Dazu muss man erst einmal die Fähigkeit haben zu unterscheiden, ob man einen Blender vor sich hat oder nicht.«
»Und was sagt Ihnen Ihr Gefühl, beziehungsweise Ihre Nase? Ist das nun ein Blender?«, fragte der Fremde provozierend. »Glauben Sie, dass ein korrekter Winzer auf einer Verkostung wie dieser einen Blender vorstellt?«
»Nein, eher unwahrscheinlich, Sie haben Recht«, Carl stöhnte. Er wunderte sich über sein radikales Urteil, betrachtete die vielen Tische im Saal, das Gewimmel der Besucher davor und die geschäftigen Winzer hinter ihren aufgereihten Flaschen. »Woran haben Sie’s bemerkt, das mit dem Blender?«
»Das sagt mir meine Nase, beim Wein wie bei den Menschen. Geht Ihnen das nicht auch so? Sie treffen jemanden, stehen ihm gegenüber – und auf einmal haben Sie ein komisches Gefühl. Das ist beim Wein nicht anders. Nennen Sie es Erfahrung, nennen Sie es Intuition, Instinkt, jeder hat ihn, ich glaube, man wird damit geboren, aber Intellekt und Wissenschaft gewöhnen es uns ab, darauf zu vertrauen.« Jetzt steckte der Unbekannte seine Nase tief ins Glas, atmete ein und lächelte versonnen. »Der Winzer versteht sein Geschäft, er ist so gut, dass er eigentlich niemanden verarschen müsste. Der Wein ist hervorragend gemacht, der Mann ist ein ausgezeichneter Handwerker, aber der Wein ist und bleibt ein Blender. Es wäre interessant zu wissen, warum der Mann lügt, weshalb er andere hinters Licht führt.«
»Möglicherweise bleibt ihm nichts anderes übrig«, entgegnete Carl und wunderte sich, wieso er ein derart persönliches Gespräch, und als solches betrachtete er diese Unterhaltung, mit einem Fremden führte. Mit wem sprach man schon über Ehrlichkeit, über Lüge, Wahrheit und Charakter? Carl hatte den Mann vor fünf Minuten zum ersten Mal gesehen, ihn beobachtet, wie er sich diskret durch die Menschenmenge im Barocksaal geschoben hatte, ohne irgendwen anzustoßen, was fatale Folgen gehabt hätte, denn fast alle, die sich im Haydn-Saal des Schlosses Esterházy drängten, hielten ein zumindest halb gefülltes Weinglas in der Hand. Weißweinflecken ließen sich noch rauswaschen, aber Rotwein hinterließ dramatische Spuren auf der Garderobe – dem Gewand – wie die Österreicher sagten.
War es das, was ihm an dem Fremden aufgefallen war, die legere Kleidung? Das zerknautschte Sakko, die verwaschenen Jeans? Und als sie nebeneinander vor dem Tisch desselben Winzers gestanden hatten und sich nacheinander den Chardonnay hatten einschenken lassen, waren ihm die feinen, gepflegten Hände aufgefallen, der Ehering. Schon interessant, was man alles an einem Menschen entdecken konnte, wenn man nur sein Äußeres genau betrachtete. Raum für unendlich viele Spekulationen...
»Aufdringlich ist er. Mit Chardonnay kann man vieles machen. Tropische Früchte, Birne, Honigmelone, vielleicht – es könnte Himbeere sein, ganz unterschiedliche Aromen, der reine Obstladen, sogar Zimt. Alles so deutlich, dass es manchmal aufdringlich wirkt. Dieser hier überdeckt etwas, er ist in eine bestimmte Richtung gezogen, fast parfümiert; er will was sein, was er nicht ist, verstehen Sie? Ich glaube, es liegt an der Hefe, Reinzuchthefe. Überbetonung, die Eigenschaften stehen für sich allein, sind nicht verbunden, kein einheitliches Ganzes. Gleich beim ersten Eindruck ist er opulent, zu wuchtig, aber der Eindruck täuscht, er vergeht schnell und macht – tja, wie soll ich sagen – einer gewissen Leere Platz. Der ist spätestens in zwei Jahren hin.«
Jetzt war es an Carl, den Fremden lachend zu fragen: »Wen meinen Sie denn jetzt wieder – den Wein oder den Winzer, der ihn gemacht hat?« Ihm gefiel das Gespräch, die Andeutungen, das Vage und zugleich Eindeutige.
»Ich spreche vom Wein, aber für den Winzer wird das auch gelten. Natürlich nicht das mit den Düften. Möglicherweise nimmt er ein zu starkes Rasierwasser und riecht seinen eigenen Wein nicht mehr richtig.«
»Man müsste wissen, welcher Winzer dafür verantwortlich ist. Dieser Wein hat all das, was einer Harmonie im Wege steht«, pflichtete Carl ihm bei – und hatte das Gefühl, sich anzubiedern, ein derartiges Urteil stand ihm noch lange nicht zu, altklug war es. Er war aus sich herausgegangen, was er sonst möglichst vermied, zumal auf einem so unsicheren Parkett wie der Beurteilung von Wein – und Menschen. Sich in den Vordergrund zu drängen, dabei aufdringlich zu wirken oder gar mit seinem Wissen zu protzen, war ihm ein Gräuel. Es hätte nicht zu seinem Wesen gepasst. Er hielt sich lieber im Hintergrund, das entsprach auch seinem Beruf. Und bei der nächsten Frage des Fremden hatte er den Eindruck, als wären seine Selbstzweifel berechtigt.
»Sind Sie Lehrer?«
»Um Himmels willen, nein! Ich verstehe ein wenig von Wein, nicht viel, ich liebe ihn, aber ich bin kein, äh, Experte oder Kenner. Ich bin nur...«, Carl zögerte, war sich unsicher, ob er es sagen sollte, konnte nicht einschätzen, wie es ankommen würde, mochte sich aber auch nicht mit falschen Federn schmücken, rang sich dann schließlich doch mit einem Seufzer durch. »Ich bin Mitglied in einem Weinclub, bei uns in Stuttgart, nur so aus Spaß, lange kein Profi, aber deshalb bin ich nicht hier.«
»Ist das ein Verein, dieser Weinclub?«
Dem ironischen Blick nach zu urteilen, der Carl jetzt traf (oder war es ein skeptisches Lächeln?), war sein Gegenüber genauso wenig ein Freund von Vereinsmeierei wie er selbst. Der Übersetzerverband war unerlässlich, eine berufliche Notwendigkeit, dem Weinclub hingegen war Carl aus Freude am Probieren beigetreten, auch um dem täglichen Einerlei vor dem Computer zu entfliehen und der Welt der Worte zu entkommen.
»Es ist im Grunde ein Freundeskreis, mit mehr oder weniger regelmäßigen Treffen. Wer von einer Reise besondere Weine mitbringt, stellt sie vor, wer bei einem Händler was Besonderes entdeckt, bringt es mit und lässt die anderen probieren – oder wir legen zusammen und leisten uns was Besonderes, was man sich allein nie kaufen würde... Hier, heute, das ist eine gute Gelegenheit, so viele Burgenländische Winzer trifft man sonst nirgendwo auf einem Haufen. Es ist gut für den Gesamteindruck, auch um Kontakte zu knüpfen, wenn man später die Kellereien besuchen will...«
Es war, als hätte er sich selbst das Stichwort gegeben, und zum zwanzigsten Mal an diesem Nachmittag suchten seine Augen nach dem Tisch von Maria Sandhofer. Die junge Winzerin hatte ihn auf die Idee gebracht, hier nach Eisenstadt zu kommen. Er hatte es als eine Einladung aufgefasst, und sie hatte ihm versprochen, ihn mit einigen Kollegen und besonders mit ihren Kolleginnen von der Gruppe Die Sieben bekannt zu machen, um deren Weingüter zu besichtigen. Doch wenn er ehrlich war, dann war er ausschließlich Marias wegen hier, einzig und allein ihretwegen. Sie hatte es ihm angetan, letzten Herbst, als im Hotel »Le Méridien« am Schlossgarten Burgenländische Weine vorgestellt wurden. Er hatte sie angesehen, sie waren ins Gespräch gekommen, und nach der Veranstaltung, auf der sie sich ein wenig verloren gefühlt hatte, waren sie essen gegangen: Sympathie auf den ersten Blick, wenn nicht mehr, bei ihm jedenfalls...
Carl konnte sie nirgends entdecken, Maria Sandhofer war nicht besonders groß, er wusste zwar, wo ihr Tisch stand, aber der war so dicht umlagert, dass sie hinter den Gästen verschwand, die ihre Weine probieren wollten. Maria hatte mit ihrem Weißburgunder, an dem Carl besonders das dezente Fruchtaroma und seine Trockenheit schätzte, erinnerte er ihn doch an die Weine des Burgund, die meisten Preise gewonnen. Mit dem Blaufränkischen, dem fürs Burgenland typischen Rotwein, kam sie bestens zurecht, wie sie es ausgedrückt hatte. Sein Favorit allerdings war Marias Pinot Noir, mit dem sie auch international gepunktet hatte.
Trotz dieser Erfolge war Maria Sandhofer bescheiden, das war zumindest sein Eindruck, erhascht in flüchtigen Momenten eines ersten zaghaften Zusammentreffens, das nicht länger als drei Stunden gedauert hatte und bei dem beide versucht hatten, sich so viel wie möglich voneinander mitzuteilen, nachdem die anfängliche Scheu überwunden war. Bescheiden, ja, so hatte er sie in Erinnerung, aber engagiert, fasziniert von ihrer eigenen Arbeit, umtriebig und aufmerksam, mit dem Herzen dabei. Sie war vollständig von dem überzeugt, was sie tat, zeigte nicht den geringsten Zweifel. Sie wirkte so jung dabei, voller Tatendrang. Dieses altmodische Wort traf es am besten. Und sie wirkte verletzlich.
Sie hatte an jenem Abend erzählt und erklärt, er hatte ihr gebannt zugehört, zwar nicht sehr viel verstanden, aber sich jedes Wort gemerkt und ihr in die grün-braunen Augen geschaut. Er hatte gewollt, dass sie weiter redete, hätte dieser leisen und dabei entschiedenen Stimme noch Stunden zuhören können. Dabei hatte er sich vor dem gefürchtet, was unweigerlich kommen musste: der Abschied. Um Mitternacht waren ihr fast die Augen zugefallen, und er hatte sie zurück ins Hotel begleitet. Am nächsten Tag war der gesamte Tross österreichischer Winzer zur nächsten Präsentation nach Frankfurt gefahren. Beim Abschied hatte er ihr versprechen müssen, sie unbedingt am Neusiedler See zu besuchen.
Auf leichten Sohlen war er in jener Nacht nach Hause gegangen, fröhlich und beschwingt, verwirrt, ein bisschen wie in Trance. Nur gut, dass Johanna auf Geschäftsreise war. So hatte er sich in einen Sessel fallen lassen und die Wände angestarrt und im Geist Marias Stimme gehört. Was sollte er davon halten, was denken? Dabei war er sich nicht einmal sicher, was er fühlte. Er war sozusagen völlig durch den Wind. Erst als er am nächsten Morgen aufwachte und Maria der erste Gedanke in seinem Kopf war, sie vor ihm stand, ob er die Augen nun geschlossen hielt oder aus dem Fenster starrte, war ihm klar, dass er sich verliebt hatte.
Maria wiederzusehen war unmöglich. Keine Chance. Sie war unterwegs, on the road again, mit ihrem Winzer-Tross. Von Frankfurt sollte es nach Hamburg gehen. Einen Moment lang hatte er erwogen, ihr nachzufahren, aber auf dem Schreibtisch lag zu viel Arbeit...
Das war Vergangenheit, seit damals war ein Dreivierteljahr vergangen, das Gefühl der Verliebtheit war glücklicherweise (oder leider?) verblasst, nur die Erinnerung daran war geblieben, eine schöne Erinnerung wie an einen Sommertag, an dem man morgens bei strahlendem Licht zu einem Ausflug aufbricht. Dann und wann hatten Maria und er einen Gruß ausgetauscht, mehr vorsichtig als enthusiastisch, via Telefon und Brief, sie per E-Mail. Aber jetzt war er hier, mit ziemlich viel Herzklopfen. Kaum hatte er sie gesehen, war das Gefühl wieder aufgeflammt. Er ging einige Schritte in die Richtung, wo er ihren Tisch hinter einer Wand aus Menschen mit Weingläsern in den Händen vermutete, und zögerte – sie wird beschäftigt sein, fürchtete er, und für mich heute genauso wenig Zeit haben wie in Stuttgart.
Da fiel der Blick auf das Glas in seiner Hand, er hielt es so schräg, dass er beinahe etwas verschüttete, obwohl nicht mehr viel drin war. Mit gesenktem Kopf kam er zum Stehtisch zurück. »Wenn dieser Chardonnay ein Blender ist, sind dann die anderen Weine dieses Winzers nicht genauso...?«
Aber die Antwort blieb aus, der Fremde war gegangen. Carl sah sich um – sein Gesprächspartner war wie vom Erdboden verschluckt. Dabei hätte er den Mann sehen müssen, er war nicht klein gewesen, aber weder tauchte der ungekämmt wirkende Schopf auf, noch sah er das Gesicht mit der runden Brille. Meine Güte, wie unhöflich von mir, fuhr es Carl durch den Kopf. Er hatte ihn einfach stehen lassen, sie hatten sich nicht einmal vorgestellt. Er wusste gar nicht, in welcher Eigenschaft der andere hier gewesen war – aber vielleicht traf er ihn wieder? Der Typ war interessant gewesen, besonders das, was er über Aromen und Reinzuchthefe gesagt hatte. Im Gegensatz zu ihm selbst verstand er was davon.
Vielleicht war der Fremde zu dem Tisch zurückgegangen, wo man ihnen den Blender eingeschenkt hatte? Wo war das gewesen? In dem Gewusel, wo man sich nach allen Seiten entschuldigend durchdrängeln musste, hatte er jegliche Orientierung verloren.
Das Licht, die vielen Menschen, ihre Stimmen, der Saal mit dieser traumhaften Akustik – eine der weltbesten für Kammermusik wie Orchester – das Klirren der Gläser, Rufe, das Lachen – und irgendwo dazwischen Maria – verwirrt hielt Carl sich an der Tischplatte fest. Wie konnte jemand so schnell verschwinden? War der Fremde beleidigt, weil Carl sich weggedreht hatte? Wieso störte es ihn, dass der Mann gegangen war? Bei Verkostungen waren kurze, beiläufige Begegnungen an der Tagesordnung. Man wechselte ein paar Worte, tauschte sich über diesen oder jenen Wein aus, bemerkte etwas zu dem einen oder anderen Winzer, tastete sich dabei diskret mit Fachbegriffen ab, um einen Eindruck seines Gegenübers zu gewinnen, und danach ging jeder seiner Wege. Der Fremde konnte ihm also gleichgültig sein. Aber er war es nicht. Eben noch hatte er ihm den Rücken gekehrt, im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt suchte er ihn. Carl empfand das Verschwinden als Verlust, es war so plötzlich erfolgt, als hätte er das Gespräch nie geführt, aber der Beweis dafür stand auf dem Tisch: das halb geleerte Glas. Verdammt, wo hatte man ihnen diesen Wein eingeschenkt?
Säulen flankierten den Haupteingang, durch den Carl den Saal betreten hatte. Fasziniert war er unter der Balustrade stehen geblieben. In der zweiten Hälfte des 17.Jahrhunderts war die ehemals gotische Burg unter Paul I.Fürst Esterházy zu einem Barockschloss umgebaut worden und hatte dem Adelsgeschlecht in den folgenden Jahrhunderten als Residenz gedient. Wenn man nach oben schaute, öffnete sich unweigerlich der Mund – jemand rempelte ihn von hinten an und entschuldigte sich tausendmal. Das holte Carl auf den Boden zurück, und er suchte sich eine Ecke, wo er ungestört die Deckenmalerei betrachten konnte. Im langen Tonnengewölbe reihten sich drei riesige Gemälde aneinander, typisch fürs 17.Jahrhundert, monumental, leidenschaftlich und dramatisch bewegte Figuren, alles sich konzentrierend auf das Göttliche, von dem die weltlichen Herrscher ihre Macht ableiteten. Für Monarchen und dergleichen Despoten verspürte Carl nicht die geringste Sympathie, aber die Festlichkeit des Saals in Licht, Gold und Rot war überzeugend und ein idealer Rahmen für den Anlass. Die Fenster in der langen Seite des Saals führten auf den Innenhof, die der gegenüberliegenden Wand waren blind, sodass sich der Eindruck ergab, als handelte es sich um ein freistehendes Gebäude.
Der angenehme Klang der vielen Stimmen war überraschend gewesen. Es war laut, eindringlich statt aufdringlich, man hörte gut und genau, jedes harte Zischeln wie sonst in großen Menschenmengen fehlte, die Stimmen aller verschmolzen in einem Bogen, aber der einzelne Sprecher war nah. Hier hatte Josef Haydn 1761 als Vizekapellmeister im Dienste des Fürsten begonnen und eigens für diesen Saal komponiert. Haydn hatte dafür gesorgt, dass bei seinen Konzerten der Marmorboden mit Holz dielen abgedeckt wurde, um die Akustik zu verbessern. Der Saal, in Schuhschachtelform, so der Begriff, war aus dem rechten Winkel, er wies keine parallelen Flächen auf, die ein Flatterecho hätten entstehen lassen, und die Nischen in den Wänden unterstützten diese Wirkung.
Bis ins hohe Alter hinein hatte Haydn hier seine Kompositionen vorgestellt, und Carl nahm sich vor, auf jeden Fall eines der Konzerte zu besuchen, die hier im Rahmen der Haydn-Festspiele veranstaltet wurden. In den drei Wochen Urlaub würde sich sicher eine Gelegenheit finden.
Er drängte in Richtung Eingang, wo er seine Einladung hatte vorlegen müssen und sein Name auf der Gästeliste abgehakt worden war, denn diese Veranstaltung war dem Fachpublikum aus dem In- und Ausland vorbehalten. Weinliebhaber wie er gehörten eigentlich nicht dazu, aber er hatte einen Weg gefunden, trotz dem hinzukommen. Außerdem war er felsenfest davon überzeugt, dass ein Drittel der Anwesenden weder einen Weinladen besaß noch für eine Supermarktkette einkaufte. Weine, die dort angeboten wurden, stellte man hier sowieso nicht vor, dazu waren sie zu gut und zu teuer.
Am Eingang hatte er ein Glas in Empfang genommen und die Runde entlang der Tische der Winzer im Uhrzeigersinn genommen. Er hatte mit Weißwein begonnen, um nicht durch das Tannin der Rotweine die Mundschleimhaut zu strapazieren. Und vielleicht am Ende des ersten Drittels hatte er bei einem Winzer seinen Arm mit dem Glas vorgestreckt, hatte es drei Finger hoch gefüllt bekommen, den Arm vorsichtig zurückgezogen und war dabei mit jemandem zusammengestoßen. Dieser Jemand und er hatten sich aus dem Gewühl herausgewunden und ihr Gespräch begonnen.
Vergebens suchte Carl nach dem Winzer, bei dem die Begegnung stattgefunden hatte. Er war so viel herumgestoßen worden, hatte manchen Tisch wegen des Gedränges ausgelassen und dabei die Übersicht verloren. Aber den Tisch von Maria Sandhofer hätte er mit verbundenen Augen gefunden.
Sie empfing ihn mit einem Lächeln, bei dem ihm nicht ganz klar war, ob es das für gute Freunde war oder ob es vielleicht doch etwas mehr bedeutete, was ihm viel lieber gewesen wäre. »Womit willst du beginnen, mit dem Welschriesling? Du kennst meine Weine zwar, aber die neuen sind anders. Bei den Weißen habe ich jetzt die neuen Jahrgänge hier. Die Roten sind ausgereifter, der St. Laurent und der Blaufränkische sind neu, die habe ich zwar letztes Frühjahr abgefüllt, aber die brauchten noch Zeit auf der Flasche. Noch ein Jahr, und sie sind besser, in drei Jahren sind sie richtig klass.«
Klass? Ein derartiges Urteil hätte Carl niemals abgeben können. Nicht dass es ihm an Mut mangelte, seine Meinung zu sagen, aber ihm fehlte die Erfahrung, Wein war nicht sein Metier, er war hier zum Lernen. Außerdem mochte er die Winzer, ihre Art war ihm angenehm – es waren Bauern und Künstler, Handwerker und Visionäre, sie waren grob und hatten ein feines Gespür, sie verfügten über Weitblick, wenn er daran dachte, was Maria gerade über den Blaufränkischen gesagt hatte, und sie waren präsent, anwesend, genau hier, in diesem Moment. Und solche, die der Erfolg arrogant und reich gemacht hatte, waren ihm bislang nicht begegnet. Unangenehm waren eher jene Besucher, die alle wichtigen Winzer kannten, jedes Weinbaugebiet bereist hatten und mit Fachbegriffen um sich warfen. Angeber gab es auch in seinen Kreisen, nur dass Übersetzer eher stille Leute waren, Eigenbrötler, die ihre Arbeit im Verborgenen taten, Kellerasseln und Grottenolme, die aber trotz dem auch ganz gerne mal ins Licht traten, wenn er an sich selbst dachte...
Maria Sandhofer stand allein hinter ihrem umlagerten Tisch. Sie schenkte ein, beantwortete Fragen, stellte richtig, setzte sich auseinander, erklärte, und das alles mit einer Selbstverständlichkeit, die Carl bei dieser jungen Frau erstaunte. Sie vertröstete ihn auf den nächsten Tag.
»Du kommst am Nachmittag zu uns, ich nehme mir Zeit, wir fahren durch die Weinberge, ich zeige dir... Ja bitte schön? Den Sauvignon blanc möchtn ’S probieren?«
Wieder unterbrach jemand ihr Gespräch, und sie griff nach dem Sauvignon, suchte den Korkenzieher, Carl fand ihn unter einer Preisliste, nahm ihr die Flasche ab und öffnete sie. Dann trat er ungefragt hinter den Tisch und räumte leere Flaschen in Kartons, ordnete die Prospekte, besorgte neue Gläser und erhielt dafür ein sehr dankbares Lächeln.
»Mein Vater wollte eigentlich mitkommen. Er kennt alle Einkäufer und Weinhändler, alle kennen ihn, aber er fühlt sich heute nicht wohl, das Herz, verstehst du?« Hinter dem Präsentierlächeln tauchte ein sorgenvolles Gesicht auf. »Er sollte überhaupt nicht mehr arbeiten...« Für einen Moment irrten Marias Augen fahrig durch den Saal, sie reckte den Kopf, als suche sie jemanden, dessen Begegnung sie allerdings fürchtete. Etwas schien ihr Angst zu machen. Carl folgte ihrem Blick, aber in der Menschenmasse um ihn herum war nicht ein bekanntes Gesicht. Und um sie zu fragen, was ihr Angst machte, kannten sie sich zu kurz. Aber er konnte hier bleiben, bei ihr.
Die Runde durch den Saal war vergessen, Carl half ihr, schüttete den Restweinkübel aus, entkorkte den nächsten Weißwein, trieb irgendwo neues Eis auf, kannte nach zehn Minuten alle Rebsorten des Weingutes Sandhofer und schenkte ein. Maria und er arbeiteten Hand in Hand, als hätten sie es ein Leben lang getan. Und er lernte schnell. Auf dem Weingut bewirtschafteten sie 21Hektar, bauten vier Weißweintrauben an, bei den Roten waren es sechs, auch Pinot Noir, zu Deutsch Blauburgunder, eine schwierige Rebsorte, aber die Weine gehörten zu denen, die Carl am liebsten trank. Er las vor, was er auf den Informationsblättern zu den einzelnen Weinen fand, und kaum jemand bemerkte, dass er nicht vom Fach war. Bei komplizierten Fragen oder Bestellungen verwies Carl auf Maria: »Fragen Sie die Chefin...«, was sie mit einem verlegenen Grinsen quittierte. Der Fremde, mit dem er über den »Blender« gesprochen hatte, blieb verschwunden.
Die Zeit verging schnell, Carl hatte vergessen, weshalb er hergekommen war, seine neue Aufgabe hielt ihn gefangen. Andere Winzer kamen vorbei, Maria stellte ihn überall vor als »einen Freund aus Deutschland«. Interessierter zeigten sich ihre Freundinnen, die rings um den Neusiedler See Weingüter betrieben und sich zur Gruppe Sieben zusammengeschlossen hatten.
»Du lernst sie sowieso alle noch kennen«, beruhigte ihn Maria, als Carl klagte, er habe sämtliche Namen bereits wieder vergessen. »Wie lange bleibt ihr am See?«
»Drei Wochen«, antwortete Carl und wandte sich rasch einem Besucher zu, um das Thema nicht weiter zu vertiefen. Sie hatte einen heiklen Punkt berührt.
Mittlerweile war es draußen schummrig geworden, Ende Juli waren die Tage zwar noch lang, aber die Sonne ging früher unter, außerdem war man hier weit im Osten, zwanzig Kilometer von Eisenstadt entfernt begann Ungarn. Gerade war die Wandbeleuchtung aufgeflammt, als Carl eine Bewegung unter den Anwesenden bemerkte. Es zog sie zu den Fenstern, einige standen bereits dort und schauten hinunter in den Hof. Maria murmelte etwas von »die blöde Landeshauptfrau« und schloss sich eher unwillig den anderen an.
Der Schlosshof war erleuchtet. Rechts und links vom Portal an der Treppe hatten sich mehrere Personen versammelt, eine dunkle Limousine hielt, ein weiteres Fahrzeug folgte und stoppte direkt daneben. Drei Männer sprangen heraus und gingen drohend auf Frauen und Männer zu, die mit Plakaten in den Händen durchs Tor gelaufen kamen. Die beiden Polizisten im Hof zogen sich unentschlossen zurück.
»Keine Autobahn im Burgenland! Keine Autobahn im Burgenland!«, skandierten die Demonstranten und warfen mit Flugblättern um sich. »Schützt das Burgenland! Schützt das Burgenland!« Mehr Polizei erschien auf der Bildfläche, es wurde gejohlt: »Das Welterbe ist unser Erbe! Das Welterbe ist unser Erbe!« Der Fahrer öffnete den Schlag der Limousine, eine nicht gerade schlanke und kurzbeinige Frau stieg aus, den dunkelblonden Kopf stolz im Nacken, und sie machte abgeschirmt von einem Sicherheitsbeamten eine wegwerfende Geste in Richtung der Demonstranten.
Die Blitzlichter der Fotografen flackerten, Carl meinte für eine Sekunde, unter ihnen seinen Gesprächspartner von vorhin gesehen zu haben, aber er war zu weit weg, um das mit Sicherheit sagen zu können. Die Frau schritt jetzt auf die Treppe zu, einige Umstehende klatschten Beifall, sie nickte huldvoll und hob dabei grüßend die Hand. Der Polizeiwagen hatte inzwischen die Durchfahrt blockiert, um weiteren Demonstranten den Zugang zum Schlosshof zu verwehren.
»Die fehlt uns gerade noch«, knurrte Maria genervt, die so dicht vor Carl am Fenster stand, dass er ihre Wärme spürte. »Die Kuh kommt tatsächlich rauf. Das wird ja ein schöner Abend. Eigentlich war sie für 18Uhr angesagt. Ich glaube, ich packe zusammen, oder besser wir...«, sie blitzte Carl vertraulich an.
Die Schaulustigen strömten diskutierend von den Fenstern zurück und verteilten sich wieder vor den Tischen, das Gemurmel wurde lauter, der Vorfall im Schlosshof war rasch vergessen, und ohne viel Aufsehen zu verursachen, betrat die Landeshauptfrau, »in Deutschland heißt so was Ministerpräsidentin«, wie Maria abfällig sagte, den Haydn-Saal.
Die Landeshauptfrau mischte sich mit ihren Begleitern leutselig unters Publikum, begrüßte hier einen Winzer wie einen alten Bekannten, schüttelte dort einem anderen die Hand und ließ sich von einem Dritten eine Probe einschenken, an der sie vorsichtig nippte.
»Von Wein keinen blassen Schimmer«, murmelte Maria, und ihre Stimme, die Carl bisher als ausnehmend angenehm empfunden hatte, klang gar nicht mehr freundlich. »Sie versteht es bestens, jedem genau das zu sagen, was er hören will. Alle fallen darauf rein. Früher Lehrerin, dann Direktorin in einer Nachbargemeinde von Eisenstadt, sie ist über die Gewerkschaft in die Politik gekommen. Schon da, so heißt es, hat sie jeden weggebissen, der ihr in die Quere kam. Und sie kann Leute benutzen, dafür hat sie ein Gespür...«
»Sie ist eine Frau, das ist in dieser Männerwelt der Politik immerhin ein Fortschritt«, wandte Carl vorsichtig ein, der sich über die Person – mit kaltem Lächeln bahnte sie sich den Weg zum nächsten Winzer – keinerlei Urteil erlauben konnte. Die »Lehrerin« immerhin hätte er ihr angesehen, er hätte sie sich gut dabei vorstellen können, wie sie auf dem Schulhof die Kinder nach dem Klingeln wieder in die Klassenzimmer trieb.
»Eine Frau?«, fragte Maria spitz. »Kaum abzustreiten, ja, aber das ist der einzige Unterschied zu den Männern, die sonst bei uns Politik machen. Die hier versteht es besser als jeder andere, dich in Sicherheit zu wiegen und dir dann in den Rücken zu fallen, wenn du dich abwendest. Ich halte sie für eine Meisterin der Intrige. Glaubst du, jemand, der anders ist, schafft es bis in so eine Position? Und bleibt dabei sauber? Politik bei uns auf dem Lande, und das sind wir hier, ist ganz direkt, persönlich, alles läuft über Beziehungen. Bei uns sind die Politiker nicht so abgeschottet vom Volk, Eisenstadt ist mit zwölftausend Einwohnern winzig; man trifft sich auf der Straße oder hier zum Beispiel. Aber man tut sich nichts. Da wird kein Porzellan zerschlagen, was man hinterher nicht kleben könnte, dazu ist Österreich zu klein, man kann sich schlecht aus dem Weg gehen. Und wir sind nicht so rabiat wie ihr Deutschen. Manchmal bedauere ich das. Aber die Wahrheit sagt keiner – da wird gemauschelt und gedreht, eine endlose Packlerei, jeder mit und gegen jeden...
»...Packlerei?«
»Na, sie paktieren, mal mit diesem, mal mit jenem, Freindl- oder Vetternwirtschaft eben. Man sorgt halt für seine Leute. Und die sorgen für einen.«
»Das macht doch jeder«, wiegelte Carl ab und sah, wie die Landeshauptfrau mit einem ihrer Berater einige Worte wechselte und der Mann daraufhin einen Block aus der Jackentasche zog und etwas notierte.
»Nein, das macht nicht jeder, und vor allem nicht mit unserem Geld und nicht auf unsere Kosten!«, erwiderte Maria mit einer Härte und Entschiedenheit, die Carl überhaupt nicht bei ihr vermutet hätte. Jetzt bekam er den wütenden Blick ab, der für die Landeshauptfrau bestimmt war.
»Dieses Autobahnprojekt, das sie realisieren will, ist der größte Blödsinn, den man sich vorstellen kann – besonders für uns Winzer wäre es eine Katastrophe. Die Demonstranten vorhin haben völlig Recht, diese Frau ist Gift!«
Auf der Bühne am Kopf des Saals rollte ein Bühnenarbeiter Kabel aus, stellte ein Mikrofon auf und machte den ersten Soundcheck: »...eins... eins... eins...« Die Aufmerksamkeit des Publikums wandte sich vom Wein ab und der Landeshauptfrau zu, die mit einigen Offiziellen recht ungelenk die wenigen Stufen zur Bühne hinaufstakste und sofort den Arm nach dem Mikrofon ausstreckte, als wäre ausschließlich ihr das Rederecht vorbehalten. Einer der Offiziellen kam ihr zuvor, zog das Mikrofon aus der Halterung und hielt eine kurze Begrüßungsrede, wobei er die Bedeutung der Anwesenheit der Landeshauptfrau herausstellte und ihre Verdienste um den lokalen Weinbau würdigte.
Der Beifall war spärlich, ein großer Teil der Anwesenden war fremd hier, wollte Weine probieren und nicht Politikerreden lauschen, die überall ähnlich klangen. Dann ergriff die Landeshauptfrau das Wort, jegliches Gemurmel erstarb.
»Liebe Gäste aus dem Ausland, liebe Weinfreunde und nicht zuletzt liebe Winzerinnen und Winzer! Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und grüße natürlich vor allem unsere Winzerinnen und Winzer, denen wir diese wunderbaren Kreszenzen verdanken, die wir hier heute zur Freude aller...«
Bis jetzt war die Landeshauptfrau Carl völlig gleichgültig gewesen, doch nach den wenigen Worten wuchs seine Ablehnung ihr gegenüber. Es war die Stimme. Eine Zumutung, ihr konnte selbst die Akustik eines Josef Haydn weder Schmelz noch Esprit verleihen. Machte nicht der Ton die Musik? Vielleicht lag hier das Geheimnis ihres Erfolges, dass die Widersacher ihr zustimmten, damit sie möglichst rasch den Mund hielt und man zur Abstimmung kam...
»...finden wir uns heute hier in dieser wunderbaren Kulisse des Schlosses Esterházy zusammen. Wein hat man bei uns zur Zeit Haydns genauso geliebt und getrunken wie heute. Und immer waren es besondere Weine, die unsere Heimaterde und unsere Winzer hervorgebracht haben. Das Burgenland, eines der kleinsten Bundesländer Österreichs, aber auch mit das erfolgreichste, ein Bundesland der Aufsteiger, denn wir haben vieles gemeinsam auf den Weg gebracht, haben uns bis in die Weltspitze vorgearbeitet...«
»...wir?«, hörte Carl jemanden fragen, und einige zaghafte Lacher waren zu hören.
»...Erfolg ist etwas, das mit dem Burgenland einherschreitet. Doch wenn der Erfolg allzu selbstverständlich erscheint, dann besteht die Gefahr, dass er nicht richtig wahrgenommen und geschätzt wird. Gerade deshalb sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, wie viel Mühe, Anstrengung und nicht zuletzt Kapital in dieser Arbeit steckt.«
Carl erinnerte sich daran, kurz vor der Abreise in einer Broschüre gelesen zu haben, dass die Europäische Union dem Burgenland die meisten Mittel zur Modernisierung des Weinbaus zugeteilt hatte.
»...habe es zu Beginn meiner Amtszeit gesagt und wiederhole es heute: Der Wein ist ein wesentlicher Motor unserer Wirtschaft und bedarf der besonderen Förderung, wenn wir Arbeitsplätze schaffen wollen und das Wachstum im Blick haben und nur dem Wohl der Bevölkerung verpflichtet...«
»Die hat nur ihr eigenes im Blick«, grummelte Maria, und er konnte sich das Grinsen nicht verbeißen. Wahrscheinlich hatte sie nicht Unrecht. »Politiker sollten die Zeit bezahlen müssen, in der sie uns mit ihren Werbesendungen vollquatschen...«, schob sie leise nach.
»...Das ist der Rückhalt, den Sie, meine lieben Winzerinnen und Winzer, von meiner Regierung brauchen, und darauf müssen Sie sich verlassen können – grade wo immer neue Anbieter auf umkämpfte Märkte drängen, nicht zuletzt Australien und Südafrika. Die Welt ist vernetzt, wir alle rücken näher. Der Fall des Eisernen Vorhangs hat unserem Burgenland eine Schlüsselstellung gegeben, als Vermittler zwischen dem Osten und dem Westen Europas. Wir sind zur Drehscheibe geworden, zwischen dem Süden und dem Osten, zwischen dem Balkan und dem Westen, eine Drehscheibe zwischen Italien und Polen sowie der Slowakei...«
»Oh, also darauf will sie hinaus«, rutschte es Maria heraus. »Wir sollen Transitland werden, den gesamten Verkehr wollen sie hier durchleiten...«
»Können Sie denn nicht mal die Goschn halten!«, schimpfte jemand hinter ihnen, und Maria war still, aber das grimmige Gesicht blieb.
»...selbstbewusst für unsere Ansichten ein, allerdings werden wir die vorgebrachten Bedenken entsprechend berücksichtigen. Ich habe einen engen und vertrauensvollen Kontakt auch zu den Gegnern, und das wird so bleiben, da bin ich ganz zuversichtlich – bei gegenseitigem Respekt. Wir müssen lernen, unsere Ansichten und Gefühle wechselseitig zu respektieren, wir müssen uns ernsthaft bemühen...«
»Damit meint sie bestimmt nicht sich selbst!«, fuhr Maria dazwischen.
»Gehen ’S doch raus, wenn ’S das nicht hören wollen«, kam jetzt von links. »Aber bitte stören ’S net weiter.«
»...bei einer kreativen Politik muss der Staat zwar an den richtigen Stellen eingreifen, aber auch an den richtigen Stellen wieder loslassen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nur so gemeinsam die Ziele erreichen...«
»Fragt sich nur, wessen Ziele«, grollte Maria weiter, diesmal leiser, sodass sich kein Protest mehr erhob.
»...würde ich mich im Namen der Landesregierung freuen, nachher beim Empfang unsere ausländischen Gäste auf ein Glas Wein und einen Imbiss begrüßen zu dürfen, und wünsche besonders unseren ausländischen Gästen im Burgenland noch einen angenehmen Aufenthalt, gute Geschäfte und allen anderen einen guten und sicheren Heimweg...«
Der Beifall ebbte rasch ab. Maria drehte sich um und kehrte schnurstracks zu ihrem Tisch zurück. »Den Wein liefern wir, kostenlos, aber die Frau tut, als wäre er ein Geschenk der Landesregierung. Gehst du zu dem Empfang?«, fragte sie.
Bevor Carl antworten konnte, kam eine stattliche Frau auf sie zu, die Maria ihm als Karola vorstellte. Sie war Marias beste Freundin, Winzerin, und gehörte selbstverständlich zum Kreis der Sieben. Sie betrieb ihre Kellerei in Mörbisch, einem kleinen Ort am Neusiedler See, kurz vor der ungarischen Grenze.
Die rothaarige Frau, etwas älter als Carl, konnte mit Traktor und Pflug sicher zehnmal besser umgehen als er mit seinem Wagen. Und genauso war ihr Händedruck. Apropos Wagen– Carl sah auf die Uhr. Wieso hatte Johanna nicht angerufen? Es war ihm zwar recht, aber ihm wurde mulmig. Sie hätte ihn längst abholen sollen. Er nahm sein Mobiltelefon aus der Tasche und stellte fest, dass es eingeschaltet war.
»Du gehst sicher nicht zu dem Empfang«, sagte Karola zu Maria, die sich daran machte, den Tisch abzuräumen und Flaschen wie Prospekte für den Heimweg zu verpacken.
»Nein, mir tut der Rücken weh, die ganze Zeit stehen, seit 14Uhr sind wir hier, nein, ich muss morgen früh raus...«
»Wie immer«, stöhnte Karola. »Und wann kommen Sie zu mir?«, wandte sie sich an Carl. »Maria hat mir von Ihren Plänen erzählt. Mal sehen, was wir Ihnen beibringen können. Wahrscheinlich werden Sie schneller zum Winzer, als dass ich eine von Ihren Sprachen lerne – was war das noch mal? Russisch und...«
»Nein, nein, kein Russisch.« Er lachte. »Das ist mir zu fremd – und zu schwierig. Nur Englisch und Portugiesisch.«
»Portugiesisch stelle ich mir kompliziert vor. Aber Englisch sprechen wir mittlerweile alle ganz leidlich. Die vielen Messen im Ausland, wissen Sie? Dann haben Sie sicher länger in England und Portugal gelebt?«
»Ich habe in London eine Weile studiert, auch in Oxford und in Coimbra.«
»Kenne ich nicht. Ist ja spannend. Davon müssen Sie mir erzählen. Wann kommen Sie zu uns nach...?«
Die Veranstaltung löste sich auf, die Tische wurden abgeräumt, Flaschen und Informationsmaterial verpackt und nach unten in die Autos verfrachtet. Auf dem Platz vor der majestätischen Front des angestrahlten Schlosses wählte Carl erneut Johannas Nummer. Sie meldete sich noch immer nicht, ihr Mobiltelefon war ausgeschaltet. Er hatte einen Bärenhunger, und das Restaurant, für das er nebst Begleitung eine Einladung besaß, sollte zu den besten des Burgenlandes gehören.
»Schau an, in den Taubenkobel. Dann gehören Sie sozusagen zu den VIPs«, lachte Karola. »Da können wir nicht mithalten.«
»Gehen Sie denn nicht noch irgendwo essen?«, fragte Carl. »Ich würde lieber mit euch gehen, ich warte nur auf...«
»Nein, wir sind nicht in den Ferien, für uns ist das alles unheimlich anstrengend. Ich bin ganz früh wieder im Weinberg. Wir müssen ausdünnen, das heißt, alle überflüssigen Trauben rausschneiden, dann die Laubwände entblättern, die Geiztriebe entfernen. Jetzt im Juli beginnt die Umfärbung, die Trauben nehmen Farbe an, das ist der Zeitpunkt dafür...«
Ein großer schwarzer Wagen kroch die Hauptstraße herauf, Carl sah den Dachgepäckträger, die Scheinwerfer, er erkannte sie von weitem.
2
Sie war noch immer ziemlich weit vom Ufer entfernt, als sich die Sonne in einem fahlen Rot über dem Leithagebirge senkte, stechend, unangenehm, künstlich. Johanna kannte sich in diesem Revier nicht aus. Überall änderte sich das Wetter. Es konnte ein Rot sein, das vor Unwetter warnte, vor Gewitter, Sturzregen und Sturm, genauso gut konnte es einen neuen, wunderschönen Tag ankündigen. Keine Wolke am Himmel, nur verwehte Schleier. Und darunter das Leithagebirge!
Was für ein Name. Gebirge! Dramatisch hörte es sich an, mächtiger jedenfalls als Schwäbische Alb oder Weserbergland. Als Carl den Namen zum ersten Mal genannt hatte, war ihr dazu ein Alpenpanorama in den Sinn gekommen. Schroff, steil und felsig, zumal man bei Österreich an nichts anderes dachte. Aber es war lediglich ein langer bewaldeter Höhenzug. Also lagen auch hier mal wieder Wirklichkeit und Vorstellung weit auseinander, wie so oft. Stuttgarts Hügel waren steiler. Saß man immer wieder seinen eigenen Vorstellungen auf, bis man – durch die Umstände oder Prügel gezwungen, endlich richtig hinsah? Johanna wäre das Alpenpanorama lieber gewesen, wenn sie am Segel vorbeischaute, doch als Surfrevier war der Neusiedler See großartig.
Der Höhenzug begleitete den See auf seiner ganzen Länge. Der attraktive Surflehrer, der sie am Vormittag ins Revier eingewiesen hatte, nannte es »...den letzten Ausläufer des Alpenbogens, aber keine 500Meter hoch. Von dort kommt der Wind. Gib gut Obacht, er treibt dich raus auf den See, der Wind kann heftig werden...«
So war es gewesen, den ganzen Tag über, dann zogen weiße Schönwetterwolken über den tiefblauen Himmel und brachten Böen mit. Erst am späten Nachmittag verschwanden die Wolken und mit ihnen der Wind, der nun fast gänzlich einschlief. Johannas Surfbrett bewegte sich kriechend über die sich beruhigende Wasserfläche. Sie war grau statt blau, hier ein Glitzern, dort ein Reflex, und sacht legte sich der rosa Schimmer aufs Wasser.
Johannas Beine zitterten, ihre Arme schmerzten, der Nacken war verspannt. Sie war total ausgepowert, müde wie ewig nicht mehr, und hielt sich mühsam aufrecht. Das Plätschern des Surfbrettes auf den gekräuselten Wellen lullte ein. Glücklicherweise musste sie sich nicht mehr anstrengen, so wie am Nachmittag. Da hatte sie das Trapez gebraucht, hatte den Gurt einhaken und sich mit ihrem gesamten Gewicht, das in Kummer-Zeiten 65Kilo betrug, ins Segel hängen müssen. Dabei waren ihre Arme seit Monaten nichts anderes gewohnt, als Aktenkoffer zu tragen und ihren Wagen zu steuern. Jetzt erforderte es die letzten Kraftreserven, das Segel senkrecht zu halten, damit der Wind eine Angriffsfläche hatte und sie ans Ufer brachte. Zu ihrem Pech hatte der Wind gedreht, sodass sie noch einige Schläge benötigen würde, um Mörbisch zu erreichen.
Sie hatte mal wieder den alten Fehler begangen und sich übernommen, sich zu viel zugetraut, den Wind und den See unterschätzt, obwohl der Surflehrer davor gewarnt hatte, besonders vor der kurzen, harten und die Kräfte zehrenden Welle des flachen Steppensees. Sie war längst keine dreißig mehr, sie hatte keine Kondition, die alte Spannkraft von damals, Ausdauer und Training, fehlten. Aber sie konnte sich verzeihen, denn es war nach vielen Wochen endlich wieder ein Tag auf dem Wasser, der erste von vielen, die sie herbeigesehnt hatte, mit nichts anderem beschäftigt sein als dem Wind, den Wellen und mit sich selbst. Keiner wollte etwas von ihr, niemand belastete sie mit Dingen, die sie normalerweise tat, um ihr Geld zu verdienen und nicht unbedingt, weil sie getan werden mussten und die (allerdings nur bei ehrlicher Betrachtung) ihre Kräfte überstiegen. Aber wer konnte sich schon Ehrlichkeit leisten? Wer Schwäche eingestand, war verloren. Die Welt bestand aus Siegern – mittlerweile auch aus Siegerinnen, dachte sie, und die Anstrengung war für diesen Augenblick vergessen.
Sie sah einen dunstigen Himmel, fühlte die leichte, frische Brise im Gesicht, die sie ein wenig vorwärts brachte und all den Muff, den Gestank und die überflüssigen Gedanken aus ihrem Kopf trieb, die sich in langen Monaten äußerster Anspannung angesammelt hatten. Das Schlimmste daran war das Gefühl der Leere.
Und obwohl sie alles tat, diese Gedanken nicht an die Oberfläche gelangen zu lassen, die sie nach außen abschirmte, drückten sie doch von unten gegen die Kruste. Immer wieder nahm sie sich zu viel vor, überschätzte ihre Kräfte. Wann würde sie das kapieren? Außerdem war sie völlig aus der Übung. Sie hatte nicht einmal mehr Zeit und absolut keinen Nerv fürs Fitness-Studio, nur Arbeit. Yoga wäre vielleicht hilfreich gewesen, aber das war was für esoterische Weiber, und außerdem fühlte Johanna sich dafür zu jung. Ihre einzige körperliche Anstrengung bestand darin, morgens die Beine aus dem Bett zu schwingen, den Müll mit runterzunehmen und auf Geschäftsreisen den Koffer durch Hotelhallen hinter sich herzuziehen. Und dann am ersten Tag gleich mitten auf den See – eigentlich Wahnsinn, was sie hier tat.
Es war unverantwortlich. Jeden anderen, der sich so verhalten hätte, hätte sie zusammengestaucht: Stunde um Stunde auf dem Wasser, die Zeit vergessend, die Sonne vergessend, die Kraft des Windes unterschätzend. Weit hinauszufahren, ohne sich langsam an das unbekannte Revier zu gewöhnen, sich erst einmal eine Stunde hinauszubegeben, den See zu testen, die Welle, das Brett, sich selbst auszuprobieren. Nein. Bloß weg, weg von den nervenaufreibenden Anforderungen, weg von den Zweifeln, die über ihr zusammenschlugen, die Magenschmerzen und Sodbrennen verursachten, wovon sie besser niemandem etwas sagte.
Luft holen, Dampf ablassen, der Deckel war kaum noch draufzuhalten, so groß war zuletzt der Druck gewesen. Einfach in den Wind und die Wellen eintauchen, sich mitnehmen und reinigen lassen – geradezu sehnsüchtig hatte sie den Kitern nachgeschaut, die von ihren Schirmen mitgerissen durch die Luft segelten, mit dem kleinen Brett an den Füßen wieder aufsetzten und eine Gischtfahne hinter sich herziehend weiterrasten. Das war sicher noch packender als mit ihrem Sturmsegel bei sechs Windstärken übers Wasser zu gleiten, die Welle fast im Nacken. Sie würde das Kiten lernen, hundertprozentig. Es sollte nicht schwierig sein, aber anders als Windsurfen, eher wie Snowboarden, das hatte zumindest der Surflehrer vorhin am Hafen gesagt. Aber Snowboard fahren war was für junge Leute. In der Szene war sie nie gewesen.
Ihre Arme waren schwer wie Blei, die Hände schmerzten, sie krampften sich um den Gabelbaum, da half Ausschütteln nicht viel. Die Beine zitterten wieder vor Anspannung. Sie fühlte sich heiß, hin und wieder fröstelte sie leicht, in ihren neuen Neopren-Anzug eingezwängt, den sie extra für die Reise gekauft hatte. Viel zu warm, sie brauchte einen ohne Arme und Beine. Aber so waren glücklicherweise nur Hals und Wangen verbrannt, die Hände glühten, vom Zupacken und von der Sonne. Sogar auf den Fußrücken fühlte sie den Sonnenbrand. Ihre Nase würde aussehen wie eine Tomate und sich pellen, obwohl sie sich mit Schutzfaktor 25 eingerieben hatte. Ihr Haar, im Nacken zusammengebunden, war so dicht, dass die Strahlen nicht bis auf die Kopfhaut durchkamen. Und die Stirn ließ sich mit Wasser benetzen, es roch komisch, etwas brackig, und schmeckte leicht salzig.
Sie hatte sich vorhin zum Ausruhen aufs Brett gesetzt und das Segel auf dem Wasser liegen lassen. Gleich waren Surfer gekommen und auch ein Segler hatte Hilfe angeboten. Hilfe? Sich helfen lassen? In diesem See konnte man sogar in der Mitte stehen, er sollte nirgends tiefer als einen Meter sechzig oder siebzig sein. Der Surflehrer – oder war er der Besitzer der Surfschule? – hatte von einer so genannten Seedurchquerung zu Fuß gesprochen. Außerdem hätte sie ihre Schwäche niemals eingestanden. Sie hatte sich wieder aufgerafft.
Zumindest hatte sie einen Fehler nicht begangen – einfach drauflos zu fahren. Mehrmals hatte sie sich die Silhouette des Ufers eingeprägt, die Namen der Orte am Ufer runtergeleiert, von Süden nach Norden: Mörbisch, Rust, Oggau, Breitenbrunn – die anderen Dörfer lagen weiter vom See entfernt... sie musste die richtige Zufahrt finden, denn das Ufer war überall mit Schilf bewachsen, ein Gürtel, an vielen Stellen bis fünf Kilometer breit, aber es gab Orientierungspunkte, die Kirchtürme und die Routen der Ausflugsdampfer, die den See kreuzten. Denen brauchte sie nur zu folgen. Der Süden war tabu, er gehörte zu Ungarn, und das Ufer hinter ihr im Osten gehörte zum Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Zu allem Unglück drehte der Wind noch weiter nach Süden, Johanna musste abfallen, was sie mindestens zwei weitere Schläge kosten würde.
Müdigkeit und Erschöpfung zusammen mit dem Glücksgefühl, endlich mal wieder einen ganzen Tag für sich gehabt zu haben, versetzten Johanna in einen angenehmen Dämmerzustand, ein bisschen wie ein wohliger Schwips. Wäre sie nicht zum Umfallen müde gewesen, sie hätte ewig weiterfahren mögen, in die Abendsonne hinein, sich um nichts kümmern, alles vergessen, irgendwann an ein Ufer kommen, sich fallen lassen und schlafen...
Sie verlor plötzlich den Halt auf dem Brett, ihr Fuß rutschte, sie glitt aus, hielt sich am Gabelbaum fest, riss ihn an sich und fiel rückwärts ins Wasser, über sich das Segel. Sie geriet unter Wasser, schlagartig war sie wach, hielt die Luft an, mit drei Schwimmstößen hatte sie sich vom Segel befreit und tauchte prustend auf. Der Schreck brachte sie zurück in die Wirklichkeit. Nein, sie war nicht eingeschlafen, sie war nur ausgerutscht. Igitt, was war das Schleimige an den Füßen? Erschrocken zog sie die Beine an, streckte sie vorsichtig wieder aus, tastete, tatsächlich, sie hatte Grund unter den Füßen, sie konnte stehen.
Der Hafen von Mörbisch, wo sie vor drei Stunden gestartet war, ließ sich an den Kulissen und Beleuchtungstürmen der Seebühne ausmachen. Den ›Graf von Luxemburg‹, den sie dort im Juli und August über spielten, würde sie sich ersparen, Lehárs Operetten waren ihr zu seicht und anspruchslos, lieber hätte sie ein Schauspiel gesehen, aber in Österreich zogen Operetten die meisten Besucher an. Das Land war ihr fremd, früher mal, in ihrer alten Zeit, da hatte sie den düsteren Dramatiker Thomas Bernhard gelesen, auf Carls Empfehlung hin, sie kannte das erschreckende Weltbild der Elfriede Jelinek, eines von Ernst Jandls wunderbaren Gedichten hingegen konnte sie noch immer hersagen.
manche meinen
lechts und rinks
kann man nicht velwechsern
werch ein illtum!
Aber Operetten? Doch als Ansteuerungspunkt war die Seebühne ideal.
Sie schaute auf die wasserdichte Uhr und dachte mit Schrecken, dass die Zuschauer für den ›Grafen‹ im Anmarsch waren. Hoffentlich kam sie nachher mit dem Wagen gut durch. Sie erreichte die schilffreie Bucht vor dem Hafen, es war noch einmal ein kurzer Schlag nach Norden erforderlich, und dann stieg sie fünf Meter vor dem Ufer vom Brett, schob es durch seichtes Wasser zum Strand, schälte sich bis zur Hüfte aus ihrem schwarz-roten Neopren-Anzug, ließ sich ins Gras fallen und schloss die Augen.
»Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht«, hörte sie jemanden sagen und sah zwischen zusammengekniffenen Lidern, wie sich ein gut gewachsener Dreißigjähriger mit langem, blonden Haar neben sie hockte. »Ich habe schon mit dem Fernglas nach dir Ausschau gehalten. Hätte sein können, dass etwas an deinem Rigg gebrochen ist. Ist ja nicht das beste Material, mit dem du gekommen bist. Und auskennen tust du dich auch nicht. Andererseits – ich habe gedacht, so eine Frau wie du, die weiß, was sie tut, nicht wahr?«
Meine Güte, was für ein Schleimer. Oder war er nur charmant? Hatte man nirgendwo seine Ruhe? Konnten einen die Kerle nie in Ruhe lassen? Im ersten Unwillen wollte Johanna sich zur Seite drehen, aufstehen, ihr Brett aufs Auto laden und verschwinden, mit dem letzten Quäntchen Kraft, aber als sie sein strahlendes Lachen sah und seine schönen blauen Augen, ließ sie sich zurücksinken. Der Typ sah verflucht gut aus, ziemlich stattlich, die Erscheinung, gut proportioniert, ausgesprochen sportlich, kein Anabolikababy, aber durchtrainiert, sogar die Stimme war sympathisch – nur etwas jung. Jetzt dämmerte es ihr: Da neben ihr hockte der Surflehrer, dem das kleine Areal neben dem Schilfgürtel gehörte, wo er seine Surfschule betrieb, Bretter und Segel verlieh und einen Campingwagen stehen hatte, der ihm anscheinend als Aufenthaltsraum diente. Das Büro war weiter vorn in einem rechteckigen Pavillon mit großen Fenstern untergebracht. Das alles hatte er ihr längst erzählt, Hans Petkovic, von allen Hansi genannt.
»Du bist viel zu lange draußen gewesen«, sagte er nachsichtig. »Lass es ruhig angehen. Da hat man mehr von. Ich kenn das. Da ist der Wunsch, alles hinter sich zu lassen. Nur der See, der Wind und du, dein Board – was will man mehr, nicht wahr? Hier...«, er hielt ihr einen Kraftdrink hin, Red Bull, von dem sich viele Leute seines Schlags ernährten, wenn sie dazugehören wollten. Johanna nahm die Dose und trank begierig.
Der Surflehrer sprach mit breitestem österreichischem Akzent. Es hört sich charmant an, beinahe zu charmant, und dieses Lächeln ist überzeugend, fast zu überzeugend, dachte Johanna und wünschte sich gleichzeitig, dass er weiter redete, sie hier liegen bleiben konnte und nichts machen müsste, nicht einmal auf ihn eingehen.
»Du bist aus Stuttgart, nicht wahr? Ich hab’s an der Autonummer gesehen, als du das Board und das Segel gebracht hast. Kannst es gern hier bei mir lassen. Da kommt nichts weg. Es ist nie etwas gestohlen worden. Die Menschen hier sind anständig, sind von Grund auf ehrlich. Ja allerdings, deine Geldbörse lass besser nicht herumliegen. Es kommen reichlich Fremde her. Aber die Surfer sind okay.« Er tätschelte ihre Schulter, lachte gut gelaunt und zeigte weiße Zähne. »Aber so lange solltest du nicht in die Sonne gehen, und setz morgen besser ein Basecap auf!«
Ratschläge, so gut sie auch gemeint sein mochten, gingen Johanna momentan total auf den Wecker. Konnte man sie nicht in Ruhe lassen? Unbeabsichtigt fiel ihr Blick auf ihren Handrücken. Sie hatte vor dem Losfahren den Ehering abgezogen. Er störte sie beim Surfen wie jeder Ring, die Hände mussten frei sein. Nur jetzt war es ihr aus einem ganz anderen Grund lieb, dass sie ihn abgezogen hatte. Es verbaute nicht von vornherein... Meine Güte, was denke ich für dummes Zeug, sagte sie sich und sah den Surflehrer an. Er war bestimmt zehn Jahre jünger als sie. Wie kam sie nur auf eine solche Idee, dass er... Aber er lächelte, nahm ihr die Dose aus der Hand und stellte sie in Gras.
»Der See ist ein geiles Revier, einfach Spitze, klass – wie wir Wiener sagen. Der Wind ist stetig, meistens jedenfalls. Er kommt fast immer vom Gebirge. Aber Sturm kann schnell aufkommen, besonders bei einem Gewitter. Dann komm schleunigst ans Ufer. Eine Viertelstunde – und du bist mitten im Inferno, Wellen von anderthalb Metern Höhe, ja wirklich«, sagte er eindringlich und riss, um es zu unterstreichen, die Augen auf. »Ist nicht übertrieben. Ich habe dir hier eine Broschüre mitgebracht, wasserdicht, mit den Notsignalen. Kannst ja mal durchlesen, bei Gelegenheit, oder aufs Board kleben. Du machst Ferien hier, nicht wahr? Wie lange bleibst du? Bist allein, nicht wahr?«
Aha, die Testfrage. Johanna dachte wieder an den Ring und wie sie ihn bei solchen Gelegenheiten ins Spiel brachte. Sie legte die rechte Hand auf den Konferenztisch, streckte wie zufällig die Finger aus, und zwar immer dann, wenn ein Mann zu borniert war, um Abstand zu halten, oder andere Signale nicht erkennen wollte. »Ich bin verheiratet«, sagte sie, und es klang wie eine Entschuldigung.
»Macht nichts«, meinte Hans, als würde ihn der Umstand keinesfalls veranlassen, seine Annäherungsversuche einzustellen. »Verheiratet ist ja nicht gestorben.«
Es war das erste Mal, dass er Johanna zum Lachen brachte. »Ihr macht getrennt Urlaub? Oder hat dein Mann dich hier abgesetzt, damit er freie Bahn...«
»Mich setzt niemand ab«, sagte Johanna schärfer, als sie beabsichtigt hatte. Mochte der Surflehrer es als Hinweis, als Klarstellung oder als Drohung auffassen.
Hansi zögerte eine Sekunde, zog dann erstaunt, gespielt oder nicht, die Augenbrauen hoch. »Das glaube ich auch«, lenkte er ein. »Was macht er, dein Mann? Holt er dich ab? Ach nein, du bist ja mit dem Wagen gekommen.«
»Er ist in Eisenstadt. Wasser hätte keine Balken, sagt er immer, er schwimmt zwar gern, er badet, aber Wassersport? Nein. Kein Sportler, er ist mehr – ein – Intellektueller.« Es klang ein wenig abfällig, so wie sie es gesagt hatte. Es war ihr rausgerutscht wie das mit dem ›Absetzen‹. Was war los mit ihr? Weshalb betonte sie diesem Mann gegenüber ihre Eigenständigkeit so sehr? Hatte sie es nötig, sich zu distanzieren? Schob sie Carl von sich weg, um dem Mann an ihrer Seite ihre Freiheit deutlich zu machen? Erwartete sie von ihm, in die lokale Surferszene eingeführt zu werden? Sie war gut, und eigentlich hatte sie sich früher stets ihren Platz erobern können. Aber sie hatte mittlerweile die Verbindung verloren, die Leute waren ihr zu jung, zu grün, zu unprofessionell, nicht gut genug. Doch sie drängte die Fragen und Zweifel rasch beiseite, darin hatte sie inzwischen Übung. Was sie nicht weiterbrachte, war bedeutungslos. Wozu sich Gedanken machen? Sie war genau da, wo sie sein wollte, und das war nicht da, wo Carl sich gern aufhielt.
»Spielt er Golf?«, bohrte Hans weiter, »oder ist er einer von den Weinfreaks? Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben – so heißt es doch, bei Wilhelm Busch? Von alten Knaben wimmelt es hier. Die kommen wegen unserer wunderbaren Weine. Sonst ist nichts mehr los mit ihnen. Schau«, er zeigte in Richtung Leithagebirge, »das ganze Grün, bis oben zum Wald, der ganze Berghang ist voll damit, rund um den See nichts als Weinstöcke. Die Weine muss man einfach probieren, ich kenne da einen sehr schönen Heurigen. Da lad ich dich mal ein...«
Jetzt fängt der auch mit Wein an, dachte Johanna entsetzt, das kann heiter werden. Glücklicherweise kamen zwei junge Mädchen, etwa halb so alt wie sie, und zerrten den Surflehrer weg. Anscheinend kannten sie ihn.
Hansi hier, Hansi dort, hieß es, Hansi, kannst du mal... sie glucksten, scherzten, und Johanna merkte verblüfft, dass es ihr gegen den Strich ging, wie die Mädchen um Hansi herumflatterten und ihn zum Pavillon zogen. Was wollten die jungen Dinger, denen die blonden Pferdeschwänze kokett um die Ohren flogen? Wieso drängten sie sich dazwischen?
Mach dich nicht lächerlich, Johanna, sagte sie sich, stand auf, streifte den Neopren-Anzug vollständig ab und zupfte ihren Bikini zurecht. Es kostete sie viel Mühe, sich die schmerzenden Glieder nicht anmerken zu lassen, als sie steif zum Pavillon ging, um Hans nach der Dusche zu fragen.
Er musterte sie von oben bis unten, verzog anerkennend den Mund und schickte sie zu dem Schuppen, wo er die Surfbretter und Segel aufbewahrte, drinnen sei die Dusche und eine Umkleidekabine, sie möge bitte nur biologisch abbaubare Seife benutzen, »wir sind hier sehr bewusst, was den Umweltschutz angeht.«
Sie brauchte eine halbe Stunde, bis sie sich wieder als einigermaßen menschlich empfand. Sie trug ein rotes Trägertop und eine enge geblümte Baumwollhose, zog aber wegen der Mücken, die in blutdürstigen Schwärmen aus dem Schilf aufstiegen, eine langärmelige Bluse über.
Hans Petkovic pfiff anerkennend, als sie geschminkt, frisiert und parfümiert auf ihn zukam. »Eben noch Sportlerin, jetzt ganz Dame«, meinte er begeistert, »was spielst du lieber?«
Johanna merkte, wie sie es genoss, dass sie ihm gefiel. »Beides«, antwortete sie beiläufig. »Zeig mir bitte, wo ich die Sachen hinbringen soll.« Gemeinsam rollten sie das Segel auf und verstauten es zusammen mit dem Surfbrett im Schuppen. Damit war klar, morgen würde sie wieder kommen, und Hansi versprach, ihr Material auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Aber das Kiten könne sie besser auf der anderen Seite des Sees lernen, sie müsse nach Podersdorf, da gebe es richtigen Strand. »Ich komme mit und gebe dir die ersten Stunden. Bei dir reichen drei oder vier, dann kannst du das. Und zum Üben brauchst du keinen Lehrer.« Er müsse allerdings eine Vertretung für seine Schule auftreiben, was in der Hochsaison jedoch einfach sei. Die Freaks rissen sich um Jobs, bei denen sie mit ihrem Hobby Geld verdienen könnten. »Auch gute Leute kriegt man billig. Man muss den Jungs nur alles Mögliche versprechen. Aber du musst sie kontrollieren, sonst hängen sie nur cool ab und bandeln mit den Mädels an...«
Der Besucherstrom in Richtung Seebühne war versiegt, Johanna fand auf dem riesigen Parkplatz schnell ihren Wagen wieder, ließ sich in den Sitz fallen und schlug die Tür zu, um nicht noch länger die Melodien des »Grafen« hören zu müssen. Ihr schauderte bei dem Kitsch.
Der Weg nach Eisenstadt war auch ohne Navigationssystem zu finden: die Dammstraße zurück nach Mörbisch, durch den Ort, dann nach rechts, in Rust nach links, durch St. Margarethen hindurch, immer geradeaus nach Eisenstadt, dann käme ein Kreisverkehr, dahinter Baumärkte, Supermärkte, Gartenmärkte und welche für Tiernahrung...
Der Weg zum Schloss Esterházy sei ausgeschildert, hatte Carl morgens erklärt. Auf einmal empfand sie den Gedanken, ihn zu treffen, bedrückend. Nichts von dem, was sie den Tag über erlebt hatte, interessierte ihn. Sie konnte es ihm erzählen, er hörte zu, aber ihre Begeisterung teilte er nicht. Und über Hans oder Hansi hielt sie besser den Mund. Allerdings waren Carls Weinverkostungen für sie ähnlich langweilig. Während des Urlaubs würden sie tagsüber getrennte Wege gehen, niemand vermisste den anderen – dann blieben nur die Abende, und sie dachte an Hansi – wieso hatte sie sich eigentlich auf Carls Vorschlag eingelassen, im Burgenland Urlaub zu machen? Ein ungutes Gefühl beschlich sie. Aber glücklicherweise gab es den See; und wieder kam ihr der Surflehrer in den Sinn.
Scheinwerfer strahlten die Front des Schlosses an, in dunklem Gelb leuchtete die breite Fassade, von zwei Fensterreihen aufgelockert. Der Einfall des Lichts betonte die Rund und Spitzbögen darüber auf dramatische Weise. Zwischen den beiden Fensterreihen zog sich eine Reihe kleiner dunkler Nischen mit Büsten undefinierbarer Personen, sicher die Vorfahren der Esterházys aus der Zeit, als aus den kriegerischen Reitern der Magyaren sesshafte Fürsten hervorgegangen waren, denn einige trugen eine Art Turban, was bei der Dunkelheit nur undeutlich zu erkennen war. Sie verlieh dem mächtigen Bau eine Aura von Einsamkeit und herrschaftlicher Größe. Nach rechts hin fiel der Schlosshügel leicht ab. Dort begann die Fußgängerzone, wo sich die Feriengäste