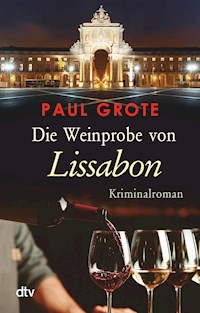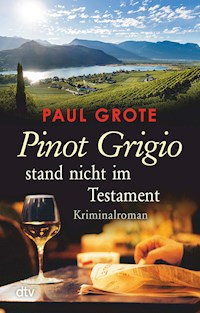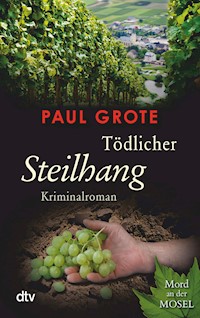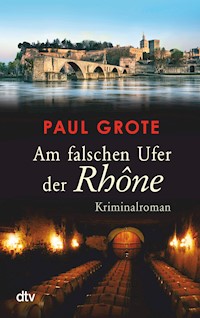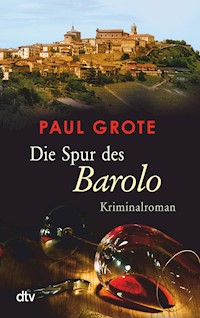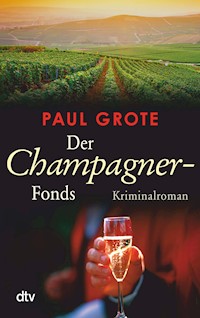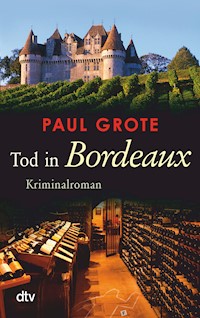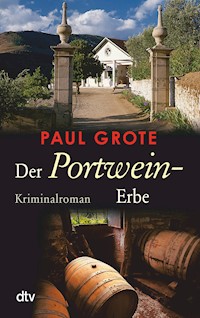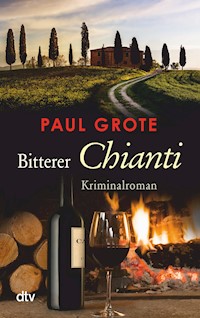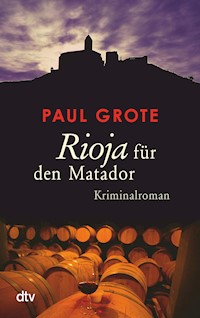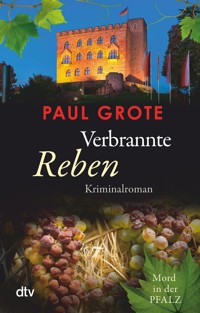
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Krimi
- Serie: Europäische-Weinkrimi-Reihe
- Sprache: Deutsch
Späte Rache Der Einbruch in die Galerie seiner Frau Verena ist nur das Vorspiel. Die nächsten Schläge gegen die Winzerfamilie von Philipp Achenbach treffen das Leittier seiner Schafherde und die Bewässerungsanlage. Während Sohn Thomas und sein Kompagnon Manuel versuchen, das Weingut auf den Klimawandel vorzubereiten, erfolgen weitere Angriffe. Richten sie sich nur gegen die Winzer? Oder steckt etwas anderes, viel Größeres dahinter?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Der Einbruch in die Galerie seiner Frau Verena ist nur das Vorspiel. Die nächsten Schläge gegen die Winzerfamilie von Philipp Achenbach treffen das Leittier seiner Schafherde und die Bewässerungsanlage. Während Sohn Thomas und sein Kompagnon Manuel versuchen, das Weingut auf den Klimawandel vorzubereiten, erfolgen weitere Angriffe. Richten sie sich nur gegen die Winzer? Oder steckt etwas anderes, viel Größeres dahinter?
Von Paul Grote sind bei dtv außerdem erschienen:
Tod in Bordeaux
Bitterer Chianti
Rioja für den Matador
Der Portwein-Erbe
Verschwörung beim Heurigen
Der Champagner-Fonds
Ein Riesling zum Abschied
Sein letzter Burgunder
Die Spur des Barolo
Am falschen Ufer der Rhône
Pinot Grigio stand nicht im Testament
Die Weinprobe von Lissabon
Tödlicher Steilhang
Königin bis zum Morgengrauen
Die Insel, der Wein und der Tod
Ein Weingut für sein Schweigen
Paul Grote
Verbrannte Reben
Kriminalroman
Gewidmet all jenen Winzern am Rande des Pfälzer Waldes und der Haardt, die mit Respekt vor der Erde ihre Arbeit machen
Alles beginnt mit Èşù,
er öffnet den Weg.
Und alles endet mit Èşù,
denn er verschließt ihn auch.
Personenverzeichnis
Stern, Jungwinzer
Thomas Achenbach, sein Freund und Kompagnon
Simone Latroye, Weinbautechnikerin aus Saint-Émilion
Philipp Achenbach, Gründer des Weingutes
Verena Baederle-Achenbach, Galeristin
Leonie, Biotechnikerin, Tochter des Galerie-Hausbesitzers
Efe, Geflüchteter aus Nigeria, Angehöriger der Yoruba
Grigoriy, Geflüchteter aus der Ukraine
Johanna Breitenbach, Umweltingenieurin und Dozentin
Hélène (Waltraud) Haller, Landschaftsmalerin
Beatrix von Weiden, Journalistin
Francesca und Arnold Sturm, Gastronomen aus Düsseldorf
Pascal Bellier, Kommissar der Police judiciaire (Kripo Metz)
Schleichmeier, Polizeiobermeister
Voss, Polizeimeister
Lieselotte Ender, resolute Winzerin
Hannes Schmidtlein und Nicole Herberts, Sommeliers
Winzer des Verbandes der Prädikatsweingüter
Hölzer, Wunderlich und weitere Winzer
PrologDas Arbeitsessen
Er hatte seinen Namen in Diconne geändert, gleich nach den Ereignissen damals, und den seiner Tochter gleich mit. Sie hatte pro forma geheiratet – jemanden, der ihm verpflichtet war – und dessen Namen angenommen. Natürlich hatte er den Mann dazu überredet – auf seine Art eben, na ja, sie schien nichts gegen die Art zu haben, wie er Probleme löste, im Gegenteil. Sie stachelte ihn noch an, und der Erfolg gab den Ausschlag. Außerdem hatte der neue Gatte seiner Tochter Geld genommen, er würde es nicht wagen, den Mund aufzumachen. Diconne wusste: Ihr war das alles egal, sie musste ja nicht mit ihm ins Bett gehen, und eine gemeinsame Wohnung war nicht vorgesehen. Hauptsache, sie hatte den Namen. Und Ausweise, die jedes Lesegerät täuschten.
Mit seinem neuen Namen kam er gut klar: Adrien Diconne, Wohnort Nantes. Klang sympathisch. Man hatte sich viel Mühe gemacht, die Lebensläufe waren bis zu den Großeltern bereinigt. Er hatte sich seinerzeit dringend aus dem Geschehen ausklinken müssen, zumindest in der Öffentlichkeit. Wie hätte es gewirkt, wenn es weder Eltern noch Großeltern in den Analen gegeben hätte? Das war jetzt vorbei. Die neuen Dokumente waren sicher, denn für Diconne stand viel auf dem Spiel. Sogar für die neue Geburtsurkunde hatte »der Alte«, wie sie ihn jetzt nannten, das entsprechende Papier besorgen lassen und bei einem Trödler eine mechanische Schreibmaschine, auf der das D seines neuen Namens in die Höhe rutschte. Es sah richtig echt aus.
Diconne nippte an seinem Wasserglas und wartete. Äußerlich gelangweilt schaute er zur Tür des Restaurants. Der Alte verspätete sich. Er trat kaum noch selbst auf, dazu war er zu bekannt. Thierry Patour, wie er sich jetzt nannte, zog jedoch weiter alle Fäden im Hintergrund. Von ihm stammten die Ideen und selbstverständlich auch der Generalplan, den sie gegenwärtig in die Praxis umsetzten.
Auch wenn der Alte sich kaum in der Öffentlichkeit zeigte, so war es unumgänglich, das Wesentliche mit ihm persönlich zu besprechen. Es gab zusätzlich ein ungelöstes Problem, seit sie ihren Wirkungskreis nach Frankreich, Spanien und Italien erneut auf Deutschland ausgedehnt hatten. Es würde kein Leichtes sein, es zu lösen, das Wie musste durchdacht sein, um das neue Projekt nicht zu gefährden, denn beides griff ineinander. Letztlich sind wir alle zusammen schlauer als irgend so ein dummer deutscher Polizist, den man mit diesem Fall betrauen wird, sagte sich Diconne. Und bis die Bafin darauf kommt, werden Jahre vergehen.
Doch so viel Zeit benötigen wir gar nicht, freute sich Diconne, grinste in sich hinein, und es machte ihn zuversichtlich. Die finanziellen Hintergründe begriffen die schwerfälligen Behördenhengste der Bafin sowieso nicht, andernfalls würden sie woanders arbeiten, das hatte der Alte im Fall von Wirecard und bei der Pleite der Kryptobörse FTX verfolgt. Beides hatte er auf Geheiß des Alten genau studiert. Die anderen Aufgaben übernahm seine Tochter. Sie als Frau war deutlich unauffälliger.
Als der Alte das Restaurant betrat, von einem Kellner zum Tisch in der Ecke begleitet, war Diconne doch erstaunt, wie sehr er in letzter Zeit gealtert war. Immer dann, wenn sie sich länger nicht gesehen hatten, fiel es ihm auf. Schlohweiß war Patour geworden, ging leicht nach vorn gebeugt, führte sogar den Gehstock in der Hand. Spätfolgen der vielen Jahre im Gefängnis? Es war ihm nicht schlecht ergangen, mitnichten, nur die Betten seien grauenhaft gewesen, sonst sei er gut versorgt und seiner besonderen Stellung wegen nicht nur von den Mitgefangenen respektiert worden. Der eine oder andere Beamte war ihm geradezu dankbar und hatte ihm jeden Wunsch erfüllt.
Auch wenn seine Augen in einem zusehends alternden Körper steckten, waren sie so wach und misstrauisch wie immer, durchdringend scannten sie das Restaurant und die anderen Gäste, aber scheinbar blieb nichts, was seinen Verdacht hätte erregen können, haften. Der Verdächtigste war er. Nur – war es ihm bewusst? Aber wer sollte ihn heute nach den Operationen noch erkennen?
Diconne stand auf und begrüßte Patour mit Handschlag. Der Alte hingegen umarmte ihn. Wurde er sentimental? Wusste er nicht mehr, was vorgefallen war? Die zweite Kugel stammte damals nicht aus einer Polizeiwaffe …
»Gut siehst du aus, mein Freund!« Patour trat einen Schritt zurück und betrachtete Diconnne von Kopf bis Fuß. »Ganz im Gegensatz zu mir. Kommst du geradewegs von der Côte d’Azur? Hast einige Wochen auf deiner neuen Jacht verbracht?«, fragte er lächelnd. »Das ist vernünftig, wofür sonst das ganze Geld?« Eine Antwort erwartete er nicht.
Um noch mehr Geld zu machen, dachte Diconne, etwas anderes gibt es für den Alten nicht. Die Jahre im Knast hat er genutzt, das Vermögen der Strafvollzugsbeamten und der Mitgefangenen zu mehren (was für grässliche Wörter), legales und illegales Geld, Beute, gut versteckt und sicher angelegt, seine Provisionen waren garantiert höher als die eines jeden Finanzmaklers. Und manches wird er für sich selbst abgezweigt haben, unauffindbar, irgendwo sich selbst vermehrende Millionen …
»Auch der Vollbart steht dir ausgezeichnet, Diconne. Das graue Haar wirkt seriös, gut so, aber der Bart sollte gestutzt werden, sonst verwechselt man dich noch mit einem Araber, das kommt nicht gut an, besonders wenn du so braun gebrannt daherkommst, es macht den Leuten Angst. Vous ne reconnaît pas un cochon.«
Nein, es erkannte ihn wirklich kein Schwein, sie hatten die jüngsten Veränderungen mit Bekannten und sogar mit einer Software zur Gesichtserkennung getestet. Er hatte sich auch die Augenbrauen gestutzt und die Schlupflider beseitigen lassen. Aber Angst? Wer sollte ihn erkennen, besonders hier? Die einzige Gefahr bestand darin, dass der Alte observiert wurde, dass irgendein Profiler an ihm dranhing. Aber wer sollte den auf den Trail schicken? Der Alte war umsichtig. Im Knast hatte er alle Mithäftlinge danach befragt, wie man ihnen auf die Schliche gekommen war. In Sachen Methodik und Strategie war er unschlagbar. Nur ein Zufall hatte damals ihr Projekt zu Fall und Patour in den Knast gebracht.
Er griff nach der Speisekarte und blätterte uninteressiert darin herum. Er kannte sie alle, die besten Restaurants in London, Madrid, Rom, Paris und jetzt hier – in Neustadt an der Weinstraße. Es langweilte ihn, die Blasiertheit der Köche und das Getue des Personals gingen ihm auf den Geist. Doch es gehörte dazu.
Sie bestellten – der Alte war Vegetarier geworden, aber Fisch aß er noch. Dann kam er zum Thema, »Wie weit sind wir? Steht die Organisation vor Ort?«
Diconne griff mit gesenktem Blick in die Tasche seines Sakkos und holte ein Blatt Papier hervor, schob Platzteller und Besteck beiseite und strich das Organigramm glatt: »Die Feldforschung ist fast abgeschlossen. Die Namen und Objekte sind bekannt, weitere folgen, die Dokumente erhalten wir nach den ersten Gesprächen. Jeder weiß, was zu tun ist, die Aufgaben sind verteilt. Nur an den Behörden und der Politik muss noch gearbeitet werden. Das besprechen wir besser nicht hier. Außerdem sollten die Aufkäufer dabei sein. Mich interessiert vielmehr, ob du unsere …«, er suchte nach dem passenden Wort, »unsere Freunde gefunden hast?«
»Nichts einfacher als das. Rien de plus facile. Wir könnten nachher vorbeifahren. Wir haben sogar jemanden für die Nahaufnahmen. Spricht fließend Deutsch.«
»Ich vermute mal, dass es diese Frau ist?«
»Treffsicher wie immer.«
»Großartig. Und – hast du dir schon was für sie überlegt?« Es war klar, dass der Alte diesmal nicht die Frau meinte.
»Allerdings.« Diconne grinste und war sich seiner Überlegenheit bewusst. »Wasser, das ist es … Ohne Wasser kein Wein! Das ist nur als erster Schritt gedacht, danach …«
»Dann legt los.«
Der Kellner trat an ihren Tisch. »Wasser, meine Herren? Mit oder ohne Kohlensäure?«
1.Elwedritschen
Sie wollte nicht aufwachen, sie wehrte sich, von diesem entsetzlichen Ton aus dem Schlaf gerissen zu werden, und klammerte sich an einen diffusen Traum. Todmüde zog sie sich das Kissen über den Kopf, doch der Ton durchdrang die Daunen.
Und da war Philipps Hand: »Verena, dein Telefon«, murmelte er, und genauso nervig tätschelte er ihren Arm. »Wach auf!«
Weder wollte sie geweckt noch gestreichelt werden, sie empfand seine Berührung als unerbittlich. Erst nach Mitternacht waren sie ins Bett gekommen: die Vernissage, die Gäste, viele Gesichter, Kunstbeflissene und Journalisten, hundert Gespräche, Smalltalk und Klugscheißer, und als Gastgeberin hatte sie präsent zu sein. Es war ein Erfolg, klar, für sie und für Hélène. In ihrem Kopf war alles durcheinander und schien an diesem Morgen unwirklich … Aber der Klingelton kannte keine Gnade. Es musste, ja, es konnte nur etwas Unangenehmes sein, so rabiat, wie er in ihr Ohr eindrang.
Verena blinzelte, der erste Schimmer des Morgens zeigte sich hinter dem Vorhang, und die Vögel machten schon wieder Krach, ohrenbetäubend ihr Gezwitscher. Unwillig befreite sie sich vom durchgeschwitzten Laken, es war bereits jetzt widerlich heiß, griff nach dem Smartphone und schaute aufs Display – die Nummer des Anrufers wurde unterdrückt. Da erlaubt sich jemand einen üblen Scherz, dachte sie grimmig, eine Unverschämtheit war das. Oder war etwas mit ihrem Vater? Das allerdings wäre der einzige Grund …
»Was ist? Wer ist dran?«, murmelte Philipp Achenbach neben ihr, wälzte sich auf die andere Seite und zog sein Laken über den Kopf.
»Keine Ahnung«, sagte Verena mit beschlagener Stimme, räusperte sich und tippte auf den grünen Punkt. »Wer ist da?«
»Frau Baederle?«, fragte eine männliche, hellwach klingende Stimme. »Frau Veronika Baederle-Achenbach?«
Wieso sprach sie der Anrufer mit einem falschen Vornamen an? Galt der Anruf nicht ihr? »Was wollen Sie – mitten in der Nacht?«
»Hier Polizeiobermeister Schleichmeier!«
Schlauchmeier? Was für ein blöder Name – was die Leute sich einfallen ließen, und witzig fanden sie es obendrein, andere aus dem Schlaf zu reißen. Schlaumeier? Und dazu noch Polizeiobermeister? »Lassen Sie den Quatsch!« Ärgerlich drückte Verena das Gespräch weg. Dieser Meier sollte sich schleichen, am besten zum Teufel. Sie legte das Smartphone zurück auf den Nachttisch und überlegte, das Gerät abzuschalten, als der Klingelton erneut ertönte. Sie zögerte. Wenn sie sich weiter ärgerte, würde sie kaum wieder einschlafen, also nahm sie das Gespräch an, holte tief Luft, um dem Anrufer eine passende Antwort zu geben.
»Es geht um Ihre Galerie, Frau Baederle-Achenbach, um die Galerie Südstern, hier in Bad Dürkheim!« Es war dieselbe Stimme wie zuvor, nur klang sie jetzt befehlsmäßig. »Bei Ihnen ist eingebrochen worden! Gestern war bei Ihnen Eröffnung, soweit ich weiß, und wie es aussieht, wurden sämtliche Bilder abgenommen, und – abtransportiert, wie mir Ihre Nachbarin, Frau … äh …«
Der Anrufer zögerte, schien sich irgendetwas versichern zu wollen, Verena vernahm dumpfes Stimmengemurmel im Hintergrund. »Frau Dehmel, ja?«, sagte der Anrufer und machte eine Pause, anscheinend um seine Worte wirken zu lassen, und wiederholte den Namen.
Frau Dehmel gab es wirklich, die Familie wohnte im Haus neben der Galerie, die Nachbarn waren selbstverständlich auch bei der Vernissage dabei gewesen – bei diesem besonderen Ereignis für Bad Dürkheim –, weniger aus Interesse an der Kunst, vielmehr aus Neugier. Dann gab es diesen Schleimmeier wirklich? Verena versuchte ihre Gedanken zu sortieren. »Sie sind tatsächlich Polizist?« Gänzlich war sie noch nicht überzeugt.
Es war eingebrochen worden, bei ihr? So ein Quatsch. Wen hatte sie denn ausgestellt? Lokale Künstler und zurzeit eine Künstlerin, und wenn das stimmte, wenn tatsächlich … Doch was war in ihrer Galerie zu holen? Wohl kaum die Acrylbilder von Waltraud, äh … von Hélène, wie sie sich nannte? Oder gar die wunderbaren Vasen, die sie in Murano so günstig erstanden hatte? An ihren allzu niedrigen Wänden hingen keine alten Meister, kein Degas, kein Feininger oder gar ein Ambroise Dubois der manieristischen Schule von Fontainebleau. Eigentlich schade. Bei ihr standen die Keramiken von Giesela, die vierzig Zentimeter hohen Plastiken von Rolf Sommer, und ausgestellt waren die Acrylbilder von Hélène Haller, die in Wirklichkeit Waltraud hieß und mit HH signierte …
»Eingebrochen?«, fragte Verena. »Bei mir?«
»Sehr richtig!«, sagte der Polizist inzwischen ungehalten. »Ein-ge-bro-chen! Haben Sie es endlich begriffen?«
»Und die Bilder sind weg?« Unglauben mischte sich mit Entsetzen. »Alle?«
»Das jedenfalls gibt Frau Dehmel an. Leere weiße Wände. Da hängt nichts mehr, nicht ein Bild. Gestern bei der …«, er zögerte, als dächte er darüber nach, wie man das Wort Vernissage ausspricht, »bei der Eröffnung Ihrer … Ausstellung seien noch alle da gewesen. Und die Ladenkasse steht offen …«
Absurd. Einfach idiotisch. Da war so gut wie nichts dringeblieben. Eintritt hatten sie nicht genommen, und das Geld von den Verkäufen würden sie erst am Ende der Ausstellung erhalten. Verena versuchte, den Gedanken eines Einbruchs an sich heranzulassen, ein Angriff auf ihre … Provinzgalerie? Völlig absurd.
Ganz ehrlich gesagt waren die Bilder von Hélène Haller alias Waltraud das Risiko, bei einem Einbruch geschnappt zu werden, kaum wert. Sie hatte Hélène helfen, ihren Namen bekannt machen wollen (natürlich nicht ganz selbstlos), der Mann vom Wochenblatt und der von der Rheinpfalz waren da gewesen, das lokale TV, sie würden morgen berichten, Internetblogger, gut für sie, sehr gut für Hélène – aber unter diesen Umständen?
»Es wird Zeit, dass Sie herkommen, Frau Baederle …«, das »Achenbach« schob er widerwillig hinterher. »Wie lange brauchen Sie?«
Anscheinend wusste dieser Schlaumeier – sie grinste innerlich beim Gedanken an seinen Namen und versuchte, sich den Mann vorzustellen –, dass sie auf dem Weingut Achenbach & Stern lebte. Für die zehn Kilometer bis ins Zentrum von Bad Dürkheim würde sie höchstens eine Viertelstunde benötigen. Das sagte sie diesem Schlauchm… diesem Polizisten. Sie schwang die Beine aus dem Bett.
Inzwischen war Philipp halbwegs wach. »Wozu brauchst du eine Viertelstunde?«, fragte er schlaftrunken.
Verena zog die Vorhänge zurück und ließ den Morgen herein. »Ich brauche dich«, sagte sie, »sofort!« Und sie widerholte, was dieser Schleim- oder Schlauchmeier gesagt hatte.
Kaum fiel das Wort vom Einbruch, hatte Philipp Achenbach die Füße am Boden, stand auf, griff nach dem Bademantel und taumelte ins Bad, während Verena noch versuchte, das Gehörte in ihrem Kopf zu sortieren. Mein Mann ist ein Phänomen, dachte sie und sah ihm nach. Er ist immer da, ist immer präsent; kaum geschieht etwas, reagiert er, funktioniert, sucht und findet Lösungen, stellt Verbindungen her, zögert nicht, sich einzubringen. Und Thomas, sein Sohn, ihr Stiefsohn, war ähnlich, nein, fast schlimmer, sagte sie sich, und weniger diplomatisch. Nun gut, wie soll er auch sein, wenn der Vater es ihm ein Leben lang vorgemacht hat.
Sie dachte daran, Thomas zu wecken, bis sie sich erinnerte, dass er wieder in Saint-Émilion war, bei seiner Freundin Simone. Er würde erst am frühen Abend zurückkehren. Eigentlich hatten Philipp und sie geplant, ihre Tour durch die Pfalz zu beginnen, seit Langem hatten sie sich das vorgenommen: bei den besten Winzern wollten sie vorbeischauen, in die Geschichte eintauchen, wandern, Zeit füreinander haben, ohne den Besserwisser Thomas und ihren Teilhaber Manuel. Wie oft hatte sie diesen Wunsch geäußert! Jetzt endlich hatte sie Philipp so weit – und nun das! Ein Einbruch? Sie glaubte es noch nicht. Für den Abend erwarteten sie Kunden, ein Ehepaar, Restaurantbesitzer aus Düsseldorf, die sich ihr Weingut ansehen wollten. Selbstverständlich würde verkostet, es würde wie üblich über Wein geredet und spät werden – und sie würden die Reise wieder verschieben müssen. Es war zum Verzweifeln.
Philipp hatte Manuel längst geweckt und ihn über das Geschehene informiert. Er würde die Schafe aus dem Stall lassen und sie in den Teil des Weinbergs treiben, den sie gestern mit dem Elektrozaun abgeteilt hatten. Ursprünglich war das ihre Aufgabe gewesen, sie war die Schäferin hier, sie hatte mit dem Experiment begonnen, doch mit der Zeit hatte Manuel daran Gefallen gefunden und ihr die Arbeit mit den kleinen bretonischen Quessants aus der Hand genommen, wofür sie ihm dankbar war. Inzwischen hatte Efe, ihr Mitarbeiter aus Nigeria, die Aufgabe übernommen, er hatte einen Narren an den Schafen gefressen und war feinfühlig genug für die kleinen Tiere, die ihnen viel Arbeit abnahmen. Sie hielten den Bewuchs im Weinberg niedrig, erledigten die Unterstockarbeiten, was ihnen den Einsatz von Glyphosat ersparte, fraßen die Wasserschosse, und dabei düngten und belüfteten sie mit ihren kleinen Hufen den Boden.
Während Verena sich unter dem kalten Wasser der Dusche erholte, dachte sie daran, dass Thomas die Geduld, die er den Weinstöcken entgegenbrachte, für die Tiere nicht aufbrachte. Er war zu schnell, wollte immer zu viel (was sein Vater natürlich anders sah), und Grigoriy, ihrem ukrainischen Praktikanten, waren die kleinen Schafe unheimlich. Efe hingegen, den sie, völlig verzagt, aus einer Unterkunft für Geflüchtete befreit hatten, machte sich prächtig und sprach mit den Quessants auf Yoruba, was bis auf die Schafe hier niemand verstand.
Die aufgehende Sonne ergoss ihr blendend weißes Licht über die bis zum Pfälzer Wald bestockte Ebene, als sie den Hof verließen und in die Landstraße einbogen. Es wird wieder ein heißer Tag werden, vermutete Philipp, viel zu heiß für Ende Mai, viel zu trocken, ihnen würde nichts anderes übrig bleiben, als höher liegende und geneigte Flächen künstlich zu bewässern. Der Regen im Vorjahr hatte nicht die erwartete Entspannung gebracht. Laut Zeitungsberichten trockneten auf den Höhen des Pfälzer Waldes bereits die ersten Quellen aus. Besonders die Neuanlagen am Libellenberg mit Manuels jungen Weinstöcken litten, und das, obwohl der Sommer nicht einmal begonnen hatte. Manchmal fürchtete Philipp sich vor der Zukunft, er sorgte sich, wie es weitergehen sollte, nicht nur für sie, sondern für alle Kollegen, und nicht nur hier in der Pfalz, nicht nur hier in Deutschland, nicht nur … Auch unter diesem Gesichtspunkt sah er die Reise positiv, sicherlich ließ sich von den Erfahrungen der Kollegen profitieren. Aber vorerst musste ein anderes Problem gelöst werden.
»Deine Hélène fällt in Ohnmacht, wenn sie erfährt, dass ihre Bilder verschwunden sind«, sagte Philipp – sie würde sicher theatralisch werden oder einen hysterischen Anfall bekommen. Innerlich zuckte er mit den Schultern, aber das durfte er nicht zeigen, er musste sich jede Reaktion verkneifen. Er wusste, wie sensibel Künstler auf Kritik reagierten, und ganz besonders Waltraud-Hélène Haller, wie er sie im Stillen mit Doppelnamen nannte. Thomas und Manuel wussten, wie er wirklich über sie dachte, und auch die beiden hielten sich Verena gegenüber bedeckt. Wer würde diese Bilder klauen, Acryl und Aquarelle, alles heimische Motive? Es war keine große Kunst, obwohl gestern bereits drei Bilder verkauft worden waren. Er hatte die roten Punkte an den Rahmen gezählt.
Würden sie wirklich bezahlt werden? Oder hatte Waltraud-Hélène die Punkte selbst auf die Rahmen geklebt, um sich interessanter zu machen? Das fragte er sich, als sie durch die im milchigen Morgennebel liegenden Weinberge auf Bad Dürkheim zufuhren: Hitze und Feuchtigkeit, das beste Biotop für Mehltau. Eine Vertraute Verenas und Hélène würden sich während ihrer Reise um die Galerie und ihre Bilder kümmern, der Pfälzer Wald in Acryl, zwei Burgen im Abendrot und das Hambacher Schloss, bei äußerst gutem Willen von Caspar David Friedrich inspiriert, dachte Philipp böse, aber näher dran: Wälder, Wege im Wald, die Wachtenburg im Abendlicht, Brücken über plätschernden Bächen, die Kapelle auf der Kleinen Kalmit und sogar eine Stadtansicht mit Brunnen: golden strahlende Elwedritschen, die freundlichen Fabelwesen von rechts und links, sowie Neustadt von oben, vom Bürgergarten aus gesehen, einer Ersten Lage.
Philipp mochte die Haller nicht, auch nicht ihre Art, sich als die Heimat- und Landschaftsmalerin zu gebärden, und hatte sich gestern notgedrungen zusammengerissen, was er weder die Malerin noch seine Frau und schon gar nicht die Besucher der Vernissage hatte merken lassen. Er empfand Waltraud-Hélène als anmaßend, sie hielt sich für besser, als sie war, obwohl er wenig von Malerei verstand und sich tunlichst aus Verenas Angelegenheiten heraushielt. Schließlich hatte sie Kunstgeschichte studiert und nicht er! Besonders vor der Reise wollte er jede Art von Verstimmung vermeiden. »Ich verstehe davon nichts!«, war eine seiner Ausreden. »Wie soll ich das beurteilen?« eine andere. »Es spricht mich nicht so an«, hätte wieder als wertend betrachtet werden können. Bilder gefielen ihm oder nicht, das war nicht nur bei ihm so. Ein Wein gefiel, oder er gefiel nicht, es war lediglich an den Experten, darüber zu urteilen, sich zu Qualität und Machart zu äußern. Thomas war der Ansicht, dass die Technik die Spiritualität verdrängte, wenn es sie überhaupt gab.
Was würde jetzt aus ihren Reiseplänen? Wenn der Tag so begann, was käme dann noch auf sie zu? Morgen hatten sie starten und in Bad Bergzabern übernachten wollen, dort sollte ihre Schlösser-, Burgen- und Weingütertour beginnen, seit Langem freute sich Verena darauf, und er durfte und wollte ihr die Freude auf keinen Fall verderben. Zu den Winzern, die auf seinem Programm standen, würde sie nicht mitkommen, das war geklärt. »Bitte keine Keller mehr!«, wiederholte sie. Die Nuancen des Weißburgunders bedeuteten ihr wenig, wenn nicht sogar gar nichts, Chardonnay war ihr eh zu flach, ob Sauvignon blanc nun grasig wirkte, nach Holunder schmeckte oder vielleicht sogar nach Grapefruit, war ihr gleich.
Aber erst einmal musste Thomas aus Saint-Émilion zurück sein. Philipp war gespannt, was er zu berichten hatte, es gab da gewisse Andeutungen, wie es mit dem Weingut von Martin Bongers und seiner Patentochter Simone weiterging. Seit Thomas sie an der Rhône unter dramatischen Umständen kennen- und lieben gelernt hatte, führten beide eine Fernbeziehung, keiner konnte (oder wollte) sich bisher für einen endgültigen Standort entscheiden. Simone war für Martin und ihr Weingut unabkömmlich, während er hier zumindest auf Manuel zählen konnte. Und auf Efe, denn solange muslimische Banden in Nigeria wüteten, würde auch er bleiben. Ruhe kehrte in jenem Land vorerst nicht ein.
Das rotierende Blaulicht eines Polizeiwagens riss ihn aus seinen Gedanken.
»Konnten sie das nicht abschalten?«, zischte Verena böse, die während der Fahrt geschwiegen hatte. »Das macht die gesamte Nachbarschaft rebellisch. Wie peinlich. Da, sieh, da stehen sie schon und lechzen nach Neuigkeiten!«
Die Gruppe der Schaulustigen, die sich an einem der beiden Polizeiwagen versammelt hatte, umfasste etwa zehn Personen. Trotz der frühen Stunde wurde eifrig mit den Uniformierten diskutiert oder auf sie eingeredet – wahrscheinlich hatte jeder seine eigene Theorie zu dem merkwürdigen Diebstahl.
Es war schon etwas Besonderes, so ein Einbruch in eine Galerie. Das hatte das Städtchen noch nicht erlebt. In Köln, wo Philipp und Thomas die meiste Zeit ihres Lebens verbracht hatten, gehörte das zwar nicht zum Alltag, aber das Heulen von Martinshörnern zerriss des Nachts häufig die Stille. Halt dich zurück, sagte sich Philipp, das ist nicht deine Veranstaltung, halt dich raus, das hier ist Verenas Angelegenheit.
»Frau Schröter ist auch schon da«, sagte Verena voller Ingrimm und starrte der Frau nach, die gegenüber wohnte. Sie wusste, dass die Nachbarin nichts von Künstlern hielt, egal, ob sie musizierten, Bücher schrieben oder malten, doch jetzt ging sie mit einer riesigen Kaffeekanne von einem zum anderen, verteilte Plastikbecher und schenkte ein. So machte man sich beliebt. Das Ganze glich mehr einer Bürgerversammlung über die Erweiterung der städtischen Radwege statt der Besichtigung eines Tatortes. Und Frau Schröter spielte Versammlungsleiterin.
Vergeblich suchte Verena unter den Umstehenden nach Hélène Haller – hatte man sie schon informiert?
Als sie aus dem Wagen stieg, wandten sich alle aus der Gruppe ihr zu. Ein großer Kopf mit einer blauen Mütze stach daraus hervor. Das wird er sein, dieser Schleicher oder der Schlaucheimer, vermutete Verena und suchte verzweifelt nach dem richtigen Namen. Es würde reichen und nicht unhöflich klingen, wenn sie ihn mit »Herr Kommissar« anreden würde. Hatte er seinen Dienstgrad am Telefon genannt? Sie war zu schlaftrunken gewesen, um aufmerksam zuzuhören. Vielleicht würde »Hauptkommissar« ihm schmeicheln?
»Sie waren es, der mich angerufen hat, Herr …«
»Schleichmeier, Polizeiobermeister.« Der große, unsympathische Mittvierziger mit den gelangweilten Augen und den nach unten weisenden Mundwinkeln nahm ihr die Peinlichkeit ab und gab ihr die Hand. »Gut, dass Sie endlich gekommen sind.« Der Vorwurf war nicht zu überhören. »Wir gehen am besten hinein und sehen uns den Schaden an.«
Verena nickte und schloss sich ihm klopfenden Herzens an. Sie kannte hier jeden Stein, jede Treppenstufe, jeden, der hier wohnte und der sie anfänglich mehr argwöhnisch als wohlwollend beobachtet hatte, als sie den Laden mit einem Angebot an Kunstgewerbe eröffnet und erst vor Kurzem zur Galerie umgestaltet hatte. Eine kleine Galerie war immer ihr Traum gewesen. Das Kunsthandwerk, der Verkauf, war lediglich ein erster Schritt in diese Richtung gewesen. Es war damals genauestens zur Kenntnis genommen worden, als sie sich vor zehn Jahren mit Philipp zusammengetan hatte: zwei Fremde, beide nicht von hier, beide schon in fortgeschrittenem Alter, sie ledig, keine Kinder, er geschieden, ein Sohn, welche Schlüsse die Nachbarn auch immer daraus gezogen hatten.
Vorsichtig, als bestünde die Gefahr, auch jetzt noch auf Einbrecher zu treffen, ging Verena auf die hintere Tür zu. »Haben Sie die Künstlerin noch nicht verständigt?«
»Welche Künstlerin?«, fragte der Polizeiobermeister. »Sie meinen die Malerin, deren Bilder hier gezeigt wurden?«
»Ja, Hélène Haller.« Empört hielt sie den Polizisten am Ärmel fest. »Schließlich ist sie betroffen.«
»Wir halten uns erst mal an Sie, Frau Baederle.« Verschnupft machte er sich los und blieb stehen. »Die Einbrecher werden mit dem Fahrzeug bis an die Tür gefahren sein und sie aufgehebelt haben. Da hatten sie einen kurzen Weg, um die Bilder rauszubringen.« Schleichmeier bückte sich und wies auf die Spuren, die der Kuhfuß am unteren Rand der Tür hinterlassen hatte. »Einbruchsicher ist das hier nicht. Ich halte das für fahrlässig. Sie hätten zu uns kommen sollen, wir beraten selbstverständlich auch Geschäftsleute in Sicherheitsfragen. Ich hoffe, dass Sie versichert sind. Waren die Bilder kostbar?« Erst jetzt schien er Philipp zu bemerken, der den beiden lautlos gefolgt war. »Was wollen Sie hier?«, fragte er barsch und vertrat ihm den Weg.
Verena stellte ihn vor: »Das ist Herr Achenbach, mein Mann.«
»Ach, der Winzer«, knurrte Schleichmeier, halbwegs besänftigt.
Gemeinsam betraten sie den langen Flur, der an dem winzigen Büro und der Abstellkammer sowie der Toilette vorbei zu den Ausstellungsräumen führte. In allen Räumen brannte Licht. Vorn, im großen Raum zur Hauptstraße hin, sahen sich zwei Uniformierte nach möglichen Spuren um. Allzu engagiert gingen sie nicht vor. Philipp hielt es nicht für besonders professionell. Was hätten sie auch finden sollen? Fingerabdrücke oder Fußspuren? Liegen gelassene Einbruchswerkzeuge?
»Sie werden Handschuhe getragen haben!«, meinte einer der Beamten.
Was für eine grandiose Erkenntnis, sagte sich Verena und verkniff sich den Kommentar.
»Aber Spurensicherung ist nicht unsere Aufgabe. Zuständig ist die Kripo Neustadt. Die wird irgendwann hier aufkreuzen«, fuhr der Beamte fort. »Wann? Fragen Sie mich das nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis.«
»Also trampeln Sie hier nicht herum und fassen Sie nichts an«, fügte der Polizeiobermeister in befehlsmäßigem Ton hinzu.
Aber es war nicht sein Blick, der Verena verunsicherte, es war die fremde Umgebung. Sie fühlte sich beobachtet und angestarrt von etwas, das es eigentlich nicht gab, etwas nicht Existentes und doch Vorhandenes, das nicht sein konnte, weil es das NICHTS war.
Die Leere starrte sie an, weiße Wände, fast blendend, an denen nicht ein einziges Bild mehr hing. Nur die Leisten, ganz oben, knapp unter der Decke, waren übrig, an denen noch bis vor wenigen Stunden, seit sie die Galerie Südstern abgeschlossen hatte, die Bilder gehangen hatten. Nur die zehn mal fünfzehn Zentimeter großen Schildchen mit dem Titel des jeweiligen Bildes, dem Preis und dem Namen der Künstlerin waren geblieben und komplettierten die Leere, sie unterstrichen ihren Eindruck. Also hatte auch das Nichts ein Format, einen Preis und einen Urheber.
Panik ergriff Verena, sie glaubte zwischen die nackten weißen Wände zu stürzen, als öffnete sich unter ihr das Nichts. Ihr wurde übel, hervorgerufen von einer Mischung aus Schuld und Angst. Sie war für Hélènes Bilder verantwortlich, die Malerin hatte ihr die Arbeit vieler Jahre anvertraut, ihr Werk. Und sie? Sie hatte versagt. Wie sollte sie das Hélène erklären? Himmel, was sollte sie ihr sagen? Wie würde sie reagieren? Für den späten Vormittag waren sie hier verabredet.
Immer noch starr vor Schreck tastete Verena mit der rechten Hand um sich, suchte nach Philipps Hand, doch da war nur eine fremde Hand, hart und unbekannt, die des Polizisten Schleichmeier, und entsetzt zog sie ihre Hand zurück.
»Ist Ihnen nicht gut?«, fragte der Polizist, plötzlich besorgt. »Sie sind ganz blass, besser, Sie setzen sich.«
Hinter dem kleinen Tresen stand ein Stuhl, dort befand sich auch die Kasse mit aufgezogener Schublade. Außer einigen Papieren war kein Euro, nicht einmal ein einziger Cent verblieben. Verena starrte in die leere Kasse. Gab es eine Steigerung für leer? Die Wände waren leer, die Kasse war leer, und sie selbst fühlte sich ähnlich. Glücklicherweise hatte sie wie üblich vor dem Gehen die Scheine eingesteckt, das tat sie immer, bevor sie den Laden abschloss.
»Wollen Sie Ihrer Frau nicht endlich mal ein Glas Wasser holen?«, pfiff der Polizist Philipp an. »Gehen Sie schon. Nicht, dass sie uns noch umfällt. Nun setzen Sie sich endlich, Frau Baederle!« Schleichmeier schob sie in Richtung Stuhl, während Philipp sich auf die Suche nach einer Flasche Selters machte.
»Was ist mit Spuren der Einbrecher? Haben Sie irgendetwas gefunden, das uns weiterhilft?« Philipps Frage, als er Verena das Glas überreichte, klang in ihren Ohren ungewollt scharf. Doch sie sah ihm an, dass es ihn ärgerte, dass Schleichmeiers Kollegen tatenlos herumstanden, sich mit Bekannten unterhielten, vielleicht sogar den Fall kommentierten, statt Ermittlungen aufzunehmen.
»Die Spurensicherung weiß Bescheid!« Schleichmeier blickte herablassend an Philipp herunter und wandte sich dann an Verena: »Wer wusste von den Bildern, Frau Baederle?«
Sie hielt die Frage für blödsinnig, eine Vernissage war eine öffentliche Veranstaltung. Es gab Einladungen, und wer sonst noch zufällig die Galerie betreten hatte, war nicht abgewiesen worden. »Es stand in der Zeitung, also wussten es viele.«
»Wie viele Besucher hatten Sie gestern hier? Wie viele Hände haben die Türklinken angefasst? Wo, bitte, soll man an einem quasi öffentlichen Ort nach Spuren suchen?« Sein Achselzucken und sein abfälliger Blick zeigten deutlich, dass er die Idee der Spurensuche für Schwachsinn hielt.
Verena drückte ihm die Gästeliste in die Hand, dann wandte sie sich an Philipp: »Was überlegst du? Ich seh doch, dass dir etwas aufgefallen ist.«
Philipp ließ sich nicht lange bitten und wies den Schlaumeier darauf hin, dass auch die Anordnung der wenigen Gegenstände in den Räumen Rückschlüsse auf das nächtliche Geschehen ermöglichte. »Neben der Spüle in der winzigen Teeküche stehen die geleerten Flaschen, darunter eine unseres fünf Jahre alten Rieslings. Den haben wir nicht ausgeschenkt. Den muss jemand aus dem Klimaschrank genommen haben, jemand, der etwas davon versteht, der weiß, dass Rieslinge mit gutem Potenzial mit dem Alter reifen und komplexere Geschmacksbilder entwickeln. Wir haben den Gästen nur den Jahrgang aus dem vorletzten Jahr eingeschenkt, von dem waren noch einige Flaschen übrig.« Philipp hielt dem Polizeiobermeister eine Flasche hin. »Nehmen Sie die Fingerabdrücke von genau dieser Flasche. Tun Sie’s einfach! Meine sind sowieso dran, ich habe die Flasche eingeräumt. Möglicherweise ist es eine Spur, vielleicht auch nicht …«
Der Polizist schien längst nicht überzeugt, aber inzwischen standen so viele Zuhörer um ihn herum, dass er sich wohl nicht dem Vorwurf aussetzen wollte, untätig zu sein, und er ließ die Flasche von einem Untergebenen eintüten.
»War die … Künstlerin sehr bekannt, vielleicht sogar berühmt?«, fragte er dann.
»Ich wollte ihr dabei helfen, es zu werden.« Verena erinnerte sich daran, wie häufig Hélène sie nach ihren Pressekontakten gefragt hatte, insistiert hatte sie geradezu. Die Artikel in den beiden regionalen Zeitungen schienen ihr fast wichtiger als ihre Bilder. »Wenn du nicht in den Medien bist, gibt es dich gar nicht«, pflegte sie zu sagen.
»Was will sie eigentlich?«, hatte Verenas Stiefsohn Thomas gefragt. »Will sie Geld verdienen, berühmt werden oder Bilder malen? Was will sie?«
Obwohl Verena bereits auf dem Weg hierher Hélène auf den Anrufbeantworter gesprochen hatte, ohne das Ausmaß der Katastrophe zu kennen – sie hatte lediglich von einem Einbruch gesprochen –, war die Malerin noch nicht erschienen. Hätte Verena gewusst, was sie erwartete, hätte sie kaum den Anruf gewagt, schon allein, um sich nicht Schleichmeiers Vorwurf der Fahrlässigkeit auszusetzen.
»Wir haben nach zwölf gemeinsam die Galerie verlassen, also Hélène, ihr … äh … Begleiter, mein Mann und Manuel und ich natürlich.«
»Wer bitte ist Manuel? Ihr Sohn?«, fragte Schleichmeier.
»Nein. Manuel Stern ist Teilhaber des Weingutes, es heißt schließlich Achenbach & Stern. Mein Stiefsohn Thomas Achenbach ist in Frankreich und kommt heute Abend zurück.« Die Fragen des Polizisten regten sie auf, also fuhr sie schnell fort: »Wir alle waren nach dem stundenlangen Herumstehen todmüde. Ich habe zuletzt alle Türen kontrolliert, das mache ich immer.«
Sie war heilfroh gewesen, endlich nach Hause gehen zu können, nach den sich ewig wiederholenden Gesprächen über das Verständnis von Kunst, über Dilettantismus und Stil. Dann waren da Hélènes Malschülerinnen, gut situierte und meist gelangweilte Hausfrauen, nicht zu vergessen die Rentnerinnen, denen mehr an Selbsterkenntnis lag als an der Entwicklung ihrer Fähigkeiten. Und da waren noch die Kunstbeflissenen gewesen, die kein Ende hatten finden können. Und dabei hatte sie immer lächeln, sich alles anhören müssen, immer auch mit dem Gedanken ans Geschäft.
»Ich bin mit vierzig Prozent an den Verkäufen beteiligt. Somit bin auch ich geschädigt.«
»Es ist anzunehmen, dass Sie versichert sind, Frau Baederle?«
»So ist es.« Sie war es endgültig leid, ausgefragt zu werden, und wandte sich ab. Sie schaute in die Ecke, wo Philipp die Weinkisten gestapelt hatte. Im Gegensatz zu anderen Galerien, wo Kosten gedrückt und billige Weine ausgeschenkt wurden, nutzte er die Gelegenheit, Kunden und Gäste von seinen Weinen zu überzeugen. Die leeren Kisten ließen darauf schließen, dass fast alle Rieslinge und Grauburgunder verkauft worden waren. Oder hatten die Diebe den Rest mitgenommen? Sie schaute in den Kühlschrank, ergriff eine angebrochene Flasche Weißburgunder und schenkte sich ein Glas ein. So früh etwas zu trinken, war sie nicht gewohnt, und sofort fühlte sie sich beschwipst. Was für ein angenehmes Gefühl, auf diese Weise auf Distanz zu gehen.
Philipps Winzerkollegen waren die angenehmsten Gäste gewesen. Sie gaben ehrlich zu, von Malerei nicht das Geringste zu verstehen, ein Bild sprach sie an, ein anderes gefiel ihnen eben nicht, und bei den Aquarellen der Weinberge und Rebgärten im Abendrot, in flimmernder Hitze und im Morgennebel drehten sich die Gespräche darum, um welche Lage es sich womöglich handelte und wo die Staffelei gestanden haben mochte. Und man stritt ohne Ernst, ob es dieser Weinberg verdient habe, auf diese Weise dargestellt zu werden, denn der Winzer habe … Und schon waren die Weinmacher wieder bei ihrem Lieblingsthema angekommen: dem Wein.
Gegen elf Uhr erschien Renate Körner, die angeboten hatte, sie in ihrer Abwesenheit zu vertreten. Philipp war längst zum Weingut zurückgefahren, um Manuel bei der Tagesarbeit zu unterstützen. Außerdem wollte er nach Efe und den Schafen schauen. Mit dem Experiment hatten sie im letzten Jahr begonnen. Verena hatte zufällig davon gehört und das Weingut Jean Buscher in Hessen besucht, wo man damit Erfahrung hatte. Sie hatte es rasch zu ihrer Sache gemacht und dadurch auf dem »Weingut der drei Männer«, wie sie es nannte, an Gewicht gewonnen und auf diese Weise vieles über die Pflege der Weinstöcke und die Wiederaufarbeitung von Böden gelernt.
»Was für eine Katastrophe!« Empörung sprach aus der Stimme von Renate Körner, mit gerecktem Hals die leeren Wände betrachtend, als wäre Verena für das Verschwinden der Bilder verantwortlich. »Gestern waren sie noch hier! Wer kommt auf eine derart schwachsinnige Idee, sämtliche Bilder zu stehlen? Und nicht eines ist geblieben? Die tollsten waren sie ja nun nicht gerade.«
Ein Bedauern über das Vorgefallene konnte Verena den Kommentaren nicht entnehmen. Was zählte, war die Sensation. Sie nahm das Gesagte mit einem gequälten Lächeln hin. Die Körner, wie sie in Hélènes Malkurs genannt wurde, hielt ihre eigenen Werke sowieso für die besten und gab bei jeder Gelegenheit damit an, welche Kunstausstellungen sie besucht habe, sei es in Frankfurt, in Karlsruhe, Basel und sogar in Berlin. Sie hätte eher mit der Geldsumme angeben können, die sie für Farben, Leinwand und Pinsel ausgab.
Obwohl Verena die Körner recht gut durchschaute, war sie ihr dankbar, dass »die liebe Renate« sich angeboten hatte, die Galerie während der Reise entlang des Pfälzer Waldes für die Nachmittagsstunden offen zu halten. Das Geschäft mit dem lokalen Kunstgewerbe musste weitergehen. Und morgen würden sich nach den Artikeln in den Lokalzeitungen hier die Neugierigen auf die Füße treten.
»Unter diesen Umständen kann ich dir leider nicht mehr helfen, meine liebe Verena, das musst du verstehen, so leid es mir tut«, trompetete die Körner für alle hörbar. »Aber mich mit der Polizei und womöglich mit Räubern herumzuärgern und irgendwelchen Besuchern erklären zu müssen, was hier vorgefallen ist, meine Liebe, wobei ich das selbst noch gar nicht begreife – das geht zu weit. Dazu fehlen mir die Nerven. Nein, das kann ich nicht, nicht unter diesen Umständen.« Sie wandte sich zum Gehen, machte einige Schritte in Richtung des Hinterausgangs, wo Schleichmeier Nachbarn befragte, und kam zurück, sich gänzlich der Bedeutung ihrer Wichtigkeit bewusst.
Verena starrte ihr entgegen, mit sich hadernd, ob sie enttäuscht, wütend oder erleichtert sein sollte. Um eine Erkenntnis jedenfalls war sie reicher, dass in der Krise nur auf wenige Verlass war. Das jedoch nutzte ihr jetzt gar nichts.
»Ich bin sicher, du findest einen Ersatz«, sagte die Körner mit erhobenen Augenbrauen, »bei euren vielen Beziehungen hier im Ort und bei den Leuten, die ihr kennt – und so beliebt, wie du überall bist.«
Letzteres war ein Gefühl, das Verena völlig fremd war. In einer Mischung von Erstaunen und Erschrecken nahm sie wahr, dass die Körner näher trat, sie auf beide Wangen küsste, sich umwandte und die Galerie verließ.
Was nun?, überlegte Verena, während sie der Frau nachblickte oder vielmehr in den luftleeren Raum starrte, den sie hinterließ. Pech haben, bestohlen werden, der Blamage bei ihrer ersten Ausstellung ausgesetzt sein und schließlich versetzt werden – das war zu viel. Sie setzte sich wieder auf den Stuhl hinter der leeren Kasse. Nein, die Reise mit Philipp, auf die sie sich seit Wochen freute, würde sie nicht aufgeben. Sollte sie die Galerie zumachen, ein Schild ins Fenster hängen, »Wegen Diebstahls geschlossen«, und sich um nichts weiter kümmern? Aber es handelte sich nicht um ihre Bilder, es waren Hélènes Werke.
Wieder erschienen Nachbarn, stellten Fragen, auf die Verena keine Antwort wusste, verlangten nach Erklärungen, die sie nicht geben konnte, Mutmaßungen wurden geäußert, Theorien aufgestellt und auch ehrliches Bedauern ausgedrückt. Unter den Bekannten waren zwangsläufig auch die Bewohner der beiden oberen Etagen dieses Hauses. Leonie war eine von ihnen, die Tochter des Hausbesitzers, eine ziemlich attraktive junge Frau.
Sie hatte sich bisher im Hintergrund gehalten, still zugehört, nur ihrem aufgeschlossenen und neugierigen Blick war Verena gestern einige Male begegnet, und mit Manuel hatte Leonie sich angeregt unterhalten. Jetzt erst wurde Verena bewusst, mit welcher Selbstverständlichkeit sich Leonie hier bewegt hatte. Sie war nah an die Bilder herangetreten, hatte genau hingesehen und hatte sich wieder zwei Schritte entfernt, als prüfte sie die Wirkung auf sich – geradezu fachmännisch. Ob ihr die Bilder gefallen hatten, war ihr nicht anzumerken gewesen.
Jetzt wirkte sie anders, so als nähme sie Anteil am Ereignis, als wäre sie unschlüssig, kehrte von den geradezu aggressiv leeren Wänden zum Angebot an Kunstgewerbe zurück, nahm die verschiedenen Objekte in Augenschein, fasste sie an und prüfte. Aber was? Sie musste sich schon länger in der Galerie aufgehalten haben, so lange, dass Verena, in immer gleiche Gespräche vertieft, immer dieselbe Geschichte erzählend, sie letztlich gar nicht mehr bemerkt hatte. Sie hätte auch nicht sagen können, ob Leonie den Auftritt der Körner aus der Nähe miterlebt hatte, was jedoch im nächsten Moment klar wurde.
»Ich hätte Zeit, Frau Baederle, ich könnte mich um Ihre Galerie kümmern«, sagte sie in einen Moment der Stille hinein. »Ich hätte Lust dazu. Ich habe noch Resturlaub, den muss ich nehmen, sonst verfällt er. Ich stelle mir das hier recht interessant vor. Kunst und Wein haben mich schon immer interessiert.«
Verwundert hörte Verena diese Worte. Der erste Lichtblick? Sie wusste, dass Leonie bei einer Consulting-Firma arbeitete, die biotechnische Unternehmen beriet. Was genau sie dort machte, danach hatte Verena nie gefragt, aber Leonie arbeitete sicher nicht in der Registratur.
»Mir würde es Spaß machen, es wäre eine schöne Abwechslung bei all dem technischen Kram, mit dem ich mich sonst herumschlage. Und Ihnen wäre geholfen. Lassen Sie mich machen, ich arbeite auch auf Provisionsbasis, und mit der Polizei …«, sie rümpfte die Nase in Richtung Schleichmeier, »mit so einem werde ich fertig.« Sie grinste frech. »Die Diebe werden kaum wiederkommen, jetzt, wo nichts mehr zu holen ist. Oh, Entschuldigung, das war nicht besonders mitfühlend …«
»Schon gut«, antwortete Verena, noch verwirrt von dem plötzlichen Angebot, das sie mit einem Schlag ihrer Sorgen entledigen würde und die Reise rettete, und ohne viel nachzudenken, willigte sie lächelnd ein. Sie mochte die junge Frau. Ein Teenager war sie gewesen, als sie den Laden eröffnet hatte, fast noch ein Kind.
Schnell war man sich einig, praktische Fragen holten Verena aus der Leere, und sie sah wieder Bilder an den Wänden.
Alles war besprochen, am Nachmittag würde sie mit Leonie den Kampf gegen die Leere aufnehmen. Sie war gerade dabei, Ware aus dem Keller zu holen, als die Künstlerin aufkreuzte, mit prallen Segeln bei Windstärke neun bis zehn, mit Begleiter im Schlepptau und eine Monsterwelle voller Vorwürfe vor sich herschiebend. So zog man die Aufmerksamkeit aller auf sich: Seht her, hier ist die leidende Künstlerin, Hélène Haller, die sich aufgeopfert hat und der von frevelnder Hand ihr Werk geraubt wurde.
Drohend baute sie sich vor Verena auf: »Was ist hier passiert?« Sie blickte die weißen Wände an, drehte sich einmal um sich selbst, alle Blicke auf sich gerichtet wissend, schritt in den Flur, der in seiner strahlenden Kahlheit nur trostlos wirkte, breitete mit weit aufgerissenen Augen fragend die Hände aus und betrachtete sogar den glänzenden Dielenboden vorwurfsvoll, als hätten auch hier ihre Bilder gelegen. Dann wandte sie sich abrupt Verena zu, die ihr zerknirscht und mit schlechtem Gewissen gefolgt war.
»Was soll das?«, fragte sie theatralisch von oben herab, sich des Mitleids aller bewusst. »Was ist mit meinen Werken geschehen? Du hast sie doch nicht etwa abgehängt?« Eine lächerliche Vermutung, doch mit Feindschaft in der Stimme. Leise und auf das Folgende gespannt, hatten sich die Anwesenden in diskretem Abstand um sie geschart. Lediglich einer der Polizisten war noch zugegen, der die Szene verständnislos betrachtete. Schleichmeier hatte sich davongeschlichen.
Hätten Rembrandt, Franz Marc oder Chagall die Frage nach dem Verbleib ihrer Werke gestellt, Verena hätte durchaus Verständnis dafür gehabt, aber die Bilder von Waltraud – denn letztlich war sie Waltraud und nicht Hélène – als »Werke« zu bezeichnen, schien doch ein wenig gewagt. Sie merkte, wie in ihr Widerwille aufstieg. Sie erinnerte sich zu gut, wie Waltraud darum gebettelt hatte, unter ihrem Künstlernamen in ihrer Galerie ausstellen zu dürfen. »Ich werde dir immer dankbar sein«, hatte sie noch gestern Abend in ihrer Eröffnungsrede geflötet. Allem Anschein nach war sie die Einzige in Bad Dürkheim, die sich dazu bereit erklärt und sich die Arbeit mit Werbung, dem Druck von Prospekten und den Einladungen gemacht hatte. Zuletzt war alles auf Waltrauds Wunsch hin versichert worden. Darum hatte Philipp sich gekümmert.
»Mein Werk! Mein Werk der letzten Jahre – alles weg? Verloren! Alles verschwunden? Spurlos? Was sagt die Polizei?«
»Nichts«, antwortete Verena, viel zu kleinlaut für ihr eigenes Empfinden. »Noch nichts«, schob sie etwas energischer nach.
»Welches verbrecherische Gehirn denkt sich eine solche Untat aus, so eine Schweinerei? Wie stehe ich jetzt da?« Mit diesen Worten sah Waltraud sich um, bei den Umstehenden um Mitleid heischend, doch Verena nahm Befremden und Irritation wahr, das Lamento schien nicht gut anzukommen.
In einer Gebärde des Leidens breitete die Künstlerin ihre Arme aus, im Versuch, die Dramatik des Auftritts weiter zu steigern. »Und du, Verena, du hast das alles nicht gesichert? Wie stümperhaft. Ich hätte mir eine andere Galerie suchen sollen. Habt ihr etwa die Türen offen gelassen? Wer ist zuletzt gegangen? Etwa Manuel? Der schien mir ziemlich angetrunken gewesen zu sein …«
»Du kennst hier alles, jeden Raum, wir haben alles begutachtet«, warf Verena ein, »alles war besprochen, du warst damit einverstanden, wir sind übrigens zusammen gegangen.«
»Wer, wenn nicht du als Galeristin, hat für die Sicherheit zu sorgen?«, unterbrach die Malerin. »Wenn ich diese Tür schon sehe«, sie war mittlerweile zu der aufgehebelten Tür stolziert, immer weniger Publikum im Schlepptau, das von dem Auftritt peinlich berührt schien. »Es muss ein Kinderspiel gewesen sein, hier einzubrechen. Die brauchten nicht einmal Licht zu machen, von der Straße fällt genug Licht von der Laterne durchs Schaufenster. Kannst du dir nicht denken, wie verzweifelt ich bin?« Sie schluchzte laut auf. »Alles weg, alles …« Sie schlug die Hände vors Gesicht, aber nur so weit, dass ihr Make-up nicht verschmiert und ihr kunstvoll hochgestecktes Haar in Unordnung geriet. Und immer ging ein Blick in die Runde, sich der Aufmerksamkeit der Neugierigen versichernd. Ihr Begleiter hatte noch nicht ein Wort gesagt, er nickte lediglich nach jedem Satz.
»Hast du eigentlich die Presse informiert?«, fragte Waltraud mit hochgezogenen Brauen, dann wandte sie sich ab und steuerte auf die Toilette zu.
Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, breitete sich betretenes Schweigen aus. Beinahe schuldbewusst, als wären sie alle für das Drama verantwortlich, blickten sich die Anwesenden an. Das Ereignis hatte sich blitzschnell in der Nachbarschaft herumgesprochen, und da in Bad Dürkheim montags nicht allzu viel Sensationelles geschah, brachte der Einbruch in die Galerie manche dazu, mal eben rasch die Wohnung oder das Geschäft zu verlassen, um an der Aufregung teilzuhaben.
Gerade in dem Moment, als der Reporter der Rheinpfalz mit Mikrofon und Kamera auftauchte, trat HH melodramatisch aus dem Toilettenraum, mit perfektem Make-up, wohl wissend, wie frau sich in Szene setzt. Alle Spuren der Tränen – wenn es denn überhaupt echte gegeben hatte – waren beseitigt, doch in eigenartiger Weise unterstrich das neue Augen-Make-up sowohl Trauer wie Verzweiflung der um ihr Werk und den Ruhm betrogenen Malerin. Die Schatten um die Augen waren stärker, sie schienen tiefer in den Höhlen zu liegen, was den Ausdruck des Leidens verstärkte.
Sich bemalen kann sie, dachte Verena, alle Achtung, vielleicht wäre sie besser Visagistin geworden. Aber das waren Gedanken, wie sie nur Philipps Sohn Thomas laut zu äußern wagen würde. Und Ruhm? Im Grunde ihres Herzens hatte Verena Waltrauds Bitten um die Räume nicht nur aus Mitleid nachgegeben. Auch sie wünschte sich für ihren Laden Publizität, sie hoffte, sich damit einen Namen zu machen, und sie fürchtete, dass auch etwas Eitelkeit mit im Spiel war. Zu ihrem Ärger musste sie sich jedoch anhören, wie Hélène Haller gegenüber dem Journalisten ihre Vorwürfe wiederholte, als wäre Verena die Schuldige und nicht die Einbrecher. Sie forderte den Journalisten lautstark auf, mit einem Aufruf alle Besucher der gestrigen Vernissage zu bewegen, ihre Handyfotos der Polizei und ihr zur Verfügung zu stellen, denn ganz gewiss hätten sich die Diebe unter die Gäste gemischt, um die Lage auszukundschaften.
»Spießerkram«, hatte Thomas in seiner von Verena als impertinent empfundenen Art Hélènes Bilder genannt. Er war am Freitag vor seinem Aufbruch nach Bordeaux kurz mit Manuel in der Galerie vorbeigekommen, um das Hängen der Bilder zu sehen. »Das ist was für Kaffeefahrten, aber keine Kunst, damit verdirbt man sich höchstens den Ruf«, hatte er Manuel zugeflüstert.
»Und du weißt ganz genau, was Kunst ist!?« Verena hatte jedes Wort verstanden.
»Sie nutzt dich aus«, hatte er gesagt, »du bist zu gutmütig.« Charmant war er nicht, ihr Stiefsohn, wie immer in seinem Urteil selbstherrlich und radikal. Beim Wein mochte es seine Berechtigung haben, da verzieh er sich nicht den kleinsten Fehler und gab sich die größte Mühe. Doch mit Menschen ging er hart ins Gericht, da war er unnachsichtig, nahezu gnadenlos. Es ärgerte Verena, dass Philipp ihn nicht bremste und seine Positionen sogar unterstützte. Wenn Vater und Sohn gemeinsam agierten, stand sie einer unüberwindbaren Phalanx gegenüber, mit Manuel als Schlichter.
Aber in letzter Zeit hatte sich etwas an Thomas’ Verhalten geändert. Wenn er nach einem Wochenende mit Simone Latroye aus Saint-Émilion zurückkehrte, schien er wie ausgewechselt. Ähnlich war es, wenn Simone einmal im Monat den Besuch erwiderte. Die Tochter des vor vielen Jahren ermordeten Winzers übte einen wunderbaren Einfluss auf Thomas aus, sie mäßigte allein durch ihre Anwesenheit sein aufbrausendes Temperament, sie schaffte es, zu ihm durchzudringen und eine Seite in ihm zu wecken, die bis auf Manuel und seinem Vater allen verborgen blieb. Und nicht nur ihr gegenüber schien er dann zugänglicher zu sein.
Inzwischen hatte auch der Lokalberichterstatter vom Wochenblatt ein Interview beendet und verließ die Galerie. Jetzt spielte Hélène Haller einer freien Journalistin, die sich als Beatrix von Weiden vorgestellt hatte, das trauernde Opfer vor. Sie schien zusehends in diese Rolle hineinzuwachsen und sich darin immer mehr zu gefallen.
Die Journalistin wirkte überaus interessiert und zugewandt, die elegante und sehr gepflegt wirkende Mittdreißigerin im knallroten Sommerkleid bildete einen positiven Kontrast zur Malerin, der sie ein winziges Aufnahmegerät entgegenhielt, das sie ihrer elend teuren Handtasche mit dem zum A stilisierten Hufeisen entnommen hatte.
Frau von Weiden war für die Allgemeine Zeitung tätig, außerdem, sagte sie, habe sie Zugang zum Mannheimer Morgen, einem besonders wichtigen Meinungsbildner, und selbstverständlich zur Rheinpfalz. Le Républicain Lorrain sei ihr Hausblatt in Frankreich. Für eines dieser Blätter fest zu arbeiten, würde sie zu sehr in ihrer journalistischen Freiheit einschränken, wie sie vertraulich äußerte, außerdem seien die Zeiten vorbei, sich in ihren Ansichten von irgendwelchen Chefredakteuren oder Ressortleitern bremsen und zurechtweisen zu lassen, die in vorauseilendem Gehorsam den Anzeigenkunden gegenüber wichtige Artikel zensierten oder gar nicht ins Blatt ließen.
Bei diesen Ausführungen scharten sich wieder Besucher um die Künstlerin, die Galeristin und die Journalistin. Letztere könne sicher helfen, den Fall zu klären und die Bilder wiederzufinden, auf derartig spannende Geschichten sprächen »ihre Redaktionen« gewiss an, betonte sie. Als besonders reizvoll empfand sie die Verbindung der Galeristin zum Weinbau und bedauerte, bei der Vernissage nicht anwesend gewesen zu sein.
Bei so viel Publikum wiederholte Hélène Haller ihre Vorwürfe gern, sprach von verspieltem Vertrauen, während Verena sich leise entfernte. Sie bekam nur Bruchstücke des Interviews mit, aber es sei klar, so die Malerin, dass Verena Baederle für den Einbruch mitverantwortlich sei. »Sie hat eben nicht für die gebotene Sicherheit gesorgt!« Dass Hélène Haller sich gestern noch mit allem einverstanden erklärt hatte, blieb unerwähnt, auch dass alles mit der Versicherung besprochen und fotografiert worden war.
Vor aller Augen hier darüber einen Streit auszutragen, war Verena zu dumm. Außerdem betrat gerade in diesem Augenblick der Gutachter der Versicherung die Galerie. Jetzt wurde es heikel …
2. KapitelDorade mit Steinpilzen
Am späten Nachmittag parkte Verena ihren Wagen auf dem Hof des Weingutes und schlug die Wagentür deutlich heftiger zu als gewöhnlich. Sie war von den Gesprächen in der Galerie total verärgert und überaus reizbar. Von den immer gleichen Fragen hatte sie lediglich zwei beantworten können: dass nämlich nicht ein Bild zurückgelassen worden war und dass sie keine Vorstellung der möglichen Täter hatte. Dementsprechend miserabel war ihre Laune. Außerdem war es entsetzlich heiß geworden, sie fiel vor Müdigkeit fast um und hatte lediglich zwei belegte Brötchen gegessen, die ihr Leonie zusammen mit einem Eistee gebracht hatte.
Leonie war sowieso der einzige Lichtblick des Tages. Bei dem Gespräch mit dem Versicherungsmenschen war sie dabeigeblieben und hatte beruhigend auf Verena eingewirkt. Anschließend hatte sie mit der jungen Frau anstehende Aufgaben besprochen und ihr einen Überblick über das Angebot an Kunsthandwerk gegeben, das Stoff- und Holzarbeiten, Keramiken, die Vasen aus Murano-Glas, Schnitzereien, kleine Plastiken und die Ton- und Metallarbeiten lokaler Künstler umfasste.
Die Weine des Gutes Achenbach & Stern, die in der Galerie zum Verkauf standen, ließen sich einfach erklären, denn zu jedem gab es eine kurze und eine ausführliche Beschreibung. Nächstes Frühjahr würde sie das Angebot noch ausweiten können, denn dann käme die ausschließlich von Manuel kreierte neue Stern-Serie vom Libellenberg dazu: Pinot blanc, Pinot gris und Pinot noir – Weiß-, Grau- und Spätburgunder. War es Spielerei oder ein ernsthafter Versuch? Das würde sich zeigen. Verena wusste lediglich, dass es Manuels Wunsch war, diese drei Weine ausschließlich nach seinen Vorstellungen zu entwickeln (natürlich unter Thomas’ und Philipps Mithilfe). Man musste Geschmack haben, um es zu erkennen, und den hatte Manuel. Er hatte sich viel vorgenommen.
Philipp hatte, vom deutlichen Zuschlagen der Autotür alarmiert, eilig die Gäste verlassen, war die Freitreppe heruntergekommen und empfing Verena im Hof. Er sah ihr den Stress an, und sie ließ sich aufatmend in seine Arme fallen.
»Gut, dass du da bist«, sagte er nach einer Weile, »es passt dir wahrscheinlich überhaupt nicht, übrigens mir auch nicht«, warf er versöhnlich ein, »wir haben bei all der Aufregung vergessen, dass wir Besuch bekommen.« Philipp wies auf den silbernen Wagen, neben dem Verena ihren kleinen blauen Fiat geparkt hatte. »Sie sind gerade eingetroffen.«
»Deine neuen Düsseldorfer Kunden?«
Normalerweise sprach sie von »wir«, doch entsprechend ihrer Laune schwenkte sie um, dann war es entweder »dein« oder »euer« Weingut. Philipp registrierte das besitzanzeigende Fürwort, ein Indiz für ihre Laune, doch er ignorierte es. »Richtig, unsere Kunden. Sturm heißen sie, Francesca und Arnold. Die beiden haben, wie sie sagte, vor drei Jahren das italienische Restaurant ihrer Eltern übernommen und sind irgendwie auf unsere Weine gekommen …«
»Wahrscheinlich so ein Edelschuppen für die Düsseldorfer Schickeria.«
Philipp überging den Einwand. »Sie war Wirtschaftsprüferin, er hat inzwischen seine Tätigkeit als Anwalt aufgegeben. Es sind sehr angenehme Leute. Sie haben Geschmack und Stil, deshalb soll’s mir recht sein. Und sie kaufen und verkaufen unseren Wein.«
Philipp hatte die Gäste ins Kaminzimmer begleitet, es war im Sommer der kühlste Raum, und ihnen sozusagen als Beruhigung ihren besten Riesling sowie den Weißburgunder vom vorvorigen Jahr eingeschenkt. »Sie bleiben zum Essen, Verena, ich habe sie eingeladen. Das schafft eine gute Basis für die Verkostung. Sie wollen auch unsere anderen Weine probieren. Und essen müssen wir sowieso, Manuel ist in der Küche. Beim Essen wird sich deine Laune hoffentlich bessern.«
»Und wie ist es mit deiner?«, fragte sie scharf. Sie schien sich zu ärgern, dass Philipp nicht genauso empört wie sie auf das Ereignis der vergangenen Nacht reagierte. »Thomas ist noch immer nicht zurück?« Es war ihm wohl anzusehen, wie nervös es ihn machte, wenn er seinen Sohn auf der Autobahn wusste. Die tausend Kilometer bewältigten er und Simone jeweils an einem Tag.
»Er braucht diesmal ziemlich lange. Und wir? Wann fahren wir endlich?« Sie fragte es in halb traurigem, halb vorwurfsvollem Ton. Philipp verstand, dass der Tag grauenhaft für sie war, einer, den man am liebsten aus seinem Leben streichen wollte.
»Bei dem Chaos in der Galerie und dem hysterischen Theater, das Waltraud veranstaltet hat – ihren Auftritt hast du ja verpasst –, dann dieser Polizist – am Nachmittag war er wieder da –, kommen wir niemals weg. War das Hotel in Bad Bergzabern nicht bereits für heute gebucht?«
»Ich hab’s vorsichtshalber storniert«, antwortete Philipp. »Du wirst den morgigen Tag sowieso zum Einarbeiten deiner neuen Mitarbeiterin brauchen. Wie schön, dass Leonie das übernimmt! Wir haben mordsmäßig Glück gehabt, vielmehr du, so schnell Ersatz zu bekommen. Wie ist sie? Aber meinst du, es ist klug, dass uns die Tochter deines Vermieters in die Karten guckt?«
»Ich habe nichts zu verheimlichen.«
»Kann die das? Was hat sie bisher gemacht?«
»Leonie macht einen guten Eindruck. Sie hat eine rasche Auffassungsgabe. In ihrem momentanen Job scheint sie nicht ausgelastet zu sein, sie ist mit der Entwicklung neuer Pflanzensorten befasst, aber ihr Chef lässt sie nicht hochkommen, wie sie meinte. Sie ist auf der Suche nach einem besseren Job.«
»Biotechnik kann sehr spannend sein, besonders was Hitzeresistenz und die Empfindlichkeit von Trockenheit angeht. Vielleicht sollten wir sie mit Johanna zusammenbringen, sie könnte testen, was deine neue Kraft draufhat.«
»Musst du dich sofort wieder einmischen? Das sind nicht meine Themen, mein Lieber. Leonie soll mich in meinem Laden vertreten und nicht auf eurem Weingut arbeiten. Bring sie mit wem auch immer zusammen, wenn wir zurück sind und ich mich von der Katastrophe erholt habe. Ich wollte mir eigentlich in Ruhe die Schlösser und Burgen ansehen, das Schloss von Bergzabern, dann die Burg Landeck und Spangenberg, in die Geschichte eintauchen und natürlich in die Dramen. In deine kalten Weinkeller geh bitte ohne mich. Volle Holzfässer und blubbernde Gärröhrchen kann ich hier jeden Tag sehen, pneumatische Weinpressen und Abbeermaschinen, Filter, was weiß ich …«
Philipp wusste nicht, was er darauf antworten sollte. Er hoffte, dass Verenas Abneigung gegen seinen Beruf mit den heutigen dramatischen Ereignissen zu tun hatte. Oder lag es daran, dass sich hier alles fast nur um den Wein drehte? Ihre gemeinsame Freundin Johanna Breitenbach, Umweltingenieurin und Dozentin an der Hochschule Geisenheim, war seit dem Kauf des Weingutes mindestens einmal im Monat bei ihnen, hatte an der Hochschule Thomas und Manuel unterrichtet und immer wieder vergeblich versucht, Verena für den Weinbau zu begeistern. Johanna war nicht nur beim Auf- und Umbau ihres Weingutes hilfreich gewesen, sie gab wesentliche Anregungen hinsichtlich eines ökologischen und tatsächlich nachhaltigen Weinbaus – nachhaltig in dem Sinne, dass man dem Boden das zurückgab, was man ihm entnahm, und die Weinlandschaft rekultivierte. Philipp ärgerte sich, dass jedermann über Nachhaltigkeit quatschte, dabei kannte kaum jemand die richtige Bedeutung des Wortes. Begriffe wie »auf Dauer«, »auf lange Sicht« oder »langfristig« waren aus der Mode gekommen. Alles musste »nachhaltig« sein. So ein Quatsch.
In Geisenheim saß Johanna direkt an der Quelle des theoretischen Weinwissens, der wissenschaftlichen Versuche und des internationalen Austauschs. So hatte sie ihn, aber auch Manuel und Thomas nach ihrem Studium stets auf den neuesten Stand der önologischen Theorie gebracht, was die beiden sofort in der Praxis ausprobierten. Über zehn Jahre war so eine enge Freundschaft entstanden und Johanna ein häufiger Gast. Sie hatten ihr unter dem Dach ein Gästezimmer eingerichtet, wo sie die Wochenenden verbrachte, wenn sie nicht zu ihrem Mann Carl nach Stuttgart fuhr oder er hierherkam. Auch ihn, einen Übersetzer, kannten sie gut, und so war eine enge Verbindung zwischen allen entstanden. Und wenn Manuel an Wochenenden eines seiner Klavierkonzerte gab, war Johanna sowieso hier, eine Tradition, der sie seit seinem grandiosen Auftritt beim Rheingaufestival im Kloster Eberbach folgte.
»Über Leonie und ihre Fähigkeiten kann ich mir selbst ein Urteil bilden«, antwortete Verena nach einer Weile. Sie war auf der Treppe stehen geblieben und betrachtete die Blumenkübel auf den Stufen.
Ihre Anspannung war überdeutlich, und Philipp hielt sich zurück. »Du scheinst ziemlich angegriffen zu sein, du solltest …«
»Was ich sollte, weiß ich ganz gut selbst. Ich kann es nicht leiden, wenn du mir sagst, was ich sollte!«
Es gab diese Tage mit besonders viel Stress, an denen Philipp besser den Mund hielt und tief durchatmete. Es war mit Verena nicht zu reden, allerdings auch kein Wunder nach dem nervenaufreibenden Tag. »Mit dem Versicherungsmenschen bist du übereingekommen?«
»Ja, bin ich, aber darüber später. Ich will duschen, mich umziehen, und du leistest besser deinen Gästen Gesellschaft!« Das klang kaum verbindlicher. Wieder nahm sie diese klare Trennung zwischen sich und den drei Männern vor. Aber schloss sie sich letztlich damit nicht selbst aus? Von den drei Männern tat das keiner – ihre Stimmung war demnach im tiefsten Gewölbe des Weingutes Achenbach & Stern angekommen, erbaut im Jahre 1778.
Dorthin führte Philipp »seine« Gäste zuerst. Zum einen gewannen sie so eine Vorstellung des Gutes und von Manuels Arbeit in Kälte und Halbdunkel, zum anderen machte er sich bei diesem Rundgang ein Bild vom Weinwissen seiner Besucher und erfuhr, wie stark das Interesse wirklich war, oder ob es ihnen nur darum ging, sich selbst darzustellen.