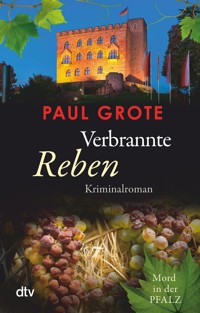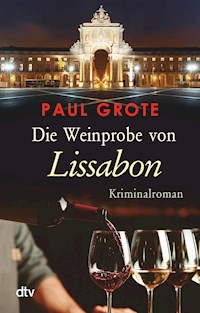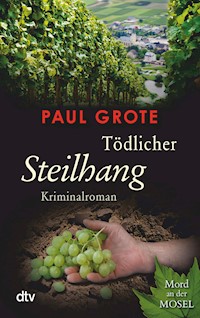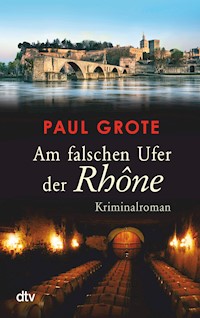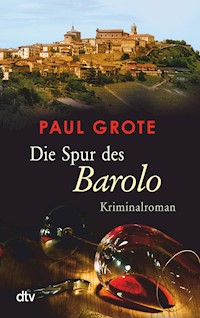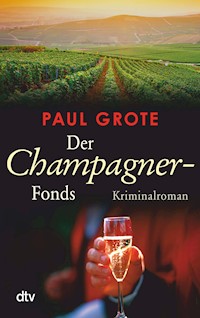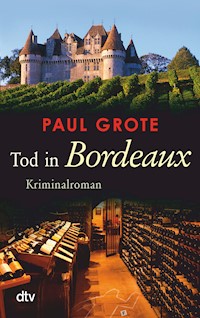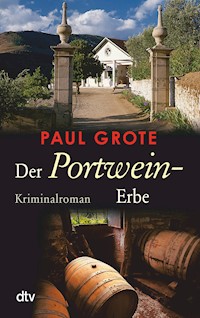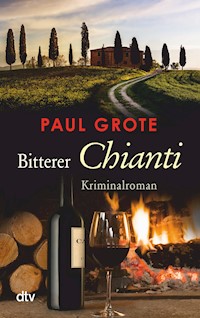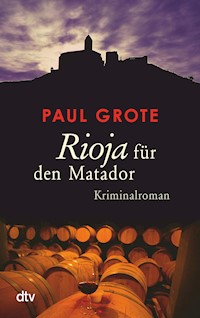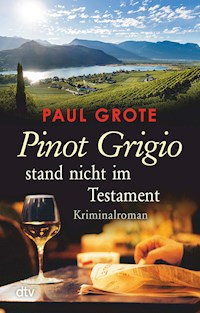
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Europäische-Weinkrimi-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der Mensch, der Wein und das Böse »Kommen Sie zu uns nach Südtirol!« Mit diesen Worten lädt Winzer Werner Kannegießer den Fotografen Frank Gatow auf sein Weingut ein. Doch als der Hamburger in Südtirol eintrifft, um Weinberge und modernste Kellereien zu fotografieren, ist der Winzer tot. Er soll beim Tauchen in der Karibik ertrunken sein. »Angeblich«, wie seine Tochter Theresa meint. Sie bezweifelt die Version vom Herzschlag unter Wasser. Aber dafür fehlt ihr jeglicher Beweis. Und für einen Mord in der Karibik sind die Bozener Carabinieri nicht zuständig. Erst auf Theresas Drängen hin stellt Gatow halbherzig Ermittlungen an. Schon bald stolpert er über zahlreiche Ungereimtheiten, und auf einmal scheint ihm der Mordverdacht gar nicht mehr so abwegig. Doch dann begeht er einen folgenschweren Fehler …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Paul Grote
Pinot Grigio
stand nicht im Testament
Kriminalroman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Om mani padme hum
Text der Gebetsmühle in Pavillon 8
auf Schloss Sigmundskron
Personen
Frank Gatow, Fotograf
Antonia Vanzetti, seine Ehefrau und Winzerin
Werner Kannegießer, Südtiroler Winzer
Loretta Leiterer, seine erste Ehefrau und Mutter von Anette und Barbara
Claudia, Kannegießers zweite Ehefrau
Anette Förster, älteste Tochter aus erster Ehe
Barbara, zweite Tochter aus erster Ehe
Theresa, Tochter aus zweiter Ehe, Önologin
Marco, Sohn aus zweiter Ehe, studiert Önologie und Weinbau
Ravelli, Barbaras Freund, Anwalt und Spekulant
Matteo, Fotograf, Gatows Freud und Wohnungsgeber
Marcella, Matteos Freundin, Food-Stylistin, sie sorgt für Frank
Carl Breitenbach, Übersetzer und Gastdozent
Henry Meyenbeeker, La Rioja, gibt wichtige Hinweise
Stefan Leiterer, Politiker
Oskar Bauer, Gutsverwalter
Dr. Passoni, Kannegießers Hausarzt
Dr. Cassignano, Tierarzt
Hella, Theresas Freundin, reitet in derselben Equipe
Tenente Gesso, ermittelnder Carabiniere
Ricardo, ein Haflinger Wallach
1. Kapitel
»Er ist beim Tauchen ertrunken – angeblich, wie es heißt. Aber ich glaube es nicht.«
Nach diesen Worten wandte Theresa Kannegießer ihren Kopf zur Seite und blickte in den langen dunklen Gang zwischen den Fässern. Auf der linken Seite standen die kleinen Barriques, sie waren in zwei Reihen übereinandergestapelt. Gegenüber standen die botte da vino, die wuchtigen Fässer, einige von ihnen mit geschnitztem Boden, teils sehr künstlerisch gestaltete Arbeiten, andere mehr grob, besondere Ereignisse der Geschichte des Weinguts markierend. Fast bedächtig ging die junge Önologin an der Reihe entlang, strich mit der Hand über die Fässer, den Kopf unter dem niedrigen Gewölbebogen gesenkt, das Gesicht noch immer abgewandt, als wolle sie vermeiden, dass der fremde Besucher in ihrer Mimik las.
»Angeblich ertrunken?« Frank Gatow war entgeistert stehen geblieben und betrachtete nachdenklich die schlanke Gestalt der jungen Frau mit dem offenen Gesicht, das die Kurzhaarfrisur besonders betonte. »Ist Ihnen klar, was Sie da gerade gesagt haben?« Seine Worte hallten dumpf in dem niedrigen Keller.
Die Önologin zog ihre verwaschene blaue Jacke fester um die Schultern, als sei ihr kalt, dabei musste sie die Kellertemperaturen gewohnt sein. Schließlich gehörten die Kontrolle der Fässer hier im Keller des Weinguts Johannishof und das ständige Probieren zu ihren wesentlichen Aufgaben, um die Entwicklung der reifenden Weine zu verfolgen und weitere Maßnahmen im richtigen Moment einzuleiten.
»Was meinen Sie damit? Können Sie sich nicht denken, was bei einem Fremden wie mir, den der Tod Ihres Vaters nicht unmittelbar etwas angeht, das Wort ›angeblich‹ auslöst?« Frank war sich selbst nicht sicher, ob er erschrocken, besorgt oder entsetzt sein sollte. Gleichzeitig kamen ihm Zweifel in den Sinn und Skepsis gegenüber dieser schwerwiegenden Behauptung. »Ich werde sicher nicht der Erste sein, mit dem Sie darüber sprechen, Signorina Kannegießer! Ein leichtsinnig dahingesagtes Wort kann ein gewaltiges Gewicht haben, es kann eine Lawine auslösen und auch zu sehr bösen Reaktionen führen.«
Dass diese Reaktionen für die junge Frau unangenehme Folgen haben könnten, war Frank Gatow in dem Moment klar geworden, als sie das Wort »angeblich« an den Satz angehängt hatte, mit dem sie die Todesumstände ihres Vaters kurz und knapp beschrieben hatte. Jemand, der so etwas aussprach, brachte sich womöglich selbst in Gefahr. Frank betrachtete sie nachdenklich. Sollte er weiter auf das Thema eingehen oder seinen Rundgang durch das Weingut fortsetzen? Schließlich war er zum Fotografieren hergekommen und nicht, um sich mit den – ja, unter Umständen auch Hirngespinsten einer jungen Frau zu befassen. Vielleicht konnte oder wollte sie sich nicht mit den schrecklichen, in gewisser Weise aber auch banalen Todesumständen ihres Vater abfinden? Das Ganze zu dramatisieren, war möglicherweise ihre Art der Trauer. Doch er musste sich mit der Frage beschäftigen, er konnte ihr schlecht ausweichen. Schließlich hatte erst der Kontakt mit ihrem Vater, Werner Kannegießer, ihn auf die Idee gebracht, den Fotoband über Südtirol, seine Weingüter, die Winzer und deren Weine zu machen. Und natürlich über die Berge, die Alpen, die Dolomiten! Sie waren ständig präsent, man brauchte nicht einmal den Kopf zu heben, immer standen sie am Horizont wie unüberwindliche Mauern. Kannegießers Weingut weit oberhalb des Kalterer Sees gehörte unbedingt in ein Buch über Südtirol. Daher, das wurde Frank jetzt bewusst, kam er um die Beschäftigung mit dem Tod des Winzers nicht herum, besonders da sein Weingut zurzeit auf Sparflamme betrieben wurde, halbherzig, wie Theresa es formuliert hatte. Bis vor einer halben Stunde war er davon ausgegangen, das Weingut Kannegießer in den nächsten Tagen aufzusuchen. Die Önologin würde ihm sicher Zutritt verschaffen. Schließlich lebte sie dort. Also musste er ihr zuhören.
Abrupt drehte sich die junge Frau um, sah Frank an und kam langsam auf ihn zu. »Ich weiß sehr genau, was ich sage!«
Das Glitzern in ihren Augen, waren das Tränen? War es Kummer, oder war es Hass? Frank merkte immer häufiger, dass seine Augen von Jahr zu Jahr schlechter wurden, eine Katastrophe für ihn als Fotografen. Ständig musste er den Dioptrienregler im Sucher korrigieren. Sein Gespür hingegen war feiner geworden.
»Und natürlich habe ich mit anderen darüber gesprochen, Herr Gatow.«
»Auch mit denen, die das vielleicht treffen oder betreffen könnte?« Das klang beinahe vorwurfsvoll.
»Sicher, das habe ich. Aber nicht mit vielen, jedoch mit denen, die es angeht. Da sind die Familien meines Vaters, zwei sind es, die beiden Töchter, die er mit seiner ersten Frau gezeugt hat …« Theresa lachte unfroh. »… meine geliebten Stiefschwestern. Dann meine Mutter und mein jüngerer Bruder. Alle von uns haben irgendwie mit Wein zu tun, schließlich wurden wir auf dem Weingut geboren, wir wurden quasi mit Wein getauft, haben dort unsere Kindheit und Jugend verbracht, haben in denselben Kinderzimmern gelebt, teils mit denselben Sachen gespielt. Das prägt – kann ich Ihnen sagen – und schafft auch Widerwillen.«
Es waren ungute Erinnerungen, der Bitterkeit ihrer Stimme nach zu urteilen. »Meine Mutter …« – Theresa suchte nach den richtigen Worten – »… ist auch ein Fall für sich. Aber ich will nicht vorgreifen, nur so viel, denn Sie werden es ja doch erfahren: Sie ist kurz nach Vaters Tod zu ihrem Freund gezogen.«
Viel weiter konnte man kaum vorgreifen, dachte Frank. Wollte sie ihn negativ beeinflussen? Die Mutter würde diesen »Freund« bereits vor dem Tod des Vaters gekannt haben. Was für eine katastrophale Ehe, gelinde gesagt, musste es gewesen sein, wenn Kannegießer von dem Freund gewusst haben sollte, aber auch falls nicht.
»Hatten Sie, Herr Gatow, mal das Vergnügen, meine Mutter zu treffen? Wahrscheinlich nicht. Stimmt, Sie waren noch nie hier. Und sie hat meinen Vater nie auf Geschäftsreisen begleitet.«
»Nein, Ihre Mutter habe ich bislang nicht getroffen.« Nach dem, was er soeben erfahren hatte, war Frank auch wenig daran gelegen. »Sie sprachen eben von wir, in Bezug auf die zweite Familie. Wer gehört dazu?«
»Mein kleiner Bruder, Marco, er ist gerade mal neunzehn Jahre alt, das Nesthäkchen, der einzige Italiener, wie es in der ersten Familie heißt. Dabei wissen sie, dass sie ihn damit beleidigen.«
Bei beiden Begriffen, sowohl beim Italiener wie auch beim Nesthäkchen, war keinerlei Herablassung aus Theresas Stimme herauszuhören. Wieso konnte sich jemand beleidigt fühlen, Italiener genannt zu werden? Schließlich waren alle Südtiroler Italiener. Doch anscheinend nahmen die anderen Theresas Bruder nicht für voll, oder verachteten sie die Kinder aus der zweiten Ehe des Vaters?
»Er ist überlastet worden, mein Brüderchen, immer, mein Vater hat ihm alles aufgebürdet, viel zu viel für sein Alter. Alles hat er können sollen, er war derjenige, der eines Tages das Weingut übernehmen sollte, der Mann, nicht ich, obwohl es eigentlich mein Interesse ist und letztlich auch mein Ziel! Ich kann es, und ich scheue die Verantwortung nicht. Marco fehlt die Vorstellung, die Vision für die Zukunft unseres Weinguts sowie der Wille, seine Ideen auch durchzusetzen. Aber er ist der ideale Erste Offizier. Ich würde gern mit ihm arbeiten, er ist absolut verlässlich. Wir beide wären das ideale Team. Außer uns ist niemand in der Familie dafür geeignet, und niemand ist so gut ausgebildet wie ich.«
Es hörte sich für Frank ein wenig zu selbstbewusst an. Er wusste nicht, wie alt Theresa war, sie mochte das Studium gerade erst hinter sich gebracht haben. Aber er war sich darüber klar, dass man mit zunehmendem Alter junge Leute immer häufiger unterschätzte, ihnen zu wenig zutraute. Seine Tochter Christine hatte ihn bereits eines Besseren belehrt: Sie war heute eine bessere Fotografin als er, auf jeden Fall kreativer, wagemutiger und distanzloser, wobei er überzeugt war, einen tieferen Blick für das zu haben, was hinter den Dingen lag, was sich unter der Oberfläche abspielte, was verborgen bleiben sollte.
»Marco sollte der Starwinzer werden«, fuhr Theresa fort, »er, der erste Sohn nach drei Töchtern. Papa wollte ihn außerdem zum versierten Taucher machen, zum richtigen Mann, wie er sagte, zumindest so, wie er sich den vorstellte. Ja, mein Vater war das, was manche einen Macho nennen. Marco kränkelt, wurde behauptet, verstehen Sie? Ich weiß es besser, es war seine Art von Protest. Fußball interessiert ihn nicht, Autos sind für ihn lediglich Mittel zur Fortbewegung. Und sich unter Wasser zwischen Korallen und bunten Fischen zu bewegen? Ein Unding, die ersten Tauchgänge mit Papa müssen die Hölle für ihn gewesen sein. Er hat sich verweigert, bewusst oder unbewusst – egal. Das ist seine Sache.« Mit einem scheinbar gleichgültigen Achselzucken setzte sie einen Schlusspunkt unter ihre Ausführungen.
Frank war inzwischen näher getreten, hatte die verstohlene Handbewegung bemerkt, mit der Theresa sich über die Augen gefahren war, aber dem Grund für die Tränen war er nicht nähergekommen. Am liebsten hätte er dieses verminte Feld familiärer Streitigkeiten sofort verlassen und wäre zum Wein zurückgekehrt, zu dem, was in den Fässern ringsum lagerte, gärte oder reifte. Die geschnitzten Motive auf den Böden der Fässer interessierten ihn. Welche Anlässe hatte es dafür gegeben, wer hatte die Schnitzereien angefertigt, wie musste er sie ausleuchten, um alle Konturen herauszuarbeiten? Am schwierigsten war es, die Reflexe in den lackierten Flächen zu vermeiden. Hier unten war alles anders, in diesem Gewölbe lebte die alte Welt des Weins, oben, im Licht, weithin sichtbar, stand die moderne Architektur.
Theresa jedoch klebte geradezu an ihrem Thema. Wieso erzählte sie ihm das alles, ihm, einem Fremden, dem sie heute zum ersten Mal gegenüberstand? Ihm wurde kalt. Bei den Kellertemperaturen von vierzehn Grad musste man in Bewegung bleiben.
»Mein Vater war zum Tauchen nicht wie in den Jahren zuvor ans Rote Meer gefahren, nicht nach Marsa Alam. Diesmal hatten ihn die Korallenriffe von Los Roques gereizt. Das ist eine Inselgruppe vor Venezuelas Küste im Karibischen Meer. Der Krieg im Nahen Osten, die Militärdiktatur in Ägypten, das hat ihn von seinen bisherigen Zielen abgehalten, nicht aber der Rat seines Arztes. Ach, es war kein Rat, Dr. Passoni hat ihm das Tauchen quasi verboten. Sein Herz würde es nicht mehr mitmachen, er sollte vorsichtig sein und auf keinen Fall mehr so tief tauchen. Als mein Vater mir das erzählte, hat er sogar noch gelacht. Bei Los Roques geht es gleich auf dreitausend Meter Tiefe runter. Doch Papa hat abgewiegelt, alles Blödsinn, hat er gemeint. Sein Herz würde es nicht mitmachen, wenn man ihm das Tauchen verböte, das hat er gesagt. Ich glaube, er hat davon geträumt, sich von einem Manta ziehen zu lassen, die dort vorkommen, obwohl es strikt verboten ist. Sie wissen ja, wie eigensinnig er war …«
Frank hatte Kannegießer für entschieden gehalten, für einen Mann, der gewusst hatte, was er wollte. Doch eigensinnig? Ja, vielleicht, irgendwie schon.
»Aber es war nicht das Herz – also doch, es war das Herz, aber ich glaube nicht, dass es von allein stehen geblieben ist.«
Theresa schwieg und schaute Frank direkt in die Augen, als müsste sie ihn mit einem offenen Blick vom Gesagten überzeugen. Für einen Moment kam bei Frank die Erinnerung an ihren Vater auf. Auch der hatte seine Worte in dieser Weise unterstrichen, mit diesem direkten Blick.
»Der Atemregler soll vereist gewesen sein, sagen die einen, er habe einen Tiefenrausch bekommen, sagen die anderen, oder er ist zu schnell aufgestiegen. Tiefenrausch lautet die Version der Leute auf der Tauchbasis, und der Herzschlag sei die Folge davon gewesen. Die bestehen natürlich auf einer Erklärung, die sie nicht in Schwierigkeiten bringt. Das könnte Kunden vergraulen. Seine Begleiter – man taucht nie allein, daran hat er sich gehalten – hatten ihn vor dem Riff angeblich kurz aus den Augen verloren, und plötzlich habe man ihn leblos im Wasser treiben sehen, nahezu schwebend. Deutsche waren nicht dabei, auch keine Italiener oder Österreicher. Es waren wohl einige Russen, ein Holländer und zwei Franzosen – hat man uns zumindest gesagt. Die Venezolaner redeten sich raus, sprachen angeblich kein Englisch oder Französisch, die waren froh, als Papas Sarg endlich im Flugzeug war …«
Mitten im Satz kam der Wortschwall zum Erliegen. Sie starrte auf den Boden, dann kniff sie die Augen zusammen und sah Frank misstrauisch an. »Interessiert Sie das eigentlich, Herr Gatow? Um sich mein Gejammer anzuhören, sind Sie nicht hergekommen.«
Ganz sicher nicht. Frank hatte nicht einmal gewusst, dass Werner Kannegießers Tochter auf diesem Weingut arbeitete, und er war noch immer schockiert, erst heute vom Tod ihres Vaters zu erfahren.
Wie konnte eine diplomatische Antwort ausfallen? Er wollte die junge Frau nicht verärgern, doch ein tiefes Mitgefühl mit Kannegießer stellte sich nicht ein, dazu hatte er den Winzer längst nicht gut genug gekannt. Natürlich war er überrascht und betroffen. Sie waren sich sympathisch gewesen, durchaus, man war interessiert aneinander, das Gespräch war gerade erst eröffnet worden, und Kannegießer – sie waren nicht einmal beim Du angekommen – hätte die Person sein können, die Frank in Südtirols Weinwelt hätte einführen können. So gesehen war sein Tod ein Rückschlag. Sicher hatte er die besten und wichtigsten Winzer und Genossenschaften gekannt, zumal er eine Art Vorreiter in Sachen Weinbau gewesen sein soll. Besonders in Hinsicht auf die Verbesserung der Qualität und des Einsatzes von Holzfässern soll er sich einen Namen gemacht haben. Frank schätzte, dass von Kannegießer außerdem ein ehrliches Wort in Bezug auf die Kollegen zu erwarten gewesen wäre. Durch seinen Tod war Frank nun wie bei allen vorherigen Fotoreisen auf die eigene Nase angewiesen, auf die Augen und sein Gespür. Dabei war ihm immer weniger daran gelegen, hinter die Kulissen zu schauen, zumindest nicht hinter die menschlichen, da lag meistens zu viel Dreck, so kam es ihm inzwischen vor. Das lag nicht in seinem Interesse. Daran änderten auch die Ausführungen der jungen Frau nichts. Eine diplomatische Antwort, eine, die nicht verletzte, ohne zu schwindeln, wollte sie das?
»Der Tod Ihres Vaters betrübt mich sehr, sowohl menschlich wie beruflich. Er war ein interessanter Mann, den ich gern näher kennengelernt hätte. Was die Umstände seines Todes angeht: Dazu kann ich mich – das verstehen Sie sicher – nicht äußern. Zum Tauchen habe ich keinerlei Bezug, mich hat auch die Unterwasserfotografie nie interessiert. Ich sehe die Fische lieber vor mir auf dem Teller, gebraten, gegrillt oder im Salzmantel, hingegen ist mir Salzwasser immer ein Gräuel gewesen …«
»Das geht mir ähnlich«, sagte Theresa und schien sich gefasst zu haben. »Mir sind der Kalterer See und der Montiggler See viel lieber als das Meer, nicht zum Baden, nur zum Schauen, obwohl mein Vater dauernd versucht hat, auch mir das Tauchen schmackhaft zu machen. Zu viel Druck erzeugt eben Gegendruck, wie bei Marco.«
»Und Ihre Mutter?«, fragte Frank, sich im nächsten Moment daran erinnernd, was Theresa über sie und den Freund gesagt hatte. »Wie steht sie zu Ihren Äußerungen?« Glaubte Theresa wirklich, dass ihr Vater … dass ihn jemand … dass er eines unnatürlichen Todes gestorben sei?
Statt zu antworten, ging Theresa zu einem Schränkchen an der Wand und entnahm ihm zwei bauchige Weingläser. Sie hielt sie trotz ihrer kleinen Hände geschickt zwischen den Fingern und trat an eines der großen Fässer. Sie ließ ein wenig Wein hineinlaufen, gerade mal eine Daumenbreite. Eines der Gläser reichte sie Frank. Er versuchte, in ihrem Gesicht zu lesen, was es mit der Mutter auf sich hatte, doch Theresa verweigerte die Antwort.
»Das ist unser heutiger Kalterer See – aus der Vernatsch-Traube. Leute Ihres Alters«, sie zwinkerte ihm zu, »kennen meist noch das Zeug, das unter diesem Namen früher in Liter- oder Zweiliterflaschen in Deutschland verkauft wurde, in den Billigketten. Da war Kalterer See noch keine geschützte Ursprungsbezeichnung. Heute würde ich einen solchen Wein als untrinkbar bezeichnen. Lambrusco aus der Emilia-Romagna war ähnlich gruselig.«
»So alt bin ich nun auch wieder nicht«, sagte Frank, ein wenig pikiert, und griff mit der linken Hand nach dem Glas. Ein Schmerz durchzuckte ihn, er hatte eine falsche Bewegung gemacht, zog die Hand zurück und streckte den rechten Arm aus. »In den Siebzigerjahren waren bei mir Limonade und Cola angesagt, dann kam das Bier, der Wein erst sehr viel später.«
»Sie dürften in etwa der Jahrgang meines Vaters sein«, schätzte Theresa, »wahrscheinlich sind Sie ein bisschen jünger. Gehören Sie zur sogenannten Toskana-Fraktion? Sie leben schließlich dort.« Sie hatte Franks Visitenkarte aus einer der vielen Taschen ihrer Jacke gezogen.
Frank stülpte die Unterlippe vor. Für die Politlinge der rosa-grünen Toskana-Fraktion hatte er niemals Sympathien gehegt.
»Habe ich etwas Falsches gesagt?« Theresas unschuldiger Augenaufschlag war viel überzeugender. »Schließlich wohnen Sie in Gaiole in Chianti.«
Frank erklärte, dass seine Frau dort ein Weingut betreibe, die Tenuta Vanzetti, und dass er sie bei seiner allerersten Fotoreportage über Wein kennengelernt habe und geblieben sei. Es sei ein wunderbarer Platz zum Leben, obwohl man in dem Geschäft kaum zur Ruhe käme, höchstens mal im Winter. Der Wein, sein Jahreszyklus und die Verkaufsaktivitäten ließen kaum Zeit zum Atemholen.
»Das kenne ich zu gut. So sah es bei uns zu Hause auch aus. Hier beim Johannishof angestellt zu sein, ist anders, aber als Inhaber und nicht als reicher Weinbaron ist man dauernd auf den Beinen. Aber Sie haben gar nicht probiert.« Sie zeigte mit ausgestrecktem Finger auf das Glas, das Frank in der rechten Hand hielt.
Er probierte nicht gern in der Frühe, er schob das Verkosten so lange wie möglich hinaus, am liebsten verlegte er es auf den Nachmittag, besser noch auf den Abend. Der Alkohol trübte seinen Blick, und Wein gehörte für ihn zum Essen, danach trank er lieber einen Grappa oder einen Cognac zum Kaffee. Er starrte auf das Glas in seiner Hand und führte es an die Nase.
Die Farbe konnte er bei der schlechten Beleuchtung im Keller nicht definieren, denn die Strahler unter den Fässern warfen symmetrische und grotesk wirkende Schatten an die rauen Mauern des Gewölbes und verfälschten das Licht. Aber der Wein war recht durchsichtig, sehr hell, bei Weitem nicht so dicht wie die Weine der Toskana. Er hatte einen schönen fruchtigen Duft, wirkte sehr frisch und jung.
»Dieser Vernatsch kommt nie ins Barrique, das bleibt unserer zweiten autochtonen Rebsorte vorbehalten, dem Lagrein. Der kann das vertragen, denn der bringt genügend Kraft, Gewicht und Gerbstoff mit. In einem Monat werde ich ihn hier abfüllen. Wie gefällt der Wein?«
Direkt danach gefragt zu werden, war Frank peinlich, obwohl ihm dieser Wein gut schmeckte, sehr gut sogar. Wenn er leichter gewesen wäre, hätte er ihn als fad empfunden. In diesem Fall war die Antwort einfach für ihn; anders war es aber, wenn man zu einem mangelhaften Wein etwas sagen sollte, zu einem, der keinerlei Struktur aufwies oder so fett war, dass man nach einem Glas bereits genug hatte, bei dem Vanillegeschmack und Nelke das Weinaroma verdrängten. Mit zunehmendem Alter und wachsender Erfahrung hatte sich Franks Geschmack immer stärker in die Richtung leichter, eleganter Weine entwickelt. Wenn er abends mit Antonia (oder auch ohne sie) auf der Loggia saß, die Füße auf der Brüstung, den Sonnenuntergang genießend oder ein Buch in Händen haltend, trank er Antonias leichtesten Chianti, genoss den Luxus, dass eigens für ihn ein Fässchen reserviert war, das sie fast mit der gleichen Liebe pflegte, die sie für ihn empfand. Sie selbst liebte mehr die Kräftigen, die Würzigen, allerdings von einer spritzigen Säure am Leben erhalten.
Die junge Önologin, die noch immer auf Franks Urteil wartete, erklärte, dass der St. Magdalener und der Meraner auch aus der Vernatsch-Traube gekeltert würden. In Italien hieß sie Schiava, und ihr wurde eine große genetische Ähnlichkeit mit der in Württemberg kultivierten Rebsorte Trollinger nachgesagt. Manche Experten sahen sie sogar als identisch an, andere wieder nicht, führte sie aus.
»Der St. Magdalener kommt aus dem gleichnamigen Dörfchen bei Bozen, und der Meraner aus dem besonders warmen Umland der Stadt. Man muss die Erträge der Vernatsch-Traube unbedingt beschränken, sonst wird der Wein unerträglich. Also – wie finden Sie ihn?«
»Sind Sie dafür verantwortlich?« Es machte Frank Spaß, sie ein wenig hinzuhalten. Ein erfahrener Kellermeister oder Önologe hätte nicht nachgefragt, ob der Wein gefällt, er hätte es im Gesicht seines Gegenübers gelesen.
»Ich bin noch nicht lange hier, erst ein Jahr, in der kurzen Zeit habe ich mich noch nicht ausprobieren können. Was wir im letzten Jahr geerntet haben, die jungen Weißen, die nicht ins Holzfass kommen, die nur im Stahltank ausgebaut werden, ja, für die bin ich verantwortlich. Die anderen stammen von meinem Vorgänger, und bei den Roten redet der Chef mit. Und? Wie gefällt er?«
»Sehr schön«, meinte Frank versöhnlich lächelnd, was mehr davon hervorgerufen wurde, dass ihn Theresas Fragen an seine Tochter erinnerte, als sie ihm ihre ersten Fotoarbeiten vorgelegt hatte. Damals war Christine fünfzehn gewesen. Dann rief er sich wieder den Grund seines Aufenthaltes hier ins Gedächtnis. Er blickte auf die Uhr, es war kurz vor elf, viel zu spät, um draußen zu fotografieren, zu viel Dunst in der Luft, zu viel Helligkeit. Er konnte die Innenaufnahmen machen, aber da gab es außer den Fassböden wenige Motive, die der Mühe lohnten, alles andere hatte er zigmal abgelichtet. Deshalb kam er auf das Thema zurück, er konnte ruhig seiner wachsenden Neugier frönen.
»Sie sagten, dass Sie mit der Familie über den Tod Ihres Vaters gesprochen hätten.«
»Das ist richtig. Angenehm ist was anderes, es war geradezu schrecklich, ein Albtraum.«
»Und? Was sagt Ihre Familie oder besser Ihre beiden Familien, die Stiefgeschwister zu Ihrem ›angeblich‹?«
Theresa Kannegießers Gesicht verfinsterte sich schlagartig. »Die ganze Bande hält mich für verrückt. Ich sei übergeschnappt, sagen sie, ich sei krank. Die Todesumstände seien klar, ich aber würde mich mit solchen Thesen ins Abseits stellen, außerdem würde das ein schlechtes Licht auf die Familie werfen. Ich würde das Ansehen meines Vaters beschmutzen, meinen sie, ich würde üble Gerüchte und Verdächtigungen in die Welt setzen. Das fiele dann auf die ganze Familie zurück. Das kommt besonders vom neuen Ehemann von Loretta – na ja, so neu ist der gar nicht«, sie kicherte, »er ist schon ziemlich alt, er ist Politiker und Jurist und meint, dass nur er sich um die Erbschaft kümmern kann, um die Aufteilung des Besitzes, weil er was von Gesetzen verstünde und über die richtigen Beziehungen verfüge. Er wirft mir vor, ich würde durch meine Behauptung eine gerechte Verteilung des Erbes hintertreiben, weil ich auf das Weingut scharf sei. Ja, das bin ich, aber ich finde, da ist nichts Unrechtes dran. Alle anderen wollen das Gut auch, besonders er. Er ist Abgeordneter in der SVP, der Südtiroler Volkspartei, Sie wissen sicherlich besser, wie Politiker ticken. Sie, Herr Gatow, kommen schließlich aus Italien.«
Das war wieder eine Äußerung, die Frank nicht verstand und die ihn ärgerte. Schließlich waren sie hier in Italien, und auch die Südtiroler waren Italiener. Was steckte hinter diesen Vorbehalten?
»Aber auch die anderen von der sogenannten Familie sind wie …« Theresa suchte wieder das passende Wort, schaute in ihr Glas und schwenkte es, als würde das Wort sich wie die Aromen aus dem Wein lösen. »… wie die Leichenfledderer, ja, das sind sie alle. Die wollen nicht das Weingut, die wollen auch nicht die zweiundzwanzig Hektar, die wollen keinen Wein machen – die wollen das alles nur, um es zu verscherbeln, um alles zu Geld zu machen«, ereiferte sie sich. »Wissen Sie, was ein Hektar Rebland heuer kostet?« Wütend schaute sie Frank an. »Eine Million, stellen Sie sich das vor, eine ganze Million! Und meine Stiefschwester, Anette, also Lorettas Tochter, wenn Sie mir folgen, die angeblich so große Weinexpertin, einen Abschluss in Önologie hat sie zwar, den aus San Michele. Aber sie hat nie praktisch gearbeitet«, ereiferte sich Theresa weiter, »bis auf das Praktikum bei uns. Wahrscheinlich schleppt sie ein Trauma mit sich ’rum, weil sie als Kind immer hat helfen müssen, oh, die Ärmste. Die sitzt jetzt faul mit ihrem Arsch auf dem Weingut Förster, den hat sie geheiratet, wenn sie nicht mit ihren Freundinnen in Bozen durch die Laubengasse tigert und sich bei Rizzolli neue Schuhe oder bei Cocchinelle neue Handtaschen aussucht. Die darf ihr Mann dann bezahlen.«
Theresas Äußeres ließ nicht darauf schließen, dass es ihr wichtig war, in diesen Geschäften einzukaufen.
»Förster reißt sich auf seinem Weingut die Beine aus. Ich glaube, er hat sie geheiratet, weil er dachte, dass er eines Tages die beiden Weingüter zusammenlegen kann. Aber Liebe?« Theresa lachte kurz auf und zog die Mundwinkel verächtlich nach unten. »Liebe war nie ein Wort in unserer Familie, höchstens eines von meinem Vater. Seine erste Frau war angeblich ein Fehlgriff, die zweite ebenfalls. Er verstand nichts von Frauen, dafür umso mehr von Weintrauben und von seinen Fischen. Genau diese Leidenschaft wurde ihm letzten Endes zum Verhängnis.«
Sie schien sich so in Rage geredet zu haben, dass Frank ihr dringend eine Pause verschaffen musste. »Lassen Sie uns in die Kelterhalle gehen, ich würde mich gern auch dort umsehen, wenn Sie erlauben.«
Oben angekommen, erhielt er den gleichen Vortrag, den er unzählige Male in den vergangenen zwölf Jahren, seit er sich hauptberuflich mit Wein beschäftigte, über sich hatte ergehen lassen. Aber kein Winzer, dessen Weingut er besuchte, keine Kellerei, in der er fotografierte, ersparte ihm die ewig gleiche Prozedur. Sie hätten ihm ihre kostbare Zeit gar nicht opfern müssen, er hätte sich bestens allein zurechtgefunden, die Prinzipien der Weinbereitung waren überall ähnlich, auch wenn die Technik sich veränderte. Obwohl Theresa wusste, dass er auf einem Weingut zu Hause war, erklärte sie ihm den Prozess, zeigte ihm das Tor, durch welches die Trauben angeliefert wurden, wo man sie ablud, wo die Maschine zum Entrappen stand, der durchlöcherte Zylinder, in dem die Beeren von den Rappen getrennt wurden, durch welche Röhren die weißen Trauben in die Pressen und die roten in die Gärtanks geleitet wurden. Hier standen die hohen zylindrischen Edelstahlkolosse senkrecht, andernorts waren sie waagerecht angeordnet, wodurch der Wein anders werden sollte. Man hätte beide Methoden mit den gleichen Trauben durchführen müssen, um zu erfahren, ob es in dieser oder jener Weise zu besseren Ergebnissen kommen würde. Nur – was war beim Wein besser?
Der große Unterschied zwischen diesem Weingut und anderen dieser Region war natürlich, dass es sich hier um ein Privatweingut handelte und nicht um eine der großen Genossenschaften, bei denen Hunderte von Weinbauern ihre Trauben ablieferten. Morgen würde er den ersten Vergleich ziehen können, da war er in der Genossenschaftskellerei Meran Burggräfler angemeldet. Er empfand es als beruhigend, dass es nicht zu derart persönlichen Themen kommen würde wie hier. Was Theresa zu erzählen hatte, war für Frank letztlich bedeutungslos, besonders was die Schmähungen der anderen Familienmitglieder betraf. Eine Frage jedoch blieb, wenn das, was Theresa von sich gab, nicht im Reich der Fabel untergehen sollte.
»Wenn ich noch mal auf den Tod Ihres Vaters zu sprechen kommen darf: Wie haben sich die venezolanischen Behörden verhalten? Was war von ihnen zu erfahren? Haben sie sich geäußert? Gab es Ärzte, die den Toten untersucht haben? Wird in solchen Fällen im Ausland kein Totenschein ausgestellt?«
Inzwischen war Theresa, die an Franks schnellen Rundumblick gemerkt hatte, wie wenig ihn die Kelterhalle interessierte, ins Lager vorausgegangen. Hier standen mit Weinkartons gepackte Paletten neben Drahtkörben mit nicht etikettierten Flaschen. Regale reichten bis unter die Decke, darin Einzelflaschen, Magnums, Dreiergebinde oder Sechserkartons. Ein Arbeiter war damit beschäftigt, eine Lieferung zusammenzustellen. Theresa bedeutete Frank, still zu sein, um den Mann nicht zu stören, und griff nach seinem Arm.
Aus Angst vor einer schmerzhaften Berührung zuckte er erschrocken zurück. Es war der verletzte Arm, überempfindlich und trotz langer Stunden der Krankengymnastik und Ergotherapie längst nicht so beweglich wie früher. Antonias Mitarbeiterinnen wussten um das Dilemma, viele Nachbarn kannten das Drama ebenfalls, die mehr oder weniger direkt an den Ereignissen teilgenommen hatten. In der Öffentlichkeit verbarg er die Narben mehrerer Operationen immer unter langärmeligen Hemden oder leichten Jacken und hatte sich, um den Arm zu schonen, Bewegungen angewöhnt, die von anderen als linkisch angesehen wurden.
Die junge Önologin bemerkte sein Ausweichen und entschuldigte sich. »Sind Sie verletzt?«
Frank zögerte, ob er darüber sprechen sollte. »Es ist lange her, ich hatte einen schweren Unfall und habe mir dabei den halben Arm zerfetzt. Es hätte schlimmer ausgehen können, ich habe noch Glück gehabt: Der Arm ist drangeblieben.«
Entsetzt starrte Theresa ihn an. »Wie ist das passiert? Ein Autounfall?«
Dass Antonias damaliger Ehemann auf ihn geschossen hatte, musste er der jungen Frau nicht auf die Nase binden. Frank winkte ab. »Die Geschichte ist zu lang, darüber sprechen wir ein andermal, deshalb bin ich nicht hier. Es ist keine angenehme Erinnerung. Aber zurück zu den Latinos …«
»Ganz wie Sie meinen.«
Theresa wirkte beleidigt. Erwartete sie nach ihren Enthüllungen, an deren Wahrheitsgehalt Frank nach wie vor zweifelte, Gleiches von ihm? Er würde sich nicht darauf einlassen, und wenn er dieses Weingut verließ, war die Sache abgeschlossen. Nein, das war sie nicht. Schließlich behauptete die Tochter, dass der Mann, der ihn nach Südtirol geholt hatte, ermordet worden war. Also war das Verhalten der venezolanischen Behörden durchaus wichtig.
»Meine Mutter ist hingeflogen, hat sich um alles gekümmert, angeblich, so wie sie uns erklärte. Mich wollte sie nicht dabeihaben. Angeblich sprach sie auch mit dem Arzt der Tauchbasis. Aber ich glaube ihr das nicht.«
Schon wieder dieses Wort »angeblich«. Es schien Theresa zu gefallen. »Also zweifeln Sie auch daran?« Frank wusste, welche Dynamik Zweifel besaßen. Wenn sie einen packen, lassen sie einen nicht mehr los. Aber bei Theresas grundsätzlich feindlicher Haltung der ersten Familie gegenüber war es möglich, dass sie sich verrannt oder sich in ihren eigenen Hirngespinsten eingesponnen hatte.
»Der Arzt auf Los Roques war wahrscheinlich lediglich ein Krankenpfleger oder einer, der mal einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert hat. Meine Mutter hielt ihn natürlich für einen richtigen Arzt. Ein Freund, der Spanisch spricht, hat den Bericht gelesen, er hat für mich angerufen und meine Ahnung bestätigt. Die zwei Inselpolizisten wollten Dollar sehen, für ihre Ermittlungen, für Auskünfte, für was auch immer. Geholfen hat’s nichts. Die haben sich um nichts gekümmert und nur Probleme geschaffen, wo vorher keine waren, um an deren Beseitigung zu verdienen. Alle Vorurteile, die man Venezuela oder den Latinos generell entgegenbringt, haben sich als zutreffend erwiesen, besonders die über Korruption. Am meisten hat die Fluggesellschaft geholfen, denn anders als mit kleinen Propellermaschinen kommt man dort nicht hin und wieder weg. Die haben später reichlich an der Überführung von Papas Leiche aufs Festland verdient. Und als meine Mutter dort war, waren die Leute, die bei dem …« Theresa zögerte, sah die Zweifel in Franks Augen und entschied sich dann für die harmlosere Version. »… die also bei dem angeblichen Tauchunfall dabei waren, längst abgereist. Deren Anschriften oder E-Mail-Adressen hat sie auch nicht mitgebracht. Am schlimmsten soll es auf dem Flughafen von Caracas gewesen sein. Wie der heißt, weiß ich nicht mehr. Vier Tage hat’s gedauert, bis sie den Sarg freigegeben haben, Sie können sich nicht vorstellen, welchen Papierkrieg das ausgelöst hat.«
»Also gibt es keinerlei Zeugen von dem Unfall, es gibt niemanden, der Ihre Annahme unterstützen könnte? Von bestätigen will ich gar nicht reden.«
Die junge Frau wich seinem Blick aus. »Nein!«
»Wie kommen Sie dann darauf, dass Ihrem Vater Gewalt angetan wurde? Irgendetwas muss Sie schließlich dazu veranlasst haben. Ein solcher Verdacht kommt nicht von ungefähr …«
Bei ihr vielleicht, dachte Frank und wusste selbst nicht genau, was ihn dazu trieb, weiter auf dieses Thema einzugehen. Ein wenig hatte er das Gefühl, dass man Verrückten ihre Fantasien lassen musste, sonst wurden sie bösartig und schlugen um sich.
Bis auf sie selbst und ihren Bruder Marco hatte Theresas Ansicht nach niemand Werner Kannegießer geliebt, nicht einmal seine Frau, wie sich gezeigt habe, und die erste Frau höchstens zu Beginn der Ehe. Theresa glaubte, dass jene Frau ihn hasste, dass sie noch immer nicht verwunden hatte, dass er sie einer Jüngeren wegen verlassen hatte, wenn auch mit einer großzügigen Abfindung.
»Meine Stiefschwestern haben es ihm bis heute nicht verziehen, auch die neue Heirat nicht. Marco und mich begreifen sie als lebende Beweise des Verrats, sie fühlen sich in die zweite Reihe versetzt.« So zumindest hätte es Anette, die erste Tochter, in einem bösen Streit ihr gegenüber ausgedrückt, der beinahe tätlich geendet hatte. »In dieser Familie ist sich niemand grün. Hier ist jeder des anderen Feind.«
»Hat Ihr Vater Anlass dafür gegeben?«
»Wenn Sie seine Lebensgestaltung als Anlass sehen, dann ja. Meiner Ansicht nach hat er das nicht, aber das sieht jeder Beteiligte von seiner eigenen Warte aus. Nach ihm wurde ich am meisten angefeindet. Mein Bruder hat es leichter, weil ihn sowieso niemand für voll nimmt.«
»Hat Ihr Vater gewusst, dass seine Frau, also Ihre Mutter, ihn betrügt?« Die Frage, eigentlich viel zu indiskret, bewegte Frank mehr in dem Sinne, ob und wie jemand damit umging. Das hatte viel mit den dramatischen Umständen zu tun, unter denen er Antonia kennengelernt hatte, und sein verletzter Arm erinnerte ihn täglich daran.
»Ich würde mir das nicht gefallen lassen«, sagte Theresa, statt eine direkte Antwort zu geben. »Aber Papa liebte alle seine Kinder, auch wenn die beiden ersten das anders sehen. Das hat ihnen ihre Mutter eingeredet. Er hat niemals schlecht über Anette und Barbara gesprochen, mir gegenüber jedenfalls nicht. Und er liebte seine Fische. Er hat niemals unter Wasser gejagt, mit Harpune zum Beispiel, er aß auch keinen Fisch. Lebendig seien sie viel schöner, meinte er, und wenn er sich an ihnen freuen wolle, in ihr Element eintauche, müsste er sie schützen. Er hat viel Geld für Organisationen gespendet, Greenpeace und so, die sich um den Erhalt der Riffe und der Wale kümmern. Meine Mutter hat das fürchterlich genervt, sie meinte, er solle sich der Familie widmen und für das Geld lieber eine weitere Arbeitskraft einstellen, dann hätte er mehr Zeit für uns.«
»Ihr Vater wurde überführt, so habe ich Sie verstanden …«
Theresa nickte und schob einen Hubwagen an die Seite, den ein Lagerarbeiter im Weg hatte stehen lassen.
»Wurde er dann hier untersucht oder obduziert?« Frank zweifelte weiter, ob es einen konkreten Verdacht gab oder Theresa sich heillos verrannt hatte.
Jetzt wurde ihr Nicken heftiger. »Sie wollten ihn gleich einäschern, aber weil ich ein Riesentheater gemacht habe, wurde er obduziert. Bis auf Marco waren die anderen dagegen. Ich habe mich mit Dr. Cotarelli zusammengetan, seinem Arzt, und gemeinsam haben wir den Aufstand gemacht, bin sogar zur Polizei, zu den Carabinieri, die für Mord zuständig sind. Die sagten aber, sie wären nicht für eventuell in Venezuela begangene Morde zuständig, da sollte ich mich an die dortige Polizei wenden. Die da drüben würden sich totlachen. Zur Zeitung bin ich auch gegangen. Klar, die haben darüber geschrieben, sehr vorsichtig, allerdings nur über den Herztod, man hätte durchaus Zweifel herauslesen können. Danach sind alle wieder über mich hergefallen: Ich würde die gesamte Familie als Mörder darstellen, darin waren sich sogar die beiden Ehefrauen einig. Sie würden dafür sorgen, dass ich in Südtirol niemals ein Bein auf den Boden kriegen würde, das heißt keine Anstellung im Weinbau. Sie würden meinen Ruf zerstören, wenn ich nicht aufhören würde, sie anzuschwärzen. Das ist mir egal, für meinen Vater ist es mir wert, dann gehe ich eben nach Deutschland, da brauchen sie gute Önologen, da gilt eine Frau was, und die sprechen meine Sprache …«
»Aber Sie müssen doch irgendeinen Anhaltspunkt dafür haben, dass Ihr Vater …« Frank weigerte sich, das Wort Mord auszusprechen. Es war schlimm genug, dass er es dachte. »Ergab die Obduktion irgendwelche Hinweise auf einen gewaltsam herbeigeführten Tod?«
»Nein …«
»Gib es Zeugen?«
»Nein …«
»Gibt es sonstige Beweise, Indizien?«
»Nein …« Theresa schwieg eine Weile mit gesenktem Blick. Dann sah sie auf: »Können Sie mir nicht helfen, die zu finden?«
»Ich?« Im Griff nach der Kamera erstarrt, blieb Frank stehen. Nein. Er würde nicht so wahnsinnig sein, sich in den Krieg dieser zerfetzten Familien um zweiundzwanzig Millionen Euro hineinziehen zu lassen.
2. Kapitel
Wie schön und erholsam konnte die Welt sein, die Natur, auch eine von Menschen gestaltete Landschaft, wenn die Macher möglichst weit weg waren, dachte Frank aufatmend, als er die schmale Straße bergab fuhr, mitten durch ein grünes Meer junger Weinblätter. Zum Kalterer See hin fielen die Weingärten sacht ab, weich, einladend und sein Gemüt beschwichtigend. Jenseits des Wassers, das so grün schimmerte wie die Umgebung, wuchs ein bewaldeter Berg in die Breite und Höhe, als wolle er betonen, dass die dahinterliegenden Berge, gestaffelt wie Theaterkulissen, die Tiefe und Perspektiven vorgaukeln, noch höher anstiegen. Doch bis an die im satten Blau stehenden Wolken reichten sie nicht heran. Alle diese Berge hatten Namen, doch obwohl Theresa sie genannt hatte, erinnerte Frank nicht einen. Anders war es bei dem in seinem Rücken liegenden Kalksteinmassiv, der Mendelklamm, die ihn mit ihrer Mächtigkeit beeindruckte, deren senkrecht aufsteigende Wand wie eine Mauer in tausendachthundert Meter Höhe an den Wolken kratzte. Winzig und verloren lag darunter das Weingut Johannishof, wo er bis vor Kurzem fotografiert hatte und wo sich die junge Theresa zwischen Holz, Glas und glänzendem Edelstahl in ihrer Arbeit vergrub, um nicht am Tod des Vaters zu verzweifeln oder von ihren Zweifeln und Vorwürfen gefressen zu werden.
Es musste grauenhaft sein, ein so katastrophales Bild von seinen Angehörigen mit sich herumzuschleppen. Dabei gingen einen die Vorgängerfamilie und deren Sprösslinge im Grunde nichts an, doch man kam an ihnen nicht vorbei. Südtirol war so klein und übersichtlich, dass es kaum möglich war, sich aus dem Weg zu gehen. Frank erinnerte sich leider zu gut an den Krieg, den Antonias verstorbener Mann Massimo aus dem Gefängnis heraus angezettelt hatte, als sie die Scheidung eingereicht hatte. Am schlimmsten war es für sie gewesen, dass er die Kinder hineingezogen und nicht nur gegen sie, sondern ganz besonders auch gegen ihn aufgehetzt hatte. Er, Frank, sei schuld daran, dass man ihn ins Gefängnis gesteckt habe, so Massimo Vanzettis Logik, denn er hätte nie auf ihn geschossen und ihm den Arm zerfetzt, wenn Frank nicht mit Antonia ein Verhältnis begonnen hätte. Das war eine Argumentation, der sich auch Sohn Piero gerne anschloss. Er war in seines Vaters schmierige Baugeschäfte mit der öffentlichen Hand eingestiegen und fühlte sich in dem Schleim, der nach Mafia roch, anscheinend äußerst wohl. Frank hielt ihn für einen Gangster, der bis heute kein Wort mit ihm sprach – und mit seiner Mutter nur das Nötigste. Sogar mit seiner Schwester Felicitas hatte er jeglichen Kontakt abgebrochen, als er erfuhr, dass sie mit seiner Tochter Christine verkehrte und die beiden jungen Frauen sich recht gut verstanden. Irgendwo stand immer ein schwarzes Schaf herum. Bei Theresa schien es eine ganze Herde zu sein. Oder existierte die nur in ihrer Fantasie?
Das Gespräch hatte Frank stärker bewegt als gedacht. Er wusste, wie schwer es war, mit einem schwierigen Schicksal fertigzuwerden. Doch im Gegensatz zu Theresa und der Familie Kannegießer hatten sie ihre Erbstreitigkeiten hinter sich. Massimo Vanzetti war noch vor der Scheidung im Gefängnis gestorben, somit hatte er Antonia als Noch-Ehefrau nicht vom Erbe ausschließen können. Sie hatte sich mit dem Weingut zufriedengegeben, es war ihr Glück, ihr Universum. Für die Kinder war weit mehr übrig.
Als Frank die Scheiben des Lancia herunterließ, wehte ihm die warme, nach Gräsern und Blumen duftende Luft um den Kopf, den schmerzenden linken Arm kühlend. Ihm war, als wäre er aus der Dunkelheit aufgetaucht, aus der Düsternis und Zukunftslosigkeit einer Geschichte wie von Edgar Allan Poe: Nicht der Untergang des Hauses Usher, sondern des Hauses Kannegießer. Frank hielt an einem Gatter, denn ein hinter ihm drängelnder Traktor wollte vorbei. Er stieg aus und setzte sich auf einen großen, sonnenwarmen Stein, ließ die Schultern sacken und atmete auf, als wäre ihm der Stein, auf dem er saß, vom Herzen gefallen.
Rechts von ihm wuchs Wein, was sonst? Außer Weinstöcken hatte er einige Gemüsegärten gesehen, die wahrscheinlich der Selbstversorgung dienten. An die Apfelplantagen im Etschtal hatte er sich noch nicht angenähert, denn er war erst seit gestern hier und noch dabei, sich in die neue Umgebung einzusehen. Und er wusste, dass er vieles erst sehen würde, wenn er die Bedeutung zwar nicht begriffen, so doch erfasst hatte. Inmitten der Reben zu sitzen oder von ihnen umgeben zu sein, war für Frank immer eine Erholung, hier fühlte er sich aufgehoben. Es war nicht das freundschaftliche Gefühl, das er seinen fünf Reihen gegenüber hegte, die Antonia ihm zum »Spielen«, wie sie es sagte, überlassen hatte. Immer nur das zu fotografieren, was andere taten, reichte ihm nicht mehr. Er wollte im Kleinen selbst ausprobieren und experimentierte mit Methoden, von denen die Winzer sprachen, die er fotografierte. Das betraf den Winterschnitt, die grüne Lese, mit der die spätere Erntemenge bestimmt wurde, das Beschneiden der Trauben selbst, denn sie reiften unterschiedlich, besonders Sangiovese mit den breiten Schultern, die er dann wegschnitt. Auf diesem Hintergrund sah er auch Antonias Hilfe bei den Texten zu seinen Fotobüchern. Denn auch sie war ständig bemüht, ihre Arbeit im Weinberg zu vervollkommnen, und gab sich selten mit dem einmal Erreichten zufrieden.
Frank schaute nach links, auch dort wuchsen Reben, aber auf eine andere Weise als gegenüber, wo sie in langer Reihe am Drahtrahmen rankten. Diese Stöcke waren hoch, sie wirkten alt, sie wuchsen an einem senkrechten Pfahl empor und breiteten die Tragruten über einem weitmaschigen Drahtgeflecht aus. Es reichte bis an die nächste Reihe, und die Pfähle stützten sich gegenseitig. So bildete sich ein Laubdach, die Trauben hingen darunter im Halbschatten. Ähnliches wurde vereinzelt in der Toskana praktiziert. Die Beeren hier waren noch winzig, hart und grün, Ende Juni konnte es kaum anders sein. Um welche Rebsorte handelte es sich? Sangiovese mit den gezackten und zweimal tief gebuchteten Blättern hätte er erkannt, Cabernet Sauvignon hatte normalerweise vier Buchten mit nicht so spitzen Zacken, und die beiden Hälften des Blattes überlappten sich am Stilansatz. Merlot hätte er auch erkannt, eines Tages war es so weit gewesen, da hatte er plötzlich den Blick dafür gehabt. Die Manier, in der früher Trauben und Blätter gezeichnet worden waren, hatte das deutlicher herausgestellt. Die Blätter der Weinstöcke dieser Pergola-Erziehung hingegen kannte er nicht. Bei der Vielfalt an Rebsorten, in Südtirol sollten es zwanzig sein, hätte er genug zu tun. Aber es ging ihm hier weit weniger um die Reben als viel mehr um die Architektur, sie war modern.
Gleich würde er zum Kalterer See hinunterfahren, sich in einem Café einen Platz am Wasser suchen und auf den See starren, um möglichst nichts zu denken außer an einen großen Eisbecher mit frischen Erdbeeren und Sahne.
Wie lange er auf Theresa hatte einreden müssen, bevor sie ihn seine Arbeit hatte machen lassen und er fotografieren durfte. Es hatte eine Ewigkeit gedauert. Zu allem Ungemach und zu dem, was in seinem Kopf herumschwirrte, hatte er ihr versprechen müssen – so inständig, beinahe herzzerreißend hatte sie ihn gebeten, ihr zu helfen –, sie bei dem Vorhaben zu unterstützen, den Tod ihres Vaters zu klären. Er verstand nicht, wieso sie gerade ihn dafür ausgewählt hatte. Nur weil er in ihren Augen unabhängig war? Jeder andere wäre hilfreicher. Sie konnte unmöglich wissen, was damals in der Toskana geschehen war und wie die Dinge am Kaiserstuhl während der Baden-Baden Wine Challenge eskaliert waren. Es wäre beinahe in einer Katastrophe geendet, sowohl für ihn wie auch für Henry Meyenbeeker, mit dem er die Sache durchgestanden hatte. An seinen Besuch bei Henry und seiner Frau Isabella in La Rioja dachte er gern. Im folgenden Jahr waren der Freund und seine Frau bei ihnen auf der Tenuta Vanzetti zu Gast gewesen. Es war eine gute und interessante Woche gewesen, in der sie nur herumgefahren waren, Weingüter besucht und Wein probiert hatten, einfach aus Lust und Laune, ja, ein wenig Kultur hatte sein müssen, Uffizien, einige Palazzi, das »Caffè Gilli«, das niemand betreten durfte, der Gefahr lief, sein oder ihr Verlangen nach Pralinen nicht beherrschen zu können … und über seine Flucht aus dem Café auf dem Motorrad lachten die alten Kellner dort noch heute.
Ihm brummte der Kopf, die Sonne im Gesicht zu spüren, tat gut, und er nahm die Sonnenbrille ab. Viel zu fotografieren hatte es da oben nicht gegeben, jedenfalls nicht das, was ihm vorgeschwebt hatte. Aber er stand erst am Anfang. Das einzig lohnenswerte Objekt, im Prospekt des Weinguts groß herausgestellt und von verschiedenen Seiten fotografiert, war der neue Verkostungsraum. Er hatte sich – nach allen Seiten offen – wie ein Glaskasten dargestellt. Durch die Abbildungen im Prospekt war bei Frank der Eindruck entstanden, das gesamte Weingut sei in dieser Weise modernisiert worden statt nur der Teil, der vom Publikum zwecks Verkostung und Weinverkauf besucht wurde. Als Theresa ihn dorthin führte, hatte sich bei ihm sofort der Eindruck eingestellt, die Menschen hinter dem Glas wären die Fische im Aquarium. Dieser Eindruck wurde dadurch verstärkt, dass man durch den Raum hindurchschauen konnte und dahinter gleich die Rebzeilen begannen, wie die Fototapete mit Wasserpflanzen hinter dem Aquarium.
An einer Weinprobe war Frank nicht vorbeigekommen. Vielleicht hatte er auch deshalb das Gefühl, sein Schädel sei weich und das, was sich darin befand, sowieso. Er war das Probieren nicht mehr gewohnt, er schluckte zu viel dabei. Da war wieder das Gesicht der jungen Frau, Theresa, eigentlich mehr ein junges Mädchen. Er sah ihr schmales, blasses Gesicht mit den wachen blauen Augen, mit den verzweifelten Augen, die sich in jenen Momenten, in denen sie über den verstorbenen Vater sprach, verdunkelten. Zerbrechlich hatte sie auf ihn gewirkt und gleichzeitig energisch. Die leicht hochgezogenen Augenbrauen mochten Ausdruck ständiger Skepsis sein. Ehrgeizig war sie auch, möglicherweise mehr als das. Ihr ausgeprägtes Kinn ließ darauf schließen. Ähnlichkeit mit ihrem Vater, so wie Frank ihn in Erinnerung hatte, nahm er kaum wahr. Mit siebzehn hatte sie die Matura mit Auszeichnung bestanden, zwei Jahre auf einem Weingut praktiziert, dann drei Jahre studiert, und jetzt diente sie seit einem Jahr ihrem Chef auf dem Weingut Johannishof als rechte Hand. Es war von ihrem Naturell her nur zu verständlich, dass sie das väterliche Weingut für sich beanspruchte. Aber mit welchem Recht? Um das zu klären, war sie vorhin nach Bozen aufgebrochen, wo sie sich mit einem Fachmann beraten wollte. In der Auseinandersetzung stand allen Beteiligten noch vieles bevor. Die Anwälte rieben sich bereits die Hände, fürchtete Frank und war froh, kein Akteur in dieser undurchsichtigen Gemengelage zu sein.
Er fuhr weiter, überquerte die Landstraße, die oberhalb des Sees die Orte miteinander verband, die er in den nächsten Tagen aufsuchen würde, von Margreid im Süden bis nach Eppan und über Terlan und Meran weiter ins Vinschgau. Das Eisacktal kannte er lediglich von der Autobahn her, vom Brenner kommend zwischen verrosteten Leitplanken hinabrasend. Genauso häufig hatte er dort im Stau gestanden, aber weder in Klausen noch in Brixen hatte er die Straße verlassen. Diesmal würde er die Landstraßen nehmen, denn das Kloster Neustift in Brixen stand auf dem Programm.
Unten am Kalterer See war kaum noch ein Parkplatz zu finden. Die Touristensaison hatte begonnen: Menschenmassen quollen aus Bussen und wälzten sich auf »Gretl am See« zu. Das riesige Gasthaus schien sie alle zu schlucken, bot unter Sonnenschirmen an den in Reihen aufgestellten Tischen für alle Platz. In Ermangelung einer besseren Alternative beschloss Frank, sich hier auf einen Kaffee niederzulassen. Oder doch lieber der Eisbecher mit Erdbeeren? Direkt am Ufer fand er einen freien Tisch und hatte eine wunderbare Aussicht auf den Tretbootverleih, und rechts lag malerisch der Campingplatz. Aber der Kaffee war in Ordnung und die Erdbeeren frisch. Sicher waren es italienische, das bedeutete, dass man großzügig mit Spritzmitteln umging. Das Eis hingegen war nicht italienisch, das kannte er besser und dachte an seine Eisdiele »La Curva« in Panzano in Chianti. Nur allzu viele kritische Gedanken durfte man sich nicht machen, sie verleideten den Genuss.
Der stellte sich wirklich nicht ein, denn immer wieder kam Frank das Gespräch im Barriquekeller in den Sinn. Er selbst hatte bei seiner Scheidung Glück gehabt. Bei ihm als freiberuflichem Fotografen war nichts zu holen gewesen. Für die Alimente hatte es immer gereicht und auch für Christines separates Zimmer in seiner bescheidenen Hamburger Wohnung. Je älter seine Tochter geworden war, desto häufiger und länger wohnte sie bei ihm. Bei Kannegießer hingegen schien alles maßlos kompliziert. Zwei Gruppen trafen aufeinander, die sich Theresa nach nicht einmal das Schwarze unter den Nägeln gönnten. Ein jahrelanger Rechtsstreit war abzusehen, zumal der neue Ehemann der ersten Frau, Loretta hieß sie, selbst Jurist sein sollte. Zweiundzwanzig Hektar? Das waren zweiundzwanzig Millionen Euro. Wieso verkauften sie nicht einfach und teilten? Zwei Frauen, jeweils zwei Kinder, das waren sechs Personen. Jeder hätte 3,6 Millionen gehabt. Das war nicht genug? Waren alle krank? Gab es denn kein Testament? Theresa hatte es nicht erwähnt.
Der Blick auf Tretboote war nicht sonderlich spannend, und der Lärm der Gäste in seinem Rücken hielt Frank vom klaren Denken ab. Es war auch unwichtig, was er dachte, denn das Theresa gegebene Versprechen sah er als höfliche Geste. Sie würde es kaum anders aufgefasst haben, sagte er sich, und konnte nicht erwarten, dass er sich wieder meldete. Frank überließ Gretl gern dem See und den Kuchen verschlingenden Massen und machte sich auf den Rückweg nach Bozen.
Er kannte die Stadt nicht, war zum ersten Mal hier und hatte am Vortag den Weg zu seinem Quartier nur mithilfe des Navigationsgeräts gefunden. Nicht anders erging es ihm jetzt, er wusste nur, dass er von Süden in die Stadt kommen würde und zur Sparkassenstraße musste. Die Wohnung seines Freundes Matteo lag in der Nähe des Siegesplatzes mit dem pompösen Denkmal. Mit ihm hatten Italiens Faschisten 1928 die Annexion Südtirols nach dem Ersten Weltkrieg gefeiert – und das, was sie für die »Italianität« hielten. Was für ein Wort! »Italianität«!? Es hörte sich so grässlich an wie »Deutschtum« oder »Leitkultur«, diese Begriffe aus dem ›Wörterbuch des Unmenschen‹. Er konnte sich kaum ein Land in Europa vorstellen, das in seinem Inneren zerrissener war als Italien: Stadt gegen Stadt, Provinz gegen Provinz, der Norden gegen den Süden, Familie gegen Familie … Was er heute gehört hatte, passte genau dazu.
Ihm war unverständlich, als er gestern den Wagen dort in Sichtweite abgestellt hatte, dass niemand diesen Marmor gewordenen Ausdruck italienischen Größenwahns abgerissen hatte – endlich mal ein sinnvoller Einsatz für Dynamit und Semtex.
Den silbernen Lancia, den er sich bei Antonia für seine Reisen ausborgte, stellte Frank in der Nähe des Denkmals ab und musste auf dem Weg zu seiner momentanen Bleibe wieder daran vorbei. In der gleißenden Nachmittagssonne stand der Marmor, die Säulen als Faschinenbündel dargestellt, dem Symbol römischer Herrschaft, das den damals herrschenden Konsuln und Prätoren vorangetragen wurde. Erst außerhalb der Stadtgrenzen Roms wurde ein Beil mit der Schneide nach außen hinzugesteckt, das Zeichen, über Leben und Tod zu herrschen. Was sollten hier, weit weg von Rom, die Beile in den Faschinenbündeln der Bevölkerung von Bozen demonstrieren? Bisher hatte Frank sich nie für Südtirol interessiert, jetzt hatte er gelesen, dass in der Stadt siebzig Prozent der Bevölkerung italienischer Abstammung sein sollten. Da erinnerte er sich, was Theresa über den Italiener gesagt hatte, den Rechtsanwalt, und dass die erste Familie Kannegießer den jüngsten Sprössling aus der zweiten Ehe Kannegießers, Sohn Marco, herabwürdigend als Italiener bezeichnet haben sollte. Hatten es die Südtiroler noch immer nicht verwunden, nicht den Anschluss an das österreichische Tirol gefunden zu haben? Waren die Demütigungen der italienischen Besatzung noch längst nicht vergessen? Die Idee Europas war tatsächlich in der Krise …
Auf der Talferbrücke blieb er einen Moment stehen und blickte durch das Flusstal auf die Berge, die am nahen Stadtrand steil anstiegen und die Stadt umschlossen, nur zu Eisack und Etsch hin offen. Inzwischen liebte Frank die Natur, er hatte bewusst seine Wandlung vom Stadt- in einen Landmenschen wahrgenommen. Dauernd in der Stadt zu leben, schien ihm inzwischen unmöglich. Ebenso eine dauerhafte Rückkehr in seine Geburtsstadt Hamburg, in der er sein berufliches Leben begonnen hatte. Aber mal ein wenig Stadtluft zu atmen, zumindest die einer Kleinstadt wie Bozen, eine Menschenmenge um sich zu haben, Cafés, Kino, Theater, einen Bahnhof, beim Einschlafen vor dem Fenster die Stimmen vorüberschlendernder Menschen zu hören, das Lachen junger Leute, das Schimpfen der Nachbarn, das vermisste er manchmal auf seinem Landsitz. Antonia hatte für diesen Mangel keinerlei Verständnis. Sie war froh, wenn sie nach einer Reise nach Hongkong oder Boston, wo sie ihre Weine vorgestellt hatte, wieder durch ihre Reben streifen konnte, den typischen Geruch von Ester in ihrem Keller wahrnahm und aufschreckte, wenn ein Auto vor dem Haus hielt oder ein Lastwagen Wein abholte.
An der Ecke vor dem Archäologiemuseum, wo die Überreste des im Eis des Ötztals gefundenen Menschen aufbewahrt wurden, wandte sich Frank nach links und betrat das sechste Haus auf der rechten Seite. Hier hatte sich sein Freund Matteo, Fotograf wie er, unterwegs mit einer Theater-Compagnie, vor Jahren eine Wohnung gekauft und sie ihm für die Dauer seines Aufenthaltes überlassen. Diese Unterkunft war ihm weitaus lieber als ein unpersönliches Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung. Es gab kleine Restaurants in der Nähe, die Frank nacheinander ausprobieren würde. Seine Kochkunst hielt sich in Grenzen, die Kochkünste Antonias hingegen waren grenzenlos. Aber er lernte. Andererseits würde er sicher Empfehlungen der hiesigen Kellereibetreiber erhalten, welcher Wein zu dieser oder jener Speise passe. Demnach wäre für Abwechslung gesorgt. Zur Not genügte ihm auch eine gute Pasta mit einem Basilikum-Pecorino-Pesto. Das bekam er noch selbst hin.
Im Flur, der mit Matteos großformatigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen tapeziert war – sie zeigten vor allem Theaterszenen und Essen –, stellte Frank erleichtert den Fotorucksack ab, brauchte einen Moment, bis er im Küchenschrank einen Teebeutel fand, und streckte sich auf dem Sofa aus. Nach zwei Stunden wachte er auf, der Teebeutel hing noch in der Tasse, der Tee tiefschwarz, kalt und untrinkbar. Am Morgen hatte er es versäumt, eine Bestandsaufnahme der Lebensmittelvorräte zu machen. Schnell holte er es jetzt nach, um sich anschließend auf die Suche nach einem Supermarkt zu machen, der auch sonntags geöffnet hatte.
Er fand alles, was er für die Soße benötigte, und auch einen trinkbaren Tee und kehrte zurück in die Wohnung in der Sparkassenstraße, ein gewöhnungsbedürftiger Name, der ihn erheiterte. Frank brauchte lange, bis er sich durch das Chaos der Küchenschränke gegraben und die entsprechenden Gerätschaften gefunden hatte. Ein fremdes Ordnungs- oder Unordnungssystem war immer eine Herausforderung. Frank pflegte seine eigene Systematik, daher würde Matteo bei seiner Rückkehr in die Wohnung nichts mehr wiederfinden.
Ein Spaghettikocher war vorhanden, die Flasche mit dem Extra Vergine di Oliva war zur Hälfte gefüllt, es gab ein Stück steinharten Parmesan und eine Reibe. Aber Frank hatte ja den Pecorino mitgebracht. Als er beginnen wollte, den Knoblauch zu hacken, hörte er ein Geräusch an der Wohnungstür. Kam Matteo etwa zurück? Waren es Einbrecher, die von seiner Abwesenheit wussten? Ein paar Ereignisse in seinem Leben hatten ihn vorsichtig und misstrauisch werden lassen. Antonia hatte sogar ein Jagdgewehr im Haus, mit dem er einige Male geschossen hatte. Aber falls sie in ihrer ländlichen Einsamkeit überfallen worden wären, hätte ein Griff zur Waffe sie auch nicht gerettet.
Mit dem Küchenmesser in der einen Hand und seinem Smartphone in der anderen schlich Frank zur Wohnungstür. Jemand machte sich am Schloss zu schaffen. Sein Schlüsselbund steckte von innen. Er machte einen Schritt zurück hinter die Wand, jetzt war nicht mehr nur das Holz der Tür, sondern Stein zwischen ihm und dem Unbekannten.
»Chi è?«, fragte er laut auf Italienisch. »Matteo non c’é!«
Eine männliche Stimme würde jeden Einbrecher abschrecken. Doch statt einer Antwort auf seine Frage, wer da sei und dass Matteo nicht zu Hause sei, stellte eine weiche Frauenstimme ihrerseits eine Frage:
»Sei tu, Franco? Sono io – Marcella, la ragazza di Matteo!«
Seine Freundin? Frank legte die Sperrkette vor die Tür und öffnete sie.
»Sempre così prudente?« Ob er immer so vorsichtig sei, fragte die Dame, die vor der Tür stand. Sie war allein, wovon sich Frank mit einem kurzen Blick ins Treppenhaus überzeugte. Er öffnete die Tür.
La ragazza di Matteo, hatte sie gesagt. Nach dieser Erklärung hatte er eine junge Frau erwartet, eine ragazza, aber keine elegante, umwerfend schöne Frau um die fünfzig mit schwarzem, glänzendem Haar. Diese hier würde auch mit siebzig nicht unsichtbar sein.
»Es freut mich sehr, dass wir uns mal kennenlernen. Matteo hat viel von dir erzählt. Und deine Bücher kenne ich auch. Schön.« Sie drängte ihn selbstbewusst zur Seite, um die Einkaufstaschen in der Küche abzustellen.
Frank war von ihrem Anblick viel zu überrascht, um passende Worte zu finden. Mit so einer Frau hatte er nicht gerechnet.
»Sollen wir lieber Deutsch sprechen?«, fragte sie mit einem Hauch von einem Akzent und hielt ihm die Hand hin. »Du sagst ja gar nichts.« Kopfschüttelnd stand sie vor ihm.
Kurz drückte er ihre Hand und zog sie schnell zurück, aber von dem Blick in ihre Augen konnte er sich nicht losreißen. Dass ein Fotograf bei der Wahl seiner Liebsten sich von seinen ästhetischen Vorstellungen leiten ließ, war verständlich, allerdings war es selten, dass sie sich in ihre Modelle verguckten. Marcella hätte auch heute auf jedem Laufsteg Aufsehen erregt.
»Matteo rief mich an und meinte, ich solle ein wenig für dich sorgen. Ohne deine Frau seist du in Bezug auf Essen ziemlich hilflos. Ich habe heute zufällig mal Zeit. Ich habe das mitgebracht, was man als Grundausstattung bezeichnen könnte, aber wie ich sehe, scheinst du nicht ganz aufgeschmissen zu sein.«
Sie überblickte das von Frank angerichtete Chaos, sah die Pilze, das Öl, den Knoblauch und die Zucchini, lächelte verzeihend über die offen stehenden Schranktüren und schloss sie. »Überlass das mir, zumindest heute. Ich kenne mich hier aus. Wenn du willst, bringe ich dir was bei, ich gebe nämlich Kochkurse nach Feierabend. Nach der Arbeit in der Fakultät brauche ich was Handfestes, was zum Sehen und zum Riechen. Design und Künste müssen anfassbar sein. Seit meine Kinder erwachsen sind, jetzt koche ich für Matteo, auch beruflich. Und du …«, sie griff in eine ihrer Einkaufstaschen und zog eine Flasche Rotwein heraus, »… du machst diesen Wein schon mal auf.«
Bereits bei der Ansicht des Rückenetiketts schwante Frank etwas, und als er die Flasche drehte, sah er den Namen der Kellerei am unteren Rand des blauen Etiketts: Tenuta Vanzetti. Es war die vier Jahre alte Riserva, ein großartiger Jahrgang.
»Ich bin über alles im Bilde. Matteo und ich sind zwar auch Südtiroler, aber die Brotzeit mit Speck, Schinken, Wurst und Schüttelbrot wiederholt sich. Wir lieben die italienische Küche. Du weißt, dass Matteo eigentlich Food-Fotograf ist, Spezialist für Lebensmittelaufnahmen für Magazine und Kochbücher?«
Frank kannte Matteos Aufnahmen. Ihr Anblick machte hungrig.
»Dass ich seine Food-Stylistin bin, wusstest du nicht? Nein? Ich arrangiere die Lebensmittel, das Essen, ich bereite die Gerichte zu, er fotografiert sie nur. Na ja, ich arbeite schon unter seiner Anleitung. Ich muss ja wissen, was er will, und unsere Ideen mischen sich. Steh nicht rum, mach den Wein auf und stell ihn kalt. Ich habe gehört, dass man euren Sangiovese kühl trinken soll.«
Der nach hinten raus liegende Balkon war gerade groß genug für einen gut gedeckten Tisch und zwei Stühle. Die Flasche war leer geworden, und dass der Chianti Classico kein Heimweh hervorgerufen hatte, lag an Marcellas Anblick. Die Espressomaschine funktionierte, und der Abend war lau, es wurde dämmrig, die Stimmen aus der Nachbarschaft waren nicht zu laut, und vom Straßenverkehr hörten sie nichts. Es hätte der perfekte Abend sein können, um sich zu verlieben, aber Frank war bereits verliebt. Immer dann, wenn er sich besonders wohlfühlte, fehlte ihm Antonia umso mehr. Gleichzeitig wunderte er sich, wie gut er sich mit Marcella verstand, es war ähnlich wie mit ihrem Mann, ihrem ragazzo, zu ihm war die Sympathie auch spontan entstanden.
Das Gespräch drehte sich um die Umstände, die Frank veranlasst hatten, seinen Lebensmittelpunkt von Hamburg ins Chianti zu verlegen. Rein zufällig hatte er vor dreizehn Jahren einen Auftrag bekommen, Weingüter für einen Weinführer zu fotografieren, obwohl er vom Wein und Weinbau absolut nichts verstanden hatte. Dann traf er Antonia, leckte Wein (von dem Blut sprach er besser nicht) und war geblieben.
Selbstverständlich sprachen sie über ihre Kinder, ein immer wiederkehrendes Thema. Marcellas Söhne waren jünger als seine Tochter Christine. Von ihnen hatte Marcella als Alleinerziehende viel gelernt, vor allem wie Männer ticken, und auch, sich gegen sie durchzusetzen. Es hatte ihr nichts von ihrem Charme genommen. Wirklich selbstbewusste Frauen besaßen Franks Erfahrung nach sowieso viel mehr davon.