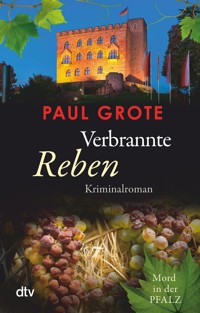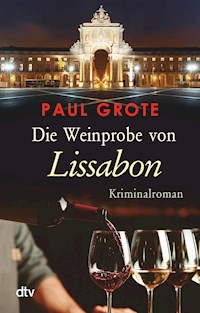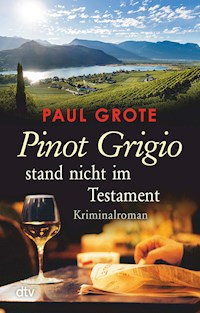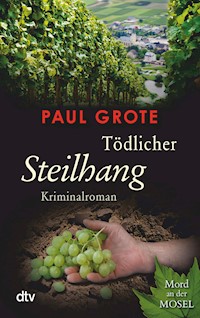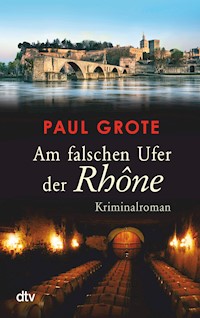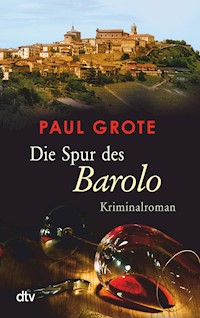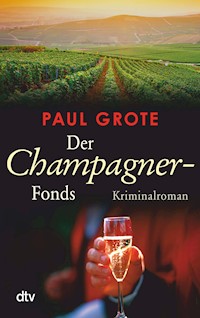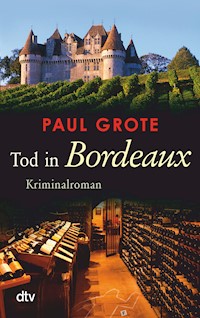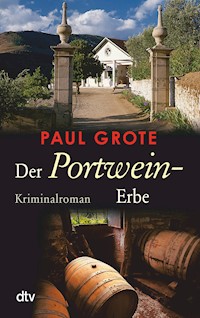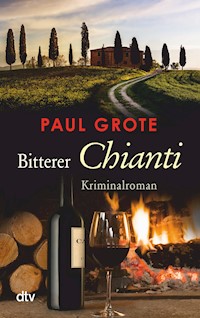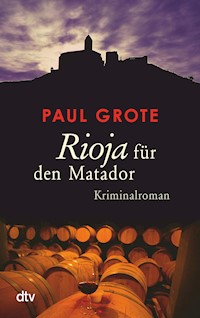Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Europäische-Weinkrimi-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Der Tod der Weinkönigin Gestern noch strahlende Siegerin bei der Wahl, heute findet man die fränkische Weinkönigin tot in einer Würzburger Diskothek, gestorben an einer Drogenüberdosis. Motiv und Hergang der Tat geben der Polizei Rätsel auf. Nicolas Hollmann hat sich seinen Urlaub in Franken eigentlich anders vorgestellt. Mit seiner Familie auf Verwandtenbesuch in Würzburg wollte er, Besitzer eines Weinguts am Rio Douro, während der Ferien mehr über Weißwein und dessen Anbau erfahren. Doch nun wird er von verschiedenen Seiten bedrängt, bei seinen Winzerbesuchen Hintergründe des Falls zu recherchieren. Und tatsächlich stößt er auf alte Feindschaften …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Grote
Königin bis zumMorgengrauen
Kriminalroman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe 2014
© 2014 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Umschlagkonzept: Balk & Brumshagen
Umschlagfotos: mauritius images/Manfred Mehlig,
plainpicture/Mato und Fränkischer Weinbauverband e.V.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
eBook ISBN 978-3-423-42340-3 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-21535-0
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de/ebooks
Dieser Roman ist allen jüdischen
Weinhändlern aus Kitzingen gewidmet
»Alle Geschöpfe töten – Ausnahmen scheint es nicht zu geben; aber auf der Liste ist der Mensch der Einzige, der zum Vergnügen tötet; er ist der Einzige, der aus Bosheit tötet, der Einzige, der aus Rache tötet. Also – auf der ganzen Linie ist er das einzige Geschöpf, das eine niedere Gesinnung hat.«
Mark Twain
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Danksagung
Kapitel 1
So konnten sie unmöglich weitermachen. Er hatte sich das alles ganz anders vorgestellt – obwohl Rita ihn gewarnt hatte. Aber anscheinend musste er ihre Familie selbst erleben, um zu verstehen, was sie aus Würzburg vertrieben hatte. Nicolas hatte versucht, sie zu besänftigen, er hatte vermitteln und die Parteien auseinanderhalten wollen, was auf ganzer Linie gescheitert war. Rita hatte seine Vermittlung in ihrer Wut als gegen sie gerichtet empfunden, als wolle er ihr in den Rücken fallen, statt bedingungslos Partei für sie zu ergreifen. Aber genau das hatte sie von ihm erwartet, nicht mehr und nicht weniger – ja, sogar verlangt.
»Du stehst auf ihrer Seite!« Rot vor Zorn war sie gestern geworden, messerscharf waren die Worte gekommen, er hätte sich verletzt zurückziehen können, aber verletzt war sie, das hatte er in diesem Moment begriffen, nichts von den alten Konflikten war geklärt.
Vor der Reise war ihm das Ausmaß des Zerwürfnisses nicht klar gewesen. Dass da etwas schwelte, dass auch nach zehn Jahren Abstand noch Glut unter der Asche war, das wusste er, Rita hatte nie einen Hehl aus dem miserablen Verhältnis zu »ihren Leuten«, wie sie die Familie nannte, gemacht. Dass jedoch ein Windhauch genügte, um die Glut in prasselnden Flammen aufgehen zu lassen, hatte er nicht geahnt. Hätte er das schon vorher begriffen, wäre er nie und nimmer hergekommen, er hätte die Reise nach Würzburg niemals angetreten. Er hätte wie immer seine Kunden besucht und wäre wieder nach Hause geflogen.
Rita war eine durch und durch selbstständige Frau, und das schätzte er an ihr. Sie traf ihre Entscheidungen ruhig und überlegt, sie holte seinen Rat ein und auch den anderer, in Bezug auf die Beurteilung von Menschen besonders den von Otelo. Ihr provador, eine Art Weinmeister und die Nase seiner Quinta, war für sie zu einem Mischwesen aus Vater und Großvater geworden, und so hatte sie ihre kleine Agentur für Weinreisen durch Portugal innerhalb von fünf Jahren Schritt für Schritt aufgebaut und auf stabile Beine gestellt, seit einiger Zeit mithilfe seines Freundes Happe. Jetzt begannen beide, ihren Wirkungsbereich mithilfe von Henry Meyenbeeker nach Spanien auszudehnen. Der Journalist kannte so ziemlich jede gute Kellerei auf der Iberischen Halbinsel. Er war eine große Hilfe für Rita.
Sie konnte Argumente abwägen, sie schätzte Widerspruch – aber nicht den ihrer Eltern! Bei Ulrike und Hans Berthold schwang bei jedem Wort ein Vorwurf mit, etwas Beleidigtes, Gekränktes, weil ihre Tochter anders geworden war als sie, das Gegenteil von dem, was sie sich gewünscht hatten. Aber was hatten sie sich gewünscht? Und auch er, der Schwiegersohn, war alles andere als ein Wunschkandidat. Unter finanziellen Gesichtspunkten schien er der lange ersehnte Glücksfall zu sein, aber da sich seine Einstellungen mit denen ihrer Tochter deckten, spürte er hinter der aufgesetzten Freundlichkeit eine tiefe Missbilligung und jene Überheblichkeit, die er als die Verbitterung der Zukurzgekommenen interpretierte. Offene Verachtung hatte Ritas Vater ihm nur gezeigt, als ihm klar wurde, dass man mit ihm nicht einen einzigen Satz über Fußball wechseln konnte, nicht einmal über den FC Bayern München, geschweige denn über den FC Porto. Und Wein war für Berthold kein Thema.
»Ich bin aus Ulm – und da trinkt man Bier!« Irgendein Stolz und der bayerische Akzent schwangen mit.
Nicolas Hollmann wälzte sich auf die linke Seite, vergrub den Kopf im Kissen, legte eine Hand über das freie Ohr, um die zankenden Stimmen, die von unten heraufschallten, nicht hören zu müssen. Aber die Hand rutschte herunter, und er hatte wieder die spitzen Stimmen der beiden Frauen in seinem Kopf. Mutter und Tochter. Er sah sie vor sich, unten am Küchentisch, beide einen Kaffee in der Hand, beide im Morgenmantel, und es vergingen keine zehn Minuten, bis sie sich wieder in der Wolle hatten. Rebecca hatte es nicht ausgehalten, war sofort wieder raufgekommen und zu ihm ins Bett gekrochen. Auch ihr war diese Situation unmöglich zuzumuten, zumal die Frau, die von ihr »Oma« genannt werden wollte, eine völlig fremde Person war, deren Zärtlichkeiten – für sie Zudringlichkeiten – sie sich konsequent entzog. Frau Berthold begriff das nicht und war natürlich beleidigt, sie war es eigentlich immer. Vier Tage kannte sie das kleine Mädchen persönlich und erwartete kindliche Liebe, oder das, was sie dafür hielt. Und er sollte sie »Mutter« nennen? Dabei waren Ritas Eltern nicht einmal zu Rebeccas Geburt auf ihrem Weingut am Rio Douro erschienen, obwohl sie ihnen die Flugtickets hatten spendieren wollen. Die Begründung war, natürlich durch die Blume, dass Rita und er weder standesamtlich noch kirchlich verheiratet seien und das Kind nicht von einem Priester taufen lassen wollten.
Wahrscheinlich streiten sie wieder mal über dieses Thema, dachte Nicolas und konnte sich nicht erinnern, wann er zuletzt mit einer derart üblen Laune den Tag begonnen hatte. Nicht einmal Dauerregen zur Weinlese deprimierte ihn so sehr. Er spürte plötzlich, wie Rebecca seine Hand vom Ohr wegzog und ihn anpustete. Er mochte es nicht, es kitzelte, sie liebte es, zumal er heftig reagierte, und sie lachte ihn an.
»Holst du mir Kakao?«
»Hast du dir die Zähne geputzt?«
Rebecca kletterte aus dem Bett und rannte ins Badezimmer. Nicolas brauchte etwas länger, um sich in dem kleinen Raum den Bademantel überzuziehen. Die Enge dieses Einfamilienhauses war der räumliche Ausdruck der hier herrschenden geistigen Verhältnisse. Doch solche Gedanken behielt er tunlichst für sich, er wollte die Gastgeber nicht beleidigen und Rita nicht zusätzlich verletzen. Aber war man selbst nicht immer der Maßstab seiner Welt? Rita und er lebten mit ihrem Kind hoch auf dem Berg, traten morgens auf die Terrasse ihres Hauses und hatten den Himmel über sich, den Fluss unter sich, die Weinberge um sich, und unweigerlich zog ein Lächeln auf seine Lippen, wenn seine Tochter auf die Brüstung kletterte und sich an ihm festhielt. So erlebten sie den Sonnenaufgang, wenn dort, wo der Fluss herkam, die Sonne über den Horizont stieg und ihr Feuer über die gewaltigen Berge und die Rebstöcke schüttete. Wie ihm das fehlte, merkte er hier bereits nach wenigen grauen Tagen, obwohl es in dieser Jahreszeit auch in Portugal nicht besonders warm war, aber zumindest war es wärmer als hier im kalten Nieselregen.
Mit aufgesetztem Lächeln trat er in die Küche und legte Ritas Mutter freundschaftlich die Hand auf die Schulter, was ihm im Gegenzug ein kaltes Lächeln eintrug, das sofort wieder in sich zusammenfiel und Rita verblüfft dreinschauen ließ. Ein Augenzwinkern stellte alles klar.
»Ein Glas Kakao fürs liebe Kind«, sagte er und ging zum Kühlschrank.
Sofort sprang Frau Berthold auf. »Der muss aber warm gemacht werden. Kalte Getränke sind für Kinder ungesund!« Wieder stand ein Vorwurf im Raum. Sie riss ihm die Milchpackung aus der Hand.
»Aber sicher doch.« Was für ein beschissener Morgen, dachte Nicolas, lächelte weiter und beschwichtigte Rita, die bereits zur Entgegnung ansetzte, mit seinem Blick. Da sie ständig mit Reisegruppen von Weinenthusiasten unterwegs war, hatten Dona Firmina, ihre Haushälterin, und Otelo, sein Lehrmeister in den Dingen des Lebens, die Stelle der Großeltern übernommen und sich mehr um Rebecca kümmern können. Und wenn sie nicht im Kindergarten in Peso da Régua war, begleitete sie ihn, im Keller, im Weinberg oder im Büro. Rebecca. Während er auf das Ceranfeld mit dem Milchtopf starrte, erinnerte er sich an die erste Reaktion der Großeltern.
»Rebecca – ist das nicht ein jüdischer Name?« Der vorwurfsvolle Unterton war nicht zu überhören gewesen.
»Nein, alttestamentarisch«, hatte er geantwortet und hätte den Telefonhörer erwürgen können. Da waren ihm die Gleichgültigkeit seines Vaters und die aufgeregte Freude seiner selbstverliebten, seit zwanzig Jahren mit einem neuen Mann verheirateten Mutter lieber. Er wusste, dass er von beiden außer Geld nichts zu erwarten hatte. Immerhin etwas.
»Übrigens habe ich meine Beziehungen spielen lassen«, sagte Frau Berthold und reckte wichtigtuerisch den Kopf, drehte ihn leicht zur Seite, riss die Augen auf und machte mit ihren schmalen Lippen einen spitzen Mund. »Ich habe dir etwas verschafft, mein lieber Nicolas, was nicht einmal ich mir bisher geleistet habe: eine Einladung zur Wahl der Fränkischen Weinkönigin!« Jetzt nickte sie zur Selbstbestätigung zweimal langsam. »Du wirst zur Jury gehören! Ich hätte keine bekommen, da ich nichts von Wein verstehe, aber da du sozusagen mein … äh … Schwiegersohn bist und ein wichtiger ausländischer Weinproduzent, ist das was anderes.«
»Und ich?«, fragte Rita. »Für mich hast du keine Karte?«
»Kindchen, wieso sollte jemand wie du unsere Weinkönigin wählen?«
Rita hasste es, wenn sie »Kindchen« genannt wurde.
»Du hast ja nichts mit Wein zu tun, du bist ja nur Reiseleiterin. Aber Nicolas, der wird schon beurteilen können, was gut ist für unser Frankenland, wen er zu wählen hat, nicht wahr, Nicolas? Unsere Kandidatin ist Anneliese aus Escherndorf, Anneliese Fünfinger! Ich hoffe, du wählst richtig. Ich werde natürlich unter den Zuschauern sein. Ich habe mir eine Besucherkarte geleistet.« Jetzt heischte sie nach Dankbarkeit und nach einer Umarmung.
»Toll!« Nicolas gab ihr beides, der Kakao war heiß, und er konnte sich zurückziehen.
Sie konnten hier nicht bleiben, es käme über kurz oder lang zum Muttermord, davon war Nicolas überzeugt. Er selbst sah die Situation wesentlich gelassener. Ritas Eltern waren Fremde für ihn, ihr Verhalten nahm er als Teil der »Menschlichen Komödie«. Leider wurde es meistens langweilig, wenn man das Stück mehrmals gesehen hatte, noch dazu von schlechten Schauspielern aufgeführt. Rita hatte ihm viel über ihre Eltern erzählt, da oben, auf ihrem Berg, abends nach der Arbeit und nach Dona Firminas traumhaften Abendessen, die Beine auf der Brüstung, ein Glas Wein in der Hand. Mit zweieinhalbtausend Kilometer Abstand hatte sie frei über die Gründe sprechen können, weshalb sie nach Portugal gegangen war. Sie hatte sich dort sofort wohlgefühlt und war von ihrer Gastfamilie, bei der sie während ihres Studienjahres der Romanistik gewohnt hatte, gleich herzlich aufgenommen worden. Ihre guten Sprachkenntnisse hatten es ihr leicht gemacht, sich zu integrieren, und sie hatte die richtige Idee gehabt.
Er dagegen war vor einigen Jahren nach Portugal gekommen, um sein Erbe in Augenschein zu nehmen, ohne jedes Wissen um das Land und um den Wein. Dort wirklich angekommen war er erst, nachdem er sich quasi unter Lebensgefahr das Erbe seines Onkel Friedrich erkämpft hatte. Nicolas’ Eindrücke von Portugal waren längst nicht so positiv wie die von Rita, ziemlich schrecklich sogar, aber war nicht das Leiden ein Anlass zur Erkenntnis und zur Veränderung?
Ritas Vater war wie immer früh zur Arbeit gegangen, ein Behördenangestellter des mittleren Dienstes ohne jede Ambition, aber mit Pensionsanspruch. Nicolas wusste nicht, worüber er sich mit ihm unterhalten konnte, der Vater wollte nichts Neues erfahren, und die mitgebrachten Fotos, die sie auf seinem Rechner am ersten Abend angeschaut hatten, langweilten ihn. Es grenzte an ein Wunder, dass dieser Mann Rita das Abitur ermöglicht hatte.
»Er hat es nicht meinetwegen gestattet, sondern um vor den Nachbarn damit anzugeben.« Immer wenn sie von ihren Eltern sprach, bekam sie ein hartes Kinn, und die Augen flackerten. »Aber ein Sprachstudium wäre zu viel des Guten gewesen.«
Die Lehre im Reisebüro war gut genug gewesen. Studiert hatte sie danach, Romanistik, auf eigene Kosten, den Kredit zahlte sie immer noch ab. Sie hatte intuitiv ein Studienfach gewählt, das geistig genauso weit von ihren Ursprüngen entfernt lag wie ihr neues Zuhause. Dann, das hatte sie besonders geärgert, war genau das eingetreten, was ihr Vater vorhergesagt hatte: Sie war arbeitslos. Romanisten waren nirgends zu gebrauchen, und fürs Lehramt fehlten ihr die Nerven. Doch bereits auf der ersten Tour als Reiseleiterin für ihre ehemalige Lehrfirma war ihr die Idee gekommen, sich selbstständig zu machen und Weinreisen zu veranstalten.
Seine Quinta do Amanhecer, das Weingut der Morgenröte, war schon unter Friedrich Hollmann ein internationales Haus, jetzt machten Nicolas und seine Mitarbeiter weiter Portwein. Seine wichtigsten Kunden waren in Holland, Großbritannien und Frankreich, deutsche Kunden kamen erst an vierter Stelle. So war es auch mit den Gästen, die sie am Rio Douro empfingen.
Sie geht zu hart mit ihren Eltern ins Gericht, dachte Nicolas, ihr fehlt die Gelassenheit, sie lässt alles zu nah an sich heran, sagte er sich, sie ist längst nicht fertig mit ihnen, und er ärgerte sich, dass er nicht wieder einschlafen konnte, aber die Stimmen von unten drangen durch die Wände, sie schwollen immer dann an, wenn seine Gedanken leiser wurden und verstummten. Ja, sie mussten hier weg, möglichst bald, für Rita war es in jedem Fall besser, und Rebecca fühlte sich bedrängt, ihre Großeltern machten ihr Angst, wenn sie ihr drohten – und das für eine angebrachte Erziehungsmethode hielten. Derartige Prinzipien hatten sie allem Anschein nach aus dem letzten Jahrhundert herübergerettet. Nur wohin sollten sie gehen, wo sollten sie bleiben?
Sechs, jetzt noch fünf Wochen im Hotel würden teuer. Zurück nach Portugal konnten sie vorerst nicht. Rita hatte Besuche bei diversen Reisebüros vereinbart, um ihr Projekt vorzustellen, sogar in Wien und Graz. Für ihn stand die Düsseldorfer Weinmesse auf dem Plan, um seine Weine zu präsentieren. Neben deutschen Händlern suchten Weinaufkäufer aus der ganzen Welt dort ihr Sortiment zu erweitern. Sie alle waren besonders jetzt, in der für Portugal so dramatischen Krise, wichtige Abnehmer. US-Einkäufer, die in Portwein verliebten Briten und Australier traf er auf der London International Wine and Spirits Fair Ende Mai. Außerdem gab es jede Menge Verabredungen mit Weinhändlern und eine abendliche Präsentation, sein Terminkalender war randvoll.
Wo verdammt sollten sie mit Rebecca bleiben? Es war falsch, sich auf Ritas Mutter verlassen zu wollen, die tagsüber auf das Kind achtgeben wollte. Nein, seine Tochter würde er der Frau nicht überlassen. Dieser Gedanke brachte Nicolas wieder auf die Beine.
Das Badezimmer, für zwei Personen ausgelegt, früher mal für vier, als Rita hier noch mit ihrer Schwester gelebt hatte, war eng und hätte dringend einer Renovierung bedurft. Und es roch nach einem längst aus der Mode gekommenen Aftershave, beinahe wie ein Desinfektionsmittel. Nicolas beeilte sich mit Duschen und Rasieren und saß fünfzehn Minuten später am Frühstückstisch, wenn man den so nennen konnte, mit Graubrot, Butter und Marmelade und dem schrecklichen Filterkaffee. Man hätte das bei gutem Willen als Unwissenheit abtun können, ihm, der im weitesten Sinne mit Geschmack und Düften arbeitete, der ständig auf der Suche danach war, sich zu verbessern, Derartiges vorzusetzen. Als er die Lebensmittel eingekauft hatte, die Rita und er schätzten, hatte Frau Berthold natürlich wieder die Beleidigte gespielt.
»Unser Essen ist euch wohl nicht gut genug?!«
Die Erklärung, dass ihr Frühstück deshalb so üppig sei, weil es bis abends vorhalten müsse, wurde nicht akzeptiert. Abends gab es eine fränkische Brotzeit.
Zum Original gehörten roter und weißer Presssack, dazu kam eine gute Leberwurst, ein mild geräucherter Schinken sowie ein Stück Göttinger, Pfefferbeißer und ein Ziebeleskäs. Leider hatte man sich bei den Bertholds auf Blutwurst kapriziert, die er verabscheute. Blut in der Speise war ihm zutiefst zuwider. Ritas Vater aß mittags im Amt, und ihre Mutter machte sich untertags »schnell etwas«.
»Wir werden zur Wahl allerdings nach Schweinfurt fahren müssen, Nicolas!« Ulrike Berthold kam übergangslos auf das Thema Weinkönigin zurück. »Nur eine halbe Stunde mit dem Zug. Es geht mittags los, abends sind wir wieder hier. Und zu essen und zu trinken gibt’s da auch. Es beginnt mit einem Sektempfang!« Bei diesen Worten spreizte sie sich, wuchs um zehn Zentimeter und blickte Rita, die in ihren Kaffeebecher starrte, von oben herab an. »Morgen bekomme ich die Eintrittskarten. Die Plätze sind nummeriert.«
»Und wer wird da gewählt?« Nicolas war die Einladung unangenehm. Mit dem Thema Weinkönigin hatte er sich nie beschäftigt, hatte nie eine kennengelernt, kannte lediglich Fotos, auf denen die meist blond gelockten jungen Frauen oder Mädchen mit pausbackigen Gesichtern und strahlendem Lächeln im Dirndl in eine Kamera blickten, umgeben von wichtigen Männern, die mindestens dreißig Jahre älter und fünfzig Kilo schwerer waren. Er hielt das Ganze für eine längst überholte Angelegenheit, überflüssig im modernen Wein-Marketing, so wie er es verstand. Aber in Zeiten der Auflösung überkommener Werte wurde das längst Überholte aus dem Keller geholt und aufpoliert. Doch vertrocknete Rettungsringe aus Kork trugen nicht bei rauem Seegang.
»Es gibt drei Kandidatinnen …« Frau Berthold nannte ihre Namen und spulte die Lebensläufe ab. Sie plapperte los, während Rita mit Rebecca im Badezimmer verschwand. Er ließ den Redeschwall über sich ergehen und wusste danach nichts mehr vom Gesagten, lediglich dass er sich nächsten Dienstag im Schweinfurter Konferenzzentrum einfinden sollte, nebst hundertfünfzig anderen Juroren, alles namhafte Leute aus der deutschen Weinwelt. Das war das Einzige, was ihn mit dieser überfallartigen Einladung versöhnte.
Diesen Quasi-Urlaub hatte er sich etwas anders vorgestellt. Bei der Arbeit musste er sich nicht abschirmen, er konnte sein, wie er war, sagen, was er dachte, und tun, was getan werden musste und wie er es für richtig erachtete. Er und seine Mitarbeiter waren aufeinander angewiesen, eingespielt, und alle zogen gern am gleichen Strang. Außerdem hatte Onkel Friedrich, der das Weingut gegründet hatte, zusammen mit seinem Freund Otelo, ein System der Gewinnbeteiligung eingeführt und damit einen Ansporn geschaffen.
Als Veranstalterin von Weinreisen hatte Rita es längst nicht so leicht, aber ihr stand sein Freund Happe zur Seite, und auf den war Verlass. Sie empfand die Mehrheit ihrer Gäste als angenehm. Einige Spinner waren darunter, Aufschneider gab es immer, aber die waren eher amüsant, als dass sie penetrant wurden. Die Besserwisser, die ihm sagten, wie er seinen Wein zu machen hatte, empfand er als die unangenehmsten. Rita brachte ihre Gäste im Kleinbus auf seine Quinta, wenn es um Portweine und die starken Roten vom Rio Douro ging. Wenn ihn jemand nervte, brachte er ihn mit Fachfragen zum Schweigen, dazu reichten meistens drei, die dem Besserwisser vor Augen führten, dass es noch viel zu lernen gab. Und wer blamierte sich schon gern vor anderen?
Auf all diese Details hatten Ritas Eltern bisher mit gleichgültigem Achselzucken reagiert – und jetzt überbrachte ihre Mutter die Einladung zur Wahl der Weinkönigin. Wozu das? Was bezweckte sie? Wollte sie ihm gefallen? Hatte sie erzählen dürfen, dass ihr zukünftiger Schwiegersohn in Portugal ein Weingut von sechsunddreißig Hektar besaß? Die Zahl hatte sie mehrmals wiederholt, und auch der Vater hatte die Ohren gespitzt. Mehr Land bewirtschafteten hier nur die großen, bekannten Güter wie der Staatliche Hofkeller, das Bürger- und das Juliusspital. Die großen Drei standen in dieser Woche auf seiner Besuchsliste. Aber sechsunddreißig Hektar in Portugal hatten längst nicht die Bedeutung wie die neunzehn von einem bekannten Winzer wie Paul Fürst oder die siebzehn eines ebenso erfolgreichen Horst Sauer, beide ganz oben auf der hiesigen Bestenliste.
Eine halbe Stunde später saßen Rebecca, Rita und er in der Straßenbahn und fuhren ins Zentrum von Würzburg. Sie gingen erst einmal richtig frühstücken. Rita führte sie zum »Café Michel« neben dem Falkenhaus, dem berühmtesten Haus der Stadt. Gebaut am Anfang des 18. Jahrhunderts wohnte dort zuerst der Dompfarrer, wie Rita wusste, dann war es Gasthaus geworden, und nach dem Tod des Wirts hatte es die Witwe mit einer dreigiebeligen Fassade verkleiden lassen, einer der bedeutendsten im Stil des Rokoko in Deutschland. Später wurde es Konzert- und Theatersaal, bis es bei einem britischen Bombenangriff vollständig ausbrannte. Die Fassade war nach alten Fotografien rekonstruiert worden, Nicolas vermutete, dass man dabei das Dehio-Verzeichnis der kunsthistorisch bedeutendsten Denkmäler zu Rate gezogen hatte. Das Falkenhaus schön zu finden war Ansichtssache. Rokoko lag ihm nicht besonders, er hatte bereits vor seinem Architekturstudium den Barock für sich entdeckt und weiteren Zugang in Portugal gefunden, in Braga, Lissabon und Guimarães, aber ganz besonders in Brasilien, wo er das Schwülstige und alles Übertriebene verloren hatte und sich das Wesen seiner Verspieltheit schlicht offenbarte. Einmal im Jahr flog Nicolas über den Atlantik, um seine Weine in São Paulo anzubieten. Bei der ersten Reise hatte ihn ein Geschäftsfreund mit Ouro Preto bekannt gemacht, einer Stadt im brasilianischen Bergland, wo er sich ins 18. Jahrhundert zurückversetzt gefühlt und die Werke des durchaus mit Riemenschneider zu vergleichenden Bildhauers Aleijadinho zu schätzen gelernt hatte. Riemenschneider? Hatte der nicht in Würzburg gewirkt?
Seitdem ließ der Barock Nicolas lächeln, besonders die weichen, runden Formen, die ausgemalten Gewölbe, die dramatischen Himmel, weniger der Pomp, und er war auch kein Freund des architektonischen Pathos, egal, ob es neoklassizistisch oder postmodern daherkam.
Ritas Einsilbigkeit hielt sich hartnäckig, ihre Wut zeigte sich sogar in der Art, wie sie beim Frühstück ihr weich gekochtes Ei köpfte, was sie sonst nie tat. Ein Caffè Latte, knusprige Brötchen, »Wecken«, wie Rita verbesserte, und ein wunderbares Quittengelee versöhnten sie dann allmählich mit der Welt. Nicolas betrachtete seine Frau. Sie zeigte auf dieser Reise eine Seite, die er an ihr nicht kannte.
»Du hast mich bisher ja auch noch nie in dieser Situation erlebt.« Das reichte ihr als Erklärung.
Nicolas wunderte sich wieder einmal, wie jemand sich so weit aus dem eigenen Stall entfernen und so anders werden konnte als die Eltern.
»Ich habe mich schon früh von ihnen entfernt«, sagte Rita und strich die Butter auf die Kaisersemmel. »Das funktionierte, weil sie sich mehr für meine kleine Schwester interessierten und mich in Ruhe ließen. Mein Vater sprach damals bereits davon, wie schön das Leben erst wäre, wenn er in Rente käme. Was er dann machen wollte? Davon hat er nie gesprochen. Am liebsten nichts oder Sportschau glotzen. An seiner Arbeit hatte er nie das geringste Interesse, sich aber pausenlos über unfähige Vorgesetzte beklagt.« Jetzt strich sie das Quittengelee auf die Semmel.
»Du hast dich verrannt, Rita, du schaust gar nicht mehr richtig hin. Auch hier wird sich vieles verändert haben.«
»Du hast gut reden, Nic, du hast hier nicht an jeder Ecke eine Erinnerung rumstehen.«
»Mein Gomorrha, wie du weißt, heißt Frankfurt. Aber so schlimm kann es nicht gewesen sein, wenn es dich zu dem gemacht hat, was du heute bist.«
»Mich hat Freiburg gerettet und der Umstand, dass ich dort studiert habe.«
»Vergiss nicht das Reisebüro hier in Würzburg, wo du die Lehre gemacht hast, das war dein Tor zur Welt, nach Spanien, Italien und schließlich Portugal …«
Nur unwillig stimmte sie zu: »… und Freiburgs Nähe zu Frankreich.«
»Und wenn sie dich zur Weinkönigin gemacht hätten?«
»Bist du von Sinnen? Nur über meine Leiche …«
Nach dem Frühstück machten sich Mutter und Tochter auf den Weg zu Ritas ehemals bester Freundin. Sie hatten sich im Haus einer anderen ehemaligen Klassenkameradin verabredet. Er hingegen war neugierig auf die Silvaner vom Würzburger Stein und darauf, was die großen Drei daraus machten, wie sie sich unterschieden. Es würde nicht nur ein Gang durch die Qualitäten werden, auch der durch Kellergänge und Geschichte stand ihm bevor. Um seinen Kopf freizubekommen, schlenderte er durch die Innenstadt und blieb kurz am Rathaus stehen, wo eine lange offene Flucht vom Dom am Rathaus vorbei auf die alte Brücke über den Main zuführte. Hoch darüber lag die Festung Marienberg mit einem Hauch von Schnee an den mit Reben bestockten Hängen und den Turmspitzen fast in den Wolken, und als er sich die Wollmütze fröstelnd über die Ohren zog, dachte er daran, dass sie am Tag nach der Ankunft ein Vermögen für warme Kleidung hatten ausgeben müssen. Auf einen so späten Winter waren sie nicht eingestellt. Aber es war besser, dass die Fröste sich jetzt austobten und nicht beim Austrieb der Weinstöcke.
Er wäre gern auf die alte Mainbrücke gegangen, um sich einen Eindruck von der Flusslandschaft, der Stadt und dem sie beherrschenden Stein zu verschaffen, aber der Wind war schneidend kalt. Er würde bei gutem Wetter wiederkommen, später, wenn es denn bei den häuslichen Spannungen überhaupt zu einem Später kommen würde.
An der Wahl dieser Weinkönigin teilzunehmen würde bedeuten, Ritas Eltern zumindest noch bis zur nächsten Woche ertragen zu müssen – oder sie suchten sich doch eine andere Bleibe. Das würde zumindest mit der Mutter Krach geben. Ein Auszug würde das Zerwürfnis vertiefen. Sie mussten sich eine Ausrede einfallen lassen, die ihren Auszug plausibel machte. Dem Vater wäre es gleichgültig, der wollte nur seine Ruhe.
Nicolas fand sich am Rande einer Parkanlage wieder, wo er sich linker Hand in die Büsche schlug. Soweit er wusste, gehörte sie zum englischen Teil des Hofgartens, und er folgte einem gewundenen Weg durch immergrünes Gehölz, bis sich der mathematische Teil des Gartens öffnete, der im Barock die Unterwerfung der Natur durch den Menschen darstellen und wohl auch Sinnbild des fürstbischöflichen Absolutismus sein sollte. Heute war er zweifelsohne ein Ausdruck jener Einstellung, dass Natur sich zähmen ließ. Der Mensch wohl auch? Doch die Krone der Schöpfung war weder durch die Einführung von Messer und Gabel noch durch Religion klüger oder friedfertiger geworden. Ein Garten als Denkmal des Sieges über die Natur! Herrschaft statt Kooperation. Nicolas folgte einer anderen Denkweise, er lernte von seinen Weingärten und betrachtete sich ihnen keineswegs als überlegen, sondern als der Teil, der profitierte und dankbar war.
Noch in der Blüte barocker Gartengestaltung war diese kritisiert und der Übergang zu einer unregelmäßigen Gestaltung gefordert worden, die im Englischen Garten ihren Ausdruck fand. Aber wie verhielt es sich heute, wenn man etwa an die plantagenhafte Organisation der Landwirtschaft dachte, wozu Nicolas auch den Weinbau zählte? Wenn er die mächtigen Rebberge und die durchorganisierte Terrassenlandschaft des Rio Douro vor sich sah, spürte er immer seine Sympathie für die mortorios, die aufgegebenen Weinberge, wild und zerklüftet und sehr lebendig, die sich die Natur zurückholte, mit Brombeergestrüpp, krüppligen Bäumen und alle Trockenmauern zum Einsturz bringendem Ginster.
Aber auch dieses Ensemble hier, das ihn zum Panorama der Fürstbischöflichen Residenz hinlenkte, gefiel als historisch erdacht und durchkonstruiert, als eine von vielen möglichen Ansichten mit gestutzten Hecken, Rabatten und zu Kegeln gestutzten Bäumen, Brunnen, Skulpturen und Laubengärten als Verstecken der Putten, die sich auch bei dieser Kälte nur mit einem zarten weißen Schleier bedeckten. Die großen, von Blättern entkleideten Bäume und der neblige Dunst, der es nicht richtig Tag werden ließ und jedes Geräusch dämpfte, die Stadt fern werden ließ, vermehrten den morbiden Charme der Anlage – mit ihm als einzigem Besucher. Anders als die ihm bekannten Barockgärten, der bürgerliche Het Loo im holländischen Apeldoorn und das absolutistische Versailles oder – ähnlich – Hannover Herrenhausen, war der Hofgarten von der alten Bastion begrenzt, zu der breite Treppen hinaufführten, und lief nicht im Waldland oder Jagdgebiet des Fürsten aus.
Ein Satz ging ihm bei der Betrachtung der abgezirkelten Karrees durch den Kopf, den er im Studium häufig gehört hatte. Sein Freund Happe war glühender Verfechter dieser Ansicht: »Symmetrie ist die Architektur der Einfallslosen.«
Nicolas lächelte, Happe würde es hier nicht gefallen. Einfälle zu haben musste im Zeitalter des Absolutismus gefährlich gewesen sein. Ob es heute noch so in Bayern war, wusste er nicht, aber Franken war nicht Bayern. Auf diese Feststellung legten die Einheimischen besonders viel Wert. Nicht ein einziges Mal hatte er bisher irgendeinen positiven Bezug auf Bayern vernommen.
Fröstelnd passierte Nicolas die mächtige Quer- und Rückenfront der Residenz und verließ den Garten durch ein wunderbar gearbeitetes schmiedeeisernes Tor, mehr Rokoko als Barock, überquerte die Straße und fand sich vor der Vinothek des Staatlichen Hofkellers und schaute auf die Treppenstufe, um nicht zu stolpern – und stutzte.
Er brauchte einen Moment, bis er begriff, dass nicht einfach ein Sprung im hellen Boden mit einem Metallstreifen ausgefüllt war. Vielmehr war hier in einem Band aus Edelstahl der Verlauf des Mains nachgezeichnet: wie er von Osten aus dem Fichtelgebirge und der Fränkischen Alb kommend das Frankenland durchquerte, nach Süden abknickte, wieder nach Norden schwenkte, in die alte Richtung zurückkehrte und doch wieder nach Süden weiterfloss und die Hauptrichtung einnahm, bis er es sich noch mal anders überlegte oder von einem Gebirge in Richtung Frankfurt zu einem weiteren Umweg gezwungen wurde. Dort floss der Main, den er kannte, aber der Fluss hatte ihm in seiner Jugend nie etwas bedeutet. Er war ein Verkehrshindernis gewesen, ein Grund zum Brückenbau, eine Schneise durch Frankfurt, die flüssige Trasse für Lastkähne. Was ein Fluss für den Weinbau bedeutete, hatte er erst am Rio Douro begriffen, der unterhalb seines Weingutes in Ruhe und Erhabenheit vorbeifloss. Erst seit dieser Erfahrung konnte Nicolas auch dem Main etwas von seiner Wertschätzung abgeben.
Das Beharrungsvermögen von Vorurteilen war sprichwörtlich. In Kombination mit schlechten Erfahrungen oder unguten Erinnerungen hielten sie sich ein Leben lang. Eines musste Nicolas beim Betreten der Vinothek sofort aufgeben. Er kannte zwar die Fotos von modernen fränkischen Kelleranlagen, doch insgeheim hatte er es nicht geglaubt und immer noch das Altfränkische vor Augen, die Enge, das Dunkle und Stickige, wo frischer Wind fehlte, weil die Fenster zur Welt geschlossen blieben.
Die Vinothek hingegen, mochte sie auch in der Tradition der absolutistischen Fürstbischöfe stehen, war offen, großzügig und klar. Für einen Moment spürte Nicolas die Leere, die das schwindende Vorurteil hinterließ. Er klammerte sich an den Gedanken, dass es ein Marketingtrick war und hier sicherlich nicht viele Kellereien den Schritt ins Licht gewagt hatten. Die Symbolik in der Gestaltung dieses lang gestreckten hellen Raums ließ ihn zögern. Drei gewaltige, knapp hüfthohe Steinblöcke hintereinander im Raum stellten die unterschiedlichen Böden dar, auf denen die Reben des Hofkellers wuchsen: roter Buntsandstein, grauer Muschelkalk, wie am Boden im Eingang, und ein etwas anders ziselierter und hellerer Keuper.
Das war eine geologische Klaviatur, auf der ein Winzer spielen konnte, wenn er es denn verstand. Die entsprechenden Klangbilder standen in Form von Bocksbeuteln und Bordeauxflaschen auf den jeweiligen Steinen. Aus der Decke wuchsen goldene Röhren nach unten, ähnlich den Stalaktiten. Wie die Dame am Tresen ihm erklärte, symbolisierten sie die Sonnenstrahlen. Dann wandte sie sich wieder einer älteren Dame an dem langen Tresen zu, groß, schlank, gut angezogen und in ihrem Auftreten mehr als selbstbewusst. Die Art, wie sie den Wein in ihrem Glas betrachtete und probierte, wies sie als Kennerin aus.
»… niemals, die gewinnt niemals«, hörte Nicolas sie mit herber Stimme sagen.
»Sie ist die Beste, glaub mir«, sagte die Dame hinter dem Tresen.
»Du wirst es sehen, die gewinnt nicht, die kann gar nicht gewinnen. Die Wahl machen die großen Genossenschaften unter sich aus, Sommerach und Nordheim, so ist es immer.«
»Was du sagst, stimmt nicht. Sieh dir einfach die Liste an. Die jetzige stammt aus Erlenbach.«
»Das hat nichts zu sagen.«
»Man kann dir sagen, was man will, Helen, bei dir nutzt kein Argument etwas. Wieso bist du nur so verbohrt?«
»Weil es nicht darauf ankommt, was eine kann, sondern wen sie kennt, mit wem sie bekannt ist und mit wem der Vater seine Geschäfte macht.«
Die Dame hinter dem Tresen schüttelte entnervt den Kopf. »Die haben ihren eigenen Coach, wenn du weißt, was das ist. Die müssen lernen, die werden trainiert, die eine, ich glaube, sie heißt Henriette Müller, macht eine Lehre als Winzerin und will später in Geisenheim studieren. Sie kommt aus Nordheim …«
»Siehst du, da steckt bestimmt die Winzergenossenschaft dahinter!«
»Dir ist wirklich nicht zu helfen, Helen. Da kommen hundertfünfzig Juroren zur Wahl, die kann man nicht alle manipulieren oder bestechen, viele sind von auswärts …«
Nicolas starrte in die Preisliste, um sich das Lachen zu verbeißen, und tat, als suche er Wein aus, den er gleich probieren wollte, dabei hörte er amüsiert zu. »Von auswärts« – damit war er gemeint.
»Heute wird alles manipuliert!«
»Sei doch nicht so beschränkt!«
»Beschränkt findest du mich?« Die Dame vor dem Tresen schien beinahe erfreut darüber zu sein, wieder etwas gefunden zu haben, wogegen sie opponieren konnte.
»Die Wahl ist elektronisch …«
Empört spitzte die Widerborstige den Mund und richtete sich auf. »Siehst du? Da blickt kein Mensch durch, die können machen, was sie wollen, diese Computerleute. Wer will da etwas nachprüfen?«
Entnervt den Kopf schüttelnd wandte sich die Dame hinter dem Tresen Nicolas zu und entschuldigte sich. »Das Thema bewegt uns alle. Jede Kandidatin hat ihre Fangemeinde. Die Orte rivalisieren, jeder will gewinnen, die Leute sind stolz darauf, wenn eine von ihnen gewählt wird und unsere Weine weltweit repräsentiert.«
»Weltweit?«, fragte Nicolas ungläubig. Er hatte davon auf den internationalen Messen bislang wenig bemerkt. Allerdings hatte er auch kaum Augen für das, was in Deutschland geschah, wenn es nicht seine Weine und Geschäfte betraf.
»Ja, sogar in Asien ist die letzte Weinkönigin gewesen, in China oder Singapur, irgendwo da. Das ist eine tolle Chance für die Mädchen. Wer kommt sonst schon nach Singapur?«
»Das ist wahr«, sagte er und tat uninteressiert. Dabei begann ihn die Wahl zu interessieren, wenn sich bereits im Vorfeld die weiblichen Gemüter erhitzten und sogar Freundinnen mit ihren unterschiedlichen Meinungen aufeinanderprallten.
»Welche Weine möchten Sie probieren?«
Diese Frage riss Nicolas aus seinen Gedanken. »Silvaner, in erster Linie Silvaner, und zwar die vom Würzburger Stein.«
»Da haben wir einige. Können Sie es nicht genauer sagen? Am Stein haben wir etwa dreißig Hektar. Und Müller-Thurgau, Weißer Burgunder, Chardonnay, Traminer und Blauer Spätburgunder.«
»Nein, einfach nur Silvaner.«
Kapitel 2
»Einfach nur Silvaner.«
Die Dame zog eine Schublade im Tresen auf und ließ ihren Blick über die dort gekühlt stehenden Flaschen streichen. »Dann gebe ich Ihnen zuerst einen trockenen Kabinettwein und danach die Spätlese aus dem letzten Jahr. Ist zwar alles noch ein wenig jung, aber es sind trotzdem sehr schöne Weine.«
Der Preisliste entnahm Nicolas, dass die Stein-Weine im Vergleich zu anderen Lagen des Hofkellers teurer waren. Wenn er die Preise mit denen seiner Weine verglich, war er hier durchaus konkurrenzfähig. Aber Weißwein war nicht seine Stärke, lediglich Gouveio, Malvasia und Codega, Rebsorten, die er für seinen weißen Portwein brauchte. Ob Alvarinho bei ihnen auf dem Schiefer so gut gedieh wie an der portugiesischen Küste und als grandioser Albariño im spanischen Galizien, würde ihr Versuch ergeben, auf einem im vorletzten Jahre bepflanzten halben Hektar ihrer kühlsten, nach Norden ausgerichteten Lage. Dirk Niepoort, der bei ihnen in der Nähe sein Weingut betrieb, versuchte es mit Riesling.
Es wird Zeit, sich mehr auf die Weißweine zu konzentrieren, dachte Nicolas, in Franken könnte ich lernen, doch bei unserer brutalen Hitze und dem wenigen Regen sind die Bedingungen gänzlich anders. Aber ich werde es lernen, ich habe auch gelernt, Rotwein und Portwein zu machen. Sogar Otelo, sein provador, über dreißig Jahre Kompagnon und bester Freund seines toten Onkels, hielt sich immer noch für einen Lernenden.
Nicolas betrachtete den riesigen Monolithen am Eingang, das wuchtige Urgestein dieses Planeten, schwer und gewaltig und auch geheimnisvoll, denn bei aller wissenschaftlichen Eitelkeit blieb er unergründlich. Als Nächstes folgte in erdgeschichtlicher Reihenfolge der mächtige Block aus rotem Buntsandstein, darauf, als Bühne und harter Gegensatz und doch harmonisch, die grünen Bocksbeutel, rund und zerbrechlich, deren Inhalt auf diesem Boden gewachsen war.
Die Blöcke waren seinerzeit in den Rohbau hineingewuchtet worden, als die Fenster noch nicht eingelassen waren. Auch den glatten, glänzenden Fußboden hatte es nicht gegeben, wie die Dame am Tresen erzählte, um das Streitgespräch mit ihrer Freundin zu unterbrechen. So war der Bodenbelag um die Monolithen herum verlegt worden.
Dem Buntsandstein folgte grauer Muschelkalk, ein Findling. Nicolas trat zu ihm und legte die Hand auf den Stein. Zweihundertfünfzig Millionen Jahre war er alt, hundertfünfzig Millionen Jahre jünger als »sein« Schiefer im Tal des Rio Douro, der durch die Ablagerungen von feinem Tonschlamm im Meer entstanden war. Aber anders als bei seiner Arbeit im Weinberg, wenn er meinte, den Boden, auf dem er stand, zu spüren, fühlte er hier nur die Kälte des Blocks. Die kühle, klare Umgebung lenkte ihn vom Wein ab. Ging es dem interessierten Gast anders, der sich in dieser kühlen und hochmodern gestalteten Vinothek ganz auf den Wein konzentrieren sollte?
Muschelkalk bestand aus abgestorbenen Meeresbewohnern, deren Schalen und Panzer zurückgeblieben waren, als die Urmeere sich zurückzogen und austrockneten, bis die Becken sich wieder füllten. Da lag er, der Block, das Ergebnis eines Jahrmillionen dauernden Prozesses. Das Salz, das der Weinkenner zu schmecken vermeinte, brachte im Wein die Mineralität dieser Böden zum Ausdruck, ein Stoff, der manchmal ein hauchfeines Kribbeln auf der Zunge hinterließ. Aus all dem bestand der Würzburger Stein, Deutschlands größte zusammenhängende Weinlage.
Bei ihrer Ankunft am Bahnhof hatte er einen Blick erhascht und sich erinnert, dass er hier schon im ICE vorbeigerauscht war. Achtlos war er damals gewesen, er hatte nicht einmal bemerkt, dass dort Reben wuchsen, obwohl es Sommer gewesen war. Jetzt lag noch Schnee. Ein Weinberg im Schnee – was für ein Anblick, fremdartiger konnte es kaum sein und unvorstellbar, dass die goldgelbe Flüssigkeit von diesem gewaltigen Hang stammte, der die Stadt beherrschte und den Main zum Abknicken zwang.
Eine schöne Farbe war da in seinem Glas, frisch im Geschmack und fast ein wenig zu lebendig, zu jung, wenige Monate auf der Flasche, Aromen gelber Früchte. Und beim Nachschmecken zeigte sich das, was er als Mineralität empfand. Die Spätlese war gehaltvoller, und Nicolas meinte, statt Apfel etwas wie reife Zitrone zu schmecken. Dabei empfand er es häufig als unnütz, den Wein geschmacklich in seine Bestandteile zu zerlegen. Andererseits spürte er bestimmten Aromen nach, konnte sich auf die Süße konzentrieren oder empfand den Wein als unharmonisch, weil die Säure zu stark war oder zu viel Zucker den Wein pappig wirken ließ. Aber dieser hier war elegant und schlank. Das Große Gewächs aus dem Jahr davor, ein Silvaner von alten Reben, zeigte ihm zum ersten Mal, wie Silvaner aus dieser Rebsorte sich mit der Zeit zum Besseren hin veränderte. Er verstand sowieso nicht, weshalb die Mehrheit der Weintrinker immer nach jungem Weißwein verlangte. Bei den gealterten Weinen waren die Fruchtaromen intensiver, wie auch die Restsüße des nicht vergorenen Zuckers, und es gab die typische Petrolnote. Was Nicolas jedoch irritierte, war die Flintnote, Feuerstein oder Rauch, wie auf vulkanischem Boden gewachsen.
»Sie ist typisch für den Würzburger Stein«, erklärte die Dame hinter dem Tresen und kam mit der Legende, dass zu Zeiten der Dampflokomotiven die Gleise bereits am Stein vorbeigeführt hätten und der Rauch der Loks sich am Berghang niedergeschlagen habe. Doch in Wirklichkeit sei es das typische Aroma, das nur alte, tief im Muschelkalk wurzelnde Reben aus dem Boden mitbrächten.
Inzwischen hatten sich die über die Weinköniginnen streitenden Freundinnen wieder beruhigt, der Blutdruck hatte sich normalisiert. Da Nicolas anscheinend Expertinnen vor sich hatte, fragte er nach einer möglichen Favoritin.
»Claudia!«
»Nein, Henriette!«
»Geht das schon wieder los. Das ist doch typisch«, meinte die Kundin, beleidigt die Mundwinkel nach unten ziehend, »dass du die aus Nordheim vorziehst. Typisch, da steckt die Genossenschaft DIVINO dahinter.«
»Meine Liebe, du redest Unsinn«, sagte die Dame hinter dem Tresen und seufzte.
»Tue ich nicht! Claudia wird nur deshalb nicht gewinnen, weil sie aus Iphofen kommt. Dabei ist sie ein patentes Mädchen, sie kann auf Menschen zugehen und sie vom Wein begeistern, das ist wichtig. Genau das hat sie in der Gaststätte ihrer Eltern gelernt.«
»Woher weißt du denn das schon wieder?«
»Weil die Eltern in ihrem Restaurant unsere Weine anbieten. Wenn es um Wein geht und Claudia in der Nähe ist, dann wird sie gerufen, um die Gäste zu beraten. Außerdem war sie im letzten Jahr Weinprinzessin. Es macht ihr Spaß, Menschen von etwas zu überzeugen. Das ist insofern leicht, als Iphofen schöne Weine hat, oben vom Steigerwald, vom Julius-Echter-Berg und von Castell und aus Wiesenbronn. Außerdem hat der Onkel oder jedenfalls einer aus ihrer Familie ein Weingut …«
MC Five meldete sich, die beiden Damen schauten irritiert, zwei Takte der Rockband aus seinem Handy reichten Nicolas, um ihn nach Portugal zu katapultieren. Einen derart abstrusen Klingelton hatte niemand, er hörte sich an, als zerschlüge jemand eine E-Gitarre. Die Band war längst Geschichte, alle Musiker der Chaostruppe waren entweder an einer Überdosis gestorben, betrunken bei Verkehrsunfällen umgekommen oder im Knast gelandet. Ihre Schallplatte hatte Nicolas in der Sammlung seines Onkels entdeckt. Die Musik, andere hielten es für elektronische Kurzschlüsse, erinnerte ihn immer daran, sich letztlich auf nichts wirklich einzulassen, dass alles relativ war und nichts so blieb, wie es war.
Es war Lourdes, die ihn anrief, seine rechte Hand in geschäftlichen Dingen. Sie gab ihm neue Besuchstermine durch und beruhigte ihn, »zu Hause« sei alles in Ordnung. Lourdes war eine junge, sehr bescheidene Frau, die nie etwas vergaß und die bei ihm genug Geld verdiente, um ihren arbeitslosen Lebensgefährten mit durchzubringen, der aus Lissabon aufs Land zurückgekehrt war, wie viele von hier – nein, von dort. Hier war jetzt Deutschland. Er kam durcheinander und schnell wieder ins Portugiesisch, Dona Verónica hatte ihm ihre Sprache gut beigebracht, trotzdem nahm er dann und wann noch Unterricht.
Er wusste aus dem Umgang der Deutschen mit Migranten, wie wichtig die Sprache war und auch die Arbeit am Akzent. Der galt gerade bei denen umso mehr als Makel, je schlechter ihr eigenes Deutsch war.
Dass Lourdes und seine Leute ihn patrão nannten, Patron, was mehr bedeutete als Chef, daran hatte er sich gewöhnen müssen. Aber den Vornamen zu benutzen wäre zu persönlich gewesen. Eine Grenze musste bleiben. Nicolão nannten ihn nur Otelo und sein Anwalt Pereira, der ihn in die Geheimnisse der portugiesischen Bürokratie und Vetternwirtschaft eingeweiht hatte, sofern er sie selbst verstand.
Des Streits müde und sich auch dessen Peinlichkeit bewusst, wandte sich die Dame hinter dem Tresen an Nicolas: »Wieso interessiert es Sie, ob wir eine Favoritin haben?«
Ein Lächeln, wie er es seinen Kunden gegenüber pflegte, machte es leichter, die Spannung aufzulösen. Nicolas polarisierte nicht gern, er vermittelte, ging lieber still seiner Wege und tat, was ihm beliebte, was nicht bedeutete, dass er den Weg des geringsten Widerstandes suchte.
»Unfreiwillig haben Sie mich zum Zeugen Ihrer Unterhaltung gemacht«, sagte er beiden zugewandt. »Ich bin zufällig einer der zukünftigen Juroren.« Auf einmal fand er Gefallen an der Idee, wobei er sich am Morgen noch gefragt hatte, was der Unsinn sollte, noch dazu in einer Demokratie. Königinnen – das war etwas für Rebeccas Märchenbücher.
»Und was sind Sie, wenn ich fragen darf, welche Kompetenz haben Sie, um da mitzumachen?« Die kritische Freundin brachte sich in Positur, um ihre Pfeile abzuschießen. »Sie sind nicht aus Franken!« Es klang wie ein Vorwurf. Streitlustig warf sie den Kopf in den Nacken.
»Kennen Sie den Rio Douro – der Fluss, an dessen Ufern der Portwein wächst?«
Sie kannte ihn nicht und schickte einen hilfesuchenden Blick zur Freundin hinter dem Tresen, in der Annahme, dass er sie jetzt gemeinsam auf den Arm nahm.
»Ich verstehe ein wenig von Wein, ein wenig vom Verkauf – von allem ein wenig, ich betreibe dort ein Weingut …«
»Und wieso sind Sie dann hier?«
Das Getrappel vieler Füße war bereits aus der Toreinfahrt zu hören gewesen, jetzt, als sich die Tür öffnete, kamen helle Stimmen dazu, und wie ein Schwarm von Staren in den Weinberg brach eine Gruppe Asiaten zur Tür herein, laut schwatzend und bestens gelaunt die Vinothek überschwemmend. Das war für Nicolas ein nicht unbekannter Anblick. Es waren Japaner, wie er rasch an der bunten, unkonventionellen Kleidung, den lockeren Umgangsformen und dem Alter der Besucher feststellte. Außerdem parierten sie ihrem Reiseleiter nicht mehr so schnell, wie es auf Linie gebrachte Chinesen in dunkelgrauen Anzügen taten.
Nicolas zog sich hinter ein Glas Spätburgunder mit dem für den Stein typischen Flintaroma zurück. Der Wein war erst vor einem Monat abgefüllt worden und daher noch im Stadium der »Selbstfindung«, der unausgegorenen Jugend, und wie man über Kinder in der Entwicklung kein Urteil fällte, so auch nicht über diesen Wein. Die Domina danach erinnerte ihn mit ihrer Würze an junge Franzosen von der Rhône, aber auch dieser Wein brauchte Zeit. Der Jahrgang davor zeigte besser, wohin die Reife führen konnte.
Die beiden Frauen hatten keine Zeit mehr zu streiten, die Freundin blieb still in einer Ecke und tat, als würde sie Nicolas übersehen. Die Dame hinter dem Tresen rief Kollegen zu Hilfe, um viele Gläser zu füllen. Über sein Glas hinweg hörte Nicolas dem Englisch sprechenden Reiseleiter zu.
Der erzählte vom Bau der Residenz, den um 1719 der Fürstbischof von Schönborn in Auftrag gegeben hatte, da er auf der Festung Marienberg zu weit vom politischen Alltag entfernt war, und dem es wohl auch lästig war, ständig in die Stadt hinunterzureiten, um dort die Messe zu lesen. Bis dato waren die Weine der Bischöfe oben auf der Festung Marienberg verarbeitet und gelagert worden, ebenso die der Pächter sowie die in Wein zu zahlenden Abgaben. Nicolas erinnerte sich, dass sich im Jahr 1719 die Preußen unter Friedrich Wilhelm I. Vorpommern geholt hatten, dass Karl VI. damals deutscher Kaiser aus dem Hause Habsburg war und das europäische Geistesleben unter französischem Einfluss stand. Was lag näher, als Versailles nachzuahmen? So trieb sicher auch die Eitelkeit die Kirchenfürsten zu diesem Bau. Die Residenz demonstrierte Macht und Einfluss, die Bedeutung der Kirche und des Katholizismus wurden unterstrichen. Ein Name, den Nicolas vom Studium her kannte, war Balthasar Neumann, ein Bauingenieur, der seine Karriere beim Militär begann und sie als Berühmtheit der Barock- und Rokoko-Architektur beschloss. Er hatte den Auftrag für die Residenz erhalten, deren Bau sich über Jahrzehnte erstreckte.
Ungefragt schloss sich Nicolas dem Kellerrundgang der asiatischen Besucher an, die ihn, sich freundlich lächelnd verbeugend, in ihrer Mitte aufnahmen. Zuerst wurden alle wie in früheren Zeiten mit dem Kellerrecht vertraut gemacht:
Das Zanken, Fluchen, Zotenreißen,
Mit großen Worten um sich schmeißen,
Das Kratzen, Schreiben an den Wänden
Das Klopfen an die Fass mit Händen
Fürwitz und ander Unbegier
Geziemet sich durchaus nicht hier.
Den ersten Heiterkeitssturm rief die Darstellung der entsprechenden Strafe hervor: Da wurde ein Mann, der sich nicht an das Klopfverbot gehalten hatte, über eine Bank gebeugt und durchgebläut.
Nicolas lachte nicht. Er erinnerte sich zu gut, wie er in seinem späteren Weinkeller den Betrug des Geschäftsführers aufgedeckt hatte, weil er gedankenlos gegen Fässer geklopft hatte. Aber die altfränkische Maßnahme hatte einen anderen Hintergrund: Je leerer das Fass war, desto mehr Wein war daraus verkauft worden, also musste das der beste Wein sein. Und das hatten die Käufer nicht wissen sollen.
Staunend betrat die Gruppe das von einer mächtigen Säule gestützte Gewölbe des Rondells. Statt in einem Kapitell lief sie in einem weiten runden Bogen aus, der das gewaltige Gewicht des darüberliegenden Prunkbaus auffangen musste. Rechter Hand ging es in den langen Stückfasskeller, in dem auf historischem Lager einhundert Stückfässer in zwei Reihen übereinanderlagen. Im spiegelbildlich liegenden Kammerkeller lagerten einst die besten Weine für die Bischöfe und deren illustre Gäste. Links, dem Grundriss des Gesamtkomplexes folgend, standen die drei gewaltigen »Beamtenweinfässer« von 1784. In ihnen wurde der flüssige Lohn aufbewahrt, den die Hofbediensteten erhielten, jeder die seinem Rang entsprechende Menge.
Die letzte Station in diesem Teil der Gewölbe war die Vinothek. Auch sie würde Nicolas Ideen für den anstehenden Umbau seines Weinguts liefern. In Farbe, Licht, Material und Form brach sie mit allen durch Neumann vorgegebenen Stilelementen, ähnelte mehr einer Cocktailbar, aber musste sich doch den Gegebenheiten des Raums anpassen. Nicht anders würde er bei seinem Umbau vorgehen müssen, wenn auch auf bescheidenem Niveau. Außerdem zahlte hier der bayerische Staat die Rechnung, bei ihm nicht einmal mehr die Europäische Union.
Ursprünglich waren die eben besichtigten Keller lediglich zur Lagerung des Weins benutzt worden. Die Verarbeitung war unter dem rechten Flügel der Residenz vollzogen worden, von der Traubenannahme über das Pressen bis zur Gärung. Danach hatte man den Wein in Bütten und Eimern hergebracht und in die riesigen Lagerfässer geschüttet. Die moderne Zeit verfügte über Pumpen und Schläuche, und in den sechziger Jahren war ein Verbindungsgang gegraben worden. Dort folgte man an einem Leuchtstreifen entlang dem Weg der Geschichte seit der Gründung der Bischöflichen Kellerei 1128 bis in die Gegenwart.
Hier wurde der legendäre Jahrgang 1540 gepriesen.
»Im Sommer so große Hitze, dass die Erde birst, und da man die vertrockneten Trauben beim Herbsten hängen ließ, füllten sie sich bei Regen erneut und ergaben sogar einen besseren Wein.«
Was man früher unter Qualität verstanden hatte, war Nicolas schleierhaft. Missernten, Kriege und Zwangsarbeit hatten die Winzer oder Häcker, wie die Arbeiter und Pächter der Weinberge genannt worden waren, niemals reich gemacht, nicht einmal wohlhabend. Zum Wetter waren außerdem drastische Abgaben, Gebühren und Steuern gekommen. Woher sonst hätten die Herrschenden das Geld für ihre Prachtbauten nehmen sollen? Nichts hatte sich geändert …
Als Nicolas auf die Straße trat, stellte er fest, dass sich auch das Wetter nicht geändert hatte, es war noch genauso miserabel wie vor zwei Stunden. Er überlegte, ob er Probeweine mitnehmen sollte, aber wohin damit auf dem Rückflug?
Nicolas betrachtete die imposante Fassade der Residenz mit Kuppeln und Säulen und stellte sich vor, wie einst hier die Kutschen vorgefahren waren und wie sich das Getrappel der Pferdehufe auf den Steinen angehört haben mochte. Er würde sich, obwohl die Japaner jetzt den oberirdischen Teil besichtigten, diesen Gang bis zum Barockfest aufheben, dann würde er mit Rita am Arm über Balthasar Neumanns Treppe unter den berühmten Fresken hinaufsteigen. Um wie Neumann zu arbeiten, musste man die Menschen kennen und ihren Wunsch, zu gefallen, einzuschüchtern, zu beeindrucken und sich aus der Mittelmäßigkeit der Masse herauszuheben. Und dann, in einer Bombennacht, war alles in fünfzehn Minuten zu Schutt und Asche geworden. Das hatten sich die Würzburger jener Zeit selbst zuzuschreiben.
Die Mütze tiefer in die Stirn ziehend, betrachtete er die breite Fassade dieses Weltkulturerbes, obwohl kalter Nieselregen eingesetzt hatte. Er versuchte nach wie vor, vieles zu begreifen, was sich jedoch dem Zugriff immer wieder entzog. War das, was er sah, wirklich schön, oder faszinierte das Bombastische? War sein Empfinden sein eigenes oder Ausdruck seiner Erziehung zum Architekten, nichts weiter als eine Übereinkunft, ein Abkommen, sich auf Werte zu verständigen, um miteinander zu leben, ohne sich ständig in die Haare zu geraten? Ritas Eltern waren nie in dem Gebäude gewesen, sie wollten anscheinend ihre Welt nicht kennenlernen. Er hatte sie gefragt, und sie hatten ihn nur verständnislos angeschaut.
»Es gibt Wichtigeres. Wir sehen das jeden Tag, dann interessiert einen so was nicht mehr. Außerdem haben wir keine Zeit dafür.« Wofür hatten sie sich stattdessen Zeit genommen? Rita hatte darauf keine Antwort gehabt.
Am Nachmittag wollte er das Juliusspital besuchen, den Weg durch die Geschichte fortsetzen. Es war gut, die Zeit in Würzburg damit zu verbringen, statt Rita zu beschwichtigen. Sie war ihm wichtig, nicht aber ihre Eltern, es berührte ihn kaum, dass es so wenige Berührungspunkte gab. Schade, dass es so war – mehr auch nicht. Rita war bei ihren Freundinnen besser aufgehoben, da wollte er die Frauen nicht stören. Es ging sicherlich um die Kleinen und darum, was diese oder jene Freundin trieb, wer mit wem verheiratet und wieder geschieden war, wer von den ehemaligen Lehrern noch unterrichtete, wer pensioniert oder bereits gestorben war. Diese Geschichten interessierten ihn nicht. Morgen würde er sich Rebecca schnappen, und sie würden auf ihre ganz spezielle Art die Stadt erkunden, so neugierig, wie sie mit ihren drei Jahren war. Sie sah Dinge, die er niemals gesehen hätte, so klein, wie sie waren, und sie machte ihn darauf aufmerksam. Sie würden zusammen durch die Weinberge zur Festung Marienberg hinauflaufen. Und wenn sie nicht mehr laufen wollte, würde er sie tragen.
Jetzt meldete sich sein Magen. Nicolas hatte, vielleicht aus der Urlaubslaune heraus, den Fehler gemacht, den Wein zu schlucken statt die Proben auszuspucken, und jetzt im Freien fühlte er sich ein wenig betrunken. Er schlug den Weg zum »Ratskeller« ein, an dem er vorhin vorbeigekommen war. Er wollte einfach nur essen, aber auch hier konnte er sich historischen Lektionen nicht entziehen. Wichtige Söhne und Töchter der Stadt belehrten ihn von den Wänden herab. Ein Max Dauthendey war ihm unbekannt, die Dame daneben, Gertraud Rostosky gleichermaßen. Eine Emy Roeder, war 1971 gestorben, da hatte er noch gar nicht gelebt. Der einzige Bekannte war Herr Röntgen. Wenigstens ein bekannter Name, dachte Nicolas und lächelte bei dem Gedanken, dass Röntgens Erfindung nicht auf systematischer Forschung beruhte.
Er hatte im Physikalischen Institut der Universität Würzburg mal wieder sein Labor nicht aufgeräumt. Als er dann seine Gasentladungsmaschine einschaltete, brachte er Kristalle zum Leuchten und bemerkte, dass Strahlen austraten, mit denen sich seine Hand durchleuchten ließ, sodass die Knochen sichtbar wurden.
Das gab Nicolas die Hoffnung, dass auch er es bei seinem unterentwickelten Ordnungssinn eines Tages noch mal zu etwas bringen würde. Nach Meinung seines Vaters würde er das von seinem Bruder geerbte Weingut ruinieren. Sein Vater mochte als Chef der Hollmann AG viel davon verstehen, städtische Baudezernenten zu bestechen, vom Wein aber kannte er nur die Preise.
Giovanni Battista Tiepolo, der von 1696 bis 1770 gelebt hatte, war bekannt und keineswegs Sohn der Stadt, sondern venezianischer Maler und Schöpfer der Fresken in der Residenz. Unter seinem Konterfei an der Wand bestellte Nicolas ein Menü mit Vorspeise, ein schmackhaftes Kresse-Rahmsüppchen, als Hauptgericht gab es die Brust vom »deutschen Landhuhn«, nein, beileibe kein portugiesisches Stadthuhn, das wäre zurzeit extrem schmalbrüstig, daraus ergäbe sich bei gutem Willen gerade mal ein dünnes Hühnersüppchen.
Mit den Weinen ging es ihm wie mit den Menschen. Er hätte sich an einen Bekannten halten können, an einen Silvaner vom Staatlichen Hofkeller. Aber so wie er gern neue Menschen kennenlernte, interessierten ihn auch immer neue Weine. Die Weingüter auf der Karte waren so unbekannt wie alle anderen auch. Mit einem Silvaner konnte er wenig falsch machen.
In einem Standardwerk seiner geerbten Weinbibliothek hatte er gelesen, Silvaner sei ein Massenträger für schlichte, ausdruckslose Weine. »Wenn ihr Ertrag begrenzt wird, ergibt sie (die Silvanertraube) jedoch volle, zartfruchtige, erdige Weine.«
Erdig war dieser nicht, aber voll und zart und fruchtig und zwischen Säure und Süße sehr ausgeglichen. Waren die Bücher seiner Bibliothek veraltet, hatten die Franken sich längst zu neuen Ufern aufgemacht? Diese Reise würde es zeigen. In seinem Weinführer waren jede Menge bester Weine aufgeführt, und auf ihn konnte er sich eigentlich verlassen. Ein Urteil darüber, ob die Nachspeise, die Weincreme, tatsächlich vom »fränkischen Silvaner« stammte oder von einem rheinhessischen Riesling, ließ sich jedoch beim besten Willen nicht fällen.
Sich mit vollem Magen auf die zugige Straße zu wagen war heute keine gute Idee, obgleich es zum Juliusspital nicht weit war. Doch ins Rathaus zurückzugehen, um das Ende des Schneeschauers abzuwarten, stellte sich als nicht viel bessere Idee heraus. Ohne Vorwarnung stand er in einem Raum vor dem Modell einer Ruinenanlage, und es dauerte einen Moment, bis er begriff, dass es sich nicht um eine historische arabische Stadtanlage oder Ausgrabung handelte, sondern um das Modell des im Zweiten Weltkrieg vollständig zerstörten Würzburg. »Vollständig« war ein unpassender Begriff für jenes Drama, »total« wäre besser, so total, wie es seinerzeit Tausende Berliner im Sportpalast von ihrem Joseph Goebbels gefordert hatten. Dumm nur, dass der Stein dann auf ihre Füße gefallen war.
Nicolas kannte ähnliche Modelle aus Berlin, Hannover und Köln, nur von Würzburg hatte er nicht gewusst, dass lediglich die ausgebrannten Fassaden übrig geblieben waren. Fünftausend starben in jener Bombennacht. Den einzig sicheren Bunker hatte sich Gauleiter Dr. Hellmuth in der Nähe seines Hauses errichten lassen. Wie war ein Volk beschaffen, fragte sich Nicolas, dem man den letzten Schuppen noch niederbrennen musste, bevor es begriff, dass es den Krieg verloren hatte, geschweige denn vom rechten Glauben abließ? Die Würzburger sprengten sogar am 31. März 1945 noch die alte Mainbrücke und kämpften bis zum 6. April weiter.
Ein anderer Besucher, der bei dem Anblick des Modells der Verwüstung still geworden war, erzählte nun, dass die Bücherverbrennungen auf dem Platz vor der Residenz stattgefunden hatten. Mit einem Schlag verlor der Prunkbau für Nicolas seine architektonische Unschuld und wurde lebendige Geschichte. Auch die Bücher seines Onkels wurden lebendig, genau wie Otelos Berichte aus dem Angolakrieg.
Die Weinköniginnen waren allerdings keine Erfindung der Nazis, obwohl die gern jede volksnahe Tradition mit dem Hakenkreuz übermalt hatten.
Versteckt unter der Mütze und hinter dem Mantelkragen trat Nicolas auf die Straße. Jetzt kam zu Kälte und Schneeregen auch noch die schlechte Laune über das Gesehene. Happe fehlte ihm, mit ihm konnte er über derartige Dinge reden, stundenlang. Sein bester Freund blieb zwar die Woche über meistens im Büro, das er sich mit Rita in Porto teilte. Manchmal kam er aber abends mit ihr rauf zur Quinta, immerhin waren es mehr als hundert Kilometer, wenn er nicht gerade mal wieder eine junge Portugiesin unglücklich machte. Lieber noch nahm Happe den Zug, und Nicolas und Rebecca holten ihn dann in Peso da Régua ab. Da war es meistens warm, Schneegriesel mit Graupelschauern und feucht-kalten Wind gab es dort nie.
Hier aber drückte Nicolas sich eilig an den Hauswänden der Domstraße entlang, vor sich die Doppeltürme des St. Kiliansdoms, eigentlich romanisch, aber mit den spitzen Türmen auch irgendwie anders. Mehr als ein kurzer Blick auf die rote Fassade des Neumünsters war bei diesem Wetter unmöglich. Nicolas hastete weiter die Schönbornstraße entlang, was ihn an ein Weingut gleichen Namens im Rheingau erinnerte, Schloss Schönborn. Es gab die Schönborns auch hier. Der Abend war dazu da, sich vor den Rechner zu setzen und alles im Internet nachzulesen, oder sollte er sich mit Prospekten eindecken, die er später wegwarf ? Nein, er war des Weines wegen hier. Oder doch nicht? Er war Ritas wegen hier und wegen dieser kaum erträglichen Schwiegereltern, die nichts von ihm wissen wollten. Er könnte am Abend mit Happe ein halbes Stündchen skypen und sich erkundigen, ob zu Hause alles in Ordnung war, das war sicher angenehmer.
Erstaunt hob er den Kopf, als er unvermittelt vor der gigantischen Fassade des Juliusspitals stand und den Kopf drehen musste, um von einem Ende zum anderen zu schauen. Er fand einen Eingang und musste sich zur Vinothek durchfragen, denn er war links von dem Komplex ins Krankenhaus geraten.
Die Vinothek in der Zehntscheune lag im Gebäudeflügel genau gegenüber. Um dorthin zu gelangen, wurde Nicolas wieder nach draußen und zum Durchgang geschickt, der durch den Innenhof in den Park führte. Erst hier bemerkte er die prunkvolle Fassade, die sich zur Straßenseite hin wesentlich bescheidener zeigte. Im ehemaligen botanischen Garten blieb er am Vierströmebrunnen stehen und betrachtete die muskulösen Männer und kaum verhüllten Frauen mit tropfnassem Schnee auf nackter Schulter, an Füllhörner gelehnt und von Seeungeheuern begleitet. Der Gartenpavillon in Gelb und Weiß war wieder Barock, die Vinothek hingegen überraschend modern. Es gefiel Nicolas, und es verwirrte ihn. Das Alte und das Neue zu vermischen hätte ein formloser Brei werden können, doch hier existierte das eine neben dem anderen, es stand nebeneinander. Ob es gleichberechtigt war, würde sich zeigen, er war nie zuvor in Franken gewesen. Auf der Autobahn von Frankfurt nach München hatte er sich damals lediglich Gedanken darüber gemacht, ob er bei Marktheidenfeld wieder in einen Stau fuhr.
Anno 1576 hatte der Herzog und Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn eine gemeinnützige Stiftung gegründet. Um sich zu finanzieren, wurden ihr Wälder, Felder und Weinberge übertragen, und diese machten mit hundertsiebzig Hektar das Juliusspital bis heute zum zweitgrößten Weingut Deutschlands und zum größten Silvaner-Weingut, wie ein Prospekt ihm erklärte. Weinberge in Randersacker und Lagen in Rödelsee gehörten dazu, ebenso in Iphofen und Escherndorf. An die beiden letzteren Namen erinnerte er sich. Waren sie am Vormittag in der Vinothek genannt worden, beim Streit der Freundinnen über die Kandidatinnen? Eine stammte wohl aus Nordheim, die andere aus Iphofen?
An erster Stelle der deutschen Weingüter, das wusste er als gebürtiger Frankfurter, standen die Hessischen Staatsweingüter in Eltville im Rheingau, unter anderem mit dem Kloster Eberbach.
War es von Bedeutung, dass er sich hier in dem größten Silvaner-Weingut der Welt befand? Größe war für ihn nie eine Qualität, höchstens für kleine Leute, die gern nach oben blickten. Es gab aber auch jene, die aus Größe etwas zu machen verstanden. Und oft war es schwer, ab einer gewissen Größe die Qualität zu erreichen und zu halten, denn mit kleinen Mengen, das wusste er aus Erfahrung, ließ sich leichter umgehen.