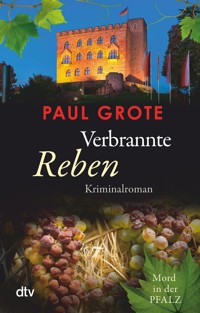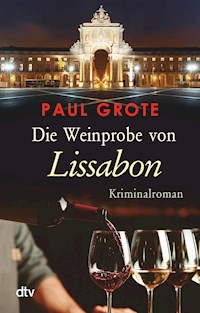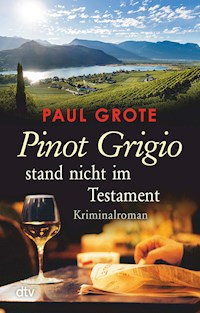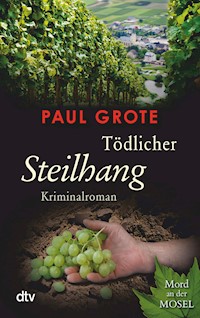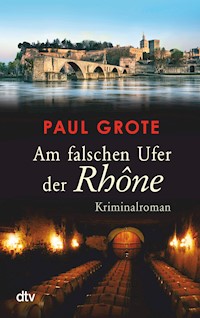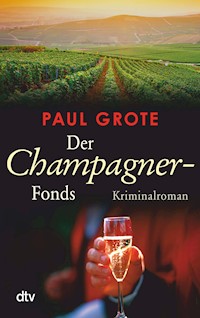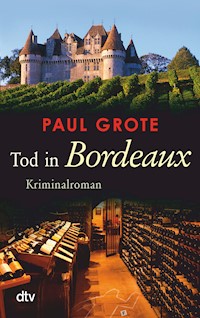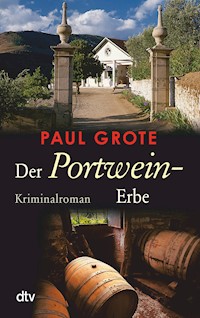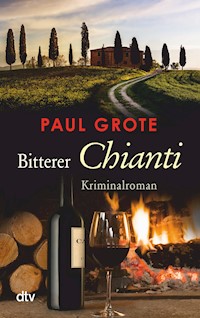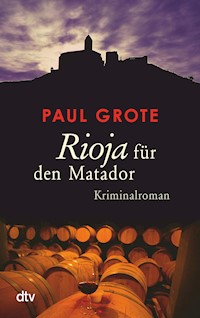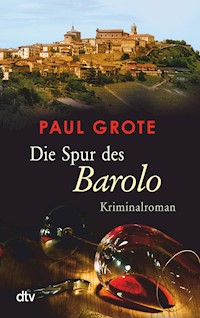
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Krimi
- Serie: Europäische-Weinkrimi-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der zwölfte Band der Weinkrimi-Reihe Die fröhliche Weinreise ins Piemont endet im Desaster. Arnold Sturm, einer der sieben Düsseldorfer Weinfreunde, ist spurlos verschwunden. Und zwar, wie es aussieht, auf dem Rückflug von Turin. Wurde er entführt? Aber wie und warum? Und lebt er noch? Ehefrau Francesca will so rasch wie möglich Antworten auf diese Fragen, aber die Behörden erweisen sich als wenig kooperativ. Also nimmt die energische Italienerin die Sache selbst in die Hand und stellt, als Wein-Einkäuferin getarnt, Nachforschungen an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Paul Grote
Die Spur des Barolo
Deutscher Taschenbuch Verlag
»Was glauben Sie wohl, wie lange die großen Gangster
ihre Fischzüge noch machen könnten, wenn die
Rechtsanwälte ihnen nicht zeigten, wo's langgeht?«
Raymond Chandler: Der lange Abschied, 1954
1
Wieso kam er nicht? Vor dem Abflug erst hatte er angerufen – da war noch alles in Ordnung gewesen. Es wird etwas passiert sein, dachte sie und schluckte. Sie fasste sich an den Hals, das Luftholen fiel ihr plötzlich schwer. Sie merkte, wie ihr Mund trocken wurde, die Beklemmung begann im Magen – und Hitze stieg ihr in die Wangen. Mühsam kämpfte sie gegen die Panik an.
Es muss etwas passiert sein, dachte sie, denn die Maschine aus Turin war längst gelandet. Wo blieben seine Begleiter? Warteten sie noch am Gepäckband auf ihre Koffer? Sie waren zu siebt unterwegs gewesen.
Francesca blickte auf die kleine goldene Uhr, die Arnold ihr zum zehnten Hochzeitstag geschenkt hatte. Die anderen Passagiere aus der Maschine hatten längst den Zollbereich passiert, da war sich Francesca absolut sicher. Für Italiener hatte sie einen Blick, es war momentan die einzige Maschine aus Italien, außerdem hatte die Frau eben ziemlich laut geredet.
»Non puoi neanche immaginarti quanta acqua è venuta giù prima della partenza, volevano persino posticipare il decollo.«
Aber der Start war nicht verschoben worden, der schwere Regen hatte nachgelassen, und die Maschine war pünktlich gestartet. Jetzt wartete sie hier bereits seit einer Dreiviertelstunde …
Wieder schaute sie auf die Uhr und blickte sich um. Einige Meter weiter rechts stand, wie sie vorhin bemerkt hatte, die Frau von Dr. Arlitt. Der Internist gehörte zu Arnolds Verein, es war die zweite oder dritte Weinreise, die sie gemeinsam unternahmen, persönlich nähergekommen war man sich jedoch auch bei gegenseitigen Einladungen nicht.
Frau Doktor jedenfalls, wie sie sich gern nennen ließ, hatte an nichts weiter Interesse geäußert als an ihrem Bridgeclub und den Modeläden auf der Königsallee. Ihr Mann kannte lediglich seinen Beruf und den Weinclub. Das Interesse an teuren Roten war wirklich die einzige Verbindung zu Arnold. Ob Arlitt als Arzt taugte, hatte er lieber nicht herausfinden wollen. Die Begleiterin von Hanna Arlitt, klein und pummelig – die hochgesteckten Haare machten sie auch nicht größer, dazu ein rosa Wollkostüm, der Rock viel zu eng –, gehörte auch zum Kreis der Weinfreunde. Sie war Francesca, wenn sie sich recht erinnerte, anlässlich eines fünfzigsten Geburtstags vorgestellt worden. War sie mit Trautmann verheiratet oder mit Grünleger? Es war seinerzeit bei höflichen Floskeln geblieben, so war ihr Eindruck oberflächlich, das gegenseitige Interesse hatte sich in Grenzen gehalten.
Die beiden Frauen hatten sich anscheinend viel zu sagen, nicht eine Sekunde schauten sie herüber. Francesca schien es, als wichen sie bewusst ihrem Blick aus. Entweder wollen sie mich nicht kennen oder übersehen mich geflissentlich, sagte sie sich. Andererseits fühlte sie sich in keiner Weise bemüßigt, hinüberzugehen. Die beiden machten trotz der Verspätung ihrer Männer nicht den Eindruck, als seien sie beunruhigt, ganz im Gegensatz zu ihr. Aber wie Francesca bemerkt hatte, waren beide angerufen worden, die Kleine in Rosa, das farblich auf ihr Mobiltelefon abgestimmte Kleid war ihr sofort aufgefallen, hatte kurz herübergeschaut und sofort wieder weggeguckt.
Normalerweise schaltete Arnold sein Mobiltelefon ein, sobald er nach der Landung eine Maschine verließ und sie ihm sagen konnte, wo auf dem Düsseldorfer Flughafen sie parkte oder auf welchem Parkdeck sie den Wagen für ihn abgestellt hatte. Wenn die Arbeit es zuließ, holten sie sich gegenseitig ab oder brachten sich zum Bahnhof oder Flughafen, es war ein lieb gewordenes Ritual, seit sie sich kannten.
Francesca rief erneut bei Arnold an, doch die Telefonstimme wiederholte nur, was sie bereits zweimal gesagt hatte: Der Dienst stünde momentan nicht zur Verfügung. Das war ein weiterer Stich im Magen.
Inzwischen musste eine Maschine aus Indien gelandet sein, Frauen in farbenfrohen Saris mit Kindern in den Armen und Männer mit Bergen von Koffern hinter überladenen Gepäckwagen drängten zum Ausgang.
Da, hinter den Glaswänden, tauchte Dr. Arlitt auf und winkte seiner Frau zu, nein, jetzt winkte er sie heran, und auch die Dame in Rosa folgte. Da entdeckte der Arzt, dass Francesca sich der Absperrung näherte. Sofort änderte sich seine Haltung. Als sei er bei etwas Verbotenem ertappt worden, ließ er den Arm sinken, starrte sie durch das Glas an, was sein Gesicht grotesk verzerrte, und wich zurück.
Es ist etwas passiert, dachte Francesca, es muss etwas passiert sein, etwas mit Arnold. Ihr Herz schlug schneller, sie versuchte, ruhiger zu atmen, sie spürte, wie eine Angst nach ihr griff, die sie nicht ignorieren konnte. Da bemerkte sie, dass auch Frau Doktor Arlitt zu ihr herüberblickte. Fragend? Nein, eher zornig, als wäre sie der Grund für die Verspätung. Dafür, dass ihr Mann sich wie in Quarantäne hinter den Glaswänden befand und sich nicht hervorwagte.
Hatte Arnold geschmuggelt und war vom Zoll erwischt worden? Was ließ sich im innereuropäischen Flugverkehr überhaupt schmuggeln? Nein, Arnold war nicht dumm, und wenn er etwas Ungesetzliches tat, ließ er sich nicht erwischen. Um Wein konnte es sich nicht handeln. Die auf ihren Reisen eingesammelten und bestellten Weine ließen sich die Mitglieder des 1. Düsseldorfer Weinclubs immer von der Spedition liefern.
Dr. Arlitt wirkte unentschlossen, als wisse er nicht, wem er sich zuwenden solle, seiner Frau oder Francesca. Dann machte er auf dem Absatz kehrt, ungreifbar verschwand er zwischen spiegelnden Glaswänden. Verstohlen stand da noch der Ehemann vom rosa Kostüm – das war Grünleger – und winkte linkisch. Er entdeckte Francesca, tat, als bemerke er sie nicht, und drehte sich weg.
Wieso tauchte Arnold nicht endlich auf, um ihr ein Zeichen zu geben? Wenigstens ein Zeichen, bitte, irgendeines, flehte sie im Stillen …
Wie eine Klammer legte sich die Angst jetzt um Francescas Hals und drückte zu, die Bedrohung war real, da war etwas geschehen. Von den anderen Männern, die mit im Piemont gewesen waren, zeigte sich keiner. Francesca fühlte sich gänzlich von der Hitze überschwemmt und stand hier mit glühenden Wangen. So hatte sie sich zuletzt mit fünfzehn gefühlt, als die Polizei ihr mitgeteilt hatte, dass ihre Eltern auf der Rückfahrt von Turin hinter dem Bernardino-Tunnel den schweren Autounfall gehabt hatten.
Gerade in dem Moment, als sie sich den beiden Frauen zuwenden wollte, erschien der Völkerkundler Trautmann im Ausgang. Der Professor legte immensen Wert darauf, dass man ihn Ethnologe statt Völkerkundler nannte, und bei passender und unpassender Gelegenheit zitierte er sein großes Vorbild, Claude Lévi-Strauss, und den von diesem postulierten Strukturalismus als Mittel, andere Völker zu begreifen. Was darunter zu verstehen war, hatte er nie erklärt. Konnte er es überhaupt?
Dem Professor folgte Grünleger, der Oberregierungsrat im Finanzministerium, heute noch farbloser als sonst, dafür einen Sonnenbrand auf der Nase. Beide zogen die Rollkoffer zaghaft hinter sich her, unbeholfen wie Jungen, die zu spät vom Spielen heimkamen und Angst hatten, dass Mutti schimpft. Was war ihnen peinlich? Dass sie Arnold in Turin vergessen hatten? Absurd, allein der Gedanke war grotesk.
Eilig drängte Dr. Arlitt an den beiden vorbei, er stürzte auf seine Frau zu, als müsse er die Begegnung mit Francesca unbedingt vermeiden. Trautmann hingegen steuerte nach einem tiefen Seufzer mit ausgestreckter Hand auf sie zu.
»Frau Sturm?«
Sie zuckte zusammen. Wieso fragt er mich nach meinem Namen, wo er mich doch kennt? Wir waren bei ihm zu Hause, es war sein Fünfzigster gewesen. Francesca wollte etwas sagen, doch sie krächzte nur, die Worte blieben ihr im Halse stecken.
»Ihr Mann, äh …« Jetzt zögerte Trautmann und wandte sich um, als könne er von Arlitt oder Grünleger Hilfe erwarten.
Francesca stockte der Atem. »Wo ist Arnold?« Mehr brachte sie nicht heraus. Sie reckte sich, um zu sehen, wer hinter dem Völkerkundler aus dem Ausgang trat. »Was ist mit ihm? Was ist passiert?«
Ihre eigene Stimme kam ihr fremd vor. Sie presste die Lippen zusammen, um ihn nicht anzubrüllen. Was wurde hier aufgeführt, was sollte das Theater?
»… er ist nicht, äh, mitgekommen!«, stammelte Trautmann und räusperte sich verlegen.
»Nicht mitgekommen? Wie? Er ist dageblieben, im Piemont, in Turin? Wo?«
»Nein, auch das nicht …« Ratlos zuckte Trautmann mit den Achseln.
»Obwohl wir zusammen eingecheckt haben«, platzte es aus Dr. Arlitt heraus, der jetzt näher gekommen war. Er sprach, als wolle er jedes Wort möglichst schnell hinter sich bringen. »Mehr wissen wir nicht.«
In einer Geste der Hilflosigkeit breitete er die Arme aus und machte ein ziemlich dummes Gesicht.
»Beim Boarding war er noch da.« Reinhold Kirsch, den Francesca recht gut kannte und mit dem sie sich duzten, war herangekommen. »Wirklich, Francesca, ich habe ihn gesehen, wie er im Warteraum aufstand, als wir aufgerufen wurden. Er hatte die Bordkarte und den Ausweis in der Hand, beides, glaub mir, niemand versteht das, keiner von uns.«
Inzwischen waren die beiden letzten Mitglieder des Weinclubs herangekommen. Nur Grünleger hielt sich fern, seine Frau redete unhörbar, aber äußerst eindringlich auf ihn ein und zerrte ihn am Ärmel, Francesca mit einem finsteren Blick strafend.
»Wir haben eben mit dem hiesigen Bodenpersonal gesprochen«, meinte Justus Heimbüchler, der Francescas Hand hielt, als wenn er sie beruhigen müsste. Den Rechtsanwalt kannte sie am besten, er arbeitete häufig mit Arnold zusammen. »Auch die Fluggesellschaft hat keine Erklärung. Sie haben sich bereits mit ihrem Büro in Turin in Verbindung gesetzt, aber dort ist er offiziell abgereist, er hat genau wie wir eingecheckt und war beim Boarding dabei, seine Bordkarte wurde ordnungsgemäß registriert, auch unsere Ausweise mussten wir vorzeigen. Also muss er in die Maschine eingestiegen sein, es kann gar nicht anders sein – nur …«, jetzt wusste auch Heimbüchler nicht weiter, »… er ist nicht da.« Mit großen, unschuldigen Augen blickte er Francesca an, als sei von ihr die Lösung des Problems zu erwarten.
»Wahrscheinlich ist er schon vorgegangen«, meinte Peter Schilling, der Steuerberater in der Gruppe, »so jedenfalls die Ansicht der Fluggesellschaft. Aber man lässt doch seinen Koffer nicht einfach stehen!«
Einer der Männer schob ihn nach vorn und stellte ihn vor Francesca ab, es wirkte wie eine Entschuldigung.
Sie schreckte zurück und starrte den Koffer an, als handele es sich um die Urne mit Arnolds Asche. Ihr wurde schwindlig, sie glaubte, den Boden unter den Füßen zu verlieren, Zweifel und Entsetzen hielten sich die Waage. Trotzdem schüttelte sie widerwillig die Hand ab, die sie zu stützen versuchte.
»Arnold hat eingecheckt, er war beim Boarding dabei – und ist jetzt nicht hier? Das gibt es nicht! Das ist unmöglich.« Sie schaute in die Gesichter dieser Männer in den allerbesten Jahren, die mit hochgezogenen Schultern, um Verzeihung flehendem oder gesenktem Blick vor ihr standen, mehr hilflos und schuldbewusst als besorgt. Nur der kleine Grünleger blieb abseits, stritt weiter mit seiner Frau in Rosa. Sie zerrte an ihm, hatte ihn fast so weit, dass er klammheimlich das Feld räumte. Er schaute herüber, ob ihn jemand beobachtete.
Francesca versuchte, das Unfassbare zu verstehen, den Sinn von Heimbüchlers Worten zu begreifen.
»Ihr seid sieben gestandene Männer, da kann doch nicht einfach einer von euch verschwinden?! Es fällt niemand aus dem Flugzeug.«
»Woher sollen wir das denn wissen?«, wagte Trautmann zu sagen, inzwischen der personifizierte Vorwurf. »Ich nehme an, er hat weiter vorn gesessen, ich jedenfalls habe ihn nicht in der Maschine gesehen.«
»Aber ihr wart alle dabei. Wer hat neben ihm gesessen? Ihr müsst ihn doch gesehen haben!«
Francesca wandte sich ab, damit niemand bemerkte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen.
Die Männer blickten von einem zum anderen, zum Schuldbewusstsein kam der Wunsch, den Flughafen schleunigst verlassen zu dürfen.
»Eigentlich hatte Arnold den Platz neben mir reserviert«, druckste Reinhold Kirsch herum, der Architekt, für sie eine der wenigen positiven Gestalten in der Gruppe. Sie fragte sich sowieso, weshalb Arnold nicht nur mit ihm, mit Schilling und Heimbüchler gereist war. Schilling, ja, vielleicht, aber mit den anderen?
»Ich dachte, er säße weiter vorn in der Reihe, wo die Notausgänge über den Tragflächen sind. Da waren Plätze frei, und man hat mehr Beinfreiheit. Beim Hinflug hat er auch da gesessen. Du weißt ja, wie eng es in den Flugzeugen ist, und Arnold ist ziemlich groß.«
»Ja, so groß, dass er kaum zu übersehen ist! Aber wie man sieht, geht auch das!«
Unter Francescas Fassungslosigkeit und Angst mischte sich Wut. Wie gleichgültig muss man anderen gegenüber sein, dass man jemanden von Arnolds Größe übersah. Oder wie selbstbezogen? Jetzt kam es darauf an, Haltung zu bewahren, vor diesen Männern keine Schwäche zu zeigen, das tat sie auch sonst nicht. Unter den Wirtschaftsprüfern, mit denen sie zusammenarbeitete, und unter den Klienten war sie fast immer die einzige Frau, abgesehen von den Assistentinnen.
Sie riss sich zusammen.
»Und wie geht’s jetzt weiter?« Fordernd blickte sie in die Runde, die deutliche Auflösungserscheinungen zeigte. »Was werdet ihr unternehmen?«
Die kleine Dicke hatte ihren Oberregierungsrat bereits abgeschleppt. Und wenn erst ein Stein fehlte, fiel der Rest der Mauer fast von allein in sich zusammen. Dr. Arlitt meinte ebenfalls, sich verstohlen mit seiner Frau Doktor absetzen zu müssen. Ein schöner Verein ist das, der 1. Düsseldorfer Weinclub, dachte Francesca, nicht der Erste, vielmehr der Letzte. Einer verschwindet spurlos, und die anderen gehen nach Hause, als ginge es sie nichts an.
So sah es wohl auch der Völkerkundler, der lieber Ethnologe sein wollte, er trollte sich mit seinem Rollkoffer. Von den ursprünglichen sieben waren jetzt nur noch drei übrig.
Der Einzige, bei dem Francesca das Gefühl hatte, dass ihm Arnolds Verschwinden wirklich naheging, und der an ihrer Not Anteil nahm, war Reinhold Kirsch, nein, auch Heimbüchler.
»Ich habe ihn nicht in der Warteschlange gesehen, er stand sicher am Ende; aber wenn er nicht dort gewesen wäre, hätten sie ihn ausgerufen. Und es wird auch kein Koffer ohne die dazugehörige Person transportiert, allein aus Furcht vor Bombenanschlägen. Ich habe es mal erlebt, dass in München alle aussteigen mussten und jeder gezwungen war, sein Gepäck zu identifizieren, weil drei Koffer zu viel an Bord waren. Die dazugehörigen Passagiere hatten sich im Flughafenrestaurant festgesoffen. Erst als das geklärt war, flogen wir ab.«
»Last call for passenger Arnold Sturm.« Was von Peter Schilling witzig gemeint war, verkehrte sich ins Gegenteil, und der Steuerberater erntete strafende Blicke. »Ich muss leider dringend los«, entschuldigte er sich, »ich habe einen Termin mit einem Mandanten. Er hat mich bekniet, ihn heute noch zu treffen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es eine Verzögerung geben würde. Eine Steuersache«, fügte er mit deutlichem Bedauern hinzu, es war ihm gleichgültig, wie diese Ausrede aufgefasst wurde.
»Wie soll das möglich sein? Jemand checkt regulär ein und kommt nicht an?« Der Beamte der Flughafenpolizei glaubte ihnen kein Wort. »Unterwegs kann niemand aussteigen!«
Bemüht, ihre erneut aufsteigende Panik nicht zu zeigen, blickte Francesca von Reinhold Kirsch zu Justus Heimbüchler, nur der Architekt und der Anwalt hatten sie zur Flughafenpolizei begleitet. In dem engen, schmucklosen Raum befand sich neben den beiden Dienst habenden Polizeibeamten noch der Stationsleiter der Fluggesellschaft, der mehrmals betont hatte, dass eigentlich die Flugbegleiter hier sitzen müssten, aber einer hätte bereits den Flughafen verlassen, der andere sei mit derselben Maschine nach Turin zurückgeflogen. Besondere Anteilnahme zeigte er nicht.
Die einzige Erklärung, die der Beamte parat hatte, war, dass Passagier Sturm sich bereits hier auf dem Düsseldorfer Flugplatz abgesetzt hatte, ohne sein Gepäck mitzunehmen. Über mögliche Gründe wollte er sich nicht auslassen. »Wenn es jemand weiß, dann Sie, Frau Sturm!« Was er damit meinte, ließ er offen. Er ließ sich aber doch zu ein paar vagen Andeutungen hinreißen, mit ausweichenden Gesten in Richtung Francesca, dass der liebende Gatte wohl mal Zigaretten holen gegangen sei, was manch einer dazu nutze, ein völlig neues Leben in »gänzlich anderen Zusammenhängen« zu beginnen. Wollte er damit sagen, dass Arnold sich eine andere Frau suchte?
»Wir prüfen selbstverständlich die abfliegenden Passagiere sowie die Passagierliste, aber wir zählen nicht die Ankommenden. Meines Wissens nach ist es bisher niemals vorgekommen, dass jemand nicht angekommen ist. Wie auch? Seien Sie gewiss, dass wir bei der latenten Bedrohung des Luftverkehrs die Augen sehr weit offen halten, sehr weit.«
»Er wird die Angelegenheit sicher an die entsprechende Abteilung beim BKA weiterleiten«, flüsterte der Anwalt Francesca zu, um ihr Mut zu machen, als der Beamte sich seiner Kollegin zuwandte. »Die vermuten heutzutage hinter allem schnell irgendwas Politisches.«
Die junge Beamtin, die zuvor ihre Ausweise kontrolliert und anscheinend auch überprüft hatte, als wären sie einer Entführung verdächtig, tippte jetzt ein Protokoll.
Für Francesca stellte sich die Situation grotesk dar. Sie erwartete noch immer, dass Arnold jeden Moment auftauchte, weil er auf der Toilette gewesen war. Oder hatte er sich einen Spaß erlaubt? Das war ihm am ehesten zuzutrauen, er liebte schwarzen Humor, es war seine Art, mit unangenehmen Ereignissen fertigzuwerden. Oder überraschte er sie hier mit einem Blumenstrauß? Vielleicht hatte er sich verlaufen?
»Wo genau sind Sie gewesen?«, fragte der Beamte von der Flughafenpolizei. Francesca spürte, dass er sich zumindest den Anschein gab, sich für den Verbleib eines Passagiers zu interessieren, selbstverständlich innerhalb seines beruflichen Rahmens.
Reinhold Kirsch blickte Justus Heimbüchler auffordernd an, der Architekt hielt es anscheinend für sinnvoller, dass ein Anwalt das Wort führte.
»Wir waren eine Woche lang in den Langhe unterwegs«, antwortete er, »das Gebiet liegt südwestlich von Mailand oder östlich von Turin – in Italien«, fügte er wegen des verständnislosen Ausdrucks in den Gesichtern der Beamten hinzu, »südlich des Städtchens Alba, wenn Ihnen das was sagt.«
»Was war der Grund Ihrer Reise? Urlaub oder geschäftlich?«
»Wir gehören einer Verbindung von Weinenthusiasten an, wir sind Weinfreunde. Deshalb veranstaltet der Club zweimal jährlich eine Reise in ein Weinbaugebiet. Wer Zeit und Lust hat, kommt mit.«
Und das entsprechende Kleingeld, dachte Francesca, doch derartig zynische Gedanken waren unbeliebt, wie sie wusste.
»Eine Reise führt in ein europäisches Land, eine in ein deutsches Weinbaugebiet«, setzte Heimbüchler fort. »Wir besuchen die Winzer und schauen uns ihre Kellereien und die Weinberge an.«
»Da wird sicherlich allerhand probiert, vermute ich mal.« Der Beamte hob kaum merklich den Kopf, so jedenfalls kam es Francesca vor, als wollte er prüfen, ob einer der beiden Männer nach Alkohol roch, und auch der Stationsleiter zeigte seine Skepsis. Hatte man es bei Arnold Sturm womöglich mit einem Alkoholiker zu tun?
»Wir sind von morgens bis abends breit«, meinte Reinhold Kirsch zu Francescas Erschrecken, aber dann lachte er, und Heimbüchler stellte die Sache richtig.
»Beim professionellen Verkosten betrachtet man den Wein zuerst, seine Farbe spielt dabei eine wichtige Rolle, die Klarheit, daran erkennt man vieles, dann nimmt die Nase den Duft auf, man riecht Stärken und Schwächen des Weins – mit der entsprechenden Erfahrung selbstverständlich – und mögliche Fehler. Zum Probieren nimmt man nur einen winzigen Schluck, um den Mund auszuspülen. Da zeigen sich dann andere Eigenschaften. Alles wird zuletzt ausgespuckt. Alkohol kann die Sinne benebeln, die man zur Beurteilung benötigt, darüber sind wir uns durchaus im Klaren.«
»Dann hatte Ihre Reise doch einen beruflichen Hintergrund?«
»Nein. Wir interessieren uns für Wein, für die Landschaft, für den Weinbau generell. Man reist mit guten Freunden und beschäftigt sich mit anderen Dingen, Kultur, Bauwerke, Malerei … Wir sind beruflich alle ziemlich eingespannt. Ja, die Geschichte der jeweiligen Region ist uns natürlich wichtig. In historischer Hinsicht ist das Piemont …«
»Wer war alles dabei?«, fragte die Polizistin. »Nur Sie beide und der … der Verschwundene?«
»Nein, wir waren zu siebt.« Während Heimbüchler die Beteiligten nannte, schrieb Kirsch ihre Namen in Druckbuchstaben auf einen Zettel und schob ihn über den Tisch. Jetzt zeigte auch die Beamtin etwas wie Interesse.
»Wo sind denn ›Ihre anderen guten Freunde‹ jetzt, wie Sie sagen?«
Die haben sich aus dem Staub gemacht, dachte Francesca, aber das geht mich alles nichts an. Sie hob den Kopf und strich sich das lange schwarze Haar aus dem Gesicht. Worüber reden sie?, fragte sie sich. Geht es überhaupt um Arnold? Oder geht es bereits um einen »Fall«, der aufgeklärt werden muss, weil die beiden Uniformierten gerade Dienst haben? Sie nahm dem Beamten seinen Spruch vom Zigarettenholen zutiefst übel. Aber was sollte man von Leuten erwarten, die lediglich ihren Job machen? Habe ich Anteilnahme erwartet? Ja, das habe ich.
»Reisen Sie immer in dieser Zusammensetzung?« Der Beamte hatte die Liste mit den Namen durchgesehen und sah Kirsch forschend an.
Heimbüchler bedeutete mit einer abwehrenden Handbewegung, das Antworten ihm zu überlassen, er war den Umgang mit Behördenvertretern gewohnt.
»Wie ich bereits sagte: Wer Zeit und Lust hat, kommt mit. Dann ist natürlich die Zusammensetzung der Gruppe entscheidend. Mit einigen ist man enger befreundet, mit anderen lediglich bekannt. In unserem Fall sind wir beide«, Heimbüchler wies auf Kirsch, »seit einigen Jahren mit dem Ehepaar Sturm befreundet, wir arbeiten gelegentlich zusammen, er ist auch Anwalt, zwar nicht in derselben Kanzlei, aber man unterstützt sich. Und Herr Kirsch wird in rechtlichen Fragen von mir beraten.«
»Wo sind die anderen?« Es war die zweite Frage aus dem Mund der jungen Polizistin.
»Die sind bereits gegangen!« Francesca hätte besser geschwiegen, so war ihr anzumerken, wie sehr es sie empörte.
Die Polizistin spürte wohl, was in Francesca vorging, und sah sie in einer Mischung von Skepsis und Verachtung an. Oder war es Neid? Francesca hatte bemerkt, wie abschätzig sie bereits vorhin von ihr gemustert worden war. Sie hatten am Vormittag ein Gespräch mit einem wichtigen Mandanten gehabt, und sie trug noch immer den eleganten, mitternachtsblauen Hosenanzug. Besonders der Blick auf ihre hohen Schuhe war ihr aufgefallen, als sie sich an den Tisch gesetzt und die Beine übereinandergeschlagen hatte.
»Sie kennen sich also gut?« Als der Beamte keine Antwort erhielt, stellte er die nächste Frage. »Ist auf Ihrer Reise irgendetwas vorgefallen, das mit dem Verschwinden Ihres Begleiters in Verbindung stehen könnte? Gab es Vorfälle, Andeutungen, Hinweise?«
Kirsch und Heimbüchler wirkten ratlos, Letzterer zuckte mit den Achseln und sah Francesca an, als wüsste sie mehr.
»Gab es Streit, kam es zu Auseinandersetzungen? Warum sind die anderen Reisebegleiter nicht hier?«
»Nein, es gab keinen Streit. Und weshalb die anderen gegangen sind, müssen Sie die Betroffenen schon selbst fragen. Ich vermute, die wollen da nicht mit reingezogen werden.«
»In was?« Der Beamte wirkte mit einem Mal sehr aufmerksam und bekam einen langen Hals.
»Na, in diese Angelegenheit eben, dass Arnold verschwunden ist. Was sonst?«
»Mehr nicht?« Skepsis und Misstrauen lag in diesen beiden in die Länge gezogenen Worten des Polizisten.
»Ich gehe dann mal«, sagte plötzlich der Vertreter der Fluggesellschaft. »Ich habe zu tun, mich braucht man hier allem Anschein nach nicht mehr.« Beleidigt stand er auf.
»Sie könnten uns allerdings behilflich sein«, sagte Kirsch und hob die Hand, woraufhin der Stationsleiter sich wieder setzte. »Sowohl beim Betreten der Maschine wie auch beim Verlassen stehen Ihre Mitarbeiter an den Türen. Vielleicht kann sich jemand von der Besatzung an Herrn Sturm erinnern? Sie müssen ihn mindestens zweimal gesehen haben: als er die Maschine betrat und als er sie verließ.«
»Was glauben Sie, wie viele Passagiere unsere Mitarbeiter während einer Schicht zu Gesicht bekommen? Bei vier oder fünf Flügen pro Tag sind das weit mehr als eintausend Gesichter. Und dabei müssen sie Plätze zuweisen, sich die Bordkarten zeigen lassen, Gepäck verstauen, Streit schlichten …«
Francesca gab sich mit der Antwort nicht zufrieden. »Man sieht immer einige Menschen genauer an als andere. Es gibt den Bordverkauf, Kaffee wird ausgeschenkt, Ihr Personal schiebt die Bedienungswagen mehrmals den Gang entlang. Man kann den Stewardessen ein Foto meines Mannes zeigen. Vielleicht ist er ihnen aufgefallen, vielleicht erinnern sie sich an ihn. Er ist besonders groß«, meinte Francesca vorsichtig.
Zaghaft oder zögerlich zu sein, lag sonst weniger in ihrer Art, sie konnte sich normalerweise gut durchsetzen. Im Umgang mit Männern, die sich für hochkarätig hielten, hatte sie es gelernt, ja lernen müssen, sonst hätte sie niemals ihre heutige Position erreicht und wäre längst in eine der hinteren Reihen verwiesen worden oder untergegangen. Aber hier und heute fühlte sie sich hilflos und schrecklich nah am Untergang, besonders wenn sie daran dachte, was sie nachher den Kindern sagen sollte. »Euer Vater ist verschwunden! Ich weiß nicht, wo er geblieben ist.« Das sollte sie ihnen sagen müssen? Niemand weiß, wo Papa steckt? Nein, das würde sie nicht über die Lippen bringen, und doch musste sie es tun. Wie von ferne hörte sie den Polizisten die nächste Frage aussprechen.
»Welchem Beruf ging Ihr Ehemann nach?«
»Wieso ging?« Francesca schrak zusammen. »Was wollt … ihr damit … sagen …?«, stammelte sie. »Er ist doch nicht …?«
»Nein«, beruhigte sie der Architekt und tätschelte ihren Arm, »das hat er nur so gesagt.«
»Ja, ja«, beeilte sich der Beamte zu sagen, »das war unüberlegt. Wir wissen ja nichts. Aber – ich meine, was macht er beruflich? Kann durchaus sein, dass uns das weiterhilft.«
»Er ist Anwalt für Wirtschaftsfragen, Steuerrecht, internationale Verträge und so weiter.«
»Einer von denen, die anderen dabei helfen, ihr Geld am Fiskus vorbei ins Ausland zu schaffen?« Die Polizistin hielt sich wohl für besonders pfiffig.
2
Es war nicht die unausgesprochene Unterstellung, ob Arnold als Wirtschaftsanwalt seinen Mandanten half, ihr Geld im Ausland zu verstecken, die Francesca aufgebracht hatte. Das Wort von der Steuerflucht war heutzutage in aller Munde, und die Abgeordneten, die am lautesten gegen Steuerhinterziehung wetterten, nutzten sicher die besten Berater. Sie wusste schließlich selbst, wie es funktionierte.
Was Francesca in Rage gebracht hatte, war die Frage der Polizistin, wie es um ihre Ehe beschaffen sei. Stand dahinter nicht letztlich die Vermutung, die mit dem Spruch vom »Zigarettenholen« aufgeworfen worden war? Der Ehemann setzt sich klammheimlich ab, verschwindet nach der Ankunft im Flughafengebäude auf Nimmerwiedersehen, nimmt eine andere Identität an, lässt sich in einem anderen Land nieder und heiratet eine Siebzehnjährige?
Dazu hätte es keiner Reise ins Piemont bedurft. Doch mehr noch als diese Unterstellung erboste Francesca die Tatsache, dass der Gedanke an ihr nagte. Dabei hatte Arnold ihr niemals Anlass gegeben, ihr Vertrauen infrage zu stellen.
Das alles beschäftigte sie auf dem Weg ins Parkhaus. Sie ärgerte sich maßlos, dass sie in ihrer gemeinsamen Vergangenheit nach Anzeichen suchte, die ein derartiges Verhalten gerechtfertigt hätten, und hasste sich dafür. Glücklicherweise hatten weder Heimbüchler noch Kirsch sie darum gebeten, im Wagen mitgenommen zu werden. Beide hatten sich ein Taxi genommen, Heimbüchler wohnte in Flugplatznähe in Stockum, Kirsch am Eisstadion. Sie hätte nach Oberkassel gemusst, aber jetzt traute sie sich nicht, den Kindern ohne ihren Vater unter die Augen zu treten, etwa so, als sei sie für sein Verschwinden verantwortlich.
Am besten konnten ihr jetzt ihre Eltern helfen. Sie brauchte jemanden, der sie in den Arm nahm und tröstete, so wie es nur ihre Mutter konnte, und sie war genauso auf den praktischen Rat Feltrinellis angewiesen. In Katastrophen blieb ihr Vater gelassen und das Verständnis in Person.
Die Familie Feltrinelli war der ruhende Pol in Francescas Leben. Arnold hatte sie sacht hinüberziehen können, ihre Kinder gehörten sowieso dazu. Sie lächelte still bei dem Gedanken. In Bezug auf die Familie war sie ganz Italienerin. In jeder anderen Hinsicht fühlte sie sich als Deutsche, als Düsseldorferin, und darin lag der dauernde Streit mit Basilio, dem sie gleich im »Tavolata« unweigerlich begegnen würde. Ihres Bruders wegen mied sie das elterliche Restaurant neuerdings. Basilio hatte ihren Vater so lange bearbeitet, bis dieser ihn offiziell zum Geschäftsführer des Restaurants ernannt hatte. Er hätte es ihm fast gänzlich überschrieben, nur um seine Ruhe zu haben, wenn sie nicht interveniert hätte. Das verzieh ihr Basilio nicht. Der Gedanke an ihren Bruder machte Francesca genauso wenig Freude wie die unverschämten Parkgebühren des Flughafens. Sie hatte geglaubt, nur eine halbe Stunde bleiben zu müssen, jetzt waren vier vergangen. Vier grauenvolle Stunden.
Wie in Trance fuhr sie ins Stadtzentrum, fertigte Alice am Telefon ab, die sich beschwerte, dass sie noch immer nicht zu Hause sei, und riet ihr, falls sie Hunger habe, ins »Tavolata« zu kommen. »Oma wird sich riesig freuen, dich zu sehen.«
Aber es war ihrer Tochter dann doch zu weit, von Oberkassel zur Graf-Adolf-Straße zu radeln oder, falls sie die U-Bahn nahm, umsteigen zu müssen. Dann doch lieber die Pizza aus dem Tiefkühlfach, dem Bruder würde sie was übrig lassen. Als Alice nach ihrem Vater fragte, drückte Francesca einfach die Aus-Taste. Das war das einzig Schöne an diesen entnervenden Geräten, man konnte sie abschalten oder zu Hause oder im Büro liegen lassen.
Nur Filmhelden fanden stets den Parkplatz vor dem Restaurant. Francesca suchte eine Viertelstunde und musste noch zwei Häuserblocks zurücklaufen, bis sie das »Tavolata« erreichte.
Ausnahmsweise war das Restaurant nicht bis auf den letzten Tisch besetzt, wie zu Messezeiten oder an Wochenenden. Ihr Vater stand mit einer Flasche Wein an einem der Tische und gab den Sommelier, über Wein redete er besonders gern. Er schaute zu ihr, und sein Lächeln erstarb. Er sah wie immer auf den ersten Blick, dass seine Tochter ein Problem mit sich herumschleppte. Er ließ sich nichts vormachen. Wie ernst das Problem jedoch war, konnte er nicht ahnen.
Es war gut, dass ihr Vater beinahe jeden Abend herunterkam, um von neunzehn bis zweiundzwanzig Uhr in der Küche die schwierigsten Aufgaben zu übernehmen. Er und ihre Mutter waren die ruhenden Pole und blieben es auch in ärgster Hektik. Außerdem war sein Weinkeller sein ganzer Stolz, besonders die Weine, von denen nur wenige Flaschen Barolo und Barbaresco seit der Eröffnung vor zwanzig Jahren hier lagerten. Ansonsten erreichte höchstens ein Aglianico del Vulture oder ein Brunello dieses Alter. Alle anderen italienischen Weine sollten seiner Ansicht nach früher getrunken werden.
Aber davon verstand Francesca nichts. Gerade mal diese wenigen Namen hatte sie sich gemerkt, vielleicht noch den vom Chianti und ob sie von den Colli Senesi kamen, den Hügeln Sienas, oder den Colli Pisane, denen um Florenz. Aus welchen Rebsorten sie gekeltert wurden, war ihr schleierhaft, und sie wollte es auch nicht wissen. Italiens Weinbaugebiete waren viel zu groß und vielfältig und mit achthunderttausend Hektar achtmal größer als die deutschen, das zumindest wusste sie, und hier trank man Riesling und Silvaner oder rote Billigweine von sonst woher.
Noch immer hing ihr das Trauma der Pizzabude ihrer Eltern nach. Sie hatte als Kind aushelfen müssen, besonders nach dem Unfall ihrer Eltern, und hatte nach Jahrzehnten noch immer den Geruch (nein, besser Gestank) von geschmolzenem und verkohltem Käse in der Nase. Dazu hatten der billige, rote Kalterer See und der weiße Frascati aus der Zweiliterflasche ihren Sinn für Wein geprägt, vielmehr zerstört.
Sie schwärmte für deutsche Küche und liebte die französische, und unter den Weinen schätzte sie inzwischen vieles, was aus Spanien kam. Aber daran waren Arnold und sein Weinhobby schuld.
»Irgendwann begreifst du es«, hatte ihr Vater gesagt und sie wohlwollend gewähren lassen.
Er hatte sie stets gewähren lassen. Und als die Eltern ihre Pizzabude in Bilk verkauft hatten, eine wahre Goldgrube, die Korbflaschen mit dem billigen Chianti hinter sich ließen und das »Tavolata« eröffneten, hatte es zwar nicht mehr nach verbranntem Käse gerochen, es lagen auch keine durchgebogenen Salamischeiben mehr auf zu dicken Pizzaböden, aber Francesca hatte weiterhin helfen müssen. Erst als ihr Vater die gierigen Blicke der männlichen Gäste und die neidischen der weiblichen bemerkt hatte, war sie aus dem Frondienst entlassen worden. Doch ihr Käse-Trauma hielt sich, und Pizza war ihr ähnlich verhasst wie der Duft von Trüffeln, bei dem anderen das Wasser im Mund zusammenlief.
Sie ging in die Küche, um den Koch zu begrüßen und zu schauen, ob ihre Mutter heute mitgekommen war. Dabei bemerkte sie, dass ihr Bruder mit einem Schwarzen zwischen der Anrichte aus Edelstahl und dem Spülbecken stand und auf Englisch auf den armen Mann einredete. Der Ton war grob und unverschämt. Francesca kannte ihren Bruder, wenn er sich aufspielte, und genau das tat er. Er machte den Mann nieder, der mit gesenktem Blick vor ihm stand, ein Tuch in der Rechten und eine Schüssel in der Linken.
»Basilio!«
Ihr Bruder wiederum kannte den Ton seiner älteren Schwester, sie war der einzige Mensch auf der Welt, den er fürchtete, und sie verstand es, diesen Umstand zu nutzen. Sie war der einzige Mensch, der ihn in seine Schranken weisen konnte. Für einen Moment vergaß sie den wirklichen Grund ihres Hierseins.
»Basilio! Ich glaube, ich muss mit dir reden!« Francescas Ton war hart und bestimmend. »Wer ist der Mann?« Sie wies mit dem Kopf in die Richtung des Afrikaners.
»Was geht dich das an?«
»Sehr viel, mein Lieber. Was macht der hier?«
»Stell dich nicht so dumm an, du siehst doch, dass er arbeitet.«
»Legal oder illegal?«
»Sag mal, Schwesterchen«, Basilio baute sich mit in die Hüften gestützten Fäusten vor ihr auf, »übernehmen jetzt die Wirtschaftsprüfer schon die Aufgaben der Gewerbeaufsicht?« Nicht nur sein Gehabe, auch seine Worte sollten überlegen klingen, besonders vor einem Dritten.
»Nein, die Ausländerbehörde übernimmt, und die bin ich! Legal oder illegal?« Francesca ließ sich nicht beeindrucken, sie lächelte dem Mann beruhigend zu, der sie verängstigt anstarrte. Er hatte begriffen, dass es um ihn ging.
»Ein Freund hat uns diesen Nigerianer empfohlen, er ist kein Muslim, das reicht mir als Referenz, und damit gut. Würdest du bitte aus der Küche verschwinden?« Basilio kochte vor Wut darüber, derart bloßgestellt zu werden. »Raus, Schwesterchen, du nervst! Wir arbeiten hier, ganz im Gegensatz zu dir …«
»Legal oder illegal? Was hat er für einen Arbeitsvertrag, zwei Euro die Stunde? Schlafen lässt du ihn unter der Treppe? Und zu essen kriegt er, was auf den Tellern der Gäste zurückkommt? Weiß Papà davon?«
»Ich habe gesagt, du sollst verschwinden!«
Basilios Aufforderung klang längst nicht mehr so überzeugend wie anfangs, er wusste, dass er Francesca in keiner Weise Paroli bieten konnte. Als Junge hatte er gewagt, in ihrem Poesiealbum Seite für Seite zuzukleben, und die Kloppe, die er danach von ihr bezogen hatte, würde er sein Leben lang nicht vergessen. Francesca schämte sich bis heute dafür und hatte es gleichzeitig nie bereut.
»Wovon soll ich wissen oder nicht wissen? Streitet ihr schon wieder? Kinder, werdet ihr jemals erwachsen?« Signor Feltrinelli war unbemerkt in die Küche getreten, er ging auf die beiden zu, da erst bemerkte er den Afrikaner und blieb verwundert stehen.
Es war für Francesca das Zeichen, dass auch er nichts von dem Mann wusste, der sich die Schüssel schützend an den Bauch presste.
»Ich glaube«, sagte sie scharf, »dein Sohn beschäftigt einen Illegalen hier. Ich habe nichts dagegen, Asylbewerbern oder Illegalen Arbeit zu geben, aber wenn, dann zu Bedingungen, zu denen auch Deutsche hier arbeiten. Und Kalle ist nirgends zu sehen. Hast du ihn rausgeschmissen?«
Die Frage war an ihren Bruder gerichtet.
»Stimmt, wo ist er?« Feltrinelli sah sich nach dem Küchenhelfer um, jedoch nicht allzu interessiert, ihn beschäftigte etwas anderes, besorgt blickte er seine Tochter an. »Was ist los mit dir, Fran? Warum bist du so aggressiv? Du bist ja völlig außer dir, Kind.« Verständnislos schüttelte er den Kopf, als er sah, wie Francesca den Kopf senkte und, die Tränen unterdrückend, die Küche verließ.
»Wir sprechen uns gleich«, sagte Feltrinelli drohend an seinen Sohn gewandt, »halte dich an die Regeln.«
Er folgte Francesca. Sie war in der Nische zwischen Küche und Lokal stehen geblieben und hielt sich eine Serviette vors Gesicht, um ihre Tränen zu verdecken. Feltrinelli nahm sie in die Arme, strich ihr über den Kopf und ließ seine Tochter weinen. So hatten sie es immer gehalten, schon damals, als sie vier Jahre alt gewesen war, und jetzt mit zweiundvierzig. Für Feltrinelli gab es da keinen Unterschied, und auch nicht für Francesca. Nach einer Weile nahm er selbst die Serviette und tupfte ihr die Tränen aus dem Gesicht.
»Was ist passiert?«
»Arnold ist weg. Er ist verschwunden. Er ist von der Reise nicht zurückgekommen!«
Feltrinelli wusste von der Tour seines Schwiegersohns ins Piemont, in die Langhe. Die Clubmitglieder hatten hier bei ihm im »Tavolata« die Reise geplant, er selbst hatte den einen oder anderen Tipp beisteuern können, er kannte sich einigermaßen aus. Seine Frau und er waren in Turin geboren, und bis ins Barolo-Gebiet waren es von dort lediglich sechzig Kilometer, nicht einmal eine Autostunde entfernt. Und er hatte den Männern, von denen zwei zu seinen Stammkunden gehörten, die dortigen Weine vorgesetzt: Dolcetto, Barbera und die aus der Nebbiolo-Rebe gekelterten regionalen DOCG-Weine. Sogar ein weißer Langhe Arneis sowie ein piemontesischer Chardonnay fanden sich auf seiner Weinkarte.
»Arnold verschwunden?« Ungläubig starrte er seine Tochter an. »Die anderen sind alle wieder zurück?«
»Ich komme eben vom Flughafen, ja, die anderen sind zurück, alle«, schluchzte Francesca und nahm ihrem Vater die Serviette aus der Hand.
Sie musste schrecklich aussehen, Lidstrich und Wimperntusche waren bestimmt total verschmiert. Als sie nach dem Taschenspiegel griff, merkte sie, wie ihr Vater sie an den Schultern nahm, sie ein wenig distanziert betrachtete und lächelte.
»Er kommt wieder. Verlass dich auf ihn. Er ist ein guter Mann. Er ist ein starker Mann, er ist ein Vater, ich kenne ihn, er weiß, was er tut, und wenn er in Schwierigkeiten geraten ist … Jetzt bring dich erst einmal in Ordnung, ich regele das in der Küche mit dem … wo kommt der her?«
»Nigeria … glaube ich zumindest.«
»Und dann erzählst du mir alles ganz genau, und wir essen etwas. Wissen die Kinder davon?«
Francesca schüttelte wortlos den Kopf.
Eine Viertelstunde später saßen sie zu dritt an einem Tisch in der Nische, die im Lokal eine gewisse Privatheit garantierte. Außer einem stillen Wasser und einem Caffè doppio rührte Francesca nicht einmal ihren Lieblingssalat mit Scampi an, sie bekam keinen Bissen herunter.
Außerdem irritierte sie die Umgebung. Es dauerte einen Moment, bis sie begriff, was sich geändert hatte: Es standen mehr Tische in den beiden Räumen als sonst, sie empfand es als zu eng und für die Gäste sicher unbequem. Wie ihr Vater seufzend erklärte, der bei seiner für einen Italiener ungewöhnlichen Größe auch Schwierigkeiten hatte, seine Beine unterzubringen, versprach sich Basilio von drei Tischen mehr eine deutliche Umsatzsteigerung. Aber dass die Gäste womöglich wegblieben, weil sie sich beengt fühlten, hatte er nicht einsehen wollen, meinte Feltrinelli schicksalsergeben.
»Der Junge muss seine Erfahrungen selbst machen.«
Basilio wollte immer mehr, egal, wovon, es reichte ihm nie, obwohl die Familie und ihre Mitarbeiter ein gutes Auskommen hatten.
»Nullwachstum ist Stillstand« war sein Credo. Wo er den Blödsinn aufgeschnappt haben mochte? Sicher von einem seiner neuen »Freunde« aus der Marketing-Branche, die sich andernorts an der neuen Pinzettenküche erfreuten, wo zwei vom Sternekoch kreativ gekreuzte Schnittlauchhalme an Gänseblümchen bereits für Furore sorgten.
Wenn Francesca anführte, dass die Gäste verstehen wollten, was sie aßen, konterte Basilio, dass sie bereits satt seien und ein Restaurant heutzutage der Unterhaltung diene.
Mittlerweile war ihre Mutter aus dem dritten Stock heruntergekommen. Die Eltern wohnten im selben Haus, wo sie eine Wohnung gekauft hatten. Auch das Lokal gehörte ihnen, was sie vor Mieterhöhungen schützte, die manchen Pächter in den Ruin trieben. Sie trug eine weiße Bluse zum schwarzen Kostüm, wie immer, wenn sie das Lokal betrat. Sie war es ihrer Stellung als Donna Marcella und auch der Bekanntheit wie ihrer Beliebtheit bei den Gästen schuldig. Oder sie stand in grauer Hose und weißer Kochjacke am Herd und scheuchte die Mitarbeiter. Heute war nicht viel zu tun, trotzdem wurde die Form gewahrt.
Francesca berichtete, dass Arnold sie noch am Vormittag im Büro angerufen habe, da seien er und seine sechs Begleiter auf dem Weg zum Flughafen von Turin gewesen, und er habe keinerlei Andeutungen gemacht, dass etwas nicht in Ordnung sei.
»Alle waren bester Laune, und obwohl er die Reise als vollen Erfolg ansah, hat er sich gefreut, nach Hause zu kommen.«
Danach berichtete sie davon, was sich im Flughafen zugetragen hatte und dass schließlich nur zwei der sechs zurückgekehrten Mitglieder des Weinclubs geblieben seien. Als sie erzählte, wie man ihr Arnolds Koffer vor die Füße gestellt hatte, verschlug es ihr die Sprache. Nach einer Pause fuhr sie fort.
»Nur Reinhold Kirsch, der Architekt, und Justus Heimbüchler, unser Anwalt, ihr kennt ihn, sind geblieben. Sie haben mich zur Flughafenpolizei begleitet. Und es war noch der Stationsleiter der Fluggesellschaft dabei. Seinen Namen habe ich vergessen.« Francesca kramte hektisch in ihrer Handtasche, um die Visitenkarte zu finden.
Ihre Mutter winkte ab.
»Lass gut sein.« Dass jemand auf einem Flug verschwand, wollte ihr absolut nicht in den Sinn. »Bei den heutigen Sicherheitsmaßnahmen? Und aus so einer Verkehrsmaschine fällt keiner raus. Entweder, das ist meine Meinung, war Arnold nicht an Bord, oder er ist gleich nach der Landung …« Überrascht vom eigenen Gedanken hielt sie sich erschrocken die Hand vor den Mund.
»Der Ansicht war auch der Polizeibeamte.« Francesca war entsetzt, dass auch ihre Mutter diesen Gedanken hatte. Sie zwang sich, nichts zu sagen, aber ihr Vater tat es.
»Wie kommst du auf einen derart abwegigen Gedanken, Marcella, dass er heimlich verschwunden ist?« Feltrinelli blickte seine Frau verständnislos an. »Man muss sich in dieser Situation genau überlegen, was man sagt«, schickte er mit Rücksicht auf Francesca leiser hinterher. Dann wandte er sich an seine Tochter. »Was werden sie unternehmen?«
»Du meinst die Polizei? Nichts werden sie tun, ich glaube, gar nichts. Der Beamte meinte, dass alle Regeln eingehalten wurden beim Einchecken und beim Boarding, also wurde Arnold vorschriftsmäßig erfasst, sowohl seine Bordkarte wie auch der Ausweis, den musste jeder vorzeigen … Das haben sie überprüft. Und da kein …«, Francesca zögerte, bevor sie das Wort aussprach, »da kein Verbrechen gemeldet wurde, werden sie auch nicht tätig. Hier herrscht Freizügigkeit, jeder Deutsche kann gehen, wohin er will, meinte der Polizist, Arnold hätte den Flughafen verlassen haben können, ohne gesehen zu werden; wenn er vorn in der Maschine saß, wird er als einer der Ersten ausgestiegen sein.«
»Warst du rechtzeitig am Ausgang, also bevor …?« Feltrinelli hob abwehrend die Hand.
»Du meinst, dass ich mal wieder unpünktlich war?«, ereiferte sich Francesca. »Dass ich vielleicht nicht rechtzeitig aus dem Büro weggekommen bin? Papa! Er war eine Woche lang weg. Ich habe mich gefreut …«
»Ist ja gut, Fran.« So nannte er sie immer, wenn ihr aufbrausendes Temperament mal wieder mit ihr durchging. »Wann haben diese Weinfreunde Arnold zuletzt gesehen?« Feltrinelli war ernst geworden, die steile Falte auf seiner Stirn war für Francesca ein sicheres Zeichen, dass ihm etwas sehr nahe ging.
»Die Weinbrüder schienen so mit sich selbst beschäftigt, dass keiner darauf geachtet hat, ob Arnold die Maschine überhaupt betreten hat.«
»Beschäftigt oder betrunken?«
»Mama! Die trinken nicht, die probieren.«
»Ich meine ja nur. Waren die Plätze nicht reserviert? Als wir zuletzt nach Turin geflogen sind«, bemerkte sie, »durften wir die Plätze nicht wechseln, obwohl Papa an den Notausgängen mehr Platz für seine Beine gehabt hätte.«
»Das ist wohl auf allen Flugzeugen so, nur auf diesem Flug sollen weiter vorn noch Plätze frei gewesen sein.«
Signora Feltrinelli kam nicht über das empörende Verhalten der Reisebegleiter hinweg. »Wie ist es möglich, dass … dass eine Gruppe eine Woche lang unterwegs ist und dann sang- und klanglos auseinandergeht, obwohl einer fehlt? Das ist doch eine richtige Katastrophe, ein Unglück. Wieso sollte Arnold den Flugplatz verlassen, und sein Koffer bleibt zurück, wie du sagtest? Wohin sollte er gehen?« Fragend sah sie ihren Mann an. »Da muss was passiert sein.«
»Male nicht den Teufel an die Wand«, versuchte ihr Mann, sie zu beschwichtigen.
»Da ist er bereits«, meinte seine Frau kurz und sah ihre Tochter forschend an. »Hast du irgendeine Idee, was ihn veranlasst haben könnte, sich, sagen wir es mal so, sich zu verdrücken? Hast du irgendeine Vorstellung, wo Arnold sich aufhalten könnte?«
Francesca starrte mit ausdruckslosem Gesicht in die leere Kaffeetasse vor sich. So leer fühlte sie sich auch, und auf dem Boden war schwarzer Satz zurückgeblieben. Es sollte Leute geben, die daraus lesen konnten.
»Ist auf der Reise irgendetwas vorgefallen, was die anderen dir verschweigen, aus welchem Grund auch immer?« Feltrinelli war vorsichtig, er wusste, wie leicht Francesca in schwierigen Momenten aus der Haut fuhr oder sich verletzt zurückzog. In beruflichen Angelegenheiten allerdings trat sie beherrscht und selbstsicher auf, das war sie ihrer Stellung schuldig.
»Davon hat keiner gesprochen, auch Arnold nicht. Das hätte Justus mir gesagt, Justus Heimbüchler.«
»Kann man ihm vertrauen?«
»Er ist immerhin Anwalt.«
»Das muss nichts heißen.«
»Wir sind hier nicht in Italien, Papà. Hier werden keine Anwälte bestochen oder gekauft.«
»Die Zeiten ändern sich auch in Deutschland, mein Kind. Nichts bleibt, wie es war. Nur Geld zählt.«
»Das ist wohl wahr«, sagte Basilio, der in die Nische getreten war. »Ich brauche diesen Tisch in zehn Minuten – für ganz spezielle Gäste.«
»Die wirst du heute woanders hinsetzen müssen, figlio mio.«
Verblüfft blickte Basilio seine Mutter an. So entschieden und eindeutig erlebte er sie selten. »Ich habe diesen Tisch für zweiundzwanzig Uhr meinen Stammgästen versprochen.«
»Die werden heute ihre edlen Hintern mal woanders platzieren«, sagte sie ruhig, jeden Widerspruch ausschließend. »Wir haben Wichtiges zu besprechen.«
»Was kann so wichtig sein«, entgegnete Basilio mit einem wütenden Blick auf seine Schwester, »wenn sie dabei ist? Hast du deine Kinder beim Kiffen erwischt, oder hast du in Alices Schulmappe Kondome gefunden?«
Als seine Eltern und Francesca ihn schweigend anstarrten, merkte er, dass er zu weit gegangen war und dass es sich doch um ein ernsteres Thema handelte.
Er kapiert nichts, und sich anzubiedern, ist eine andere schlechte Eigenschaft von ihm, dachte Francesca, vornehmlich bei den gut betuchten Gästen. Trotz seiner momentanen Hilflosigkeit war es ihr zuwider, ihm eine Brücke zu bauen. Wenn sie ihm sagte, worum es ging, war von seiner Seite nur Häme zu erwarten.
»Wir können in die Küche gehen und dort weiterreden, dein nigerianischer Sklave wird sicher nichts dagegen einwenden.«
Als auch die Eltern böse schwiegen, zog Basilio schmollend ab, doch beleidigt war er nicht wirklich, und ausgeschlossen fühlte er sich auch nicht, da er in seiner Selbstbezogenheit eigentlich nur sich selbst nahe war.
Feltrinelli sah ihm nach, wie er den Kellner anwies, zwei kleine Tische in einer Ecke zusammenzuschieben und einzudecken.
»Steht Arnolds Verschwinden eventuell in Zusammenhang mit seinem Beruf?« Feltrinellis Gesicht nahm einen finsteren Ausdruck an. »Immerhin hat er als Wirtschaftsanwalt mit schwierigen Fällen zu tun, es geht um große Summen, Millionen. Vielleicht hat er jemandem etwas versprochen und konnte es nicht einhalten? Hat er Verhandlungen absichtlich oder auf Geheiß seiner Auftraggeber scheitern lassen oder dumme Fehler gemacht? Schließlich verkehrt er mit Topmanagern und internationalen Unternehmen. Da findet sich jede Menge krimineller Energie. Ich halte es für möglich, dass ihm jemand schaden will, aus Rache, dass er jemandem auf die Füße getreten ist. Einem Prozessgegner, jemandem, der gegen ihn verloren hat. Weißt du, woran er zuletzt gearbeitet hat?«
Das Kopfschütteln Francescas wirkte mehr als hilflos. »Ich habe schon daran gedacht, morgen zu seinem Sozius zu gehen.«
»Das solltest du auf jeden Fall tun«, riet ihre Mutter und griff nach Francescas Hand.
»Nur, wie soll ich sein Verschwinden erklären? Ich kann es nicht.« Der Gedanke an den Besuch bei Sachs war Francesca maßlos peinlich, sie fürchtete, dass es auf Arnold zurückfallen würde. »Ich will mich nicht lächerlich machen, von wegen hysterische Ehefrau, versteht ihr? Die Männer in diesem Gewerbe sind gnadenlos.«
»Du hast doch sonst auch nur mit Männern zu tun. Bisher schienst du ihnen durchaus gewachsen. Oder irre ich mich?« Signora Feltrinelli war die Sorge um Tochter und Schwiegersohn deutlich anzusehen. Ihre großen Augen wirkten erschrocken, die Stimme klang unsicher.
So zerknirscht hatte Francesca ihre Mutter selten erlebt. »Wenn möglich, gehe ich gewissen Herren lieber aus dem Weg oder überlasse sie den bissigen Kollegen.«
»Es gibt also keine Andeutung, keinen Hinweis und keinen Grund, zumindest keinen offensichtlichen, weshalb Arnold verschwunden ist. Sehe ich das richtig?« Ihr Vater sah sich fragend um, sein Blick blieb an seinem Sohn hängen, der verschämt und leicht verunsichert, wie Francesca empfand, zu ihnen herübersah. »Arnold hat sich in all den Jahren, seit wir ihn kennen, immer verantwortungsvoll gezeigt, dir gegenüber auch, meine Liebe«, damit sprach er seine Frau an, »und natürlich auch gegenüber den Kindern. Weshalb sollte er sich ändern? Ich gehe nicht davon aus, dass er sich sonst wohin abgesetzt hat. Dazu gibt es keinen Grund. Oder stimmt etwas in eurer Ehe nicht? Du gehst morgen zur Bank, oder falls ihr Online-Banking macht, siehst du auf eurem Konto nach, ob es Abhebungen oder Unregelmäßigkeiten gibt.«
Francesca war des Redens müde, abwehrend wandte sie den Kopf zur Seite.
»Dann gehe ich mal davon aus«, Feltrinelli machte eine Pause, dachte anscheinend über das nach, was er sagen wollte, »wir müssen davon ausgehen, dass ein Verbrechen vorliegt. Wir können nicht umhin, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen.«
Ihre Mutter versuchte, Francesca Mut zu machen. »Jetzt werde nicht blass, Fran, wir kriegen das alles wieder hin. Hab Vertrauen, die Familie steht hinter dir, und egal, worum es sich handelt, wir werden alles tun, wirklich alles, um die Sache aufzuklären. Wir haben bisher immer alles zusammen hinbekommen. Du gehst erst mal schön nach Hause, Basilio fährt dich heim, und du bringst den Kindern schonend bei, wie die Dinge liegen. Sie sind alt genug. Bleibt ruhig und besonnen, jetzt in Panik zu verfallen, hilft niemandem.«
»Morgen nimmst du dir frei und kommst her, nein, versuche, von Arnolds Chef …«
»Er hat keinen Chef, er hat einen Partner, einen Sozius, und ein Assistent und eine Sekretärin arbeiten ihnen zu …«
»Dann sprich mit denen und versuch rauszukriegen, ob er an einer riskanten Sache dran ist. Vielleicht liegt da der Grund für sein Verschwinden. Und bring euren Anwalt mit.«
»Justus Heimbüchler?«
»Seid ihr befreundet, oder ist es eine reine Geschäftsbeziehung?«
»Wir sind per Du.«
»Bedeutet das heutzutage überhaupt noch etwas? Du hattest eine zweite Person erwähnt.«
»Reinhold Kirsch, er ist Architekt, mit ihm sind wir wirklich befreundet.«
»Dann bring am besten beide mit, und zwar so schnell wie möglich. Kommt um elf Uhr hierher.«
»Aber um elf ist hier keiner.« Basilio war unbemerkt näher gekommen. Anscheinend hatte die Neugier ihn hergetrieben. »Wir machen erst um zwölf Uhr auf, dann ist Mittagstisch.«
»Auch du bist um elf Uhr hier, verstanden, figlio mio? Und jetzt fährst du deine Schwester nach Hause.«
»Und was soll das?«
»Es geht um die Familie! Ist das klar?«
Obwohl auch Basilio in Düsseldorf geboren war, steckte doch so viel von einem Italiener in ihm, dass er sich der Bedeutung der Familie bewusst und Widerspruch ausgeschlossen war, besonders wenn seine Mutter in dieser Weise mit ihm redete. Sie war das Oberhaupt der Familie, Feltrinelli war in geschäftlichen Angelegenheiten der Boss.
»Morgen bringst du alle Unterlagen mit, die Arnolds Reise betreffen, oder diese beiden Freunde sollen alles mitbringen, den Reiseplan, die Aufzeichnungen, falls es welche gibt, Karten. Wir müssen wissen, wer wann und wo gewesen ist, wen sie getroffen haben, wo übernachtet wurde, einfach alles. Du wirst Arnolds Spur aufnehmen, Francesca, du wirst genau die Reise ins Piemont nachvollziehen, die diese sieben Männer unternommen haben. Irgendwo unterwegs ist dein Mann verloren gegangen. Wenn die Polizei ihn nicht sucht, müssen wir das tun. Außerdem haben wir Verwandte in Turin und in Bra, die werden dir helfen. Allora, schlaf dich aus. Es wird ein anstrengender Tag morgen.«
Vorerst war alles gesagt. Angelo Feltrinelli verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich zurück.
»Falls du nicht schlafen kannst, mach dir einen Fencheltee«, riet ihr die Mutter, »eine Tablette solltest du nur im Notfall nehmen. Ich glaube, unter diesen Umständen begleite ich dich besser, auch wegen der Kinder. Basilio, ich nehme deinen Wagen. Her mit den Autoschlüsseln!«
3
In letzter Zeit hatte sie das »Tavolata« immer seltener aufgesucht. Ihren Eltern gegenüber schützte sie Zeitmangel vor. Der wahre Grund war, dass sich der Charakter des Restaurants, seit Basilio die Geschäfte führte, schleichend veränderte, ihrer Meinung nach zum schlechteren. Stammgäste blieben aus, dafür kamen mehr Komödianten aus dem Showgeschäft, Gockel aus der Medienbranche, Krisengewinnler aus dem Bankensektor und die sich spreizenden Pfauen der Düsseldorfer Kunst- und Modewelt. Nicht Basilio zog sie an, nicht die Küche, sie zogen sich gegenseitig an, sie fanden hier eine weitere Bühne der Selbstdarstellung.
Basilio trug sich ernsthaft mit dem Gedanken, das Restaurant in »Tartufo« umzubenennen, in »Trüffel«, um es höher anzusiedeln und die Preise auf ein anderes Niveau zu heben. »Tavolata Tartufo« sollte es zunächst heißen, dann sollte »Tavolata« wegfallen und nur »Tartufo« übrig bleiben. Nicht nur, dass bei Francesca der Geruch der Knollenpilze Übelkeit hervorrief, Tartufo bedeutete im übertragenen Sinn auch »Heuchler«.
»Von daher passt der Name ganz gut zu dir«, hatte sie Basilio ins Gesicht gesagt. »Das ist aber auch der einzige Grund, es so zu nennen.«
Die beiden großen Spiegel, die seit Neuestem im Gang zu den Toiletten hingen, waren sicher auch dem Narzissmus der neuen Klientel geschuldet. Basilio glaubte, sie kämen seinetwegen und um die authentische italienische Küche zu genießen, die seine Mutter über zwei Jahrzehnte mit wachsendem Erfolg praktiziert hatte und mit der das »Tavolata« berühmt geworden war.
»Ich habe den Umsatz um dreißig Prozent steigern können«, verkündete Basilio selbstgefällig.
»Wenn die bunten Vögel den Baum leer gefressen haben, fliegen sie zum nächsten«, hatte Francesca gewarnt. Als Volkswirtin und Wirtschaftsprüferin kannte sie sich aus und hatte Einblick in zahllose Unternehmen. »Die alten Gäste, die davon nichts wissen, kehren dann nicht wieder zurück.«
»Die sterben sowieso aus«, war Basilios lakonische Antwort gewesen.
Die Eltern, die mit am Tisch saßen, hatten ihn entsetzt angeschaut, nicht wissend, ob ihr Sohn über sie genauso dachte. In solchen Momenten fragte sich Francesca, ob Basilio, der weder ihrer Mutter noch ihrem Vater ähnelte, ihr wahrer Bruder war. Oder hatte man der Mutter nach der Entbindung ein Kuckuckskind untergeschoben? In geistiger Hinsicht war er es allemal. Je älter er wurde, desto weniger mochte sie ihn, aber sie verachtete ihn nicht.
Angelo Feltrinelli war die Arbeit nach Jahrzehnten zwischen Tresen und Herd zu anstrengend geworden, er war Mitte sechzig, Zeit fürs allmähliche Hinübergleiten in den Ruhestand. Ihre Mutter, die den Einkauf organisiert hatte, war auf dem Düsseldorfer Großmarkt ähnlich bekannt wie bei den Vertretern vom Rungis-Express, dem Lieferanten für Austern und frisches Geflügel, benannt nach dem Pariser Großmarkt Rungis. Aber mit dem Express war es auch bergab gegangen, seit ein Investor die Firma übernommen hatte.
»Nur was man gern macht, wird auch gut«, predigte Feltrinelli, und die Mutter hatte Francesca ziehen lassen – mit Tränen in den Augen – hin zu ihren Wirtschaftsgeheimnissen. Zahlen waren für Francesca Spuren, die sie zu lesen verstand.
Die Spur aufnehmen – über den Satz ihres Vaters hatte Francesca die halbe Nacht lang gegrübelt, dann war sie irgendwann im Sessel eingeschlafen und im Morgengrauen mit verrenkter Wirbelsäule zu sich gekommen. Alice war auf dem Sofa eingeschlafen, Markus war irgendwann in seinem Zimmer verschwunden. Francesca hatte sich in ihr Bett geschleppt, doch da war ihr die leere rechte Hälfte bewusst geworden, und die Angst um Arnold hatte sie sofort hellwach gemacht.
Jetzt, vor der Tür des »Tavolata«, hätte sie im Stehen schlafen können, auch in den Armen ihrer Mutter, die sie tröstend empfing. Wieder kämpfte sie gegen die Tränen.
»Wir kriegen es hin, mein Mädchen, povera cara!« Mit diesen Worten zog sie Francesca in den halbdunklen Raum, wo ihr Vater und Basilio, der ihr finster entgegenblickte, am Tisch in der Nische warteten.
»Die Kinder sind in der Schule«, erklärte sie, küsste ihren Vater kurz auf die Stirn und tippte sogar Basilio freundlich an. Er fasste nach ihrer Hand, griff aber ins Leere.
»Wir sollten zuerst alles unter uns besprechen, dann können wir die Kinder immer noch einweihen.« Marcella Feltrinelli eröffnete die Sitzung. »Hast du sie eingeweiht … sie wissen …?«
»Ja, wir haben bis Mitternacht geredet.«
»Wir müssen in dieser Lage unbedingt alle zusammenhalten.« Feltrinellis Blick galt insbesondere seinem Sohn, und Basilio nickte mit zusammengebissenen Zähnen.
»In erster Linie müssen wir darauf achten, dass unser Restaurant keinen Schaden nimmt. Schließlich leben wir alle davon, bis auf sie. Sie hat es ja nicht nötig.« Er zeigte auf seine Schwester.
»Deine dämlichen Sprüche nutzen niemandem. Basilio! Entweder ziehst du am selben Strang, entweder begreifst du dich als ein Feltrinelli – oder wir kündigen den Vertrag mit dir.«
»Was ist das für ein Ton? Das wagst du nicht. Das sind ja deutsche Methoden«, warf er entrüstet ein.
»Mal sind wir Deutsche, mal Italiener, ganz wie es nötig ist, figlio mio.« Marcella Feltrinelli lächelte ihrem Sohn freundlich zu. »Wir sind zwar alt, aber flexibel geblieben. Noch so ein dummes, unpassendes Wort, und du bist die längste Zeit Geschäftsführer gewesen. Entweder – oder, klar?«
Basilio senkte den Kopf, er hatte verstanden, Mama hatte das Kommando übernommen. Gegen sie kam letztlich nicht einmal sein Vater an.
Bei Francesca stellte sich keine Genugtuung ein. Es wäre ihr lieber, den Bruder auf ihrer Seite zu wissen. Dass er sich dem Willen ihrer Mutter beugte, nahm sie ihm nicht ab. Aber es ging nicht um ihn, es ging um Arnold.
»Wir haben noch immer kein Lebenszeichen von ihm?«, fragte ihr Vater. »Auch die Polizei weiß nichts?«
Francesca wandte die Augen von ihrem Bruder ab und schüttelte ergeben den Kopf.
»Die suchen immer noch nicht.«
Sie hatte nach dem äußerst unerfreulichen Telefonat mit dem Präsidium den Vormittag über sämtliche Freunde und Bekannte angerufen, die etwas wissen konnten, zu denen ein näherer Kontakt bestand. Niemand hatte von ihm gehört, niemandem war in letzter Zeit etwas aufgefallen, keiner hatte irgendein Anzeichen bemerkt, das auf ernste Konflikte oder ein späteres Verschwinden hinwies. Ihr gemeinsames Bankkonto hatte sie noch in der Nacht kontrolliert, aber es gab keinerlei ungewöhnliche Bewegungen, keine große Summe war abgehoben worden. Die Kreditkartenabrechnung der Reise stand jedoch noch aus.
»Dann sehe ich keine andere Möglichkeit, als dass ihm etwas zugestoßen ist. O Gott, der Arme. Wir müssen wirklich mit einem Verbrechen rechnen.« Bisher hatte Feltrinelli den Gedanken von sich ferngehalten.
»Hatte er bei seiner Arbeit mit Italien zu tun, mit windigen Firmen oder Leuten? Was meint sein Sozius, woran hat er zuletzt gearbeitet, ein komplizierter Fall?«
Das Telefonat mit Sachs hatte nur eine Viertelstunde gedauert, Francesca hatte ihm das Nötigste mitgeteilt und die entsprechenden Fragen gestellt, die Sachs kurz und klar beantworten konnte. Seine Mitarbeiter, der Anwalt und die Assistentin, würden sich noch am Vormittag Schreibtisch und Computer vornehmen, vielleicht fand sich dort ein Hinweis. In dem Fall wollte Sachs Francesca sofort anrufen. Auf jeden Fall sei es nötig, absolutes Stillschweigen über die Sache zu wahren; und um ihre Kunden nicht nervös zu machen, würde Sachs erklären, dass Arnold bei einem leichten Sturz eine Gehirnerschütterung erlitten habe. Bei einem Beinbruch hätte er telefonieren können, so aber sei ihm Ruhe verordnet. Francesca hatte sich damit einverstanden erklärt, sie hoffte nur, dass nicht einer der Mitreisenden die Geschichte breittrat – oder eine der Ehefrauen.
»Wieso müsst ihr unbedingt von einem Verbrechen ausgehen?« Basilio schaute sich mit unschuldigem Blick in der Runde um. »Flugplätze sind hermetisch abgeschlossene Anstalten. Ist man einmal drin, kommt man nur durch den Ausgang raus. Und das ist es, was ich glaube. Mein lieber Schwager wird was zu erledigen gehabt haben und hat sich verdrückt. Den Gedanken der Flughafenpolizei halte ich für gar nicht so abwegig, vielleicht wollte er wirklich ein neues Leben anfangen. Derartige Geschichten machen immer wieder die Runde.«
Provozierend streifte sein Blick die Schwester, blieb dann am strengen Gesicht der Mutter hängen, das Grinsen fiel in sich zusammen, er schluckte und wich ihren Augen aus.
»Mein Sohn, du gehst jetzt besser, das hier ist etwas für Erwachsene. Ich habe gesagt: entweder – oder. Du hast dich für Letzteres entschieden. Du bringst schon mal den Müll raus, dann braucht unser Nigerianer, Funkin Akidele heißt er übrigens, das nicht mehr zu tun.«
»Woher weißt denn du, wie er heißt?«
»Weil Mutter ihn gefragt hat, coglione!« Auch Feltrinelli hatte die Geduld verloren. »Dann lies dir unseren Vertrag noch einmal in aller Ruhe genau durch. Ich gebe dir Zeit bis morgen. Einstweilen aber möchte ich dich hier an diesem Tisch nicht mehr sehen, hast du kapiert?«
Niemand hatte ahnen können, dass ihr Gespräch diese Wendung nehmen würde. Bedrückt sahen alle Basilio nach, der hocherhobenen Hauptes den Gastraum durchquerte und wie ein Westernheld die Schwingtür zur Küche aufstieß und verschwand. Mutter und Tochter starrten sich fassungslos an, Feltrinelli fasste sich als Erster.
»Wir müssen Arnold suchen. Das ist unsere einzige Chance, seinetwegen, deinetwegen und der Kinder wegen …«
»… und selbstverständlich auch unseretwegen«, warf Signora Feltrinelli ein. »Er braucht Hilfe, die müssen wir ihm bringen. Von diesem Gedanken und von nichts anderem müssen wir uns leiten lassen. Dein Vater und ich«, sie griff nach der Hand ihrer Tochter, »wir haben die ganze Nacht überlegt, was zu tun ist. Du musst ihn suchen, du musst seine Spur aufnehmen. Die Spur verliert sich im Piemont, also musst du hin.«
»Und was soll ich da, wo soll ich ihn suchen? Auf dem Turiner Flugplatz?« Francesca konnte sich nicht vorstellen, wie sie von Nutzen sein konnte. Sie würde dort nur verzweifelt herumirren.
»Deine Mutter und ich haben nachgedacht, es funktioniert allerdings nur, wenn du mitmachst.«
»Dann schieß mal los«, sagte Francesca skeptisch. Gleichzeitig hoffte sie inständig auf eine Lösung, denn sie wusste aus Erfahrung, dass es keine Krise im Leben ihrer Eltern gegeben hatte, die sie nicht hatten meistern können, so wie sie es geschafft hatten, aus einem miserablen Vorstadtquartier Turins auszubrechen, als Wirtschaftsflüchtlinge in Deutschland Fuß zu fassen und schließlich hier in der Düsseldorfer Innenstadt ihr renommiertes Lokal zu etablieren. Es war ein langer, ein harter und weiter Weg gewesen.