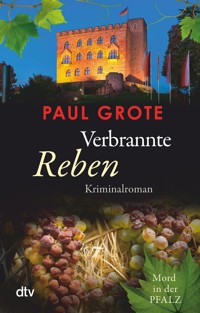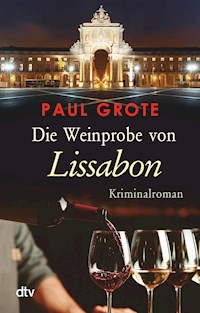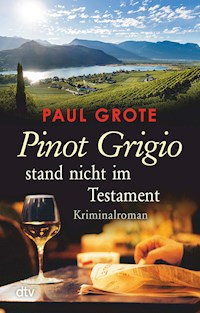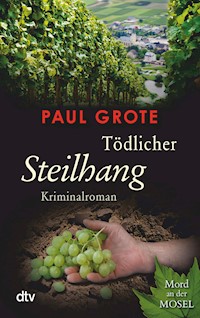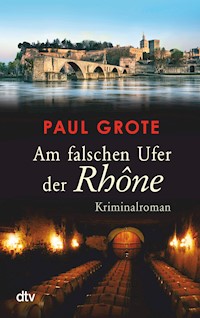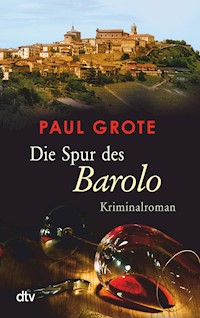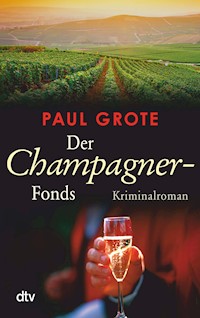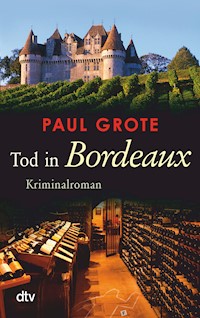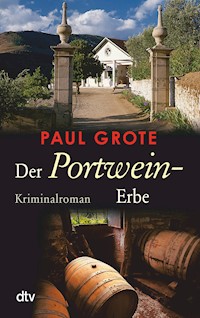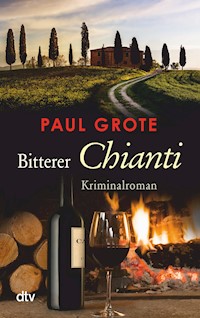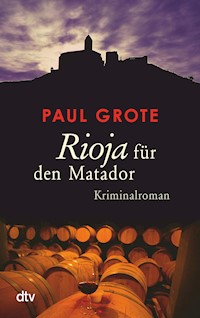6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nur im eBook Fünfzehn Jahre hat Paul Grote in Südamerika verbracht, fünf davon in Amazonien. "Amazonien ist sehr groß, zu groß ...", sagt einer der Menschen, denen er dort begegnet, und so immens sind auch die Probleme. Die wirtschaftlichen Interessen eines an natürlichen Schätzen überreichen Landes kollidieren brutal mit humanen Grundsätzen und uralten Traditionen. Die missliche Lage der Goldgräber, die Frustration der zwangsversetzten Siedler, der Zorn der Indios, deren Dörfer mutwillig abgebrannt werden, der Druck der großen Konzerne und die herrschende Korruption schaffen ein Klima der Gewalt. Aber seine Reportagen erzählen auch von den Menschen, die in dieser »Grünen Hölle« leben und überleben. Goldsucher und Gummizapfer, Kirchenleute und Gangster, Indianer und Glücksritter aller Art. Sie schildern die tödlichen Gefahren des Urwalds, aber auch dessen Schönheit und Unberührtheit, die es trotz der Rodungen auf Abertausenden von Quadratkilometern noch gibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Paul Grote
In Amazonien
Abenteuer Regenwald
Deutscher Taschenbuch Verlag
Alles beginnt mit Exú
Xangô – Gott der Gerechtigkeit und des Blitzes
Oxum – Göttin der Flüsse und des Goldes
Oxôssi – Gott der Wälder und der Jagd
Alles endet mit Exú
Inhalt
1 Die Nacht auf dem Strom
2 Die Augen des Jacaré
3 Die Prinzessin
4 Der Furz Gottes
5 Diamantensucher
6 Der Herr des Condor
7 Hitler an Bord
8 Familienbande
9 Quilombo – befreites Land
10 Betrug
11 Gouverneure und Bürgermeister
12 Verfolger und Verfolgte
13 Die Helden sind weiß
14 Unser Stein im Schuh
15 Timbó
16 Chicos Land
17 Dreißig Minuten sind genug
18 Unter Goldgräbern
19 Die Brücke
20 Huxleys Traum
21 Zu den Sternen
1Die Nacht auf dem Strom
Das Schiff erzitterte unter dem Stoß. Dumpf und hart dröhnte das Echo im Laderaum. Stille folgte, kein Knirschen, kein Splittern von Holz. Der Rumpf hob sich nicht wie beim Auflaufen auf eine Sandbank. Niemand schrie, keine trappelnden Füße an Deck. Ruhig blieb die Fé em Deus auf Kurs. Die Stille war beunruhigender als jede Panik.
Ich riss mir das Laken vom Körper. Die Bewegung versetzte die Hängematte in wildes Schlingern; hart stieß ich mit der Hüfte gegen die Reling. Mit einer Hand hielt ich mich daran fest, setzte mich auf und starrte ins Wasser. Schäumend leuchtete die Bugwelle. Ihr gleichmäßiges Rauschen, nur kurz unterbrochen von den klatschenden Wellen eines in der Nähe vorüberfahrenden Schiffes, hatte mich in den Schlaf begleitet. Ich tastete nach der kleinen Tasche an den Sparren über mir. Sie zogen sich unter dem Oberdeck entlang, dazwischen steckten Schwimmwesten. Vor dem Ablegen hatte ich mir einen dieser stockfleckigen, mit Kork gefüllten Leinensäcke ausgesucht, zu dem ich einigermaßen Vertrauen haben konnte. In der Tasche, in einem wasserdichten Plastiksack, waren Notizbuch und Pass, Kamera, Filme und das Tonbandgerät, Cruzeiros und die Ersatzbrille verstaut. Mit dem Sack, so bildete ich mir zumindest ein, hätte ich schwimmend das Ufer erreichen können.
Das Wasser schimmerte schwarz, keine zwei Meter entfernt. Die Sterne reichten vom Horizont bis zum Rand des Oberdecks. Dazwischen dümpelte die hier am Äquator auf dem Rücken liegende Mondsichel wie eine altägyptische Barke. Kühler Wind trieb mir eine Gänsehaut auf die Arme. Es war sofort windstill, als die Maschine gestoppt und auf der Brücke der Suchscheinwerfer eingeschaltet wurde. Sein Schein tastete als Finger in die Dunkelheit, zitterte unentschlossen, glitt neben dem Rumpf suchend über die Wellen, wanderte nach achtern und erleuchtete das Schraubenwasser. Schließlich verschwand der helle Lichtkegel hinter den Kabinen des Vorschiffs und der Ladung aus meinem Blickfeld. Kistenstapel und Kartons türmten sich auf, Säcke mit Zwiebeln und Orangen, deren Duft die Hitze im Unterdeck anfüllen sollte, sobald wir den Amazonas erreicht und den Passat vom Atlantik im Rücken haben würden. Bis nach Santarém würde uns dieser Duft in einem dämmrigen Zustand belassen, in einer Kopf und Körper erfassenden Gleichgültigkeit, ein süßliches, schläfrig machendes Gift. Der Scheinwerferkegel kam auf meine Seite zurück.
«Que passou», fragte eine rauchige Stimme unter mir, «was ist passiert?» Dionisio stemmte sich von seinem Lager auf einem Packen Luftballons hoch und rammte mir den Kopf ins Steißbein. «Keine Ahnung.» Ich schlug die Beine über den Rand des weiten Tuchs und trat Dionisio auf den Kopf. Sein Haar fühlte sich an wie feiner Draht. Dionisio dirigierte meine Füße in die Richtung, in der er meine Gummilatschen vermutete. Jetzt war es ein Handicap, dass ich die Neonröhre der Notbeleuchtung über unseren Köpfen herausgedreht hatte, um besser schlafen zu können. Rasch zog ich mir ein Hemd über. Ich stützte mich auf ein Holzgestell, das zur Verpackung eines Kühlschranks gehörte, und ließ mich zu Boden gleiten. Die Beleuchtung flackerte.
«Was war das für ein Stoß?» Dionisio blickte vorsichtig über die Reling.
«Hier war das nicht. Komm mit.» Ich zog ihn zum Bug.
An Steuerbord standen zwei Besatzungsmitglieder. Wir sahen nur ihre Beine und Hüften, die Oberkörper waren weit vornübergebeugt. Einen dritten hatten sie am Gürtel gepackt und hielten ihn mit dem Kopf nach unten über die Reling. Es schien, als wäre er bei einem Kopfsprung in der Luft erstarrt. Er leuchtete mit einer Taschenlampe die Bordwand ab. Von der Kommandobrücke ragten Oberkörper wie abgeschnitten über die Reling des Oberdecks.
Der Lichtstrahl des Scheinwerfers geisterte weit voraus über die Wellen und machte jede Bewegung des Schiffes mit. Die Zahl der Oberkörper nahm zu; helle Augen starrten nach unten, ohne zu wissen, was sie suchten, und auch um uns herum hatten sich tuschelnd Passagiere versammelt. Die meisten waren nur notdürftig angezogen, trugen kurze Hosen, T-Shirts; Frauen mit wirrem Haar hatten sich in Tücher eingewickelt, die auch als Bettzeug dienten. Einige Männer setzten sich rittlings auf die Reling.
«Könnt ihr was sehen?», fragte der Kommandant von oben. «Nur Schrammen», gurgelte der Matrose, der über Bord hing, halb erstickt. «Wir kommen nicht nah genug ran.» Er wurde heraufgezogen und dann in einer Seilschlinge sitzend bis zur Hüfte wieder ins Wasser gelassen. Mit der Taschenlampe im Mund, ihr Schein verzerrte sein Gesicht zur grotesken Fratze, tastete er unter Wasser die Bordwand ab. Dann nahm er die Taschenlampe aus dem Mund und spuckte aus. «Hier ist das Leck. Ich fühle den Sog.»
«Zieht ihn hoch, und seht im Laderaum nach!», befahl die Stimme von oben.
Verängstigt drängten sich die Passagiere um den Matrosen.
«Es ist nichts, Leute. Nur ein klitzekleines Löchlein. Niemand bekommt nasse Füße. Geht schlafen!»
Ich hielt ihn fest. «Sind wir auf ein Wrack gelaufen?»
Unwirsch machte er sich los. «Wahrscheinlich ein treibender Baumstamm. Nichts Besonderes.»
«So ein Baumstamm kann ein Schiff versenken», meinte ein Passagier und genoss es sichtlich, seine Mitreisenden nervös zu machen. «Dann schwimmen wir eben», grunzte ein anderer, das Gesicht im Schatten einer Strebe verborgen. Nur wenige lachten – gekünstelt und müde. Als sich die Gruppe auf die Hängematten zubewegte, berichteten die ersten bereits von anderen Unglücken, die sie selbst erlebt hatten oder von denen sie aus ganz zuverlässiger Quelle wussten: «Als die Milagre de Deus kenterte, sind 37 Passagiere ertrunken.» – «Bei der Sobral Santos waren es über hundert!» Eine Frau erzählte von der Ternura, aber mit nur 19 Toten konnte sie nicht mithalten. Die braunen oder schwarzen Gesichter der Passagiere wirkten fahl im kalten Neonlicht. Eine Röhre flackerte wie ein Stroboskoplicht und verlieh den Bewegungen der Passagiere ein roboterhaftes Aussehen.
Die Fé em Deus lag quer zu den Wellen, rollte leicht. Mit einiger Anstrengung ließ sich das Ufer erahnen, eine weit entfernte Linie am unteren Rand des sternenübersäten Himmels. Vielleicht ließ es sich mit etwas Glück und der richtigen Strömung schwimmend erreichen? Ich wusste nicht genau, wo wir uns befanden. Wahrscheinlich hatten wir die Bucht von Marajó schon überquert und waren auf dem Rio Pará. Hier, nahe am Atlantik, war der Gezeitenstrom stark. Die Wassermassen der Flüsse, die südlich vom Amazonas dem Ozean zuströmten, drängten mit Macht aus dem Delta ins Meer und wurden von der Flut wieder zurückgeworfen. Ich sah zum ersten Mal auf die Uhr. Es war Viertel nach zwei.
Die Fé em Deus hatte zuvor bei Sonnenuntergang von der kleinen Pier am Condorviertel in Belém abgelegt. Wir waren den Rio Guama hinuntergeglitten, begleitet von Kanus, vorbei an den windschiefen und verwitterten Anlegern, Treppen und Lagerhallen der Stadt, an den Bars am Ufer, die mit bunten Lichtern und dröhnenden Lautsprechern die erlebnishungrigen Flussschiffer oder Bauern lockten, die Maniok oder die kleinen Früchte der Açaípalmen in die Stadt gebracht hatten. Vor der leuchtenden Skyline fuhren schaukelnde Kähne mit kastenförmigen Aufbauten. Je weiter wir uns von der Stadt entfernten, desto mehr schmolzen die Lichter der Hochhäuser zu einem schimmernden Klotz zusammen. Noch lange war der Widerschein Beléms am Himmel zu sehen. Zwischen den Inseln hatte die Fé em Deus an einem Kreuzer der Hafenbehörde längsseits gehen müssen, Passagierlisten und Ladung waren kontrolliert worden, nicht allzu aufmerksam – die Marinesoldaten hätten etwas finden können, und das hätte Arbeit gemacht. Sie waren mehr an kleinen Booten interessiert, an den lanchas, die sich im Schutz der Nacht an ihnen vorbeistahlen und Parfüm, Disketten oder Videorecorder aus Französisch Guayana nach Brasilien schmuggelten, oder an Fracht ohne Begleitpapiere und Steuerbelege. Mit Schmugglern ließen sich Geschäfte machen, und nur wer nicht kooperierte, wurde von den Marinesoldaten hart angepackt. Es war ein leichtes, die Kontrollen zu umfahren und einen versteckten Weg zwischen den Inseln um Belém zu suchen. Der Lichtschein der Stadt war noch immer zu sehen, als wir die Kaimauern des Aluminiumhafens Vila do Conde passierten, wo ein japanischer Frachter im gleißenden Flutlicht mit Aluminiumbarren beladen wurde. Danach hatte ich mich in die Hängematte gelegt, auf dem Unterdeck neben der Reling, obwohl meine Passage erster Klasse zum Schlafen auf dem Oberdeck berechtigte. Doch mich hatte das Gewimmel der Menschen, die auf Tuchfühlung zwischen Gepäckstücken, Provianttaschen, Apfelsinenschalen und Radiogeräten in ihren Hängematten baumelten, abgeschreckt. Der kleine Dionisio war erst im letzten Moment vor dem Ablegen, mit einem riesigen Ballen Luftballons auf dem Rücken, keuchend an Bord gekommen und hatte sich unter mir, im Windschutz zwischen Kühlschrank und Tomatenkisten, sein Lager auf den Ballons hergerichtet.
Mittlerweile räumte die Mannschaft ohne jede Hektik die vordere Ladeluke frei, um sich Zugang zum Laderaum zu verschaffen. Ihre Gelassenheit hatte etwas Beruhigendes – oder war es Gleichgültigkeit? Kapitän Antônio Furtado, der an Bord nur commandante genannt wurde, kam über die vordere Treppe von der Brücke herunter, setzte sich auf die Reling, lehnte sich gegen einen Stützbalken und sah den Matrosen zu. Furtado hatte eine athletische Figur, obwohl er mit knapp fünfunddreißig Jahren das Alter erreicht hatte, in dem die meisten Brasilianer sich allmählich einen Bauch wachsen lassen. Sein Gesicht war schmal und energisch, und die Mundwinkel waren in immerwährendem Lächeln nach oben gezogen – eine Frohnatur. Er gab Anweisungen, wo Zwiebelsäcke, Milchpulver und Tomatenkisten gestapelt werden sollten, und sah den Zusammenstoß als etwas Alltägliches, eine willkommene Abwechslung auf der immer gleichen Strecke zwischen Santarém und Belém. Die Mannschaft war gut aufeinander eingespielt, jeder Handgriff saß.
Hängematten mussten aus dem Weg geräumt werden, und ihre Besitzer standen mit dem Bündel vor der Brust fröstelnd an der Reling. Die Kinder starrten halbwach mit weit aufgerissenen Augen auf das unheimliche Geschehen, klammerten sich an die Beine ihrer Eltern oder wurden auf Kisten abgelegt, wo sie weiterschliefen oder zu quengeln begannen. Eines schrie, und seine Mutter knöpfte sich unter den Blicken aller das Kleid auf und legte sich das Kind an die Brust – bis eine Alte mit langem, grauem Haar sie im Schatten der Kisten vor fremden Blicken verbarg.
Der Zwiebelberg wurde abgetragen. Es fand sich immer noch Platz für die Säcke, obwohl es mich bereits Mühe gekostet hatte, die Hängematte dort aufzuhängen, wo ich bei Seegang weder mit möglichen Nachbarn noch mit harten Teilen der Ladung zusammenstoßen konnte. Die dunklen Körper der Männer, die sich unter dem Gewicht der Säcke aufbäumten, glänzten. Wenn einer der Matrosen über die Bordwand spuckte und ruckartig den Kopf schüttelte, flogen die Schweißtropfen wie bei einem Hund, der aus dem Wasser kommt und sich schüttelt.
«Que barra pesada», Dionisio setzte sich auf eine Kiste und drehte sich eine Zigarette, «was für ’ne Schweinearbeit.» «Als du mit den Ballons an Bord gekommen bist, hast du auch nicht anders ausgesehen», erinnerte ich ihn und wich einer Kiste aus. «Und dazu hing noch eine Reisetasche an deinem Hals.» Ich gab Dionisio Feuer. Das Licht ließ seine Sorgenfalten noch tiefer erscheinen als am Abend zuvor.
Die Planken über der Ladeluke waren beiseitegeräumt. Sofort drängten sich Passagiere bis an den Rand des schwarzen Vierecks. Der commandante ließ sich eine Lampe bringen, nahm sie zwischen die Zähne und kletterte nach unten. Viele, deren Angst oder Neugier größer war als der Wunsch nach Rückkehr in die Hängematte, wären ihm am liebsten gefolgt. Der Lichtschein geisterte über Kistenberge und warf unheimliche Schatten an rohe Spanten und Planken. Die Zuschauer stierten mit offenen Mündern ins Dunkel. Stand das Wasser schon bis zu den Bodenbrettern?
«Es sind genug Schwimmwesten für alle da», sagte der Passagier zu meiner Linken, «und die beiden Rettungsflöße auf dem Dach sehen auch ganz vertrauenerweckend aus.»
«Die Schwimmwesten taugen nichts», war ein anderer Kommentar, «da rutscht man nach unten durch oder kippt vornüber und ersäuft.»
Als der Kopf des Kommandanten wieder am Lukenrand erschien, schauten ihn alle mit fragenden Blicken an. Furtado sah sich zu einer Erklärung veranlasst. «Es ist nichts. Kein richtiges Leck. Eine Planke ist nach innen gedrückt worden. Nur eine kleine Reparatur, das können wir selber machen. Also kein Grund zur Sorge.»
Aber das Misstrauen blieb. Wir gaben ihm den Weg frei. Furtado beugte sich über die Reling. «Leichte Fahrt voraus!», rief er zur Kommandobrücke. «Halte aufs Ufer zu, und schalte das Echolot ein – und die Pumpe.»
Er wandte sich leise an den Zahlmeister: «Die Risse liegen unter der Wasserlinie. Wenn sich der Druck auf die Bordwand erhöht, könnte die Planke weiter nach innen gedrückt werden. Schick einen zur Beobachtung runter.» Der Duft von frischem Kaffee zog uns in Richtung Kombüse zum Achterschiff.
Der Maschinentelegraph klingelte, die Fé em Deus nahm Fahrt auf und hielt auf das schemenhafte Ufer zu. Das Kielwasser blieb als heller Schweif achteraus, das Ufer gewann Konturen. Jetzt polterte es im Laderaum, auch unten wurde die Ladung nach achtern versetzt, um den Druck auf den Bug zu vermindern. Über die hintere Treppe stieg ich zum Oberdeck. Zwei Reihen dicht neben- und übereinander gespannter Hängematten versperrten den Weg. Mühsam schlängelte ich mich zur Kommandobrücke durch. Mithilfe des Echolots gelangten wir bis dicht unter Land. Morcego, der Bootsmann, den man wegen seiner spitzen Ohren und der vorstehenden Zähne Fledermaus nannte, verließ sich lieber auf das Lot. In die linke Hand nahm er die Leine, Part für Part fein säuberlich nebeneinander, holte mit der rechten aus, warf und ließ das Lot seitlich vom Bug ins Wasser tauchen, und die Knoten der Schnur rutschten über die Fingerspitzen. Als das Lot den Grund berührte, rief er dem Steuermann die Wassertiefe zu. Morcego holte die Leine ein, betrachtete die Erde in den Rillen des Lots, zerrieb sie und warf erneut. Der Kommandant leuchtete das Ufer ab. Der Lichtkegel des Scheinwerfers warf eine kreisrunde Scheibe auf die Uferböschung, streifte davor eine felsige Kuppe, strich über die Wellen und kehrte an einer anderen Stelle zum Ufer zurück, berührte Bäume, schreckte einen Schwarm Vögel auf und blieb schließlich am schlammigen Strand hängen.
«Weiter nach Steuerbord! Hier ist der Grund zu weich», befahl Furtado. «Und an Backbord gibt es ein Hindernis.» Das Landemanöver wurde wiederholt.
Dionisio machte es sich wieder auf den Luftballons bequem und zog Turnschuhe an, die billigsten, vom Waschen zerschlissen. «Ich kann nicht schwimmen», murmelte er tonlos. «Jetzt habe ich mich einem Schiff anvertraut, das ‹Gottvertrauen› heißt, und dann passiert so was.»
Ich war nicht sicher, ob das der Grund seiner Verzweiflung war oder die Knoten in seinen Schnürbändern.
«Meinst du, ich schaffe es zum Ufer? Kannst du schwimmen? Vielleicht kannst du mir helfen! Du kannst doch schwimmen, oder?»
«Blas die Luftballons auf, und häng dich dran», riet ein Nachbar. «Die tragen dich in den Sertão zurück, Junge, in deine Wüstenheimat, wo sie alle verdursten.»
Dionisio hörte nicht hin. Er fühlte sich elend und bemühte sich krampfhaft, sein Zittern zu verbergen. Für das Schiff bestand keine Gefahr mehr, außer, wir würden auf einen Felsen auflaufen. Aber wir waren dicht unter Land, und das Sirren von Zikaden brach über uns herein. Insekten umschwirrten die Lampen, fielen zu Boden oder auf die Schlafenden in den Hängematten, Heuschrecken landeten an Deck. Im Ruderhaus hing ein Funkgerät. Damit könnte man notfalls ein anderes Schiff rufen. Das Funkgerät war keine Attrappe. Furtado hatte bereits kurz nach der Abfahrt damit hantiert, und eine verzerrte Stimme aus dem Lautsprecher hatte geantwortet. Möglich, dass es inzwischen ausgefallen war. In Amazonien war alles denkbar und nichts sicher. Irgendetwas Unvorhergesehenes konnte immer passieren. Man brauchte lange, um sich an dieses Land der endlosen Ströme und Wälder zu gewöhnen, in dem genaue Planung sinnlos war, wo gleichgültiges Schulterzucken zu den normalen Reaktionen gehörte und man sich am besten das Fragen nach dem Warum abgewöhnen sollte. Ein anderer Baumstamm konnte sich vom Ufer losreißen – warum? Die Schiffsmaschine zu Bruch gehen – warum? Ein Hafenmeister die Weiterfahrt verhindern … Wer wusste schon, warum? Wer wusste überhaupt etwas? Dass die Reise sich verzögerte oder ganz scheiterte, war genauso wahrscheinlich wie die Aussicht auf eine angenehme Fahrt in angenehmer Gesellschaft.
Dionisio gelang es schließlich, die Schnürbänder zu entknoten und in die Turnschuhe zu schlüpfen. Er streckte die Beine, betrachtete seine Füße, drehte sie und lief dann über das Deck, als ob er neue Schuhe anprobieren würde. «Bis Manaus müssen sie halten. Da werde ich mir neue kaufen.» Das Ufer rückte in greifbare Nähe. «Ich hätte nicht mit diesem verdammten Schiff fahren sollen. Ich habe es geahnt, aber die Fähre der ENASA legt nicht in Gurupá an, und da will ich zuerst hin.»
Sicherlich würden wir der Fähre der ENASA auf dem Amazonas begegnen. Sie war nicht zu übersehen. Sie war kein Schiff, sondern eine riesige Blechkiste auf zwei Rümpfen mit mehreren Decks – hässlich, verbaut und viel zu groß. Sie war schneller als die anderen Schiffe, die den Amazonas und die Nebenflüsse berühren. Die Dauer der Reise hing vom Wasserstand ab, von der Jahreszeit. Stromabwärts, von Manaus nach Belém, brauchten alle Schiffe statt sechs nur fünf Tage. Wer ängstlich war oder als Beamter auf der staatlichen Fähre umsonst mitfuhr, um einmal im Jahr die Familie im Heimatort zu besuchen, reiste mit der ENASA. Von einem Baumstamm ließ sie sich nicht in den Grund bohren.
Das Risiko auf hölzernen gaiolas wie der Fé em Deus war sicherlich größer. Das bunt bemalte Schiff war für die ruhigen Flüsse und furos Amazoniens, die Kanäle zwischen den Inseln, gebaut. Mit der leicht geschwungenen Linie vom Bug zum Heck, der etwas gedrungenen Form des dreißig Meter langen Rumpfes und den nach allen Seiten hin offenen Decks, passte sie ideal in die tropische Wasserwelt. Die Zahl der Passagiere blieb außerhalb der Ferien überschaubar, so dass man seine Mitreisenden kennenlernen konnte; und nur wer schweigsam oder grob unhöflich war, blieb allein.
Ein schwerer, warmer Lufthauch kam vom Ufer, der Geruch von Holz, vermoderndem Laub und Erde. Die Maschine dröhnte, ließ den Rumpf erzittern, und die Fé em Deus schob den Bug auf das morastige Ufer – wir saßen fest! Vögel flatterten am Waldrand entlang und suchten sich ein anderes Versteck.
Dionisio atmete auf. «Endlich Land!» Sehnsüchtig blickte er zur Böschung, wollte sich gerade entspannt auf den Ballonberg fallen lassen, als die Angst wiederkam: «Besser nicht an Land gehen, wer weiß, was da für Getier rumläuft», sagte er und zog das Netz um die Ballons straff. Die großen weißen Luftballons mit bunten Schlieren waren sein Leben, sein Kapital, sein Bett und das Kreuz, das er durch Brasilien trug. Er war der ewige Wanderer, nur einer von Millionen anderer, die genauso lebten, getrieben von einer Hoffnung, die immer nur Hoffnung bleiben würde, der Hoffnung auf ein besseres Leben. Es war kaum anzunehmen, dass Dionisio durch sein Ballongeschäft jemals zu bescheidenem Wohlstand gelangen würde. Aber er hoffte, bedingungslos. Es war der Motor, der ihm die Kraft zum Weiterleben gab.
Dionisio stammte aus Pernambuco im Sertão, einem wüstenhaften Landstrich im Nordosten, und seine Heimatstadt war Caruaru. «Der Nordosten hat Kultur», ereiferte er sich, «es ist nicht so einsam und trostlos wie hier. Amazonien ist öde, alles Grün, dieser traurige Wald und dazwischen nur Wasser. Das kann ja kein Mensch aushalten. Und diese langweiligen caboclos und Indianer. Keine Kultur!» Er sah in die Runde. «Mein Land ist offen und weit, musst du wissen, es gibt Berge – da kann man frei atmen –, aber hier? Oh, mein Gott – und es regnet nicht wochenlang. Bei dem ganzen Wald wird man ja stumpfsinnig und krank. Wir haben unsere Feste, die quadrilla an São João. Irgendwo ist immer was los. Auch die Passionsspiele in Nova Jerusalém …, warst du mal da? Ist das nicht großartig?»
Dionisio wartete meine Antwort nicht ab. Mit seinen Schwärmereien floh er vom Schiff, vor dem unheimlichen Urwald; Wasser war nicht sein Element. Wie alle Brasilianer war er Lokalpatriot. Jeder klammert sich an seine Region, an den jeweiligen Bundesstaat, an den Landkreis, die Stadt, das Dorf, wo er geboren ist, und ist es auch noch so verloren in der Weite dieses kontinentalen Landes. Nur das kontemplative Wesen der Indigenas, der Indianer, und der caboclos, ihrer Nachkommen aus der Verbindung mit Weißen, nur sie, die an den Flussufern leben, sind der Stille und Einsamkeit der Wälder Amazoniens gewachsen.
«Irgendwo ist immer Jahrmarkt», plapperte Dionisio weiter. «Die Leute kaufen gerne Ballons – na ja, wenn sie Geld haben. Aber – glaub mir», er sah meinen skeptischen Blick, «die Kinder kaufen sie, und wir haben im Nordosten das beste Zuckerrohr und die beste cachaça, den besten Zuckerrohrschnaps, von ganz Brasilien.» Ich war nicht seiner Meinung.
«Mein Vater und meine Brüder arbeiten in Caruaru als Töpfer und Kunsthandwerker. Sie stellen Geschirr her und Vasen und kleine Tonfiguren, Musikanten mit Akkordeon und Hirten, meine Schwestern bemalen sie – und cangaceros mit breitkrempigen Hüten und Patronengurten über der Brust.» Ich kannte die Figürchen der Banditen des Sertão aus den dreißiger Jahren, ihre Führer Lampião und Maria Bonita, die brasilianische Version von Bonnie and Clyde. Zu Hunderten füllten sie die Andenkenläden in Recife, in Campina Grande oder Caruaru und staubten unverkauft ein.
«Wie bist du an die Ballons gekommen?», fragte ich und sah, wie der Kommandant in Badehose über die Bordwand kletterte. Der junge Matrose stocherte mit einem Bootshaken im Schlick, um Rochen zu verscheuchen, die Furtado schwer verletzen konnten. «Einer hatte Schulden bei meinem Vater, aber kein Geld, um sie zu bezahlen. Da hat er uns die Ballons überlassen – die könnten wir ja verkaufen –, mein Vater hat sie genommen. Besser als nichts. Außerdem, wenn du Ware hast, dann kann dir die Inflation nichts anhaben. Ich kann den Preis immer höher machen. Das Geld, das verliert seinen Wert.»
Was kam jetzt? Die ökonomischen Theorien eines Ballonverkäufers? Die Inflation war so etwas wie eine Naturgewalt, unabänderlich und zerstörerisch, fortgesetzter Terror monatlicher Preiserhöhungen von 30 bis 40 Prozent, der die Menschen in einen fortwährenden Schockzustand versetzte. Jeder Politiker versprach, die Inflation zu senken; keiner tat es, aber das Volk hoffte weiter und arrangierte sich bis dahin mit der Armut. Ich ließ Dionisio keine Chance, seine Theorie zu entwickeln. «Erzähl mir das später. Ich will sehen, wie sie das Leck reparieren!» Dionisio brummte, lehnte sich zurück und legte sich ein Handtuch über die Augen. Irgendjemand hatte die Neonröhre über uns wieder in die Fassung gedreht.
Furtado tauchte auf, holte Luft und strampelte mit den Beinen, um wieder unter Wasser zu kommen. Schlammige Wolken stiegen auf, als bade er in Milchkaffee. Weiter achtern tauchte er auf. «Bring Werg, Beitel und einen vernünftigen Hammer», prustete er. «Und du bleibst oben», blaffte er den Matrosen an, der sich neben ihm an einen Tampen klammerte. «Das mache ich lieber selbst.» Furtado nahm seine Verantwortung ernst. Und nur, wenn er die Reparatur selbst ausführte, konnte er sicher sein, dass das Leck sorgfältig abgedichtet war. Morcego hielt die Lampe über die Bordwand. Das Leck lag noch immer unter der Wasserlinie, obwohl der Bug hoch und trocken lag. Eine der schweren Planken, zwei Meter hinter dem Vordersteven, war tatsächlich nach innen gedrückt, und zwischen den Planken zog sich ein schmaler werdender Spalt nach achtern. Aus dem Laderaum dröhnten Hammerschläge, mit denen ein stiernackiger Seemann die Planken wieder nach außen trieb. Bei jedem Schlag vibrierte das Deck, und die Reling zitterte. Die männlichen Passagiere begleiteten die Arbeit mit wenig hilfreichen Kommentaren.
«Sie kommt», prustete Furtado nach einem erneuten Tauchgang. «Halt die Lampe tiefer!» Der Stiernackige kletterte aus dem Laderaum und reichte einen Bootshaken nach unten. Die graue, von der Sonne ausgeblichene Stange wirkte in seinen prankenartigen Händen wie eine Angelrute. Seine Oberarme hatten den Umfang eines Männerbeins, und verstohlen verglichen wir seine Muskeln mit den eigenen. Seine Schultermuskulatur setzte direkt am Hinterkopf an. Neben der Wirbelsäule liefen dicke Muskelstränge hinunter zur Taille. Mit eingezogenem Kopf hätte er jede Wand an Bord durchbrechen können. Seine Kraft rief Bewunderung und Abscheu hervor. Als er sich beobachtet fühlte, blickte er nur kurz zur Seite, zuckte mit den Brauen – und die Reihe der Zuschauer zog sich merklich zurück.
Die Lampe baumelte vor Furtados Gesicht. Er spie einen Wasserstrahl aus. Das schlammige Wasser verdeckte seinen Körper, so dass es aussah, als ob sein Kopf lose auf der Oberfläche schwamm. Der Stiernackige, sie nannten ihn Guincho, den Kran, gab Werg und Beitel nach unten. Furtado klemmte den Hammer zwischen die Zähne, drehte den Werg zu einem Wulst und trieb ihn zwischen die Planken. Als er im Tiefen arbeiten musste, ließ er den Matrosen sich auf seine Schultern setzen und sich unter Wasser drücken. Er arbeitete verbissen.
Den Zuschauern wurde es langweilig. Sie rollten sich wieder in den Hängematten zusammen, und nur die Köpfe lugten über den Rand. Das Unterdeck glich dem Bau von gigantischen Raupen, die in Kokons eingesponnen auf ihre Entpuppung warteten. Der Zahlmeister, ein kleiner, weißhäutiger Mann mit schütterem Haar, dessen männliche Vorfahren es in der Zeit der Sklaverei anscheinend nie gewagt hatten, eine der stattlichen Angolanerinnen oder eine zarte Frau aus Mali anzusprechen, geschweige denn zu heiraten, verfolgte vom Schreibtisch aus die Reparatur. Die Tür zu seiner Kajüte auf Steuerbord stand offen. Wie während der ganzen Reise wühlte er in Papieren, schichtete sie zu immer neuen Häufchen um, heftete sie mit Büroklammern zusammen und legte sie in die Schreibtischschublade zurück. Sonst saß er wie am Vorabend, nachdem sich die Erregung der Abfahrt gelegt hatte, mit ausgestreckten Beinen auf einem Hocker auf der Kommandobrücke und trank Kaffee. Nur als am nächsten Tag die Schlägerei ausbrach, sollte man ihn mitten zwischen den Passagieren sehen. In seiner Schreibtischschublade bewahrte Senhor Plácido einen Taschenrechner mit Solarzellen auf, der ihn immer wieder begeisterte. Überschwänglich lobte er die japanische Technologie und wollte sich nicht überzeugen lassen, dass es ein nordamerikanisches Fabrikat war. Misstrauisch beobachtete ich den Fortgang der Reparatur. Vertrauen hatte ich mir bis zu einem gewissen Grad abgewöhnen müssen – aber ich konnte nicht vor jeder Schiffsreise jeden Laderaum nach morschen Planken absuchen. Ich hatte lernen müssen, mich gänzlich auf meinen Instinkt zu verlassen, viel stärker, als ich es jemals in Europa gewagt hätte. In Brasilien, diesem Land der hitzig aufflammenden Gefühle, half der Instinkt besser als der Verstand, und Erfahrung konnte beide in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander setzen. Mich beruhigte die Tatsache, dass der Kapitän selbst die Reparatur ausführte. Das gab mir das Gefühl, die Reise genießen zu können ohne die Sorge, ob das Leck wieder aufreißen würde, wenn wir auf dem Amazonas Wind und Wellen ausgesetzt sein würden. Es passierte oft, dass jemand vorgab, von einer Sache etwas zu verstehen, was sich dann letztlich als Stümperarbeit herausstellte. Trabalho de preto nannten es die Brasilianer abfällig – eine Negerarbeit –, eines der vielen offenen und versteckten Überbleibsel der Sklavenzeit.
Ich setzte mich an den Bug und betrachtete den Strand. Die Deckenbeleuchtung erhellte nur einen schmalen Streifen und den dahinterliegenden Waldrand – unsere augenblickliche Welt. Wenn ich Zweifel an der sachgemäßen Reparatur gehabt hätte, wäre ich hier an Land gegangen. Siedler, die einem weiterhalfen, gab es immer irgendwo. Lieber den Weg ins Ungewisse einschlagen, als sich in Obhut offenkundig verantwortungsloser Menschen zu begeben, die später die Folgen ihres Leichtsinns als göttliche Fügung ausgaben. Aus diesem Grund hatte ich einmal in einem erbärmlichen Dorf Maranhãos einen Überlandbus verlassen: Der anscheinend verrückte Fahrer hatte uns in einen kollektiven Selbstmord mitreißen wollen. Er kicherte nur verständnislos, als ich ihn zum Anhalten aufforderte und mein Gepäck verlangte. Die Brasilianer beschwerten sich zwar, aber es war nutzlos, und es hörte sowieso niemand zu. Ein Risiko war das Reisen in Amazonien immer, besonders auf den kleineren Flüssen. Ein kleineres Schiff als die Fé em Deus, ein kleiner Frachter vielleicht, eine Iate, wäre von einem treibenden Baumstamm sofort versenkt worden. Deshalb hielten sich diese Schiffe meist in Ufernähe. Selbst größere Schiffe wechselten von einer Seite des Stroms auf die andere, um jederzeit anlegen und die Strömung ausnutzen zu können. Auch beim Schwimmen hielten sich alle ängstlich am Ufer, obwohl sie ausgezeichnete Schwimmer waren. Vielleicht war das auch eine Angewohnheit, die man von den Indigenas übernommen hatte, denn im flachen Wasser war man vor Kaimanen einigermaßen sicher. Weite, offene Gewässer, wie die Bucht von Marajó, die in die trichterförmige Mündung des Rio Pará überging, wurden deshalb in der Windstille der Nacht überquert.
Vom Bug der Fé em Deus zum Strand waren es nur zwei Meter und von da zum Wald nur wenige Schritte, eine kurze, steile Böschung hinauf. Ich überlegte, wie weit es wohl bis zur nächsten Hütte sei, zum nächsten Bauern oder Fischer, als sich Dionisio zu mir setzte. Er konnte nicht schlafen.
«Wenn endlich der Morgen da wäre», seufzte er, «scheiß Amazonien, puta merda», und schaute auf meine Armbanduhr. «Noch drei Stunden bis Sonnenaufgang.» Dionisio hatte Angst, aber das durfte er nicht zugeben, sogar nicht vor sich selbst und als Mann erst recht nicht. Er drehte eine Zigarette, sie zerbrach. Die zweite fiel auf die Planken. «Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Wahrscheinlich habe ich zu wenig geschlafen.» «Das wird es sein», beruhigte ich ihn und suchte die Zigarette. Ich wollte gar nicht rauchen, aber ich dachte, ich tu ihm einen Gefallen; der Tabak schmeckte billig und brannte auf der Zunge.
«Morgen, nein, übermorgen sind wir in Gurupá. Da war ich schon mal. Ich hab viele Ballons verkauft. Jetzt weihen sie dort ein Gesundheitszentrum ein und eine Landwirtschaftsschule. Die ist seit einem Jahr fertig. Die haben damit gewartet, bis das andere Gebäude auch fertig war, damit der Bürgermeister die Lorbeeren ernten kann. Auch der Gouverneur von Pará soll zur Einweihung kommen.»
«Und wo willst du danach hin?»
«Nach Monte Alegre. Da war ich schon zweimal, die Stadt gefällt mir – und auch die Mädchen.»
Seit zwei Jahren zog Dionisio mit den Ballons durch den ganzen Norden und Nordosten Brasiliens. Er schleppte sie von Jahrmarkt zu Jahrmarkt, und in Belém hatte er auf eine neue Sendung gewartet. Sie wurden in Sâo Paulo hergestellt, dreitausend Kilometer entfernt. «Alles, was ich besitze», fuhr Dionisio fort, «ist in meiner grünen Plastiktasche.» Die Nähte waren ausgerissen, er hielt sie mit einem alten Gürtel zusammen. Ein Handtuch war in der Tasche, abgegriffene Familienfotos, sein Rasierzeug – er brauchte es nicht oft, sein Bart spross nur spärlich –, Seife, ein zweites Hemd, Unterwäsche, eine Hose und eine durchscheinende Hängematte. «Wo ich Station mache, suche ich mir einen dormitorio. Du kennst die Schlafsäle, diese Bruchbuden, wo man nachts seine Tasche am Körper festbinden muss, damit einem niemand was klaut? Aber eines Tages werde ich mir in Caruaru ein Haus bauen, heiraten, viele Kinder haben und jeden Tag gut essen. Wenn ich diesmal genügend verdiene, dann kaufe ich mir Land. Zuerst baue ich die Hütte aus Holz, meine Brüder helfen mir bestimmt dabei, und später ersetze ich die Bretterwände durch Ziegel.» Dionisio spielte versonnen mit den Maschen des Netzes. «Ich habe wieder eine verdammt lange Tour hinter mir. Manchmal glaube ich, die Ballons bringen mich um. Manchmal hasse ich sie. Aber – was soll ich sonst machen? Zuerst bin ich nach Recife gefahren, dann an der Küste lang über João Pessoa, durch Paraiba, über Natal nach Fortaleza. Drei Wochen war ich in Teresina. Das ist eine komische Stadt, da ist gar nichts, ich weiß überhaupt nicht, warum es sie gibt. São Luís ist viel besser, mit den schönen alten Häusern, und die Leute sind nett. Und von da bin ich nach Belém. Jetzt fahre ich diesen Scheißfluss rauf.» Dionisio seufzte und holte tief Luft, «bis Manaus, und wenn die Straße passierbar ist, nehme ich einen Lastwagen nach Porto Velho bis an die bolivianische Grenze. Lastwagen sind billiger als der Bus. Unter der Ladefläche spanne ich die Hängematte auf, so spare ich den dormitorio. Und über Cuiabá fahre ich zurück, und wenn in Brasilia was los ist, verkaufe ich da auch was, und dann, ja dann …» Dionisio strahlte mich an, «dann geht’s wieder in den Sertão.» Plötzlich kniff er die Augen zusammen und sah mich misstrauisch an. «Andere Leute machen so was aus Spaß, solche wie du – die müssen verrückt sein.»
«Wie hebst du dein Geld auf? Wirst du nicht beklaut?» Die Frage hatte ich arglos gestellt.
Dionisio wich zurück und machte sich in den Schultern breit. «Das schicke ich immer gleich nach Hause! Damit ich es nicht ausgeben kann. Ab und an braucht der Mensch ein Mädchen, so was braucht ein Mann einfach – nur zum Vergnügen, für eine halbe Stunde oder auch mal die ganze Nacht. Diese Mädchen taugen nichts, sie klauen und spielen einem Liebe vor. Lieben tun sie nur Geld, wollen sich amüsieren, wollen ausgeführt werden. Wenn ein anderer ein paar Scheine mehr bietet, sind sie weg. Vielleicht finde ich unterwegs eine zum Heiraten, eine, die mir treu bleibt, wenn ich unterwegs bin, und die das Haus in Ordnung hält. Ich hab das Gefühl, auf dieser Reise klappt’s. Man darf die Hoffnung nie aufgeben.»
Hoffnung war das Einzige, was Dionisio vorantrieb, sie war der Motor ganz Brasiliens, eine vage Vorstellung vom Glück. Dabei verschlechterte sich alles zusehends. Doch je schlimmer die Verhältnisse wurden, desto ausgelassener und hysterischer geriet die Fröhlichkeit, um nicht am Straßenrand zu hocken und sich die Seele aus dem Leib zu heulen. Jedes Jahr, wenn Dionisio auf Tour ging, hoffte er, dass es die letzte sein würde. «Diesmal klappt’s bestimmt, Gott wird mir helfen.»
Furtado kletterte fröstelnd über die Bordwand. Guincho zog den vor Kälte schlotternden Matrosen mit einer Hand an Deck: «Der zittert, als wäre er der cobra grande begegnet.» – «Schon möglich», grinste der Zahlmeister und sah ihm aus der Tür seines Wohnbüros nach. «Von Schlangen soll es auf Marajó nur so wimmeln. Gebt ihm einen Schnaps. Aber nur einen.»
Ein Passagier betrat das Büro des Zahlmeisters. «Ist das hier Marajó?» Seinem Akzent nach kam er aus Südbrasilien.
«Genau, Senhor, das ist die Insel Marajó, mein Herr, so groß wie die Schweiz, nur hat sie keine Berge. Der Amazonas mündet nördlich von ihr in den Atlantik. Wir sind im Westen, auf dem Rio Pará. Die furos erreichen wir im Laufe des Tages, und morgen sind wir auf dem Amazonas – wenn alles gutgeht. Klar? Gehen Sie mal wieder schlafen.»
Die Flut hatte die Fé em Deus angehoben. Die Maschine dröhnte, ein Rütteln lief durch den Schiffskörper, langsam löste er sich vom Ufer. Die Kerbe, die der Bug in den Schlick gedrückt hatte, würde bald von der Flut überspült sein, und nichts würde daran erinnern, dass wir hier gelegen hatten. Im freien Wasser drehte unser Schiff. Marajó blieb in der Dunkelheit zurück.
2Die Augen des Jacaré
«Kaufen Sie 50 Schuss Kaliber 22 und zwei Schachteln Schrotpatronen», hatte Fernando da Costa am Telefon gesagt. «Und nehmen Sie Regenzeug mit, es kann nass werden – und Gummistiefel wegen der Schlangen.» Wir verabredeten uns für vier Uhr morgens am Denkmal von Oskar Niemeyer in Belém. «Sie können doch reiten – oder?»
In der Regenzeit gelangte man nur auf dem Pferd zu da Costas Fazenda auf Marajó. Was blieb mir anderes übrig? Ich dachte lieber nicht darüber nach, wie lange wir reiten müssten. Jetzt, im März bei Neumond, war ein großer Teil der Insel überschwemmt. In manchen Jahren stand die Hälfte des Landes unter Wasser. Die Fazenda von da Costa war von Urwald umgeben. Dort wollten wir jagen. Ich würde endlich Gelegenheit haben, den Urwald von innen kennenzulernen. Bisher war ich nur im Kanu an den Mauern der Uferwälder entlanggepaddelt, hatte mich von der Strömung durch schmale igarapés treiben lasen, die wie Priele im Watt in den Urwald führten, unter das dichte Blätterdach der Bäume, durch grüne, schummrige Tunnel. Die Pfahlbauten der caboclos am Ufer kannte ich, die Pflanzungen hinter den Hütten, einmal war ich auch einem Pfad ins Dämmerlicht und die Stille der Waldungen gefolgt. Da Costa kam pünktlich zum Cabanagem-Denkmal, einem hässlichen Zementklotz zur Erinnerung an einen Volksaufstand im Jahr 1835. Der fazendeiro war während der Militärdiktatur von 1964 bis 1965 Offizier gewesen, Militärarzt. Seit seinem Abschied lehrte er an der medizinischen Fakultät der Universität von Belém als Internist. Ich stieg in den Wagen, und schweigend fuhren wir die zwanzig Kilometer nach Icoarací, wo da Costa seinen Vetter an der Pier des Schlachthofs treffen wollte. Da Costa hätte in jeder europäischen Stadt zu Hause sein können. Er war klein und schlank, das Haar an den Schläfen ergraut, seine Haut blass, die Lippen waren schmal und sein Gesicht verschlossen. Er machte eher den Eindruck eines Büroangestellten als den eines Arztes oder Viehzüchters. Da Costa war müde und ärgerte sich über das schlechte Wetter. Die Wolken jagten schwarz und tief über die vierspurige Straße. Ein schwerer Schauer ging nieder. Erst als wir an der Kaimauer des Schlachthofs hielten, wo sonst Viehtransporter anlegten und sich jetzt nur die gedrungene, zehn Meter lange iate des Vetters befand, hörte der Regen auf. Die Bucht von Guajará lag in tiefer Finsternis, und Belém, zehn Kilometer stromauf am selben Ufer, blieb hinter Regenwolken verborgen.
Ein schwarzer Bootsmann mit einem Onkel-Toms-Hütte-Lachen kam barfuß von der Iate herauf, holte das Gepäck und in Plastiksäcke verpackte Geräte aus dem Kofferraum: Neonröhren, einen Transformator, einen zerlegten Sonnenkollektor und eine Antenne für ein Funktelefon. An Deck umarmte da Costa seinen Vetter, beide Männer klopften sich gegenseitig auf Schultern und Rücken, ein häufiges Ritual, mit dem man sein Gegenüber auch diskret nach Waffen abtasten konnte. Da Costa stellte mich vor: «Er soll mal eine richtige Jagd kennenlernen. So was ist bei ihm in Europa verboten. Da gibt es kein Wild mehr, und ihre Wälder haben sie seit langem abgeholzt», frotzelte er. «Sie demonstrieren schon, wenn einer nur einen Baum fällt.»
Sein Ton machte mich stutzig. Brauchte er jemanden zum Provozieren? War das ein Test, oder kam hier ein Minderwertigkeitskomplex zum Vorschein, wie er so typisch für viele mittelständische Brasilianer den Europäern gegenüber war. Sie orientierten sich an europäischen Werten und hielten das eigene Land, die eigene Kultur für rückständig, für eine Dritte Welt eben. Ich machte mich auf unangenehme Diskussionen gefasst.
Der Vetter sah mich aus offenen blauen Augen an, drückte mir lächelnd die Hand und klopfte mich ebenfalls ab. «Machen Sie es sich bequem an Bord. Das Schiff gehört Ihnen.» Er wies auf das mannshohe Halbrund der Achterkajüte auf dem Heck. Da Costa hangelte sich im schmalen Niedergang nach innen und setzte Kaffeewasser auf.
«Jerônimo!», schrie der Vetter, «wirf den Motor an.»
Der Bootsmann warf die Leinen los, sprang zurück an Deck und tauchte mit einer Kurbel hinter die Maschine. Nach dem zweiten Anwerfen lief der Diesel laut und gleichmäßig. Der Vetter verschwand im Ruderhäuschen am Bug, das Boot nahm Fahrt auf und entfernte sich vom Ufer. Es herrschte heftiger Seegang, und da Costa verkeilte sich in einer Koje. Aber an Schlaf war nicht zu denken. Nur Jerônimo machte das Schlingern nichts aus. Seine Hängematte pendelte wie eine Schiffschaukel und quietschte bei jedem Ausschlag herzzerreißend in ihrer Aufhängung.
«Nicht auszuhalten», schimpfte da Costa. «In der Regenzeit haben wir nur Dreckwetter, der März ist am schlimmsten.» Er setzte sich an eine Luke und starrte in die regengepeitschte Nacht. Zerfetzte Wolken, die der Wind vom Atlantik her über die Bucht von Marajó schob, hoben sich erst kurz vor dem Boot von der Wasserfläche. Mühsam nach Halt suchend, torkelte ich zum Bug und zwängte mich neben den Vetter ins Ruderhaus, das nur wenig größer war als eine Telefonzelle. Der Vetter saß gekrümmt auf einem Hocker hinter dem abgegriffenen Ruder und stützte sich mit den Beinen in den Ecken ab. Das Haar hing ihm wirr in die Stirn. Von der Decke fielen Wassertropfen auf Kopf und Schultern. Und immer, wenn er sich einen Tropfen aus dem Gesicht gewischt hatte, fiel der nächste.
Nach zwei Stunden kündigte ein flacher Strich im Grau des Morgens die Insel an. «Marajó!», sagte der Vetter. Es war Feststellung und Seufzer in einem. Als ob er die Insel hasste und gleichzeitig wusste, dass er nie von ihr loskommen würde.
Die Insel lag wie eine flache Schüssel am Rand der Amazonasmündung. Vom Zentrum mit dem Lago Ararí in der Mitte stieg das Land zu den Küsten hin an. Der nördliche Teil Marajós unter dem Äquator war bewaldet. Bäume wuchsen auch noch entlang der schmalen Flussläufe und furos im Westen. Wo Flüsse den Zugang ermöglichten, war der Urwald abgeholzt worden und Sekundärwald nachgewachsen. Von Osten her, von der Atlantikküste mit weißen Sandstränden und Dünen, fiel das Land in flachen Wellen zum Lago Ararí hin ab. Wenn im Januar die Regenzeit begann, «fiel Wasser», wie die caboclos sagten, tagelang, wochenlang ohne Unterbrechung, und die großen Ströme des Deltas, der Amazonas, der Rio Tocantins und der Rio Guama, drückten ihre anschwellenden Wassermassen in die Insel hinein.
Vor uns lag die trichterförmige Mündung des Rio Ararí, der seinen Anfang am Lago Ararí nahm. Dort lag Genipapo. Es wird auch das Venedig Amazoniens genannt, denn einen großen Teil des Jahres stehen die Pfahlbauten des Dorfes im Wasser, und alle Wege werden mit dem Kanu erledigt. In der Nähe bewirtschafteten der Vetter und seine Frau mit zwei Viehhirten, seinen vaqueiros, eine Fazenda. «Sie ist kleiner als die Fazenda Irateua von da Costa», jammerte er. «Ich habe Land verkaufen müssen, um das Schulgeld für meine Kinder aufzubringen.» Einen anderen Teil seines Landes hatte ihm einer der großen fazendeiros mit irgendwelchen juristischen Winkelzügen abgejagt.
Der Wind erstarb dicht unter Land. Sonnenstrahlen brachen durch die Wolken und brachten die Wassertropfen an den Zweigen des Bambusdickichts, das den langsam und trübe dahinströmenden Fluss einrahmte, zum Glitzern. Die Luft wurde so warm wie in einem geheizten Treibhaus im Winter, in dem beim Eintreten die Brillengläser beschlagen. Enten flogen über den Fluss, knallig gelbe Eisvögel und maguarís folgten ihnen, den Hals weit vorgestreckt, während die rotbraun gefiederten soccos, ein wenig größer als Fasane, tiefer ins Gebüsch hüpften. «Soccos schmecken nicht», sagte der Vetter und unterbrach seine Erzählung von den Aruá-Indigenas auf Marajó, die die ersten portugiesischen Missionare getötet hatten, die sie zum Christentum hatten bekehren wollen. Da Costa, der sich zu uns gesellt hatte, nickte. «Die Vögel sind tranig. Schade um den Schrot.»
Mir war nicht nach Jagen zumute. Die morgendliche Urlandschaft im Regen, die Vögel an den glitzernden Ufern und die umgestürzten Bäume waren ein Kunstwerk, an dem ich nichts zu verändern hatte. Dass es ein mörderisches Paradies war, erfuhr ich später, aber jetzt faszinierten mich die Silberreiher; hoch aufgerichtet und langbeinig standen sie im Schlick zwischen den dicken grünen Trieben der ingás, die alle flachen Ufer Amazoniens säumen. Erst wenn das Boot vorbei war, breiteten die Reiher die Schwingen aus und segelten wie von einer unsichtbaren Schnur gezogen über den Fluss.
Dichter Laubwald schob sich heran, wuchs in den Fluss hinein und auf der anderen Seite wieder hinaus, wand sich über eine Landzunge, wich zurück und gab den Blick auf eine Holzhütte frei. Aus der Tür starrte ein caboclo regungslos zu uns herüber. An der Plattform vor der Hütte dümpelte ein Kanu, das sich mit der Strömung drehte, die uns jetzt ins Innere der Insel trug. Da Costas Vetter hatte den richtigen Zeitpunkt abgepasst, um die einsetzende Flut auszunutzen.
Der Rio Ararí wand sich wie eine Schlange. Hinter einer weiten Biegung machten die hohen Bäume einer überfluteten Weidelandschaft Platz. Auf einer Warf inmitten sumpfiger Wiesen stand ein weit ausladendes Holzhaus, und ein Steg führte zu einem morschen Anleger. Auch wenn das Wasser weiter steigen würde, kämen wir trockenen Fußes ins Haus. Vaqueiros sahen uns entgegen. Ihre Pferde warteten neben dem Haus und etwas weiter entfernt die Wasserbüffel: massig, schwarz, die Flanken voller Schlamm, die hölzernen Sättel waren denen ähnlich, die bei mittelalterlichen Ritterturnieren benutzt worden waren.
«Büffel sind widerstandsfähiger als Pferde», erklärte da Costa – noch immer schlechter Laune, doch seine Augen begannen zu leuchten. «Die vaqueiros reiten in der Regenzeit auf ihnen. Die breiten Hufe sinken nicht so tief in den Schlamm ein, außerdem sind Büffel stärker als Pferde. Die vaqueiros veranstalten Wettrennen damit. Ein gutes Gespann kann auch einen beladenen Kahn durch den Sumpf ziehen.»
«Und jacarés greifen sie nicht an, auch die açús nicht, die großen Kaimane», fügte der Vetter hinzu.
Die vaqueiros kamen zum Anleger und legten ihre Regenumhänge, Plastiksäcke mit Löchern für Kopf und Arme, über das Geländer. Jerônimo drosselte die Maschine. Sacht trieb das Boot ans Ufer. Dann löste er die Persenning über der Ladeluke und wuchtete Säcke nach oben. Salz, Maniok und Zement verließen das Schiff, wurden zu den Pferden geschleppt und darauf festgebunden. Es wurde unerträglich schwül, die Wolken lösten sich auf in diesige Schleier vor einer blassen Sonne.
«Que tal, Seu Zezé», rief da Costa einem Alten in kurzen Hosen zu. «Wie geht’s?» Der Angesprochene trat näher. Er war bartlos, hatte ein offenes, faltiges Gesicht, in das ein Strohhut seinen Schatten warf. Die Beine des Mannes steckten in Gummistiefeln, die nur knapp über die Knöchel ragten.
«Tudo bem, Senhor Fernando. Como vai o Senhor?», erwiderte er artig die Begrüßung und nahm den Hut ab.
«Ist das dein Büffel?» Da Costa deutete mit dem Kopf auf ein schwarzes, massiges Tier, das an einem Pfahl angebunden war.
«Sim, Senhor.»
«Ist er gut zu reiten und kräftig?»
«Sim, Senhor. Sehr gut und sehr kräftig.»
«Und wie geht es deiner Frau, den Kindern, deinen Enkeln?»
«Tudo bem, Senhor. Vielen Dank. Alle sind gesund und haben zu essen.» Der Alte deutete eine Verbeugung an.
Da Costa wandte sich zu mir: «Schauen Sie sich seine Beine an.» Vom rechten Oberschenkel des Alten bis zum Knöchel zog sich ein Geflecht verwachsener Narben. Die dunkle, unverletzte Haut ließ sie wie rohes Fleisch leuchten.
«Die stammen von einem jacaré-açú», sagte der Vetter, und zu dem Alten gewandt rief er: «Wie war das mit dem jacaré, Seu Zezé? Erzähl mal. Como foi?» Die vaqueiros, die Zezés Geschichte nicht kannten, kamen näher.
«Das war da oben», der Alte zeigte stromaufwärts und trat schüchtern ans Boot. «Wir haben Holz aus dem Fluss gezogen. Ich stand im Flachen, da hat mich die Bestie angefallen und unter Wasser gezogen. Ich dachte, ich müsste sterben, das Biest würde mich fressen. Aber meine Kameraden haben mich festgehalten. Unten zog der jacaré, oben zogen die Kameraden und haben dem Teufel ihre Holzhaken in den Leib gehauen, ihre Messer, alles was sie hatten. Da hat er mich losgelassen. Die Kameraden haben mich gerettet. Hoffentlich haben ihn seine compadres, seine Vettern, gefressen oder die Piranhas. So war es, Senhores, so wie ich es erzählt habe. Und der Doktor aus Cachoeira hat mein Bein zusammengenäht. Aber ich bin fast gestorben.» Der Alte lachte.
Wir fuhren weiter, vorbei an Cachoeira, wo vor Jahren ein Junge vom Steg des kleinen Hafens gefallen und vor den Augen seiner Eltern von Piranhas zerfleischt worden war. Eine Stunde später erreichten wir den Treffpunkt, wo uns da Costas vaqueiros erwarteten.
Oberhalb der Böschung wuchs dickes, hohes Gras. Da Costa sprang an Land und schlug der Länge nach hin. «Puta merda!», fluchte er und wischte den Schlamm von den Jeans. Der Ausrutscher war nicht dazu angetan, seine Laune zu bessern. Nicht weit vom Ufer stand ein Schuppen, zwei Männer traten aus der Tür und gingen zu den Pferden unter dem Vordach. Einer von ihnen, ungefähr vierzig Jahre alt, hatte ein breites Gesicht mit hochstehenden Jochbeinen und fleischigen Lippen. Die Augenbrauen waren zusammengewachsen. Er trug einen olivfarbenen Regenmantel, dessen vorderer Teil an der Hüfte abgeschnitten war, um ihn beim Reiten nicht zu behindern. Der Rückenteil schlabberte wie die Schöße eines Fracks. Der Mann band ein Pferd los und kam uns entgegen.
«Mein capataz, der Vormann Jarico», stellte ihn da Costa vor und sah mir schadenfroh zu, wie ich auf dem einzigen Stück trockener Erde gegen Feuerameisen kämpfte, die sich in meine Waden verbissen.
«Bleiben Sie in den Pfützen, da gehen die Ameisen nicht hin», riet der Vormann.
Der zweite vaqueiro führte einen Falben zum Ufer, der anstelle eines Sattels ein hölzernes Gestell trug, auf dem die Elektrogeräte festgebunden wurden. Jarico gab mir die Zügel einer braunen Stute. «Die ist für Sie. Die Steigbügel müssen Sie noch auf die richtige Länge bringen.»
Jarico war einen Kopf kleiner als ich und beobachtete mich genau, während ich das spröde Zaumzeug prüfte und den Sattelgurt nachzog. Die Stute war mir sympathisch, ein kleines, stämmiges Arbeitspferd, das nur auf den Weiden lebte; wir würden uns verstehen. Der vaqueiro Joaquím, da Costa hatte ihm nur zugenickt, hielt sich schüchtern abseits. Der Abschied vom Vetter war kurz. Er winkte noch einmal, und Jerônimo stieß das Boot zurück in den Fluss. Als wir in den Sätteln saßen, war es bereits außer Sicht.
Vor uns lag ein dreidimensionales Aquarell, eine endlose Fläche wogender Gräser, die Feuchtigkeit der Luft ließ alle Farben ineinander verlaufen. Die stechende Sonne ließ die Augen schmerzen. Links am Waldrand erhob sich ein flacher Hügel, und im Trab folgten wir einem ausgetretenen Weg zur Kuppe, ritten eine Weile am Saum des Waldes durch niedriges Buschwerk. Pfade zogen sich durch das Grasland, dazwischen glänzten große Pfützen und schmale Wasserläufe. An den trockenen Stellen grasten hellgraue Zeburinder. Reiher segelten über die Ebene und ließen sich zwischen den Zebus nieder. Der Wald wich zurück, bis von ihm nur noch ein Strich am Horizont übrigblieb. Kein Baum, kein noch so kleiner Hügel verstellte die Sicht, kein Zaun, nicht ein einziges Gebäude.
«Wie lange werden wir reiten?», fragte ich den vaqueiro Joaquim.
«Wohl eine Stunde länger, als wir für den Hinweg gebraucht haben, jetzt, wo die Pferde beladen sind.» Joaquím führte das Packpferd. Das Tier riss ihm fast den Arm aus, es wollte genauso wenig weiter wie meine Stute. Ohne die Peitsche, mit der ich die Bremsen von den Beinen schlug, wäre sie stehengeblieben. Am Morgen hatte sie den Weg bereits einmal gemacht.
Die Sonne stand senkrecht, und wir quälten uns durch knietiefes Wasser. Da Costa hatte es sich im Sattel bequem gemacht, ein Bein über das andere geschlagen, und unterhielt sich mit Jarico. Der Vormann ritt ohne Schuhe und hakte nur die großen Zehen in den Steigbügeln fest. Am Sattelknauf hing ein ledernes Lasso und darüber eine große Machete.
An einem Fluss wartete da Costa auf uns, und Jarico trieb sein Pferd als Erster ins tiefe Wasser. Der fazendeiro folgte ihm und zog die Beine, so hoch es ging. Ich tat es ihm nach. Das Wasser stieg bis zum Sattel. In der Mitte des Flusses fühlte mein Pferd plötzlich Widerstand am Grund, strauchelte und machte einen panischen Satz nach vorn. Hitze schoss mir in den Kopf. Das Gepäck! Ich hatte es ohne wasserdichte Hülle hinter dem Sattel festgebunden. Mir fiel der Alte vom Rio Ararí mit seinen Narben an den Beinen ein … Einen Moment lang fürchtete ich, mitsamt dem Pferd im Fluss zu versinken. Die Stute fing sich, und ich wurde nur bis zur Hüfte nass.
Niemand dachte an Rast. Ich wollte mir nicht noch einmal die Blöße geben zu fragen, wie lange wir noch reiten müssten. Was hätte es genutzt, es zu wissen? Selbst als wir an eine Farm gelangten und eine Magd mit wirrem Haar und einer verwaschenen Kittelschürze uns Wasser reichte, zuerst dem fazendeiro, dann mir, danach Jarico und zuletzt Joaquím, blieben alle im Sattel.
«Senhor Guillerme ist nicht da?», fragte da Costa die Magd im Ton eines Mannes, der das Befehlen gewohnt war. Die Magd blickte demütig zu ihm auf.
«Nein, Senhor, er ist weggeritten.»
«Wann kommt er zurück?»
«Ich weiß es nicht, Senhor, er hat nichts gesagt.»
«Ist er bei der Herde?»
«Nein, Senhor. Die Männer sind alle weg – wegen des Jaguars.»
«Habt ihr einen Jaguar hier?»
«Ja, Senhor. Er hat heute Nacht wieder ein Kalb gerissen.»
Da Costa drehte sich zu mir um: «Vielleicht erwischen Sie ihn ja!» Er lächelte zum ersten Mal.
«Stehen Jaguare nicht unter Naturschutz?», fragte ich.
«Bei euch vielleicht», antwortete da Costa. Er wandte sein Pferd dem offenen Land zu. «Hier auf Marajó machen wir unsere eigenen Gesetze. Wir müssen unsere Herden schützen. Die Jaguare schlagen unsere Kälber. Das ist hier kein Zoo, hier wird gearbeitet!»
Seit die Jesuiten im 17. Jahrhundert die Viehzucht auf Marajó eingeführt hatten, wuchsen die Herden und schränkten den Bewegungsraum der Wildkatzen immer weiter ein. Der Urwald wurde gerodet, damit ging der Wildbestand zurück; also mussten sich die Jaguare von den Weiden holen, was sie brauchten. Doch von Argumenten wollte da Costa nichts wissen. Wo Tiere seine Unternehmungen behinderten, kannte er nur eine Lösung.
Wir hielten uns in einer Reihe hinter Jarico. In der feuchtheißen Stille spürten die Sinne begierig jedem Geräusch nach, und bald lernte ich, die Pferde am Schnauben auseinanderzuhalten. Der Blick auf die Uhr zeigte mir, dass wir seit vier Stunden im Sattel saßen. Doch Stunden oder Tage waren hier kein Maß, das diesem Augenblick der Unendlichkeit hätte gerecht werden können. Es war ein Gefühl der Grenzenlosigkeit, das mich überkam in dieser Welt, in der es keine Zeit gab und jede Uhr entbehrlich war. Dieses Gefühl ließ sich einatmen, breitete sich in mir aus wie eine Droge. Die Hitze, die schmerzenden Glieder spürte ich nicht mehr. Im Gleichmaß sich wiederholender Bewegungen, im Wachsen von Landschaften, die sich nur geringfügig wandelten, je weiter man in sie eindrang und dabei sacht die eigene Perspektive veränderte, im Zusammensein mit Menschen, das nicht von überflüssigen Worten ausgehöhlt wurde – in alldem zeigte sich auf Marajó die amazonische Ewigkeit. Ihr war ich bisher nur auf den Flüssen zwischen stillen Wäldern begegnet. Meine Begleiter sah ich mal von vorn, mal von hinten, sah gebeugte Rücken über den Sätteln, eine dunkelbraune Hand auf den Oberschenkel gelegt, das gewölbte Profil von Jarico mit stark gewölbten Augenbraunen oder das sich langsam entspannende Gesicht des kleinen fazendeiro, das sich mit jeder Meile, die wir zurücklegten, verjüngte. Es waren Reiter, die ich schon ein Leben lang begleitete und zu kennen glaubte wie gute Freunde, in diesem Universum, in dem es nichts weiter gab als das lange, sich in sanftem Windhauch wiegende Gras und das Wasser, dessen Oberfläche sich wieder schloss, wenn das Pferd seine Hufe herauszog, wo es kein Morgen zu geben schien, nur diesen Moment. Die fortgesetzte Wiederholung von Wiederholungen, das andauernde Déjà-vu-Erlebnis brachte ein Gefühl der Leere hervor, das mich dazu bewegen wollte, still zu stehen, mich von allem zu trennen, die Zügel fahrenzulassen. Die Indigenas sagen, dass ein Mensch sich in den Jaguar verwandeln kann – homem vira onça – oder gar in einen Grashalm, der den Wind liebt, der ihn wiegt und beugt und wieder aufrichtet, diesen Wind, der keine Wünsche erfüllt, ja sie noch nicht einmal kennt, der alles durcheinanderwirbelt und schließlich verweht.
Irgendwann erreichten wir einen Zaun, der sich in dieser Weite verlor, und wir mussten unter einem niedrigen Tor hindurch. Dahinter zerlief die Ebene in feuchtheißen Schwaden. Vor uns lag ein See. Am gegenüberliegenden Ufer stieg der Boden leicht an, und auf dem höchsten Punkt lag die Fazenda, von Palmen eingefasst.
«Mein Land!» Da Costa warf den Kopf in den Nacken und breitete die Arme aus: «Irateua.»
Der Weg dorthin war länger als erwartet. Ich war müde und war es leid, auf das Pferd einzuschlagen. Die Hufe sanken bei jedem Schritt tiefer in den Morast, und so blieb ich weit hinter den anderen zurück und genoss das Schauspiel der Silberreiher und Störche. Sie stolzierten durch das flache Gewässer, fingen hier ein Fischchen, pickten dort nach einem Frosch, schwangen sich leicht in die Luft und segelten über die Ebene.
Um das Haupthaus der Fazenda kreisten Geier. Meine Begleiter hatten bereits abgesattelt und ließen ihre Pferde frei. Man hatte das Gatter der Umzäunung offen gelassen, so dass ich bis zur Treppe reiten konnte, die zu einer Veranda führte. Von oben sah mir die Mannschaft der Fazenda entgegen. Fast alle trugen Hüte oder nach hinten gedrehte Baseballmützen. Nur einer war älter als Jarico. Er war kleiner als die anderen und hatte weißes, streng zurückgekämmtes Haar. Einige trugen kurze Hosen und Stiefel oder Gummilatschen. Ein großer Schwarzer hielt eine Decke im Arm, abgewetzte Leggins aus Leder schlabberten an seinen Beinen. Er war der Einzige mit einem Schnurrbart, und nur ihm gab der verbeulte Filzhut das Aussehen des typischen Viehtreibers. So sahen sie aus, wenn sie in die Stadt ritten, lachten, grölten, Geld hatten und von Frauen ausgenommen wurden, die sie mit schlechtem Schnaps betrunken machten.
Mein Pferd stand still, und mit Schwung wollte ich das rechte Bein über den Pferderücken heben. Es rührte sich nicht. Ich beugte mich nach vorn, um das Bein leichter nach hinten ziehen zu können – es gehorchte nicht. Von der Veranda kam ein gemeinschaftliches Grinsen. «Das ist also der Gringo, der hier jagen will und noch nicht einmal vom Pferd herunterkommt», mögen sie gedacht haben. Jarico erzählte mir später, dass es sie Mühe gekostet hatte, nicht laut loszuprusten. Ich versuchte es wieder, ich wollte mich auf dem verdammten Pferd nicht zum Gespött machen. In den Kneipen von Cachoeira und Genipapo würde man sich darüber noch in zwei Jahren kaputtlachen. Da Costa gab einem Jungen, der an der Treppe lehnte und erwartungsvoll zu ihm aufsah, als hätte er so was schon erwartet, einen Wink. Der Junge ging auf das Pferd zu, hatte bereits den Arm nach dem Halfter ausgestreckt, als der Wille die Beine belebte und mir die Schande ersparte, mir aus dem Sattel helfen lassen zu müssen. Auf dem Boden angekommen, überreichte ich dem Jungen die Zügel. Breitbeinig band ich das Gepäck los und schlingerte auf die Veranda zu. Das Grinsen der vaqueiros verwandelte sich in Neugier.
Da Costa erwartete mich am oberen Ende der Treppe. «Im Badezimmer liegt eine Salbe, falls Sie sich die eine oder andere wunde Stelle geholt haben sollten. Wollen Sie einen cafezinho?»
Ich nickte. Anscheinend hatte mir der Ritt auch die Sprache verschlagen. Gesäß und Beine waren fast taub, nur langsam kehrte das Gefühl in sie zurück.
«Marcelo! Hol Kaffee für unseren Gast!» Der Koch verschwand, und da Costa stellte mir die vaqueiros vor. Ich schüttelte rissige Hände. Der cafezinho wurde gebracht, heiß und süß. Er wirkte wie Schmieröl für die steifen Gelenke.
Die Fazenda lag eingezäunt inmitten von Kokospalmen. Auf den Zaunpfählen hockten Geier mit ausgebreiteten Schwingen. Grobe Pfähle trugen das einstöckige Hauptgebäude, unter dem ich mit eingezogenem Kopf durchgehen konnte. An der Längsseite vor der Veranda breitete sich ein Gemüsegarten mit Bäumen, Büschen und einem Ananasfeld aus. Da Costa hatte Guaven, Limonen und Orangenbäume pflanzen lassen, jambús mit lilafarbenen Blüten und Maracujasträucher. Dort war auch der Brunnen mit dem Wassertank. Bananenstauden schirmten das Häuschen mit dem Generator ab. Jenseits vom Haupthaus stand ein kleineres, flaches Gebäude außerhalb der Umzäunung, das Wohnhaus der vaqueiros. Holz war der einzige Baustoff. Alle Fenster waren mit Fliegendraht abgedichtet, und statt Glasscheiben gab es Fensterläden. Wo der Zaun an einem Teich endete, rottete ein Schuppen mit Ölfässern, einem kleinen Traktor und einem Ochsenkarren mit Scheibenrädern.
Ich hatte meinen Kaffee noch nicht ausgetrunken, als da Costa fragte: «Haben Sie die Munition?» Ich holte sie. Jarico rieb eine Flinte mit einem Tuch ab. Der Junge sprang die Treppe hinunter und stellte eine Blechdose auf den Zaunpfahl, da Costa lud das Gewehr. Eine Viertelstunde hatten sie mir zum Ausruhen gegeben. Nach dem Ritt stand die nächste Prüfung an. Ich wusste nicht, ob das Gewehr verzog, und rechnete mit einem Fehlschuss.
«Halten Sie nach rechts, gestrichenes Korn», riet Jarico. Wie weggeschnippt flog die Dose vom Pfahl. Die Geier suchten das Weite. Auch der nächste Schuss gelang, nur der dritte ging daneben, dafür war der vierte wieder ein Treffer. Da Costa schoss auch, traf, war zufrieden, und die vaqueiros trollten sich. Wir setzten uns an den Küchentisch. Der rotgesichtige Koch Marcelo nahm den Gürteltierbraten aus dem Ofen.
«Der Hund hat es gestern aufgestöbert. Wir hätten beinahe noch eines erlegt, aber da hat ihn eine Klapperschlange gebissen. Sie hatte wenig Gift, sonst wäre er jetzt hin.» Marcelo tätschelte den Hund unter dem Ofen.
«Glück gehabt», sagte da Costa kauend und schob mir Bohnen und Reis zu. «Es ist auch noch Rindfleisch da. Ab morgen müssen Sie für die Ernährung sorgen.»
Verblüfft sah ich auf: «Jagen wir nicht zusammen?»
«Nein, ich mache mir nichts mehr daraus. Ich muss den Sonnenkollektor anbringen. Die elektrische Anlage muss überholt werden, außerdem muss ich mir den Zustand der Herde ansehen – ich will einige Tiere verkaufen. Sie werden allein gehen.»
Da Costa sah mir die Überraschung an. «Keine Sorge, Sie bekommen Teixera mit. Das ist der mit dem Schnauzbart. Er ist nach Jarico der beste Schütze.»
Mir gefiel das nicht. Ich hatte da Costa nur begleiten und vielleicht auch mal schießen wollen, die Munition hatte ich eher als Beitrag zu unserem Ausflug verstanden, sozusagen als Einstand. Es herrschte allgemeines Jagdverbot, nur die Indigenas hatten in ihren Reservaten Jagdrecht, aber auf dem Land besaß jeder eine Flinte. Alle jagten, und ein junger fazendeiro