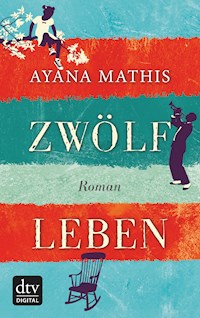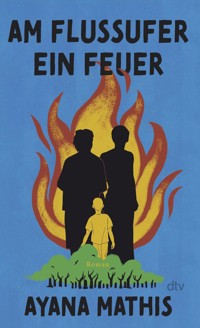
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gibt es das, einen Ort der Freiheit auf dieser Welt? Und welchen Preis zahlen wir dafür? »Mathis vermag es, den Geschichten ihrer Figuren eine epische Tiefe zu geben, die an Toni Morrison erinnert.« The New York Times Bonaparte, Alabama, 1985. Die Ufer des sterbenden Dorfes versinken im Nebel, eine Baufirma dringt auf das Land vor. Verbissen kämpft Dutchess Carson um den letzten Grundbesitz der einst blühenden schwarzen Genossenschaft. Nicht zuletzt für ihre erwachsene Tochter Ava, die allerdings von ihr und dem Erbe nichts wissen will. In Philadelphia ist diese währenddessen ganz unten angekommen, lebt im Obdachlosenheim. Als sie ihrer großen Liebe, dem ehemaligen Black Panther Cass, nach Jahren wieder begegnet, verfällt sie ihm erneut – und gerät in den Bann der radikalen Kommune Ark, die sich schwarzer Selbstbestimmung verschrieben hat. Und ihr elfjähriger Sohn Toussaint will raus, zu der Großmutter, die von ihm nichts weiß. Wenn er es nur dorthin schafft ... Nach ihrem gefeierten Debüt ›Zwölf Leben‹ ist Ayana Mathis erneut ein großer Wurf gelungen: Flirrend lebendig, rau und einfühlsam erzählt Ayana Mathis von der Zerrissenheit und den Wunden einer schwarzen Familie, von einem bedrohten Vermächtnis und von Utopien auf dem Trümmerhaufen der Geschichte. Best Book of theYear u.a. in The Washington Post, The New Yorker, The New York Times und Publishers Weekly »Eine der herausragendsten Stimmen der amerikanischen Gegenwartsliteratur.« Yiyun Li »Ein kostbarer Roman, so universal wie brisant. Man möchte ihn lesen und immer wieder lesen.« Jesmyn Ward
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Bonaparte, Alabama, 1985. Die Ufer des sterbenden Dorfs versinken in unheimlichen Nebeln, eine Baufirma dringt auf das Land vor. Verbissen kämpft Dutchess Carson um den letzten Grundbesitz der einst blühenden schwarzen Genossenschaft. Nicht zuletzt für ihre Tochter Ava, die von ihr jedoch nichts mehr wissen will. Seit sie von zu Hause fortgegangen ist, führt sie das Leben einer Drifterin. Als sie nach Jahren ihrer großen Liebe, Ex-Black-Panther Cass, in Philadelphia wiederbegegnet, verfällt sie ihm erneut – und gerät in den Bann der radikalen Kommune Ark, die sich schwarzer Selbstbestimmung verschrieben hat. Und ihr elfjähriger Sohn Toussaint will raus, zu der Großmutter, die von ihm nichts weiß. Wenn er es nur dorthin schafft …
Kunstvoll verwebt Ayana Mathis das Schicksal dreier Generationen mit wahren Begebenheiten der Black History – und erzählt von einem bedrohten Vermächtnis, von Mutterschaft und Utopien auf dem Trümmerhaufen der Geschichte.
Ayana Mathis
Am Flussufer ein Feuer
Roman
Aus dem Englischen von Susanne Höbel
Für meine Mutter
Wer kann schlafen, wenn sie –
Hunderte Meilen entfernt spür ich den gewaltigen Atem
über ihr rastloses Deck streichen.
Alle Glieder der Kette,
Schrunde an Schrunde,
rasseln aufs Mal.
Wir fahren Mutter auf dem schifflosen Meer.
Hab Erbarmen mit uns, mit dem Meer, wir fahren.
Anne Carson, »Schlafketten«[1]
»Wie lange wird deine Reise währen, und wann wirst du wiederkommen?«
NEHEMIA 2,6
Prolog
Toussaint Wright trat auf die Ephraim Avenue hinaus, er trug einen Rucksack über der Schulter, auf der Wange hatte er eine blutende Wunde. Er war dreizehn Jahre alt. Zwei Jahre zuvor hatte ein Feuer das Haus Nummer 248 in der Ephraim Avenue, wo Toussaint damals wohnte, zerstört. Bei dem Brand war nahezu alles vernichtet worden, was ihm etwas bedeutete. Nichts von dem Haus war geblieben außer ein paar Eisenträgern in seinem verkohlten Rumpf und einer alten versengten Eiche davor.
Seitdem hatte Toussaint an verschiedenen Orten gelebt – in Heimen, bei Pflegefamilien, im Pfarrhaus einer Pastorin, die er gut kannte –, aber er war immer wieder weggelaufen. Jetzt stand er lange auf der Ephraim Avenue und sah zu, wie die braunen Blätter der Eiche zu Boden fielen. Die Regenrinne am Haus 248 löste sich, bei dem metallischen Kreischen stob ein Schwarm Spatzen auf und flog in die Nacht davon. Seit zwei Tagen hatte Toussaint nichts gegessen. Den größten Teil des Weges war er gerannt; wenn er Luft schöpfen musste, hatte er sich hinter parkenden Autos oder in einer Gasse versteckt. Sein Herz schlug zu schnell, sein Blut rauschte wie Wasser. Er berührte die Wunde an seiner Wange und spürte, dass im Fleisch etwas Kleines, Hartes steckte. Glas.
Früher am Tage, in einem anderen Teil der Stadt, hatten ein paar Jungen, die an derselben Ecke wie Toussaint rumhingen, ihn mit Fragen gelöchert: Warum bist du immer allein?, und: Warum sprichst du nie? Hast du keine Mama? Oder eine Großmama oder so? Die Antworten auf diese Fragen waren unerträglich. Manchmal überkam ihn Trauer wie eine Taubheit, die ihm durch und durch ging, von den Zehen bis hoch zum Hals, sodass er nicht mehr schlucken konnte. Und manchmal war es ein Zorn, der mächtig an seiner Wirbelsäule aufstieg. Als Antwort auf die Fragen der Jungen nahm er einen Backstein vom Boden auf. Er nahm einen Backstein und warf ihn ins Schaufenster eines leer stehenden Eckladens. Er rannte.
Jetzt, in der Ephraim Avenue, stampfte er mit den Füßen auf, um sich zu wärmen. Seine Sneaker knallten dumpf auf dem Asphalt. Es hallte in der leeren, kalten Luft, und Toussaint stampfte noch fester auf. Der Häuserblock lag ganz im Schatten, als wäre die Nacht hier dunkler als anderswo. Er stemmte ein Stück der Spanplatte auf, die vor den Eingang der Nummer 248 genagelt war. Es kostete ihn seine ganze Kraft. Er duckte sich durch die entstandene Öffnung und ging ins Haus. »Hallo, hallo!«, rief er, bloß um das Echo seiner Stimme entlang der Flurwände zu hören.
Toussaint kauerte sich in die wärmste Ecke. Er hatte eine Wolldecke, ein Sandwich, das er einem besinnungslosen Betrunkenen abgenommen hatte, und das Bündel Briefe seiner Mutter, die ihm jede Woche aus dem Holmesburg Prison schrieb, während er es nicht über sich brachte, sie dort zu besuchen. Auch die Briefe seiner Großmutter hatte er bei sich. Seine Großmutter hieß Dutchess. Sie lebte in Bonaparte, einem Ort in Alabama. Dorthin war er unterwegs. Diesmal würde er die Reise wirklich machen. Toussaint fiel in einen unruhigen Schlaf und träumte, dass er noch einmal den Backstein warf. Glasteilchen leuchteten im Licht der Straßenlaterne, während sie zu Boden fielen. Der Splitterregen funkelte wie Lametta.
1985
Philadelphia
Cherry Street
Glitzerregen ging auf Ava Carson herab, als sie mit ihren zwei Koffern vor der Cherry-Street-Aufnahmestelle für Obdachlose stand. Mit einem kleinen Schrei ließ Ava die Koffer fallen. Beim Aufprall schnappten die Verschlüsse auf, und der Inhalt quoll hervor wie das Fleisch aus einer Melone, die aus großer Höhe zu Boden fällt. Visionen sind nicht wirklich, oder vielmehr sind sie es noch nicht, aber sie jagen einem Angst ein.
»Toussaint!«, rief Ava.
Er stand gleich hinter ihr, so wie vor dem Moment der Vision: ein kleiner Junge von zehn Jahren, schmächtig für sein Alter, der den Griff seines eigenen Koffers mit beiden Händen umklammert hielt. Da waren sie, an einem Vormittag Ende August: Mutter und Sohn mit drei Koffern und einem schwarzen Müllsack, prall gefüllt mit ihren Sachen.
»Was hast du da gemacht? Warum hast du …?« Ava unterbrach sich. Ihr wurde bewusst, dass sie kreischte. »Schon gut«, sagte sie. »Ist nichts.«
Sie hatte noch nie von einer Ephraim Avenue gehört. Halluzinationen. So etwas kommt vor, wenn man tagelang nicht geschlafen und vor lauter Erschöpfung einen Tunnelblick hat.
Ava kniete sich hin und kramte ihre Sachen zusammen: Pyjamas, die Seidenbluse mit der Schleife, zwei gute Röcke, die sie zum Glück eingepackt hatte, Toussaints gute Buster-Brown-Schuhe für die Schule und seinen paillettenbesetzten Michael-Jackson-Handschuh, ein paar Avengers-Comics. Sie stopfte alles wieder in den Koffer, nur dass die Dinge nicht mehr so gut hineinpassten wie zuvor.
»Ma! Du musst sie falten. Ma, sonst fällt alles gleich wieder raus.«
Schritte wichen ihnen geschickt links und rechts aus. Ein Paar abgestoßener schwarzer Schnürschuhe blieb bei einem der Koffer stehen.
»Brauchen Sie Hilfe, Miss?«, fragte die Frau.
Ava schüttelte den Kopf.
»Hier, lassen Sie mich helfen.« Ihre Hände kamen ins Blickfeld und schwebten über Avas Sachen, raue Handflächen, gräuliche Fingerknöchel, Schmutz unter den Nägeln.
»Nein!«, sagte Ava. »Ich meine, es geht schon, danke.«
»Hrmmpf«, machte die Frau und trat mit dem Absatz auf eine Hose, als sie weiterging.
In der Aufnahmestelle roch es nach Schweiß und altem Junkfood und Haaren.
Der Warteraum war groß, ähnlich wie in einer Kfz-Zulassungsstelle, und die Reihen der Plastikstühle waren am Boden verschraubt. Der Mann am Anmeldeschalter rief Ava und Toussaint immer wieder nach vorn und stellte jeweils eine einzige Frage: Name? Gut, setzen Sie sich. Ausweis? In Ordnung. Nehmen Sie Platz. Es war trostlos, obwohl viel Betrieb herrschte. Die Menschen, die hier arbeiteten, erweckten den Eindruck von Dringlichkeit, als würden sie Dinge regeln, mit den Telefonhörern am Ohr und den Aktenbergen auf den Schreibtischen vor sich. In einer Ecke des Warteraums rieb eine dünne Frau ihrem Kind die Ellbogen mit Vaseline ein, als hinge ihr Leben davon ab. Das war ein tröstlicher Anblick. So schnell geht die Welt nicht unter, heißt es ja. Ava drückte Toussaints Hand. »Vielleicht dauert es gar nicht so lange«, sagte sie.
Aber es dauerte. Eine Stunde verging, dann eine zweite. Es wurde Nachmittag, zumindest kam es Ava so vor, weil der Raum im grellen Sonnenlicht schmorte. Der Mann an der Anmeldung rief Ava und Toussaint wieder nach vorn und gab Ava einen Stapel Formulare auf einem Klemmbrett. Als sie zu ihren Plätzen zurückkamen, saß dort eine Frau, die sie herausfordernd anfunkelte, und das Kind neben ihr wühlte in einer Tüte Doritos-Chips. Nirgends im Raum gab es noch einen freien Stuhl. Es blieb ihnen nichts übrig, als sich inmitten ihrer Koffer an die Wand zu lehnen. Die schwüle Luft schnürte Ava Brust und Magen zu, und schließlich musste sie würgen und spuckte in eine Handvoll benutzter Papiertücher aus, die sie vom Boden aufhob. Eine Frau am Ende der nächsten Sitzreihe zog die Stirn kraus und wandte den Blick ab. Wer kann helfen, dachte Ava, wenn hier nur diese Frauen mit ihren Kindern sind, allesamt arm wie Brot und Wasser? Menschen, die nichts haben, können nichts tun, hatte ihre Mutter immer gesagt.
»Ma, soll ich das halten?«, fragte Toussaint. Weil es Ava nicht gelang, das Klemmbrett an die Wand zu stützen, fielen die Formulare immer wieder auf den Boden. Der Junge legte ihr seine Hand auf den Arm. Seine Augen waren groß wie Pflaumen und sprangen umher: von dem nussbraunen Baby auf der Schulter einer Frau zu dem kleinen Mädchen, das seine Haarspangen auf- und zuknipste, bis seine Mutter ihm einen Knuff versetzte, zu der Frau, die vor dem Mann an der Anmeldung ihre Papiere schüttelte. Ava bekämpfte einen neuerlichen Brechreiz und konzentrierte sich auf die Formulare.
Da standen Fragen wie: Zuletzt wohnhaft. 245 Turnstone Pike, James Creek, New Jersey. Nächste Verwandte: Keine. Familienstand: Verheiratet.Getrennt. Im Notfall zu benachrichtigen: Niemand. Welche Umstände haben dazu geführt, dass Sie Obdachlosenhilfe beantragen müssen? Vor zwei Wochen hat mein Mann Abemi Reed uns aus seinem Haus in New Jersey rausgeworfen.
Dann schrieb sie: Gestern Abend saßen Toussaint und ich an einer Bushaltestelle draußen in Northeast, gegenüber sah man in die Wohnung einer Frau. Auf ihrem Tisch stand ein Krug Eistee. An der Haltestelle war es dunkel, dann ging die Straßenlaterne über uns an, und wir saßen im hellen Licht. Die Frau in der Küche hatte uns im Blickfeld, und ich fand, dass wir da nicht bleiben konnten. Wir waren hundemüde. Ich gab fast mein ganzes Bargeld für ein Motel aus. Am Morgen fragte mein Sohn, wohin wir jetzt gehen. Kommen wir heute Abend wieder her?, hat er gefragt. Ich habe ihm bei McDonald’s ein Sandwich mit Ei gekauft. Wir saßen in dem klimatisierten Raum und sahen den Kindern auf dem Spielplatz zu. Ich hatte Geld für eine Busfahrt zurückgelegt, sodass wir in jedem Fall irgendwohin fahren konnten. Wir haben es dann für die El ausgegeben, um herzukommen.
Ava ging der Platz aus, und sie schrieb am Rand weiter. Sie wusste, dass dies nicht die Antworten waren, die man von ihr erwartete, aber sie musste es jemandem erzählen. Der Mann am Anmeldeschalter war am Telefon und sah nicht einmal auf, als sie das Klemmbrett durch den Schlitz schob. Sie ließ die Arme hängen und wartete. Nach einer Weile hob er seufzend den Kopf.
»Jetzt kommen Sie, Miss. Beruhigen Sie sich.« Er nahm das Klemmbrett. »Sie können hier nicht weinen. Beruhigen Sie … Gloria! Komm mal her, die Frau hier … grabschen Sie nicht die Scheiben an, Miss.«
Gloria kam polternd aus einer Seitentür. »Okay. Sie müssen sich beruhigen, sonst können wir …« Aber es war nicht nur Ava – die meisten Menschen im Warteraum weinten oder versuchten nicht zu weinen. Alle mieden es, sich gegenseitig anzusehen.
Gloria teilte Ava und Toussaint dem Glenn Avenue Family Shelter zu. Sie gab ihnen Fahrgutscheine – kein Bargeld. Drei Stunden waren vergangen, und sie standen wieder auf der Straße. Die dürren Äste der Bäume hier in Center City hingen schlapp in der Hitze, und die gelackten Frisuren der Geschäftsfrauen hatten den Halt verloren. Ava und Toussaint schleppten ihre Koffer und den Müllbeutel die Broad Street entlang zur Subway. Abwechselnd gingen sie mit ihrem Gepäck die Treppen zum Bahnsteig hinunter: Erst bewachte Toussaint die Sachen und Ava trug zwei Koffer nach unten, dann ging Toussaint, dann wieder Ava. Leute guckten, aber niemand bot ihnen Hilfe an. Um Avas Halsausschnitt bildete sich ein Schweißring. Toussaints Augen glänzten, seine Lippen waren weiß und ausgetrocknet. Die anderen Fahrgäste hielten von ihnen Abstand, obwohl auch sie schwitzten und manche von ihnen ebenfalls im Weg mit ihren Einkaufstüten und Wäschesäcken waren. So sind die Menschen eben.
Ava und Toussaint stiegen aus der Subway, fuhren mit dem Bus und dann noch einem und stapften durch noch mehr Straßen. Laut Wegbeschreibung waren es vier Querstraßen bis zur Tulpehocken Street, dann links. Sie zählten fünf Querstraßen, dann sechs. Die Mücken schwirrten ihnen um die Ohren.
»Ma? Ma! Ist es das?«, fragte Toussaint bei jedem Gebäude, an dem sie vorbeikamen.
Sie erreichten eine Kreuzung. Schon von der Ecke sahen sie ein einstöckiges graues Gebäude, das sich über die Hälfte des Blocks ausdehnte und groß und traurig aussah, wie staatliche Einrichtungen das meist tun. Auf der U-förmigen Auffahrt ging es turbulent zu, überall Frauen und Kinder – so viele, dass man denken konnte, nur Kindern und Müttern stießen schlimme Dinge zu. Einige Mütter hatten noch Lockenwickler im Haar, einige Kinder trugen schmutzige T-Shirts, andere hätten mal wieder einen Haarschnitt brauchen können. Ava fielen weder die Jungen in gebügelten Hosen noch die Frauen mit gepflegten Frisuren und Fingernägeln auf. Sie wusste nur, dass sie da nicht reingehen konnte. Aber Toussaint lehnte erschöpft an einem Baum. Er konnte keinen Schritt mehr tun, oder nicht mehr viele.
»Bleib bei mir«, sagte sie und nahm die Koffer. Sie packte den Müllbeutel, obwohl das Band ihr ins Handgelenk schnitt und ihre Schulter schmerzte. »Bleib ganz dicht.« Eine Frau am Eingang versuchte etwas zu sagen, vielleicht Hallo, vielleicht meinte sie auch gar nicht Ava. Ava fielen keine Worte zur Antwort ein. Gleich hinter der Tür stand ein korpulenter Sicherheitsmensch hinter einem Schreibtisch und sagte: »Wer kommt denn da?«, mit einem Lächeln, das etwas Anzügliches hatte.
»Willst du ein bisschen rumrennen, Kleiner?«, sagte er zu Toussaint, während er Avas Papiere prüfte. Er sagte, sie hätten einen hübschen Spielplatz mit einem Klettergerüst und einer Rutsche. Ava hasste ihn, weil er so dastand und weil nach Feierabend eine Küche und ein Schlafzimmer auf ihn warteten und weil er redete und redete. Er hieß Melvin. Ava hätte ihm am liebsten ins Gesicht geschlagen. »Du kannst ein bisschen rausgehen, bevor heute Abend abgeschlossen wird.« Wenn Toussaint nicht solche Bauchschmerzen gehabt hätte, wäre er gern aufs Klettergerüst gestiegen und hätte sich mit den Kniekehlen an die Stange gehängt und geschrien, als machte es ihm Angst, kopfüber zu hängen, aber in Wahrheit würde er einfach nur schreien. Er sah zu seiner Mutter hin, ob er vielleicht … aber ihr Gesicht war so verschlossen wie eine Faust.
»Montag«, sagte der Sicherheitsmensch und schüttelte den Kopf. »Montags ist hier immer die Hölle los.« Er zeigte mit dem Daumen über die Schulter. Würde wahrscheinlich einen Moment dauern; bis auf Miss Simmons waren alle schon gegangen.
»Sie wird den ganzen Tag belagert«, sagte er. »Sie können Ihre Sachen auch erst mal hierlassen.« Er zeigte auf einen Raum, womöglich ein leeres Büro. Ava schüttelte den Kopf. Sie würde ihre Sachen nicht in einem unverschlossenen Raum lassen. Sie würde Toussaint nicht erlauben, mit diesen schmuddeligen Kindern herumzurennen. Gab es denn nichts zu essen, für ihren Sohn, wollte sie wissen.
»Na, Miss, das ist doch hier nicht Pizza Hut«, sagte er. Dann: »War ein Scherz. Kleiner Scherz. Die Essenszeit ist vorbei, aber Sie können Miss Simmons fragen. Meistens hat sie was für Spätankömmlinge.«
Ava und Toussaint setzten sich auf die Stühle im Flur, bemüht, dass ihr Gepäck nicht im Weg war. Eine Frau ihnen gegenüber verdrehte die Augen. Was konnten sie denn dafür, dass sie Sachen hatten? Und saß die Frau da etwa nicht mit gespreizten Beinen da wie ein Mann und kaute Kaugummi wie eine Kuh?, dachte Ava. Im Flur war es dämmrig und zu warm. Avas Rückenwirbel drückten hart gegen die Metalllehne des Stuhls. Toussaint war zapplig.
»Nicht kratzen«, flüsterte sie. »Wir haben keine … kratz nicht.« Er hatte eine wunde Stelle oberhalb des Ellbogens.
Toussaint setzte sich auf seine Hände. »Es ist gar nicht so schlimm, Ma«, sagte er. »Sie haben den Flur geschmückt. Siehst du?«
Überall an den Wänden hingen aus Tonpapier ausgeschnittene Figuren, wie Kinder sie in der Schule basteln. Und ein breit lächelnder Apfel mit einem Spruch quer darauf. Und Brotscheiben mit Beinen und Hütchen auf einer Ernährungspyramide. Aber es gab kein Fenster, und die langen Betonwände liefen am Ende aus und waren beklebt mit offiziell wirkenden Schildern und Ankündigungen.
»Siehst du?«, sagte er wieder.
Bruchstücke einer Unterhaltung, die jemand am Münztelefon beim Tisch des Wachmanns führte, waren zu hören. »Und was ist mit Miss Jeanie? Was macht sie? War sie mal da?« Ava erschlug eine Mücke an ihrem Bein. Am anderen Ende des Flurs klackerten Münzen in einen Getränkeautomaten, dann fiel die Dose scheppernd in den Schacht. Das Münztelefon klingelte unablässig, wenn gerade niemand damit telefonierte.
»Du sollst nicht kratzen, Toussaint.«
»Du aber auch nicht. Du hast dich auch gekratzt.« Avas Beine waren voller Mückenstiche. Das Jucken war so stark, es fühlte sich wie Panik an. Sie sprang auf, dann setzte sie sich wieder.
Eine Frau mit einem sorgfältig frisierten Pagenschnitt führte sie in ein Büro und stellte sich als Miss Simmons vor. Sie setzte sich und bewegte die Lippen. Avas Oberschenkel juckten höllisch. Miss Simmons hatte perfekt oval geformte und lila lackierte Fingernägel, mit denen sie beim Sprechen auf den Schreibtisch tippte. Keine Drogen, kein Alkohol, keine Männer. Klack. Es gab Beratungsangebote. Klack. Jeder Bewohner musste aktiv auf Arbeitssuche gehen. Ava sollte sich bis Ende der Woche bei der Arbeitsvermittlung melden. Wurden die Vorschriften nicht – aufs Genauste! – eingehalten, bedeutete das die unverzügliche Beendigung des Aufenthaltes. Keine Diskussion. Klack klack. Ava rieb sich die Beine durch ihre Jeans. War Miss Carson müde?, fragte Miss Simmons. Hatte sie Drogen genommen? Sie sah etwas mitgenommen aus. Drogenberatung wurde angeboten. Essenszeiten waren streng einzuhalten. Keine Lebensmittel auf dem Zimmer. Keine Drogen, kein Alkohol, keine Männer. Alle Bewohner mussten wochentags bis neun Uhr das Haus verlassen haben. Bewohner konnten zum Lunch wiederkommen. Um neun Uhr abends war Zapfenstreich, falls keine Sondererlaubnis erteilt wurde. Mietzuschüsse standen Bewohnern zu, die auf eigene Initiative eine Unterkunft fanden. Bewohner sollten sich laufend bemühen, eine Unterkunft zu finden.
Avas Augenlider zuckten. Sie war so müde, dass sie sich am liebsten auf den Boden gelegt hätte. Miss Simmons machte mit ihnen eine Führung durchs Haus. Der Fernsehraum wird um neun Uhr abends geschlossen. Die Tür rechts führt zu einem von fünf Familienwaschräumen, jeder mit fünf Duschkabinen, Waschbecken und Toiletten ausgestattet. War bei Miss Carson alles in Ordnung? Sie sollte sich am nächsten Tag um eins zu einer psycho-sozialen Begutachtung einstellen. Für die allgemeine Aufnahmeprozedur sollte sie um zehn vorsprechen. Sie würden den Rest der Führung auf morgen verschieben. Der Junge sah ein wenig müde aus. Sie gingen einen Treppenabsatz hinunter und einen langen Flur entlang bis zu Zimmer 813. Miss Simmons zog einen Schlüssel aus der Tasche ihres Jacketts. Keine Drogen. Kein Alkohol. Keine Männer. Dann war sie weg.
Die Wände in Zimmer 813 waren von einem trüben Minzgrün. Hohe, schmale Fenster gingen auf eine Anlage mit flach getrampeltem Gras, dahinter sah man jenseits einer belebten Straße einen Parkplatz. Avas Sandalen klebten auf dem Linoleum. Im Zimmer roch es nach schmutzigen Wischmopps und den Körpern all der Menschen, die hier gelebt hatten: Kinder mit schuppigen Hautausschlägen und Frauen, die sich an dem Waschbecken in der Ecke flüchtig die Achselhöhlen gewaschen hatten – wie viele Frauen in wie vielen Jahren? –, und schmutzige Wäsche und über allem der Gestank von Ammoniak. Toussaint machte einen Schritt ins Zimmer. Ava streckte ihren Arm vor seine Brust, damit er keinen zweiten machen konnte. Hinten im Zimmer gab es einen Holztisch mit zwei Plastikstühlen. Über dem zerkratzten Waschbecken waren eine Konsole und ein Spiegel angebracht. Zwei Einzelbetten mit Metallrahmen standen sich an den Wänden gegenüber, auf der einen Matratze lag eine halbtote Kakerlake. Toussaint lehnte sich an Avas Arm.
»Setz dich auf den Stuhl, Schatz«, sagte sie. »Nicht auf die Matratze. Fass nichts an. Hier können wir nicht bleiben. Hier bleiben wir nicht.«
Nach ein paar Stunden ließ der Verkehr auf der Tulpehocken nach. Ava und Toussaint hatten sich nicht von den Stühlen an dem ramponierten, alten Tisch gerührt. Irgendwo auf den Fluren hörte man ein Baby weinen. Eine Wanduhr tickte in der Stille. Ava sah hoch und bemerkte, dass der Stundenzeiger über der Zehn flatterte wie ein zuckendes Augenlid. Ava stieg auf den Stuhl und von da auf den Tisch. Sie packte die Uhr mit beiden Händen und schüttelte sie. »Jetzt komm«, sagte sie laut.
Toussaint schreckte hoch und öffnete die rotgeränderten Augen.
»Ma?«
Ava kletterte wieder herunter. Toussaint hatte den Kopf in die Hand gestützt, aber sein Ellbogen glitt immer wieder vom Tisch. »Ma«, sagte er. »Ma, kann ich mich bitte hinlegen?«
»Bald, Schatz.«
»Mir ist schlecht, Ma. Ich glaube, ich muss mich hinlegen.«
»Ich weiß, Baby. Ich weiß. Gleich legen wir uns hin.«
Im nächsten Moment war er wieder über dem Tisch zusammengesunken. Ava beugte sich über ihn und legte ihm ihre Wange auf den Kopf. Sein Haar war feucht. Er musste sich wirklich hinlegen. Aber nicht hier. Nur dass sie nirgendwo sonst hingehen konnten, und genau deshalb waren sie in diesem Raum statt auf einer Parkbank oder in einer Subway-Station. Sie stützte sich auf den Tisch. Vielleicht könnten wir … ein Gedanke sprang ihr durch den Kopf wie eine Katze über eine Mauer. Vielleicht wäre es eine gute Idee, die rettende Idee gewesen, aber Ava vermochte es nicht, sie festzuhalten.
Toussaint schrie auf, als wäre er im Traum getreten worden. Okay. Okay. Ava stand auf. Da sie nichts hatte, um die Matratze sauberzumachen, bezog sie mit den vorhandenen Laken das Bett, auf dem keine Kakerlake lag. Trotz des schmerzenden Rückens gelang es ihr, Toussaint mit beiden Armen vom Stuhl zu hieven und ihn durchs Zimmer zu führen. Sie legte ihn auf das Bett, so wie Abraham es mit Isaak getan hatte.
Ava drehte ihren Stuhl so zum Bett, dass sie ihren Sohn beschützen konnte vor allem, was aus den Ecken kriechen und über ihn krabbeln und ihm Eier in die Ohren legen konnte. Sie zitterte vor Erschöpfung, doch sobald sie die Augen schloss, meinte sie ein Krabbeln an ihren Fußknöcheln zu spüren. Das Deckenlicht summte, und plötzlich war das Zimmer gleißend weiß und konturlos wie eine überbelichtete Fotografie. Wieder eine Vision, die sie überkam. Oder der Heilige Geist, oder der Geist ihres Vaters, der durch das Neonlicht an der Decke herabstrahlte. Was immer es war, es machte sie ruhig. Ava legte den Kopf an die Wand, und kurz darauf war sie eingeschlafen.
Brüchige Sozialgefüge
»Waren Sie in den letzten zwei Monaten manchmal traurig, Miss Carson? Hatten Sie den Wunsch, sich selbst oder anderen wehzutun?«
Miss Simmons saß Ava Carson gegenüber, ihrem Ein-Uhr-Termin. Sie hatte ihr zwei zusätzliche Tage zur Eingewöhnung gegeben, vor dieser zweiten Beurteilung. Manchen fiel es schwer, sich einzuleben, anderen weniger. Diese Frau, diese Carson, wirkte fragil, außerdem war an ihr etwas merkwürdig. Heimliche Trinkerin vielleicht, obwohl sie nicht so aussah. Ihre Augen waren klar. Oder Drogen, aber auch danach sah sie nicht aus. Dann womöglich psychische Probleme, aber die Psycho-Sozialarbeiterin hatte gesagt, sie habe die Tests bestanden. Nicht, dass das etwas aussagte. Die Leute konnten ja Depressionen haben. Sie konnten ernsthaft krank sein und trotzdem wissen, welcher Wochentag es war und wie der Präsident hieß. Sie hat nichts, hatte June nach den Tests gesagt. Das hatte June etwas verstimmt. June mochte es nicht, wenn eine hübsche, höfliche Frau ihre Zeit in Anspruch nahm, und dann nicht wenigstens ein bisschen verrückt war. Soll mir recht sein, dachte Miss Simmons. Sollen die Ava Carsons dieser Welt nur kommen, auch wenn sie ein bisschen merkwürdig sind. Erst gestern hatte eine Bewohnerin ihr in aller Seelenruhe erklärt, dass sie aus ihrem Zuhause ausgezogen war, weil ihr Vater, der offenbar ein Mistkerl war – und außerdem tot –, von der Stereoanlage Besitz ergriffen hatte und durch die Lautsprecher zu ihr sprach. Anscheinend war dieser Vater jetzt durch das Radio auf Miss Simmons Schreibtisch zu hören. Und der Geruch! Hatte sich weiß der Himmel wie lange nicht mehr gewaschen. Und die ganze Zeit ließ sie einen Zweijährigen auf ihren Knien reiten. Also wirklich.
»Miss Carson?«
»Ja, klar bin ich traurig. Ich meine, wir wissen nicht, wo wir hinsollen.«
Miss Simmons mochte es nicht, wenn Menschen weinten; allerdings war das bei ihrer Arbeit unvermeidlich. Sie wollte nicht, dass diese Carson vor ihr in Tränen ausbrach. Sie mochte es nicht, wenn die Dinge ihre Grenzen überschritten. Ihre Aufgabe bestand darin, Ordnung ins Chaos zu bringen, damit diese Frauen wieder in die Welt gehen und wie alle anderen leben konnten.
»Sie haben angegeben, dass Sie ihren bisherigen Wohnort in …« Miss Simmons warf einen Blick in Ava Carsons Akte. »In New Jersey wegen häuslicher Gewalt verlassen haben.«
»Nein! Ich meine, ja, aber es war nicht …«
»Polizeibericht?«
»Was?«
»Gibt es einen Polizeibericht?«
Ava Carson schüttelte den Kopf. Schade, dachte Miss Simmons und machte einen Strich durch Shelter House, Hill of Hope und die Women’s Rescue Mission. Diese Häuser waren für Kinder besser. Sie hatten dort Kinderbetreuung und so. Andererseits hatte keins der Häuser Plätze frei.
»Die nächsten Angehörigen?«
»Alabama.«
»Niemand hier in der Nähe?«
Ava schüttelte den Kopf.
Auch nicht der Vater des Jungen? Auf der Geburtsurkunde war ein Cassius Wright eingetragen.
»Niemand sonst? Vielleicht jemand, an den Sie bisher nicht gedacht haben und der Ihnen helfen könnte?«
813 atmete tief ein und biss die Zähne zusammen. Na, du brauchst das nicht an mir auszulassen, dachte Miss Simmons. Irgendwann mal hatte Miss Carson etwas getan oder nicht getan, weshalb sie jetzt allein war, ein Blatt im Wind. Hier landen sie nicht, weil sie den Job verloren haben oder der Freund sie schlecht behandelt hat. Sie landen hier, bei mir, wegen »brüchiger Sozialgefüge«, wie es in den neuen Richtlinien der Gemeinde hieß. Heute gab es freundlichere Begriffe für solche Dinge.
»Und Sie haben Ihr gesamtes Barvermögen mit elf Dollar angegeben?« 813 nickte.
»Nichts außer dem Bargeld? Kein Auto? Kein Eigentum auf ihren Namen, auch wenn Sie keinen Zugang haben?«
»Ich war verheiratet … Abemi, mein Mann, war, äh, religiös, und ich … ich bin zu Hause geblieben und habe mich um den Haushalt gekümmert. Aber es war dann nicht so, wie ich … Es hat nicht funktioniert.«
»Also. Letztes Arbeitsverhältnis vor drei Jahren.«
»Ja, aber – dann habe ich geheiratet und aufgehört zu arbeiten. Davor habe ich immer gearbeitet. Immer. Ich hatte mehrere hundert Dollar gespart, und die habe ich auf sein Konto eingezahlt.« Ava hielt inne und atmete tief ein. »Aber er hat mich nicht als Mitinhaberin eingetragen, wie er gesagt hat.«
Keine behält je ihr eigenes Konto, dachte Miss Simmons. Laut sagte sie: »Das kommt recht häufig vor in einer Ehe.«
»Dass Männer ihren Frauen nicht erlauben, ihr eigenes Geld zu haben?«
»Ein gemeinsames Konto, Miss Carson.«
Ava kräuselte die Lippen; kaum wahrnehmbar, aber Miss Simmons bemerkte es trotzdem.
»Es war kein gemeinsames Konto, Miss Simmons. Ich meinte nur, er …«
»James Creek, New Jersey«, sagte Miss Simmons mit einem Blick auf Avas Formular. »Das ist eine gute Gegend. Wohnung oder Einfamilienhaus?«
»Einfamilienhaus.«
»Verstehe. Gut. Also …«, sagte Miss Simmons.
813 atmete tief ein und presste die Kiefer zusammen wie eine Zwinge. Ist nicht persönlich gemeint, dachte Miss Simmons. Reg dich nicht auf.
»Ihre letzte Anstellung war bei Kelly Girl Services? Ist das richtig? 1982?«
813 richtete ihren Blick auf einen Punkt hinter Miss Simmons.
»Miss Carson?«
»Geboren 1940. Dutchess und Caro Carson. Eltern.«
»Ja, ihre biographischen Daten haben wir, Miss …«
»Philadelphia. West Oak Lane. Hellgelbes Kleid. Empire-Schnitt. September 1982.«
»Wie bitte?«
»Ja, da Sie noch einmal durchgehen wollen, was ich schon auf den Formularen da eingetragen habe, und auf den Formularen davor, und was ich mit der anderen Sozialarbeiterin besprochen habe, wollte ich Ihnen die Mühe ersparen, weitere Fragen zu stellen. Und außerdem hören die Menschen gern etwas über Hochzeiten.«
»Miss Carson, ist Ihnen nicht wohl?«
»Doch, mir geht es gut.«
Miss Simmons nahm die Brille ab und sah Ava streng an. Sie hatte die Erfahrung gemacht, dass sie so nicht hilfreiches Verhalten unterbinden konnte. Offensichtlich hatte die Frau einiges durchgemacht. Auf ihr Anmeldeformular hatte sie lauter wirres Zeug geschrieben – dass ihr Mann ferngesehen oder Hühnchen gegessen habe oder so was, während sie versuchte, ins Haus zu kommen. Aber was sollte Miss Simmons mit all den traurigen Geschichten dieser Leute anfangen? Wenn die Informationen nicht zu einem Berechtigungsschein für eine Notunterkunft führten, wollte Miss Simmons lieber nichts davon hören. Sie änderte ihre Vorgehensweise.
»Ist die Ehe noch gültig? Wurde die Scheidung eingereicht? Antrag auf Unterhalt gestellt?«
Ava räusperte sich und zog an der Schleife am Kragen ihrer Bluse. Es war eine hübsche Bluse. So konnte sie zu einem Vorstellungsgespräch gehen. Diesen Vorteil hatte sie, und sie konnte sich gut ausdrücken. 813 brauchte nur das zu tun, was Miss Simmons ihr sagte. Nichts einfacher als das.
»Miss Carson, wir wollen keine Zeit verschwenden. Ich bin mir sicher, Sie wollen hier nicht länger bleiben als nötig.« Miss Simmons tippte mit ihrem zimtbraunen Nagel auf den Schreibtisch – einmal, zweimal. »Also? Unterhalt für Sie oder das Kind?«
»Nein. Nichts«, sagte Ava leise und blickte auf ihre Handflächen.
Dicke Bohnen mit Speck
»Wir können uns nicht mit negativen Dingen aufhalten«, sagte die Neue aus 813. Sie und ihr Junge, er hatte einen komischen Namen – Too oder Two –, so in die Richtung? Jedenfalls, sie saßen an einem Tisch ganz hinten in der Glenn-Avenue-Cafeteria, als Melvin seine Mittagsrunde machte. Der Junge schaufelte das Essen in sich hinein. Muss ja einen Heißhunger gehabt haben, dass er den Fraß so schnell verdrückte – Melvin rührte das Essen, das hier gekocht wurde, nicht an. Heute waren nicht einmal die dicken Bohnen mit Speck geraten: lauwarm und trotzdem angebrannt, mit kleinen schwarzen Flöckchen zwischen den rosa Fleischbrocken.
Zwei große Standventilatoren drehten die Dosenbohnenluft im Raum herum. In der Schwüle hatten sich die Klebestreifen der Kinderzeichnungen gelöst, und die Blätter klatschten im Luftzug an die Wand. 813 stürzte das Wasser hinunter, ihr Gesicht hatte einen grünlichen Anflug. Sie war so hellhäutig, dass man es sehen konnte, wenn sie die Farbe wechselte. Das war nicht unbedingt Melvins Ding, obwohl er das für sich behielt. Auch seine Frau war eher gelblich, worauf er als Mann mit einer Anstellung bei der Stadt und Pensionsansprüchen ein Anrecht hatte. Er mochte braune Frauen, oder zumindest zimtfarbene. Es machte ihn ganz kribbelig, wenn er ein Netz von Adern unter der Haut sehen konnte. 813 war auf ihre Art hübsch. Hippie-Stil, aber zu brav. Sie trug eine Bluse, kurzärmelig mit einem hübschen kleinen Muster, und einen Jeansrock, der ein bisschen enger war, als man bei dem frommen Oberteil erwarten würde.
»Wir müssen ihn aus unseren Gedanken verbannen«, sagte sie gerade, als Melvin wieder vorbeikam, jetzt in die andere Richtung. Verbannen! Wer sagte schon »verbannen«? Lehrerinnen vielleicht. Man konnte sich nur wundern, wer alles im Glenn Avenue landete. Er schüttelte den Kopf. Wahrscheinlich meinte sie ihren Freund oder so. Alle Frauen hier hatten einen Mann, der ihnen übel mitgespielt hatte. Nach Melvins Schätzung waren an dem Nachmittag vielleicht sechzig Frauen in der Cafeteria, das hieß sechzig, womöglich sogar hundertzwanzig Typen, die mit Schuld hatten, dass diese Frauen hier waren. Und genau aus diesem Grund hatte Melvin ein einziges Kind und nicht eines mehr. Zwei Kondome immer in der Brieftasche. Alle drei Monate wechselte er sie aus. Natürlich hatte er sie schon vorher gebraucht. Immer! Worauf es ihm ankam: Niemals würden seine kleinen Soldaten bei einem Gelegenheitsvergnügen flussaufwärts schwimmen.
Die Gelbhäutige stand mit dem Tablett des Jungen auf und sah ein bisschen verwirrt um sich, als wüsste sie plötzlich nicht mehr, wo sie war oder was ihr zugestoßen war.
»Ma?«, sagte der Junge. Er war in keiner besonders guten Verfassung. Ringe unter den Augen. Mickrig. Der arme Kleine, er sah aus, als würde er gleich losheulen. Sie sollte mit ihm aufs Zimmer gehen und ihn in den Arm nehmen oder so. Melvin war kein schlechter Mensch. Er fand, für Jungen war es okay zu weinen, bis sie elf oder zwölf waren. Aber dann mussten sie mit diesem Unsinn aufhören.
Melvin lehnte sich an die Wand und ließ den Blick durch den Raum schweifen. Mittags war es freundlich, friedlich. Die meisten waren in der Stadt und trieben sich herum – angeblich auf der Suche nach Arbeit, schon klar –, und das hieß, dass Melvin es locker angehen konnte. Seit er hier arbeitete, hatte er ein paar Dinge gelernt. Als er anfing, hatte er gedacht, mit den Frauen wäre es ein Kinderspiel. Und tatsächlich blieben die anständigeren für sich und kümmerten sich um ihren eigenen Kram. Aber die anderen? Pfff. Erstens, wenn sie high waren, entwickelten sie Godzilla-Kräfte. Zweitens, brach ein Streit aus, war es zehnmal schwieriger, sie zu trennen, als wollte man bei zwei Niggern dazwischengehen. Frauen ist jedes Mittel recht – Fingernägel, Zähne, Haare ausreißen. Einmal hatte Melvin mitbekommen, wie eine der anderen mit einer abgebrochenen Haarnadel in die Wange stach. Einer Haarnadel! Sanftes Geschlecht, am Arsch. Gestern erst hatte er bei einem Streit vor den Münztelefonen eingreifen müssen. Die hatten sich gezofft, weil … Tja, wenn man vom Teufel spricht. Staatsfeind Nummer Eins betrat die Cafeteria. »Alles klar, Tess?«, rief Melvin. Damit sie wusste, dass er da war.
Beinah hätte er ein Auge verloren, als er sie gestern von einer anderen wegziehen wollte. Er und Renee waren sich einig, dass Tess gewonnen hatte, aber ihre Wange hatte drei tiefe Kratzspuren abbekommen. Heute sah sie etwas mitgenommen aus. Gewöhnlich spielte sie sich auf und versammelte ihre Getreuen um sich: »Tess hat keine Zeit für diesen Scheiß hier.« Oder gestern, kurz vor den Kratzern: »Tess soll hier rumstehen, weil diese Schlampe eine volle Stunde an einem ÖFFENTLICHEN Telefon quatscht?« Während die beiden sich in die Haare kriegten, kam die Neue herein. Und das Erstaunliche war – sie hatte überhaupt keine Angst. Der Kleine sah aus, als würde er sich gleich bepissen, aber im Näherkommen schob sich 813 zwischen ihn und die zankenden Frauen und sah aus, als hätte sie am liebsten auf sie gespuckt. Die Nase in die Luft gereckt. Einen Moment lang blieb sie wie aufgeladen stehen, als wollte sie sich einmischen. Das war mal eine Überraschung.
Jetzt beugte sich 813, am ganzen Körper angespannt, vor und flüsterte angestrengt. »Aber, aber …«, sagte der Junge. Sie nannte einen Namen – zumindest dachte Melvin, es sei ein Name – und schüttelte den Kopf. Dann wollte der Junge mit ihr beten, und sie legten über den Tisch hinweg die Hände zusammen, aber nur der Junge senkte den Kopf. Ihr Blick war starr geradeaus gerichtet. Überspannt – das war der richtige Ausdruck für sie.
Tess kam weiter in den Saal und funkelte die Anwesenden an, und wen funkelte sie wohl besonders böse an? Kaum verwunderlich, dass ihr der Anblick von 813 nicht gefiel. Tess ist gut eins achtzig groß, und ihr Gesicht hat was von einem Deutschen Schäferhund. Gar nicht unbedingt im negativen Sinn.
»Fehlt dir was?«, brüllte sie quer durch den Raum.
Oh-oh, dachte Melvin.
»Nein, Ma’am«, sagte 813. Aber wie sie das »Ma’am« betonte!
Außerdem sagte sie es mit einem strahlenden Miss-America-Lächeln: Nur mit dem Mund, die Augen hart. Ziemlich unheimlich.
»Bist du dir da sicher?«, sagte Tess. Doch selbst Tess, der Hitzkopf, wusste, dass sie diesen Kampf auf einen anderen Tag verlegen mussten. Sie und die Frau, mit der sie gekommen war, setzten sich an einen Tisch ganz vorn und machten sich über ihre dicken Bohnen mit Speck her. Nach den ersten Bissen hob Tess zu einem ihrer Monologe an – von wegen, es seien nicht die Kratzer in ihrem Gesicht, die sie traurig machten, auch nicht das Leben an sich, es liege einfach daran, dass sie ausgepowert sei, und da waren dicke Bohnen mit Speck genau das Richtige.
Schlafenszeit
Am fünften Tag im Glenn Avenue bekam Ava sechzig Dollar Nothilfe ausgezahlt – durchgeboxt, so sagte Miss Simmons, von ihr persönlich. Es mussten etliche Formulare unterschrieben werden, aber nachdem Ava das erledigt hatte, ging sie los und kaufte ein paar Dinge, die sie brauchten. Zunächst mal zwei Dosen Insektenvernichter, die Ava beide auf einmal leer sprühte, worauf es in Zimmer 813 entsetzlich stank und ihnen tagelang die Augen tränten. Jeden Morgen fanden sie Kakerlaken, die hilflos auf der Fensterbank zappelten oder halbtot von der Decke fielen. Tapfer tat Toussaint so, als sähe er sie nicht. Aber wenigstens konnten sie jetzt auf den Betten sitzen. Ava brachte die Laken in den Waschsalon und ließ sie zweimal bei höchster Temperatur durchlaufen.
Ihre Koffer und der Müllsack standen immer noch fest verschlossen in der Zimmerecke. Es gab nur den einen Schrank, die rostige Kleiderstange war durchgebogen, das Bord darüber klebrig, und von dem Geruch nach Schweißschuhen wurde Ava schlecht. Sie drückte die Tür zu, und sie blieb zu. Beinah war sie froh, dass ihre anderen Sachen, die sie in New Jersey zurückgelassen hatten, nicht diesem Schmutz ausgesetzt waren. Aber vielleicht waren sie da gar nicht in Sicherheit, in New Jersey. Was würde Abemi mit ihren Erinnerungsstücken und Wintersachen und der Bettwäsche machen? Würde er wutentbrannt alles aus den Schränken zerren und auf die Straße werfen, würde er aus all ihren kostbaren Andenken ein Feuer machen, wie dem Foto von Toussaint an seinem ersten Vorschultag, mit der kleinen Pappkrone auf dem Kopf, und ihrem Lehrerdiplom?
Nach fünf Tagen im Glenn Avenue stellte sich eine Routine ein. Auch hier mussten sie essen und schlafen und auf die Toilette gehen. Die Waschräume waren ekelhaft: Schimmelgeruch, auf dem Fußboden Haarbüschel und feuchtes Toilettenpapier, Fäkalien in nicht gespülten Toilettenbecken. Sie und Toussaint gingen nur, wenn sie es nicht länger aushielten. Ava weigerte sich, im Waschraum zu duschen – sie wuschen sich an dem kleinen Becken in ihrem Zimmer.
Ava stellte ein paar Regeln auf: Das Licht blieb die ganze Zeit an. Ava schlief drei oder vier Stunden pro Nacht auf dem Stuhl. Sie tötete Kakerlaken und Silberfische. Den Insektendreck wischte sie mit Papierservietten aus der Cafeteria von den grünen Wänden. Wenn Toussaint ins Bett ging, wickelte er sich vollständig in die Laken, sodass man nicht einen Zentimeter Haut sehen konnte. Wie eine Mumie, die mit Latex bezogene Matratze seine Bahre. Im Schlaf schwitzte er, und wenn er aufwachte, waren die Tücher nass, und sein Schädel brummte.
Eine andere Regel: Nachts gingen sie nicht aus dem Zimmer. Der Wächter, dieser Melvin, war ein Witz. Wer wollte, konnte in das Gebäude gelangen. Und wer es wollte, tat es auch. Ava hatte in der Nacht aus dem Flur männliche Stimmen gehört.
»Hier ist eine leere Flasche«, sagte sie zu Toussaint. »Für nachts.«
»Wieso?«
»Wenn du mal musst.«
»Das ist eklig.«
»Ich weiß«, sagte sie. »Ich weiß das.«
Er war zu alt, um in zwei Metern Abstand neben seiner Mutter zu schlafen. Es war ihnen beiden peinlich. Ihre Körper machten ihnen zu schaffen, mit ihren hängenden, Flüssigkeiten absondernden, anschwellenden Teilen.
»Erzähl mir was, Ma«, sagte er. »Ich kann nicht einschlafen.«
Ava erzählte ihm Gutenachtgeschichten aus ihrer eigenen Kindheit in Bonaparte, wie sie es schon sein Leben lang getan hatte. Er gab vor, das tröstlich zu finden. Vielleicht war es das. Und auch Ava fühlte sich danach besser. Die Geschichten erinnerten sie daran, dass Zimmer 813 nicht die einzige existierende Wirklichkeit war. Sie saßen einander auf den Plastikstühlen gegenüber, an dem Tisch in ihrem Zimmer.
»Hauptsächlich die Muscogee«, sagte Ava.
»Mit Federn?«, fragte Toussaint.
»Keine Federn, Toussaint. Nur Hüte.«
»Ach so. Was noch?«
»Stiefel.«
»Ma! Du weißt, was ich meine.«
Was noch? Das Knarren der breiten Bohlen auf der Veranda, wenn man sich in die Hollywoodschaukel setzte. Außerdem: Poarch-Creek-Farmer und Choctaw-Händler, die nach Bonaparte kamen, um Schuhe und alle möglichen anderen Waren gegen den Tabak aus Bonaparte (ob dort geerntet oder gestohlen), gepökeltes Schweinefleisch oder Mais-Whiskey einzutauschen. Sie kehrten bei Miss Tillie ein, wickelten dort Geschäfte ab, von denen kleine Mädchen nichts wissen sollten, und legten sich dann zum Schlafen ans Flussufer, und am nächsten Morgen waren sie verschwunden. Als wäre es 1820 und die ganze Welt würde noch 1947 solche Tauschgeschäfte mit den Indianern machen. Avas Pop sagte, Bonaparte sei ein Ort für freie Menschen; sie und die Indianer hätten sich seit dreihundert Jahren gegenseitig geholfen, frei zu bleiben. Außerdem: wie Pop das Gewehr auf Avas Schulter gehalten hatte, wenn sie auf Jagd waren. Halten, halten, dann der explodierende Schuss und der Flügelschlag, wenn der aufgeschreckte Fischadler aus dem Baum aufflog und das getroffene Wildschwein in das sommerlich raschelnde Unterholz stürzte. Der Geruch von soeben erlegtem, gebratenem Fasan. Ein Festessen, das Toussaint nicht kannte. Die Jahre der Überschwemmungen, wenn Wild die einzige Nahrung war, weil die Felder unter Wasser standen und alles verfaulte oder gar nicht erst wuchs. Dutchess im Wohnzimmer, wo sie Klavier spielte und fluchte.
Toussaints nächste Frage betraf sie, die Großmutter, die er nie kennengelernt hatte und die an einem so merkwürdigen und entlegenen Ort lebte, dass es eigentlich wie im Märchen war, wenigstens in Toussaints Vorstellung. Dutchess wusste nicht, dass sie einen Enkel hatte.
»Bonaparte war die zweite amtlich eingetragene schwarze Gemeinde in Alabama«, sagte Ava. »1868!«
»Das sagst du jedes Mal, Ma.«
»Es ist wichtig!«
»Das weiß ich doch. Was noch?«, fragte er. »Was ist mit meiner Großmutter?«
Ava konnte nie über Bonaparte so erzählen, wie es wirklich war. Es war so, sagte sie, aber eigentlich war es anders – ihre Erinnerung trog sie und verwandelte alles in hübsche Geschichten. Was sie sagen sollte, war: Als ich ein kleines Mädchen war, sah ich meinen Vater mit gesenktem Kopf und rudernden Armen über die Erdnussfelder von Bonaparte rennen. Der Kugelhagel kam von hinten. Pop fiel vornüber in die grünen Triebe. Die Grillen hörten auf zu zirpen. Das waren keine Trugbilder. Könnte Ava es so erzählen, wie es richtig war, sähe sie die ganze lange Linie ihres Lebens vor sich, gestochen scharf wie Zeitungsschrift. Vielleicht wartete Zimmer 813 schon seit ihrer Geburt auf sie, oder davor, bevor sie auf die Welt gekommen war. Möglich war’s, dass das Jetzt schlummernd im Damals lag, wie die Generationen einer Familie im Leib einer Frau. Wie entsetzlich! Aber auch welche Süße, als hätte eine Hand es liebevoll für einen zurechtgelegt, so wie man die Kleidung für ein Kind zurechtlegte.
»Was?«, fragte Toussaint.
»Nichts. Entschuldige. Wir sollten schlafen gehen.«
In den Wolfsrachen
Nachdem Toussaint eingeschlafen war, rief Ava Abemi an. »Wo seid ihr?«, fragte er. »Warum rufst du an, wenn du mir nicht sagen willst, wo ihr seid?« Er gab sich Mühe, so zu klingen, als wäre es ihm komplett gleichgültig. »Du triffst ihn doch immer noch. Ihr seid doch bestimmt wieder zu ihm zurück, nachdem ihr hier weggegangen seid.« Gleich würde er anfangen zu brüllen. Avas Kehle schnürte sich zu, als würde sie ihr von innen zusammengedrückt. Sie sah sein Gesicht vor sich: den verzerrten Mund, die feuchten, wütenden Babyaugen. Sie legte auf, bevor er weitersprechen konnte.
Sie kehrte ins Zimmer zurück und ging auf und ab, während Toussaint schlief. Bevor sie einen Plan fassen konnte, wie sie hier wieder rauskamen, musste sie etwas erledigen. Aber sie konnte ihre Gedanken nicht klar fassen, sie entschlüpften ihr wie Silberfische.
Auf dem Tisch lagen ein paar Malbücher. Man hatte ihnen Malbücher gegeben, für einen Jungen in Toussaints Alter! Ava nahm einen stumpfen Stift in die Hand. Vielleicht ist es gut, wenn ich die Dinge aufschreibe. Wenn ich eine Liste mache von allem, was passiert ist, vielleicht wird es dann klarer. Sie würde alle Einzelheiten erwähnen: Abemi und New Jersey. Cass. Dann hätte sie die ganze Geschichte, und wenn das gemacht war, würde sie erkennen, wo die Dinge fehlgegangen waren und was als Nächstes zu tun war.
Sie schrieb:
Wir sind seit fünf Tagen im Glenn Avenue Family Shelter.
Nein, so ging das nicht. Das ging nicht weit genug zurück. Sie sollte an dem Punkt anfangen, als sie geheiratet hatte. Oder vielleicht damit, was davor gewesen war. Als es nur sie und Toussaint gegen den Rest der Welt gab. Bloß dass die Welt Geld kostete, und Geld hatte Ava nicht.
Kurz bevor ich Abemi heiratete, fragte Toussaint, warum wir nicht so weitermachen konnten wie bisher, nur wir zwei, mit unseren Wochenendbesuchen im Kindermuseum und im Zoo. Aber der Zoo kostete ein Vermögen, wenn man den Eintritt und das Popcorn und die Hotdogs und McDonald’s danach mitrechnete, damit das gute Gefühl noch etwas anhielt. Und dann warMontag, und ich hatte nur noch zwölf Dollar auf der Bank. Die Miete für die Zweizimmerwohnung in der Upsal Street konnten wir uns nicht mehr leisten, deshalb zogen wir aus und wohnten in dem Apartment in der Camac Street. Danach das Apartment in der Gratz Street. Keine Bäume, dafür massenhaft Kakerlaken und Kinder von der Sorte, die sich mit meinem Sohn anlegen wollten, aber er wusste nicht, wie man sich wehrte oder stark auftrat. Wir kehrten nach Germantown zurück. Wir mieteten ein Zimmer bei Mrs Crawford in der Pulaski Street, bei ihr und ihrem gut aussehenden Mann, den ich nach Kräften ignorierte. Nur dass er mich nicht ignorierte, und so flogen wir nach ein paar Monaten wieder raus. Dann das Zimmer bei Mrs Tagliaferros …
Nein, so ging es auch nicht. Das war einfach eine Aufzählung von dem Wann und Wo. Vielleicht fing es bei Toussaint an und dem Tag, als sie vom Arzt nach Hause kam mit der Nachricht, dass sie schwanger war. Ich und Cass waren da schon nicht mehr zusammen, aber – sie konnte den Satz nicht beenden. Zu viel von Cass zu erzählen war, als würde sie durch ein Loch im Boden fallen.
Ich lernte ihn 1971 bei einem Treffen der Black Pantherkennen. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, dass ich da hinging. Eigentlich machte ich mir nicht viel aus diesen Dingen. Ich fand nicht, dass schwarz zu sein schon so etwas wie eine politische Aussage war, wie sie das hier im Norden sehen. Schwarz ist einfach, wie ein Schmetterling ist, oder ein Fluss. In Bonaparte waren wir auch einfach. Trotzdem, damals war es normal, zu solchen Veranstaltungen zu gehen. Es gab nur Stehplätze. Man drängte sich in einem Kellerraum oder einem Wohnzimmer oder einem Gemeindezentrum zusammen. Kleine Silberfunken stoben von den Menschen auf und schwirrten im Raum umher. Ich hatte beinah das Gefühl, als wäre ich zu Hause – alle gingen gerade und aufrecht, wie die Menschen in Bonaparte und nicht wie die anderen Schwarzen, denen ich bisher im Norden begegnet war. Die Schwarzen hier reden solchen Unsinn – dass sie besser dran sind als wir zu Hause, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie hier wirklich so frei sind, wie sie glauben. Bei einer dieser Versammlungen kam Cass herein und blieb hinten stehen. Ich schwöre, dass es einen Moment lang ganz still war. Nichts rührte sich. Alles verstummte. Er ist von Kopf bis Fuß goldenbraun: Augen, Haut, Haare. Fast tat es mir in den Augen weh, ihn anzusehen.
Nach dem Treffen gingen wir in einen Diner. Warum warst du bei der Versammlung?, fragte er. Wonach suchst du? Er wandte die Augen keine Sekunde von meinem Gesicht. An dem Abend redeten wir nur, auch am nächsten Abend und an allen Abenden der folgenden Wochen. Ich war berauscht von ihm. Wie im Fieber. Was für ein Gefühl das ist! Ich tat kein Auge zu, brauchte keinen Schlaf. Das erste Mal küssten wir uns im Flur vor seiner Wohnung. Die Berührung seiner Lippen auf meinen löste ein Summen in meinem Kopf aus. Wir schafften es gerade noch in die Wohnung, schon halb ausgezogen, kamen aber nicht weiter als bis zum Wohnzimmer. Ich konnte nicht genug bekommen, nicht von Cass, nicht von der Luft. Ich verließ meinen Körper und verschmolz mit seinem. So etwas hatte ich nie zuvor und habe es auch seither nicht empfunden. Und werde es wahrscheinlich auch nie wieder empfinden.
Wir blieben zwei Jahre zusammen. Cass mit seinem ewigen Glas Chivas, rauchend, trinkend, lange Vorträge haltend über Fanon und Lumumba und Gramsci bei allen abendlichen Panther-, CORE- und sonstigen Versammlungen. Immer stand er in einer Ecke, während die Menge allmählich in seine Umlaufbahn geriet, wie Planeten um eine Sonne. Seine Krawatte war jederzeit ordentlich, was immer die Uhrzeit war. Und die Frauen. Mein Gott, die Frauen. Dazu besaß er noch die Kühnheit, Arzt zu sein. Sie hängten sich an ihn, legten sich ihm, Höschen um die Knöchel, praktisch zu Füßen. Aber am Ende des Abends waren es immer wir, ich und er, die zusammen gingen. Wir flogen in seinem kleinen Saab zu mir. Nach drei, vier Stunden Schlaf ging er ins Krankenhaus zu seiner Schicht. Manchmal kam er am selben Abend zurück, manchmal nach ein paar Tagen, manchmal nach einer Woche. Ohne Ankündigung standsein Saab plötzlich unten an der Straße. Ich hielt immer Ausschau nach ihm und war – zumindest in meiner Erinnerung – fast ein wenig überrascht, dass er zurückkam. Und ein wenig ängstlich. Noch jetzt sehe ich mich in der Wohnungstür stehen, während er die Treppe hochkam. Ich spürte seine Schritte als kleine Erschütterungen unter meiner Haut.
Ava legte den Stift hin und rückte vom Tisch ab. »Oh«, sagte sie laut. An ihn zu denken war, als würde sie die Hand in einen Wolfsrachen stecken. Blut Blut Blut.
Sie musste noch einmal anfangen, bei den frühesten Anfängen, an die sie sich erinnern konnte. Die blanken Tatsachen. Sie schrieb:
Ich kam 1940 in einem Boardinghouse in Natchez, Mississippi, zur Welt. Meine Mutter heißt Dutchess Carson. Mein Vater war Wardell Lyons. Dutchess war ihm auf einer Tour begegnet. Ich habe ihn nie kennengelernt. Er starb im Krieg in Europa. Mein Pop war Caro Carson. Pop und Dutchess heirateten 1945, und wir zogen nach Bonaparte, Alabama. Dutchess gab das Singen auf. Wir wohnten in dem Haus, dass Pops Vater auf einer Lichtung am Ende der Sundown Road gebaut hatte. Dutchess wohnt da immer noch. Mein Pop ist tot.
Schlicht und klar. Abemi sagte immer, bei Ava gehe alles drunter und drüber. Bei deiner Familie geht alles drunter und drüber, und du bist genau wie sie. Was ist das für einer, der so etwas sagt? Am Anfang hatte er nicht so mit ihr gesprochen. Eine Zeitlang war alles in Ordnung gewesen zwischen ihnen. Es war gut gewesen, der Anfang war gut.
Die ganze Geschichte
Gleich nach der Hochzeit zogen Ava und Toussaint nach New Jersey. Bis dahin war Abemi nie Ehemann gewesen, und Ava nie Ehefrau. Gemeinsam würden sie herausfinden, wie man das war. Das hatte er gesagt, als er sie bat, seine Frau zu werden: Sie seien beide erwachsen und sollten einen Hausstand gründen. Nicht unbedingt ein romantischer Antrag, eher wie ein Angebot, aber es war ehrlich gemeint. Ava freute sich darauf, in das kleine Haus einzuziehen, das er gekauft hatte, und dort, in dem Haus mit Vorgarten in einer ruhigen Straße, Ehefrau zu sein. Ein Leben als Ehefrau war solide, nichts Unstetes wie zweiundvierzig zu sein und einen kleinen Jungen allein aufziehen zu müssen.
Es war keinesfalls das hübscheste Haus, das man je gesehen hatte. Einstöckig, im Ranch-Stil, etwas windschief, und jeder Quadratzentimeter der Ranch mit einem Geruch, als wären die Kühe noch da. Haha. Eigentlich war es eher der Geruch von Mottenkugeln und Schimmel, und der Teppich machte schmatzende Geräusche. Die Fensterläden waren schlammbraun, und von der schäbigen Holzverkleidung platzte die weiße Farbe ab. Abemi sagte: »Es braucht nur ein bisschen Zuwendung.« Am nächsten Tag ging er zum Heimwerkermarkt und kam mit zwei Dosen roter Farbe zurück. Nachdem er die Fensterläden gestrichen hatte, sahen sie klebrig aus, und das Rot war grell vor dem Weiß des Hauses. Vielleicht war das ein Zeichen. Also, vielleicht ist es bedenklich, wenn dein frisch angetrauter Ehemann die Fensterläden in einer Farbe streicht, die an geplatzte Äderchen im Augapfel erinnert. Nachher ist man immer klüger. Außerdem hatten Toussaint und Ava nur wenige Sachen mitgebracht. Ava kam mit ihrem Schaukelstuhl aus Rattan, einem Fotoalbum, ihren persönlichen Dokumenten und einer Steppdecke aus Bonaparte. Dazu ihre Kleidung, ein paar Andenken, Toussaints Comics. Alles andere im Haus gehörte Abemi. Der Rest ihrer Habe war an Hilfsorganisationen gegangen, zumindest nahm Ava das an, denn sie hatten alles in der Wohnung zurückgelassen. Damals hatten sie in der Broad Street gewohnt. Sicher, im Grunde war die Wohnung ein Loch gewesen, und die Hälfte ihrer Sachen war noch in Kartons und Tüten verstaut. Ava hatte nie viel ausgepackt. Sie waren so oft umgezogen, und sie interessierte sich nicht für Möbel – sie und Toussaint hatten ihre Betten und einen kleinen Esstisch und ein paar Stühle. So konnte man leben, das ging, auch wenn es nicht für jeden in Frage kam. Für Abemi nicht, das stand fest. »Lass es einfach, Ava«, sagte er, als sie für den Umzug packten. Er wedelte mit der Hand, als wären ihre Sachen etwas, über das man auf dem Gehweg hinwegsteigen musste.
Das Haus in New Jersey war ein stiller Ort, nachdem sie sich erst eingerichtet hatten. Es stand an einer Landstraße, gegenüber einem Jugendzentrum mit einem Teich am Ende der Anlage. Trauerweiden. Mr Leroy, ihr Nachbar, war dort der Hausmeister. Ganz hinten auf dem Grundstück hatte er zwischen zwei Bäumen eine Hängematte gespannt. Bei gutem Wetter ging Ava dorthin, um Toussaint zu holen. Sie fand ihn am Ufer des Teichs, wo er im Matsch spielte, während Mr Leroy in der Hängematte lag. Mr Leroy hatte immer eine Tüte Karamellbonbons dabei und fütterte Toussaint damit, und Toussaint spuckte sich die Bonbons in die Hand. Ein klebriges Kind. Es war etwas dran, was man von kleinen Jungen sagt. Toussaint roch immer nach Draußen. Selbst im Winter, wenn er drinnen spielen musste. Das erfüllte Ava mit Stolz. Stolz darauf, dass er mit ihr auf der Welt war, lebendig und klebrig und warm. Allein, dass er dieselbe Luft atmete, machte sie stolz.
Nach neun oder zehn Ehemonaten setzte Abemi es sich in den Kopf, dass er ein Kind wollte. Ava war inzwischen dreiundvierzig und hatte mit dem Thema abgeschlossen, aber Abemi wies alle Vernunftgründe zurück und ließ nicht locker. Vielleicht lag es an den jüngeren Diakonen ihrer Gemeinde, die sonntags wie Gockel mit ihren Hennen und Küken im Gefolge in die Kirche stolziert kamen. Vielleicht lag es daran, dass Toussaint nicht so schnell mit ihm warm wurde, wie er gehofft hatte. Abemi betete um ein Kind. Unaufhörlich. Als kein Zweifel mehr bestand, dass keins kommen würde, versank er in Trübsal, als wäre ihm etwas gestohlen worden. Dann wurde er wütend und blieb es. Er wurde gemein.
Ava konnte an einem beliebigen Mittwoch oder Samstag beim Abwasch sein, und er überfiel sie ohne Vorwarnung. Er stellte sich in die Küchentür, mit einem Bier in der Hand. Und das, obwohl alkoholische Getränke in ihrer Konfession nicht erlaubt waren.
»Zu wem gehörst du überhaupt?«, fragte er, dann schüttelte er den Kopf. »Zu niemandem. Du und Toussaint, ihr kommt einfach hereingeweht wie Wolken.«
Das entsprach wohl den Tatsachen. Dass Ava und Toussaint hier und dort und nirgendwo gewesen waren.
»Du weißt nicht, wie man bei einer Sache bleibt«, sagte er.
Ava versuchte ihn zu beruhigen. »Wir sind verheiratet«, sagte sie. »Ich bleibe bei dir.«
Manchmal meinte sie es auch so. Die meiste Zeit wünschte sie sich, dass sie es meinte.
»Du musst darum beten, dass Gott dich lieben lehrt«, sagte Abemi. »Du musst Gott um Hilfe bitten, dein Wesen zu überwinden.«
Es war ein Glitzern in seinen Augen, und seine Stimme klang gepresst und höher als sonst. Von Avas Wesen hatte er nie etwas verstanden. Aber wie er sie aus der Reserve locken konnte, das wusste er. Wenn sie für sich war, fragte sie sich, ob in ihr nicht doch eine Ichbezogenheit, eine Unbeständigkeit verborgen lag. Sie war eine Unsesshafte geworden, so wie Dutchess früher. Vielleicht lag ihnen das im Blut, und sie würde es an Toussaint weitergeben, der später als rastloser Mensch durch die Straßen ziehen würde, von einem Busbahnhof zum nächsten.
Ava wusste nie, was Abemi in Zorn versetzen würde: dass der Thermostat zu hoch eingestellt war oder dass sie die Aluminiumfolie falsch abgerissen hatte und die Ränder schief waren. Einmal stürmte er aus dem Schlafzimmer und schmiss die gefaltete Wäsche auf den Boden, weil er von dem Weichspüler, den Ava seit Monaten benutzte, diesmal einen Ausschlag bekommen hatte. »Nicht einmal die Wäsche kannst du waschen!« Er drückte ihr eins seiner Hemden so fest ins Gesicht, dass ein Knopf ihr das Kinn zerkratzte. Dann tat es ihm leid. Er wimmerte und winselte, so leid tat es ihm. Es war ein solches Klischee, schon damals war es ihr peinlich gewesen. Aber er hatte sie nie geschlagen.
Jedes Mal nach einem solchen Ausbruch wollte er beten.
»Lieber Gott«, begann er, als wäre er der Fernsehprediger Jimmy Swaggart. Als wäre er Moses. »Wir treten vor Dich, um Weisung und Heilung von Dir zu erbitten.« Und bei aller Zerknirschtheit brachte er dennoch eine Spitze unter: »Ich bitte um Deine Gnade für meine Frau, die Deine Hilfe braucht, damit sie empfängt und unsere Familie wachsen kann.«
In Wahrheit hätte Abemi haben können, was er angeblich wollte, wenn er es wirklich gewollt hätte. Er hätte sich eine jüngere Frau nehmen können, die ihm Babys produziert hätte. Aber in Wirklichkeit wollte er eine, die er dominieren konnte, die er jederzeit herunterputzen konnte. Im Grunde war er ein trauriger Fall. Einsam und klein. Ein armer Wicht. In seinen jämmerlichsten Momenten versuchte Ava sich an dem Gedanken festzuhalten, dass es nicht fair war, ihn mit Cass zu vergleichen.
Sie machte also weiter mit ihrem Leben als Ehefrau. Und dabei wäre es auch geblieben. Was hätte etwas daran geändert? Sie hätte nichts dazu getan, das musste sie zu ihrer Schande gestehen. Allerdings würde sie mit ihm auch keine Kinder bekommen. Dann kam Cass zurück. Fast zehn Jahre waren vergangen, als er eines Tages aus heiterem Himmel in ihren Garten in New Jersey spazierte.
Abemi erfuhr eine Woche später davon. Er beschuldigte Ava, dass sie all die Jahre mit ihm in Verbindung geblieben sei. Er beschimpfte sie als Lügnerin. Sie habe ein Verhältnis mit Cass. Sie habe ihn, Abemi, lächerlich gemacht. In seinem eigenen Haus. Er stand da und ruderte mit den Armen. Stürmte auf sie zu und bremste sich im letzten Moment. Er hämmerte mit den Fäusten auf den Tisch. Riss Töpfe und Gläser aus den Schränken und warf sie auf den Boden, an die Wand, auf Ava.
Sie verbarrikadierte sich mit Toussaint in dessen Zimmer. Sie saßen im Sessel am Fenster, der Junge auf ihrem Schoß, und zitterten beide. Plötzlich war es still. Ava schlug Toussaint die Hand auf den Mund, ganz fest, damit kein Laut herauskäme. Er riss die Augen auf und röchelte tief in der Kehle. Noch heute konnte sie seinen wilden, feuchten Atem an ihrer Handfläche spüren. Es war unverzeihlich. Sie würde sich das nie verzeihen. Sie wusste nicht, ob ihr Junge ihr verziehen hatte.
Die Stille breitete sich aus. Sie setzten sich auf das schmale Bett und hielten sich fest umarmt, bis Toussaint in einen unruhigen Schlaf fiel. Ava blieb wach und lauschte. Keine Schritte. Abemi musste da draußen sitzen, mitten in dem Trümmerfeld der Küche. Im Morgengrauen kratzte ein Stuhl über das Linoleum, Glas knirschte unter seinen schweren Schuhen. Seine Schritte kamen zu ihrer Tür. Ava sprang vom Bett auf und packte Toussaints Bastelschere. Sie hielt sie in der Faust, alles Zittern war gewichen. Aber er ging an der Tür vorbei, und Ava hörte, wie das Wasser in der Dusche aufgedreht wurde. Zwanzig Minuten später verließ er das Haus, um zur Arbeit zu gehen, als wäre es ein Tag wie jeder andere.
Als er weg war, packte Ava ihre wichtigsten Sachen in zwei Koffer und stopfte den Rest in einen Müllsack. Sie ging nach nebenan zu Mr Leroy, wo sie lange brauchte, um seiner Frau, Miss Lucille, alles zu erklären. Sie war völlig außer Atem und so überwältigt von Müdigkeit, dass sie sich eine Weile hinsetzen musste, bevor sie weitersprechen konnte. »Wir haben nur zehn Dollar«, sagte sie. Miss Lucille machte Toussaint ein Sandwich mit Schinken und Spiegelei. Sie holte eine Fünfzigdollarnote aus einer Dose auf dem obersten Bord und drückte sie Ava in die Hand.