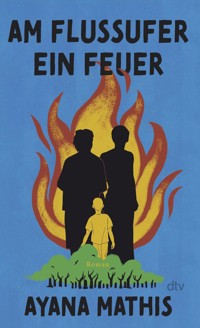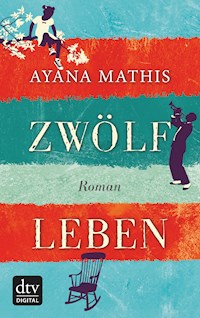
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
New York Times-Bestseller Als Hattie ihre erstgeborenen Zwillinge Philadelphia und Jubilee taufte, war das Ausdruck einer großen Hoffnung. Hatte der Norden, die »Wiege der Freiheit«, den Schwarzen, die aus dem Süden kamen, nicht Gleichheit und Wohlstand versprochen? Und schmeckte das Leben in dem kleinen Haus an der Wayne Street nicht nach Zukunft? Hattie wird noch viele weitere Kinder bekommen, aber kaum etwas von ihren Hoffnungen wird sich erfüllen. Schmerz über Versagen und Schicksalsschläge überschattet Hatties Dasein. Es ist ein Schmerz, der sich fortschreiben wird in die nächste Generation. Doch diese Saga um eine außergewöhnliche Frau und ihre zwölf Kinder, die als Geschichte der Great Migration beginnt und sich zum Tableau mit zwölf Einzelporträts über das ganze zwanzigste Jahrhundert weitet, ist trotz Scheitern und Enttäuschung ein vitales Epos – voller Lebenskraft und verhaltener Zärtlichkeit, voller Mut und Entschlossenheit im Kampf gegen Bitterkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Ayana Mathis
Zwölf Leben
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Susanne Höbel
Deutscher Taschenbuch Verlag
Für meine Mutter
Und für Grandmom
Und Grandpop
Da kamet ihr zu mir alle und spracht: Lasst uns Männer vor uns hinsenden, die uns das Land erkunden und uns wieder sagen, durch welchen Weg wir hineinziehen sollen, und die Städte, da wir hineinkommen sollen.
Das gefiel mir wohl, und ich nahm aus euch zwölf Männer, von jeglichem Stamm einen.
5. Moses 1, 22–23
Das Haus, verschlossen wie eine Taschenuhr, das Atmen der verschlossenen Herzen drinnen – nie hätte sie die erfinden können.
Rita Dove, ›Obedience‹ (Gehorsam)
Philadelphia und Jubilee
1925
»Philadelphia und Jubilee!«, rief August, als Hattie ihm sagte, welche Namen sie den Zwillingen geben wollte. »Du kannst den Babys doch nicht so verrückte Namen geben!«
Wäre Hatties Mutter noch am Leben gewesen, hätte sie August beigepflichtet. Sie wäre der Meinung gewesen, dass Hattie ordinäre Namen gewählt hatte, »protzig und gewöhnlich« hätte sie dazu gesagt. Aber sie war tot, und Hattie wollte ihren Kindern keine Namen geben, die schon auf den Grabsteinen der Familiengräber in Georgia eingemeißelt waren, deshalb gab sie ihnen Namen der Verheißung und der Hoffnung, Namen, die nach vorne wiesen, nicht solche, die zurückblickten.
Die Zwillinge wurden im Juni geboren, im ersten Sommer, den Hattie und August als verheiratetes Paar erlebten. Sie hatten ein Haus in der Wayne Street gemietet – es war klein, lag aber in einem guten Viertel und war, wie August es ausdrückte, das Haus-für-Jetzt. »Bis wir unser eigenes Haus kaufen«, sagte Hattie. »Bis wir einen Vertrag unterschreiben«, stimmte August ihr zu.
Ende Juni besetzten Wanderdrosseln die Bäume und Dächer in der Wayne Street. Die ganze Gegend hallte wider von Vogelgesang. Das Gezwitscher lullte die Zwillinge in den Schlaf und versetzte Hattie in eine solche Hochstimmung, dass sie die ganze Zeit leise vor sich hin lächelte. Jeden Morgen regnete es, aber die Nachmittage waren hell, und das Gras in dem winzigen Gartenstückchen von Hatties und Augusts Haus war grün wie die Welt am ersten Tag. Die Frauen in der Nachbarschaft buken frühmorgens, und gegen Mittag roch es in der Straße nach den Erdbeerkuchen, die sie zum Abkühlen auf die Fensterbänke gestellt hatten. Alle drei, Hattie und die Zwillinge, dösten im kühlen Schatten der Veranda. Im nächsten Sommer könnten Philadelphia und Jubilee schon laufen, dann würden sie niedlich auf der Veranda herumtorkeln.
Hattie Shepherd betrachtete ihre Kinder in den geflochtenen Körben. Die Zwillinge waren sieben Monate alt. Im Sitzen fiel ihnen das Atmen leichter, deshalb hatte Hattie ihnen kleine Kissen in den Rücken gestopft. Gerade erst waren sie ein wenig ruhiger geworden. Die Nacht war schlimm gewesen. Lungenentzündung konnte geheilt werden, aber es war nicht leicht. Trotzdem, besser als Ziegenpeter oder Grippe oder Rippenfellentzündung. Auch besser als Cholera oder Scharlach. Hattie saß auf dem Fußboden im Badezimmer, sie hatte den Kopf an die Toilettenschüssel gelehnt und die Beine vor sich ausgestreckt. Das Fenster war beschlagen von dem Dampf, der zu Tropfen kondensierte, an der Scheibe und an der Holzverkleidung herunterlief und in der Vertiefung der Kacheln hinter der Kloschüssel eine Pfütze bildete. Stundenlang hatte Hattie das warme Wasser laufen lassen. Die halbe Nacht war August im Keller gewesen und hatte Kohlen in den Heißwasserofen geschaufelt. Eigentlich wollte er Hattie mit den Kindern nicht allein lassen und nicht zur Arbeit gehen. Aber dann … ein Tag Arbeit war ein Tag Lohn, und der Kohlebunker leerte sich zusehends. Hattie beruhigte August: Er müsse sich um die Kinder keine Sorgen machen, jetzt, nachdem die Nacht vorbei sei.
Am Tag zuvor war der Arzt gekommen und hatte die Dampfkur empfohlen. Er hatte Ipecac-Sirup in geringen Dosen verschrieben und vor rückständigen ländlichen Mitteln wie Senfumschlägen gewarnt; Dampfbäder hingegen seien in Ordnung. Er verdünnte das Ipecac mit einer klaren, öligen Flüssigkeit, gab Hattie zwei kleine Pipetten und zeigte ihr, wie sie die Zunge der Kleinen mit dem Finger herunterdrücken musste, damit ihnen die Medizin in die Kehle rinnen konnte. August bezahlte drei Dollar für den Arztbesuch und fing an, kaum dass der Arzt gegangen war, Senfumschläge zuzubereiten. Lungenentzündung.
Irgendwo in der Nähe ertönte eine Sirene, so laut, dass es auch unmittelbar vorm Haus sein konnte. Hattie erhob sich mühsam vom Fußboden und wischte auf der beschlagenen Fensterscheibe einen Kreis frei. Nichts, nur die weißen Reihenhäuser auf der anderen Straßenseite, eng zusammen wie Zähne, und graue Eisflecken auf dem Gehweg, und die jungen Bäume halb tot auf dem gefrorenen Gartenstück, das ihnen zustand. Hier und dort schien im ersten Stock ein Licht – einige der Männer in der Nachbarschaft arbeiteten am Hafen, so wie August, andere fuhren Milch aus oder trugen Post aus; dann gab es noch etliche Lehrer und andere, über die Hattie nichts wusste. Überall in Philadelphia standen die Menschen bei klirrender Kälte auf, um im Keller ihren Ofen anzuheizen. In dieser Mühsal waren sie vereint.
Körniger Nebel stieg vom unteren Himmelsrand auf. Hattie schloss die Augen und dachte an die Sonnenaufgänge ihrer Kindheit – die Bilder verfolgten sie die ganze Zeit, mit jedem Tag, den sie in Philadelphia lebte, wurden ihre Erinnerungen an Georgia eindringlicher, drängender. In ihrer Kindheit wurde jeden Morgen das Horn geblasen, im blauen Morgendunst ertönte es über den Feldern und Häusern und den schwarzen Gummibäumen. Von ihrem Bett aus hatte Hattie gesehen, wie die Feldarbeiter auf der Straße an ihrem Haus vorbeizogen. Die Nachzügler kamen immer erst, wenn das Horn verklungen war: Schwangere, Kranke, Lahme, die Alten, die zu alt zum Pflücken waren, Frauen mit Babys auf dem Rücken. Das Horn trieb sie vorwärts wie ein Peitschenhieb. Die Straße feierlich, feierlich auch die Gesichter, die berstenden weißen Felder in Erwartung, die Pflücker, die sich über das Feld hermachten wie Heuschrecken.
Die Kinder sahen Hattie mit matten Augen an; sie kitzelte sie am Kinn. Bald müsste sie die Senfumschläge wechseln. Von dem heißen Wasser in der Badewanne stieg Dampf auf. Sie warf noch eine Handvoll Eukalyptusblätter hinein. In Georgia wuchs ein Eukalyptusbaum in dem Wald gegenüber dem Haus, in dem Hattie gelebt hatte, aber in Philadelphia war es schwer gewesen, im Winter Eukalyptus zu bekommen.
Drei Tage zuvor war der Husten der Babys schlimmer geworden. Hattie war in ihren Mantel geschlüpft und zum Penn- Fruit-Laden gegangen, um den Kaufmann zu fragen, wo sie Eukalyptus bekommen könne. Sie wurde zu einer Adresse mehrere Blocks entfernt geschickt. Hattie kannte sich in Germantown noch nicht gut aus und verirrte sich in dem Straßengewirr. Als sie, ganz durchgefroren, den Laden endlich fand, bezahlte sie fünfzehn Cent für eine Tüte Eukalyptusblätter, die sie in Georgia umsonst hätte haben können. »Na, du bist ja noch ein ganz junges Ding!«, hatte die Eukalyptus-Frau gesagt. »Wie alt bist du denn, mein Mädchen?« Hattie missfiel die Frage, sie sagte aber, sie sei siebzehn Jahre alt, und damit die Frau sie nicht irrtümlich für einen der unglückseligen Neuankömmlinge aus dem Süden halten würde, fügte sie hinzu, dass sie verheiratet sei und ihr Mann eine Lehre als Elektriker mache und dass sie gerade in ein Haus in der Wayne Street gezogen seien. »Na, wie schön, mein Herz. Und wo lebt deine Familie?« Hattie blinzelte ein paar Mal und schluckte schwer. »In Georgia, Madam.«
»Hast du niemanden hier bei dir?«
»Meine Schwester, Madam.« Sie erzählte der Frau nicht, dass ihre Mutter ein Jahr zuvor, als Hattie schwanger war, gestorben war. Getrieben von dem Schock des Verlusts und dem Bewusstsein, dass sie jetzt Waise war und im Norden eine Fremde, war Hatties jüngere Schwester Pearl zurück nach Georgia gegangen. Auch ihre ältere Schwester Marion war gegangen, hatte aber gesagt, sie würde wieder in den Norden kommen, sobald ihr Kind geboren und der Winter vorbei sei. Hattie wusste nicht, ob Marion das wirklich tun würde. Die Frau musterte Hattie eindringlich. »Ich komme mal mit, vielleicht kann ich mich um deine Kleinen kümmern«, sagte sie. Hattie hatte das abgelehnt. Das war dumm von ihr gewesen, sie hatte sich wie ein dummes Mädchen benommen, das zu stolz war zuzugeben, dass sie jemanden brauchte, der sich ihrer annahm. Sie ging allein nach Hause, in der Hand die Tüte mit den Eukalyptus-Blättern.
Die Winterluft war ein Feuer um sie herum und verbrannte alles, außer ihrem Willen, die Kinder gesund zu machen. Ihre Finger erstarrten zu Klauen um die braune Papiertüte. Mit glasklarem Verstand hastete sie in das Haus in der Wayne Street. Sie hatte das Gefühl, in die beiden Kleinen hineinsehen zu können, durch ihre Haut und das Fleisch hindurch, tief in ihren Brustkorb und in ihre schwachen Lungen hinein.
Hattie schob Philadelphia und Jubilee näher an die Badewanne heran. Die Handvoll Eukalyptusblätter war zu viel – bei dem Mentholdampf kniffen die Kleinen die Augen zu. Jubilee machte eine Faust und hob den Arm, als wollte sie sich die Augen reiben, aber sie war zu schwach, und der Arm fiel wieder herab. Hattie kniete sich hin und küsste die kleine Faust. Sie hob den mageren Arm ihrer Tochter – leicht wie ein Vogelknochen – und wischte ihr mit der Hand die Tränen fort, wie Jubilee es selbst getan hätte, hätte sie die Kraft dazu gehabt. »Siehst du«, sagte Hattie. »Das hast du ganz alleine gemacht.« Jubilee sah ihre Mutter an und lächelte. Wieder hob Hattie Jubilees kraftlosen Arm an das tränende Auge. Das Baby dachte, es sei ein Spiel, und lachte schwach, ein heiseres, leises, verschleimtes Lachen, aber doch ein Lachen. Hattie lachte auch, weil ihr kleines Mädchen so tapfer und so willig war – so krank und trotzdem hellwach. Sie hatte ein Grübchen, Philadelphia, ihr Bruder, hatte zwei. Sie sahen sich überhaupt nicht ähnlich. Jubilees Haar war schwarz wie das von August, und Philadelphia hatte Haut, so hell wie Milch, und sein Haar war sandbraun wie Hatties.
Philadelphia hatte Mühe beim Atmen. Hattie hob ihn aus dem Korb und setzte ihn auf den Wannenrand, wo der Dampf am dichtesten war. Er lag in ihren Armen wie ein Sack Mehl. Sein Kopf fiel nach hinten, die Arme hingen ihm am Körper hinunter. Hattie schaukelte ihn sanft, um ihn munter zu machen. Seit dem Abend hatte er nichts gegessen – beide Kinder hatten in der Nacht so heftig gehustet, dass sie das bisschen Gemüsebrühe, das Hattie ihnen eingeflößt hatte, wieder erbrochen hatten. Sie zog sein Lid mit dem Finger zurück, der Augapfel rollte in der Augenhöhle nach hinten. Hattie wusste nicht, ob er bewusstlos war oder schlief, und wenn er bewusstlos war, würde er vielleicht … vielleicht würde er …
Wieder zog sie sein Augenlid zurück. Diesmal machte er das Auge auf – da ist er ja, mein Junge! – und zog den Mund zusammen, wie er es tat, wenn sie ihn mit Erbsenbrei fütterte oder er etwas roch, das er nicht mochte. Ein richtiger Mäkler.
Das Helle im Badezimmer war zu viel: die weiße Wanne, weiße Wände, weiße Kacheln. Philadelphia hustete, immer wieder stieß er die Luft aus, dass sein kleiner Körper geschüttelt wurde. Hattie nahm die Dose mit warmem Senf vom Heizkörper und rieb Philadelphia die Brust damit ein. Seine Rippen waren dürre Zweige unter ihren Fingern; beim geringsten Druck würden sie zerbrechen und in den Brustraum sacken. Er war so pummelig gewesen, beide waren pummelig gewesen, als sie gesund waren. Philadelphia hob den Kopf, aber er war zu erschöpft und ließ ihn gleich wieder sinken. Sein Kinn ruhte an ihrer Schulter, so wie damals, als er neugeboren war und den Kopf noch nicht halten konnte.
Hattie ging in dem kleinen Badezimmer im Kreis und rieb Philadelphia den Rücken zwischen den Schulterblättern. Wenn er nach Luft rang, krümmte sich unwillkürlich sein Fuß und trat ihr in den Bauch, wenn er frei atmete, entspannte sich der Fuß wieder. Der Boden war feucht und glitschig. Hattie sang eine Melodie und irgendwelche sinnlosen Silben dazu – di-dum-dum di-da-da. Ihr fielen keine Wörter zu der Melodie ein.
Wasser rann an den Fensterscheiben und den Hähnen und der Wand herunter und in den Spalt beim Lichtschalter hinein. Im ganzen Badezimmer troff es wie im Wald in Georgia, wenn es geregnet hatte. Ein Zischen war zu hören, ein Knistern in der Wand, und das Deckenlicht ging aus. Das Badezimmer war jetzt ganz blau und neblig. Mein Gott, dachte Hattie, auch das noch. Sie lehnte den Kopf an den Türrahmen und schloss die Augen. Sie hatte seit drei Tagen nicht geschlafen. Eine Erinnerung kam ihr wie ein Schwächeanfall: sie und ihre Mutter und ihre Schwestern, wie sie beim Morgengrauen durch den Wald gingen. Vorneweg Mama mit zwei großen Reisetaschen, dahinter die drei Mädchen, jedes mit einer Teppichtasche. Durch den Morgendunst, durch das Unterholz waren sie auf dem Weg in die Stadt, ihre Röcke blieben an den Zweigen hängen. Wie Diebe schlichen sie sich durch den Wald, um den Frühzug zu erreichen, der sie aus Georgia fortbringen würde. Hatties Vater war noch keine zwei Tage tot, und in ebendiesen Minuten waren weiße Männer dabei, sein Namensschild von der Tür zu seiner Schmiede zu nehmen und ihr eigenes Schild anzuschrauben. »Seid barmherzig mit uns«, sagte Mama, als das Horn das erste Mal über den Feldern ertönte.
Philadelphias Fuß bohrte sich in Hatties Bauchnabel, und sofort war sie wieder wach, wieder in ihrem Badezimmer, bei ihren Kindern, benommen und auch verärgert, dass sie weggedriftet war. Die Kleinen fingen an zu weinen. Sie husteten und wurden geschüttelt. Die Krankheit gewann an Kraft, erst in dem einen Kind, dann in dem anderen, und dann, als hätte sie auf den besten Moment gewartet, um den größten Schaden anzurichten, schlug sie ein wie ein zweigezackter Blitz. Barmherzigkeit, Herr, Barmherzigkeit.
Hatties Kinder brannten im Fieber. Das Fieber stieg und stieg, die Beinchen strampelten, die Wangen waren glühendrot wie kleine Sonnen. Hattie nahm die Flasche mit dem Ipecac-Sirup aus dem Medizinschrank und gab ihnen davon. Die Kinder husteten so heftig, dass sie nicht schlucken konnten und die Medizin ihnen seitlich aus dem Mund rann. Hattie wischte den Kleinen die Gesichter ab, flößte ihnen mehr von dem Sirup ein, massierte ihnen die Brust. Ihre Hände waren flink bei der Verrichtung der Aufgaben, ihre Hände bewegten sich zügig und geschickt, und die ganze Zeit weinte Hattie und betete.
Wie ihre Kinder brannten! Wie sehr sie leben wollten! Hattie dachte, wenn sie einen Moment der Muße für solche Gedanken hatte, dass die Seelen ihrer Kinder Fingerhüte voller Nebel waren – flüchtig, nicht fassbar. Sie war ja selbst noch ein Mädchen, erst siebzehn Jahre länger auf der Welt als ihre Kinder. Hattie betrachtete ihre Kinder als eine Erweiterung ihrer selbst und liebte sie, weil sie ihre waren, weil sie schutzlos waren und sie brauchten. Doch jetzt blickte sie auf ihre Kinder und sah, dass das Leben in ihnen machtvoll und stark war und sich nicht einfach austreiben ließ. »Kämpft«, flehte Hattie sie an. »Macht es so«, sagte sie und sog Luft in ihre Lungen und stieß sie wieder aus, um ihnen zu zeigen, wie es ging. »So«, sagte sie wieder.
Hattie saß mit gekreuzten Beinen auf dem Fußboden, Jubilee in die eine Kniebeuge gestützt, Philadelphia in die andere. Sie klopfte ihnen sacht auf den Rücken, um den Schleim zu lösen. In dem Dreieck zwischen Hatties gekreuzten Beinen lagen die Kinderfüße übereinander – die Kraft wich aus den Kindern, sie lehnten sich matt an Hatties Oberschenkel. Und wenn sie hundert Jahre alt würde, immer würde Hattie, so wie sie jetzt ihre Kinder kraftlos vor sich sah, die Leiche ihres Vaters am Boden in seiner Schmiedewerkstatt sehen, und die beiden weißen Männer aus der Stadt, die sich nicht einmal beeilten und auch ihre Pistolen nicht versteckten, als sie sich von der Schmiede entfernten, so wenig Schamgefühl hatten sie. Das hatte Hattie gesehen, und sie konnte es nicht ungesehen machen.
Der Prediger in Georgia hatte den Norden das Neue Jerusalem genannt. Die Gemeinde sagte, er habe die Neger im Süden verraten. Am nächsten Tag war er mit dem Zug nach Chicago verschwunden. Auch andere machten sich auf den Weg, verschwanden aus ihren Läden oder von der Feldarbeit; ihre Plätze auf den Kirchenbänken, wo sie am Sonntag noch gesessen hatten, waren bei der Mittwochsandacht leer. Alle diese Seelen, die aus dem Süden geflohen waren, durchlebten zu ebendieser Zeit, im Glanz der Verheißung, den furchtbaren Winter der Städte des Nordens. Hattie wusste, dass ihre Kinder überleben würden. Auch wenn Philadelphia und Jubilee klein waren und ringen mussten, so gehörten sie doch zu den leuchtenden Seelen, gehörten sie zu den Ersten der neuen Nation.
Zweiunddreißig Stunden nachdem Hattie und ihre Mutter und ihre Schwestern sich durch den Wald in Georgia zum Bahnhof geschlichen hatten, nach zweiunddreißig Stunden auf harten Sitzen in dem Gedränge des Negerabteils wurde Hattie von dem Ruf des Schaffners aus leichtem Schlaf aufgeschreckt: »Broad Street Station, Philadelphia!« Hattie kletterte aus dem Zug, an ihrem Rocksaum klebte noch der Schlamm aus Georgia, der Traum von Philadelphia, rund wie eine Murmel in ihrem Mund, und die Angst davor eine Nadel in ihrer Brust. Hattie und Mama, Pearl und Marion stiegen die Treppe vom Bahnsteig zur Bahnhofshalle hinauf. Trotz der Mittagssonne war das Licht trüb. Das Dach wölbte sich zu einer Kuppel. Im Gebälk gurrten die Tauben. Hattie war damals erst fünfzehn und gertenschlank. Zusammen mit ihrer Mutter und den Schwestern stand sie am Rand der Menge, zu viert warteten sie auf eine Lücke in dem Menschenstrom, um zu den Schwingtüren am Ende der Halle zu gelangen. Hattie machte einen Schritt nach vorn. Mama rief: »Komm zurück! Du gehst verloren unter all den Menschen. Du gehst verloren!« Hattie sah sich panikerfüllt um; sie hatte gedacht, ihre Mutter wäre gleich hinter ihr. Die Menge war so dicht, dass Hattie sich nicht umdrehen konnte, und sie wurde von dem Strom fortgetragen. Sie erreichte die Schwingtüren und wurde auf den Gehweg vor der Bahnhofshalle geschoben.
Die Straße war voller Menschen, mehr als Hattie je an einem Ort zusammen gesehen hatte. Die Sonne stand hoch. In der Luft hing der Geruch vom Benzin der Automobile, von warmem Teer, wo die Straße frisch asphaltiert worden war, von dem üblen Gestank verrottenden Abfalls. Räder rumpelten über das Kopfsteinpflaster, Motoren heulten, Zeitungsjungen riefen die Schlagzeilen aus. Auf der anderen Straßenseite stand ein Mann in schmutzigen Kleidern und sang ein klagendes Lied, er hatte die Hände nah am Körper und hielt die Handflächen nach oben. Hattie widerstand dem Drang, sich gegen die einstürmenden Stadtgeräusche die Ohren zuzuhalten. Sie roch das Fehlen von Bäumen, bevor ihre Augen es bemerkten. Alles war größer in Philadelphia – das stimmte –, und es gab von allem mehr, zu viel von allem. Aber in dem Tumult sah Hattie nicht das Land der Verheißung. Es war wie Atlanta, dachte sie, nur größer. Damit würde sie zurechtkommen. Doch im gleichen Moment, da sie sich der Stadt gewachsen erklärte, zitterten ihr unter dem Rock die Knie, und Schweiß floss ihr den Rücken hinunter. Hundert Menschen und mehr waren an ihr vorübergegangen, in den wenigen Momenten, da sie auf dem Gehweg gestanden hatte, aber ihre Mutter oder ihre Schwestern waren nicht darunter gewesen. Hatties Augen brannten von der Anstrengung, mit der sie unter den Passanten nach ihnen Ausschau hielt.
Ein Karren auf dem Gehweg forderte ihre Aufmerksamkeit. Hattie hatte noch nie zuvor einen Blumenkarren gesehen. Ein Weißer saß auf einem Hocker, er hatte sich die Hemdsärmel aufgekrempelt und zum Schutz gegen die Sonne den Hut in die Stirn gezogen. Hattie stellte ihre Teppichtasche auf den Gehweg und wischte sich die schwitzenden Hände am Rock ab. Eine Negerin kam zu dem Karren. Sie zeigte auf einen Blumenstrauß. Der Weiße stand auf – er zögerte nicht, sein Körper verrenkte sich nicht zu einer Drohhaltung – und nahm den Strauß aus dem Eimer. Bevor er ihn in Papier wickelte, schüttelte er leicht das Wasser von den Stielen. Die Negerin gab ihm das Geld. Hatten sich ihre Hände berührt?
Als die Frau das Wechselgeld entgegennahm und in ihrem Portemonnaie verstaute, stieß sie versehentlich gegen drei der Blumeneimer. Eimer und Blumen fielen von dem Karren und landeten krachend auf dem Gehweg. Hattie wartete angespannt auf die unvermeidliche Explosion. Sie wartete darauf, dass die anderen Neger vor der Frau zurückweichen würden, über die sich gleich ein Gewaltausbruch entladen musste. Sie wartete auf den Moment, da sie sich die Augen zuhalten musste, vor der Frau und dem Entsetzlichen, das sich ereignen würde. Der Verkäufer bückte sich, um alles wieder aufzulesen. Die Negerin gestikulierte zur Entschuldigung und holte ihr Portemonnaie abermals heraus, vermutlich, um für den Schaden zu bezahlen. Wenige Minuten später war alles ausgestanden, und die Frau ging davon, die Nase in dem eingewickelten Blumenstrauß, als wäre nichts geschehen.
Hattie betrachtete die Menschen auf dem Gehweg genauer. Die Neger wichen nicht in den Rinnstein aus, um die Weißen passieren zu lassen, noch hatten sie die Augen verdrossen auf die Füße gesenkt. Vier Negermädchen kamen vorbei, Teenager wie Hattie, und plauderten miteinander. Einfach junge Mädchen, die redeten, lachten, unbekümmert waren – so wie sie verhielten sich in den Straßen der Städte in Georgia nur weiße Mädchen. Hattie sah ihnen nach, als sie weitergingen. Endlich traten ihre Mutter und ihre Schwestern aus der Bahnhofshalle und kamen auf sie zu. »Mama«, sagte Hattie, »ich gehe nie wieder zurück. Nie wieder.«
Philadelphias Oberkörper fiel nach vorn, seine Stirn stieß an Jubilees Schulter, bevor Hattie es verhindern konnte. Sein Atem war ein feuchtes, pfeifendes Rasseln. Seine Hände hingen kraftlos herab. Hattie schüttelte ihn sanft, er war schlaff wie eine Lumpenpuppe. Auch Jubilee wurde schwächer. Zwar konnte sie den Kopf halten, aber ihre Augen waren blicklos. Hattie hielt beide Kinder in den Armen und griff unbeholfen nach dem Fläschchen Ipecac. Philadelphia machte ein gurgelndes Geräusch und sah seine Mutter verwirrt an. »Verzeih mir«, flüsterte Hattie. »Ich weiß doch auch nicht. Ich will euch helfen. Verzeih mir, bitte.« Das Fläschchen glitt ihr aus der Hand und zerschellte auf dem Fliesenboden. Hattie hockte sich neben der Badewanne auf den Boden, sie hielt Philadelphia im Arm, Jubilee lag auf ihrem Schoß. Sie drehte den Hahn für das warme Wasser an und wartete. Jubilee hustete so gut es ging, sie sog die Luft so gut es ging in ihre Lungen. Hattie hielt einen Finger unter das laufende Wasser. Es war eiskalt.
Da war keine Zeit, den Brenner im Keller aufzufüllen, keine Zeit, auf heißes Wasser zu warten. Philadelphia lag schlaff in Hatties Arm, seine Füße traten ihr unwillkürlich in den Bauch, sein Kopf lag schwer auf ihrer Schulter. Als Hattie aus dem Badezimmer gehen wollte, trat sie versehentlich auf die Scherben der zerbrochenen Sirupflasche und schnitt sich in den Fuß, und das Blut färbte die weißen Kacheln und die Dielen im Flur rot. Im Schlafzimmer wickelte sie die Kinder in die Steppdecke, die auf dem Bett lag. Im nächsten Moment eilte sie mit ihnen die Treppe hinunter, in dem kleinen Vorraum schlüpfte sie in ihre Schuhe. Der Splitter drang tiefer in ihren Fuß ein. Im Nu war sie draußen und die Stufen hinunter. Dampf stieg von ihrem dünnen Hauskleid und den nackten Armen auf und verflüchtigte sich in der kalten, klaren Luft. Inzwischen war die Sonne ganz aufgegangen.
Hattie klopfte an die Tür zum Nachbarhaus. »Die Kinder haben Lungenentzündung!«, sagte sie zu der Frau, die zur Tür kam. »Helfen Sie mir bitte.« Hattie wusste nicht, wie die Frau hieß. Drinnen schlug die Frau die Steppdecke zurück und erblickte Jubilee und Philadelphia, die regungslos an Hatties Brust lagen. »Lieber Herr Jesus«, sagte sie. Ein Junge, der Sohn der Frau, kam ins Zimmer. »Hol den Arzt!«, rief die Frau ihm zu. Sie nahm Hattie Philadelphia aus dem Arm und eilte mit ihm nach oben. Hattie folgte ihr mit Jubilee.
»Er atmet noch«, sagte die Frau. »Solange er noch atmet.«
Im Badezimmer steckte sie den Stöpsel in die Wanne. Hattie stand in der Tür mit Jubilee auf der Hüfte. Ihre Hoffnung schwand, als sie sah, dass die Frau das heiße Wasser voll aufdrehte.
»Das habe ich schon gemacht!«, sagte Hattie weinend. »Kann man nichts anderes tun?«
Die Frau gab Hattie Philadelphia zu halten und durchsuchte den Medizinschrank. Sie fand eine Dose Kampfer, schraubte sie auf und hielt sie den Kindern unter die Nase, als wäre es Riechsalz. Nur Jubilee wandte ihren Kopf von dem Geruch ab. Hattie war überwältigt von dem Gefühl der Vergeblichkeit – die ganze Zeit hatte sie um das Leben ihrer Kinder gerungen, und jetzt war sie in einem Badezimmer, das so war wie ihr eigenes, bei einer Frau, die genauso wenig gegen die Krankheit ausrichten konnte wie sie selbst.
»Was kann ich tun?« Hattie sah die Frau durch den Dampf hindurch an. »Bitte sagen Sie mir, was ich tun kann.«
Die Nachbarin fand ein Glasrohr mit einer Gummiglocke am Ende. Damit saugte sie den Kindern Schleim aus Mund und Nase. Sie kniete sich vor Hattie auf den Boden, den Tränen nah. »Lieber Gott. Bitte, lieber Gott, hilf uns.« Die Frau saugte und betete dabei.
Die Augenlider der Kinder waren geschwollen und rot von geplatzten Äderchen. Ihr Atem ging flatternd. Ihr Brustkorb hob und senkte sich zu schnell. Hattie wusste nicht, ob Philadelphia und Jubilee Angst hatten und ob sie wussten, was ihnen geschah. Sie wusste nicht, wie sie die Kinder trösten konnte, aber sie wollte, dass das letzte, was sie hörten, ihre Stimme war, das letzte, was sie sahen, ihr Gesicht. Hattie küsste ihren Kindern Stirn und Wangen. Ihre Köpfe ruhten an ihren Armen. Zwischen den Atemzügen öffneten die Kinder die Augen weit, mit einem Ausdruck panischer Angst. Hattie hörte das Gurgeln tief in der Brust der Kleinen. Sie ertranken. Hattie ertrug das Leiden der Kinder kaum, aber sie wollte, dass sie in Frieden gingen, deshalb schrie sie nicht. Sie nannte sie ihren Schatz, sie nannte sie Licht und Versprechen und Wolke. Die Nachbarin betete in monotonem Murmeln. Ihre Hand lag auf Hatties Knie. Sie nahm die Hand auch dann nicht weg, als Hattie sie abstreifen wollte. Es war nicht viel, aber die Frau wollte nicht, dass Hattie in diesen Momenten allein war.
Jubilee kämpfte am längsten. Sie streckte den Arm nach Philadelphia aus, war aber zu schwach für die Anstrengung. Hattie legte die Hände der Kinder zusammen. Sie drückte die Kinder an sich, sie wiegte sie. Sie schmiegte ihre Wange an die Köpfe der Kinder. Ach, ihre samtene Haut! Sie empfand den Tod der Kinder wie einen Riss durch den eigenen Körper.
Hatties Kinder starben in der Reihenfolge, wie sie zur Welt gekommen waren: erst Philadelphia, dann Jubilee.
Floyd
1948
Die Pension war sauberer als manche andere. Die meisten Unterkünfte für Schwarze – solche, die Floyd sich leisten konnte – hatten in der Regel einen Kammerjäger und einen frischen Anstrich nötig. Floyd kratzte sich die Stiche am Rücken. In der letzten Unterkunft hatte es Bettwanzen gegeben. Aber er war im Süden, es war Sommer, und so war das eben. Hier war alles ringsum überwuchert, überall krabbelten Insekten herum und stachen einen. Er betrat das Zimmer – heiß, keine Frage, trotz des Ventilators im Fenster. Die Bettwäsche war verschossen und fadenscheinig, aber der Fußboden glänzte frisch gebohnert, und in einer Vase auf dem Nachttisch standen hübsche weiße Blumen.
»Wie nett! Meine Mama hat auch immer Schnittblumen hingestellt«, sagte Darla.
Meine Güte, Darla war laut! Auch wenn sie von sich behauptete, sie spreche leise, war es eher so, als würde sie einem von der anderen Straßenseite etwas zurufen. Sie ging um Floyd herum und stellte ihre Reisetasche neben das Bett. Die Reise hatte Spuren an ihr hinterlassen. Das Kleid war zerknittert, die Haare klebten ihr an der Stirn. Und während der fünfstündigen Fahrt hatte sie unablässig geraucht – selbst als Floyd anhielt, damit sie austreten konnte, war eine Rauchwolke hinter dem Busch aufgestiegen, wo sie sich hingehockt hatte. Von dem ganzen Rauch waren ihre Augen rot gerändert und ihre Fingerspitzen gelb.
»Du weißt ja sicherlich, dass ich heute Abend nicht unbedingt hierher zurückkomme. Aber du kannst das Zimmer behalten, bis du was für dich gefunden hast«, sagte Floyd.
»Schwer zu sagen, wer heute Abend wo ist.«
Darla war unkompliziert, sie nahm die Dinge, wie sie kamen, aber sie war auch ziemlich ordinär. Das orangefarbene Kleid leuchtete so hell, dass man davon einen Sonnenbrand bekommen konnte. Sicher, Floyd hatte bei den Konzerten noch nie ein Mädchen kennengelernt, das nicht ein bisschen grob war: Sie machten sich die Zähne mit rosa lackierten Nägeln sauber und redeten, als kämen sie geradewegs aus den Baumwollfeldern. Er war nie länger bei einer geblieben als die ein, zwei Nächte, die er an einem Ort auftrat. Am Morgen hatte er sich angezogen und sein Instrument genommen und war schon halbwegs auf Zehenspitzen aus dem Zimmer, als Darla aus dem Bett sprang und sagte: »Babyboy, ich komme einfach mit dir in den nächsten Ort. Ich hab genug von dieser dummen Stadt.« Wahrscheinlich war sein Kater schuld daran gewesen, dass er eingewilligt hatte. Zu dumm. Aber das war jetzt nicht mehr zu ändern.
»Du solltest mit mir was essen gehen«, sagte sie und setzte sich aufs Bett.
Floyd sah stirnrunzelnd auf seine Schuhe.
»Warum machst du so ein Gesicht? Ich weiß, dass wir kein Paar sind, aber du kannst mir doch trotzdem ein Tomaten-Sandwich kaufen.« Floyd lächelte. »Meine Güte – wenigstens eine Dose Sardinen. Ich habe noch nie einen gesehen, der so hölzern ist wie du.«
Darlas Schuh hing lose von ihrem Zeh herab. Sie schwenkte ihn spielerisch in Floyds Richtung. »Warum bist du eigentlich so ernst? Sei doch mal locker, das tut dir gut.«
»Ich weiß, was mir gut tut«, sagte Floyd und machte die Tür zu.
Als er beim Bett ankam, hatte er sich das Hemd schon ausgezogen, seine Hose einen Moment später. Er zog den Reißverschluss an Darlas Kleid runter, mehr gab es nicht auszuziehen. Liederlich, das Mädchen, darunter hatte sie nichts weiter an. Darla nannte ihn Daddy und Big Boy und stöhnte und schrie, und beide kamen auf ihre Kosten. Der Genuss wurde nur durch das Foto auf der Kommode geschmälert – ein sepiagetönter Bauernlümmel auf einem Pferd. Floyd hatte den Eindruck, dass der Blick des jungen Mannes ihm durchs Zimmer folgte. Seine Augen waren auf Floyd gerichtet, als er mit der Hand über Darlas Hüften fuhr, sie waren auf ihn gerichtet, als er einen Orgasmus hatte. Nachdem es vorbei war, legte Floyd seine Wange auf das Laken, gerade nah genug an Darla, dass er die feuchte Wärme ihres Körpers einatmen konnte.
Geruch nach Sex füllte das kleine Zimmer. Als Darla aufstand, um den Ventilator am Fenster einzuschalten, schlang sie sich nicht das Laken um, wie ein anständigeres Mädchen es getan hätte. Sie hatte einen hohen, runden Hintern, und ihre Oberschenkel liefen schmal auf ihre dünnen Waden zu. Vielleicht ein bisschen zu dünn, aber ihr Körper hatte eine Tatkräftigkeit, die Floyd gefiel.
Er hatte viele Frauen gehabt. Floyd sah gut aus; zwar war er nicht so hellhäutig wie mancher andere, aber er hatte welliges schwarzes Haar, das sich an den Schläfen ringelte. Nach einem Auftritt konnte er sich jede Frau aussuchen. In Philadelphia nannten sie ihn Lady Boy Floyd. Es war vorgekommen, dass er zwei Frauen in einer Nacht gehabt hatte, drei im Laufe eines Tages. Im Süden war das leichter zu machen als in Philadelphia. Sicher, auch zu Hause hatte er es mit Frauen auf Toiletten oder auf dem Rücksitz von Autos getrieben, aber in Georgia, so seine Überzeugung, waren alle Frauen lose Luder. Vielleicht lag es an ihrem Gang. Viele von ihnen – natürlich nicht die anständigen – trugen nicht einmal Hüftgürtel. Und in den Kleinstädten hatten sie auch keine Handtaschen dabei. Sie schlenderten einfach die Straße entlang, mit lose schwingenden Armen. Mit Frauen, die so frei waren, war alles möglich.
Die Frauen zu Hause, das wusste Floyd, waren wohlerzogen und anständig, so wie seine Mutter und seine Schwestern. Hattie wollte, dass er mit den Konzerten aufhörte und heiratete. Sie hatte ihm verboten, im Haus zu üben, und als er eine Stelle als Hausmeister im Downbeat Club annahm, wo er die Musiker kennenlernte, die dort spielten, hatte sie nur gesagt: »Ich weiß nicht, warum du den Dreck anderer Leute wegmachen willst.« Dann lernte er Hawkins und Pres kennen, und sie sagte nichts dazu. Aber manchmal, wenn er nach einem Auftritt in einer Scheune, wo Maisbrand ausgeschenkt wurde, oder vom Latrinenputzen im Downbeat zurück in die Wayne Street kam, geschah es, dass seine Mutter noch auf war und im Nachthemd auf dem Fenstersitz saß. Hattie war dann schwer von Schlaflosigkeit, aber sie begrüßte ihn mit einem Lächeln, und sie saßen eine Weile in der Stille der Stunde zusammen.
Als Floyd klein war, in den Jahren nach dem Tod der Zwillinge, waren nur er und Cassie und Hattie da gewesen. Hattie stand immer erst am Nachmittag auf. Manchmal, wenn Floyd stundenlang am Fußende ihres Bettes gestanden und darauf gewartet hatte, dass sie aufstand, legte er ihr die Hand vor den Mund, um sich zu vergewissern, dass sie noch atmete. Den ganzen Tag trug sie ihr weißes Nachthemd und schwebte durch die Zimmer im Haus, blass und still wie ein Eisberg. Floyd und Cassie bekamen das zu essen, was ihrer Mutter gerade einfiel – kalten Reisbrei mit Milch und Zucker oder einen Teller Cracker, mit Butter bestrichen, oder Bohnen in Tomatensoße aus der Dose –, wann immer es ihr gelang, etwas zuzubereiten. Wenn August abends nach Hause kam, gab es Musik und sein Pfeifen, und seine Stimme, traurig oder böse, aber immer eindringlich, die Hattie aufforderte sich anzuziehen, die Kinder zu baden, sich die Haare zu kämmen. Manchmal kam auch Aunt Marion, auch sie war schrill und kommandierte – oder wenigstens kam es Floyd so vor. Aber irgendwann leerte sich das Haus, und die Stille kehrte wieder ein. Obwohl Hatties Trauer das Leben erstickte, und obwohl Floyd und Cassie ungepflegt waren wie streunende Tiere, nahmen die kalten weltabgewandten Räume in der Wayne Street in Floyds Erinnerung eine besondere Schönheit an. Hattie gelang selten mehr als ein schwaches Lächeln, aber sie erlaubte Floyd und Cassie, dass sie auf ihren Schoß kletterten, ihr die Haare flochten und die Stirn küssten, als wäre sie eine lebendige Puppe. Sie waren Gefährten, die Mutter und die Kinder, und trieben, gleichermaßen verletzlich und sehnsuchtsvoll, durch die Tage. Auch jetzt, da Floyd ein erwachsener Mann war, bestand zwischen ihm und seiner Mutter ein besonderes Einvernehmen, nur mit seiner Mutter konnte Floyd heiter sein. Er vermisste ihre Stille. Oft war er versunken in einer lauten inneren Verwirrung, die ihn zu überwältigen drohte.
Floyd spürte sie am meisten auf den langen Autofahrten zwischen Auftritten, wenn er allein im Auto war und der gärig-süßliche Geruch des Südens durch die Fenster hereinströmte. Mit schnell klopfendem Herzen, von den Aufputschmitteln, die ihn zwischen den Auftritten wach hielten, flog er die Straße entlang, drückte auf das Gaspedal und fühlte sich von vernünftigen Sehnsüchten losgelöst. Zum Tanken hielt er in Ortschaften, die aus nichts weiter bestanden als einer Kirche aus Holzlatten und einer Zapfsäule. An der Tankstelle wies man ihm den Weg zu einem Haus, wo er für einen Dollar etwas zu essen bekommen konnte. War die Dame des Hauses allein, und war sie willig, gingen sie vielleicht in ihr Schlafzimmer, ehe Floyd weiterfuhr. Einmal war es auch ein Hengst von Tankstellenwart in Mississippi und einmal ein Mann in Kentucky, der einen Gemischtwarenladen hatte. Sie waren hinters Haus gegangen, als Straße und Laden leer und verlassen waren.
Auf dieser Tour war Floyd zum ersten Mal für längere Zeit von zu Hause weg. Und je länger er weg war, desto mehr gab er Trieben nach, die er in Philadelphia meistenteils zu unterdrücken verstand. In den Monaten, die er unterwegs verbrachte, waren diese Triebe drängender geworden, rückhaltloser und schwerer mit dem Mann zu vereinbaren, als der er sich begriff.
Und jetzt war er hier, wieder in einer Pension, wieder mit einer Fremden, in einer Stadt, wo er nicht wusste, in welche Richtung er gehen musste, um eine Tasse Kaffee zu bekommen. Dieser Süden. Was tat er hier, warum wanderte er in dieser Wildnis umher, nur mit seiner Trompete und ein paar Dollar in der Tasche? Floyd hatte aus Philadelphia weggehen wollen. Er war zweiundzwanzig und begierig, sich einen Namen als Musiker zu machen. Er war in den Süden gekommen, um in den Bars und Jazz-Kneipen zu spielen, aber nach drei Monaten Tournee fühlte er sich wie ein Papierdrachen, der sich von der Schnur losgerissen hatte.
Er stand vor der Kommode und drehte an den Knäufen der Schubladen.
»Herr im Himmel, Süßer. Bist du noch nicht müde davon?« Darla zwinkerte ihm zu. »Brauchst du noch mehr?«
»Ich nehme noch ein bisschen«, sagte er halbherzig.
»Na, dann musst du herkommen, wenn dir danach ist.«
Sie sah ihm zu, wie er in den Klamotten auf dem Boden wühlte.
»Oh, kannst du endlich mit dem Kramen aufhören? Du machst mich ganz nervös.«
Floyd zog eine Schachtel Zigaretten aus der Brusttasche seines Jacketts.
»Darf ich dich was fragen, Süßer? Was machst du hier in der Gegend? Du siehst aus wie einer von den jungen Kerlen, die ans Morehouse College wollen oder so.«
»Ich spiele in Musikkneipen«, sagte Floyd.
»Habt ihr im Norden keine Kneipen? Dazu brauchst du doch nicht bis hier runter zu reisen. Es muss doch andere Gründe geben, warum du zwei Tage hier und drei Tage woanders leben willst. Die meisten Leute machen so was nicht.«
»Ich hab dir gerade gesagt, warum«, sagte Floyd.
Darla zuckte mit den Achseln. »Geht mich auch nichts an.«
Die Sonne versank. Es war ein trüber Sonnenuntergang, ein dunstiger Streifen Orange tief am Himmel, die Sonne ein roter Ball, umgeben von Wolken.
»Ich glaube, ich bade jetzt«, sagte Floyd.
Er schlang sich ein Laken um und ging über den Flur zum Badezimmer. Das Bad machte ihn ruhiger. Als er wieder ins Zimmer kam, schlief Darla tief und fest, nackt und nach allen Seiten ausgestreckt, das Haar klebte ihr am Kopf, ihr Mund stand offen. Floyd lachte. Er verspürte eine seltsame Zärtlichkeit für Darlas ordinäre Art – sie wollte bei ihm keinen Eindruck schinden. Er arrangierte seinen Körper auf der Matratze um sie herum und schlief ein.
Floyd wurde von Stimmen auf der Straße geweckt. Im Zimmer war es dunkel, das einzige Licht kam durch das Fenster und durch den Türspalt. Sein Mund war ausgedörrt, und er spürte eine allgemeine, ungerichtete Gereiztheit.
Auch Darla wachte auf und sah Floyd aus kleinen Augen an.
»Was ist das für ein Krach?«, fragte sie.
Er antwortete nicht. Die Stimmen auf der Straße wurden lauter. Vom Fenster aus sah Floyd eine Menschenansammlung auf dem Boulevard vor der Pension. Er schaltete das Deckenlicht an.
»Soll ich etwa blind werden?«, fragte Darla.
Die letzten sauberen Sachen, die Floyd hatte, lagen zerknittert unten im Koffer. Er stieß die schmutzigen Kleider in die Ecke und zog sich rasch an. Das Zimmer um ihn war eng, der Geruch von Schweiß und Darlas billigem Parfum hing schwer in der Luft. Und der verdammte Bauernlümmel sah ihn immer noch von dem Foto auf der Kommode an.
»Ich gehe jetzt aus«, sagte Floyd.
»Das sehe ich.« Darla stand auf und streckte sich, dann beugte sie sich zu ihrer Tasche hinunter und nahm ein frisches, ebenfalls knallbunt gemustertes Kleid heraus. Floyd tippte mit dem Fuß auf den Boden, aber Darla beeilte sich nicht die Spur. Er klappte sein Feuerzeug auf und zu. Er seufzte.
»Baby Boy, willst du mir was sagen?«
»Ich geh schon mal raus.«
»Das ganze Theater, statt einfach zu sagen, du gehst jetzt?« Darla schüttelte den Kopf und beschäftigte sich wieder mit ihrer Reisetasche. »Du bist komisch«, sagte sie.
Unten stand die Eingangstür offen, als wäre der Besitzer eilig rausgerannt. Die Menschenmenge draußen füllte die Straßenbreite und einen Teil des Gehwegs. Die Straßen waren unbeleuchtet, aber an den vier Ecken brannten Fackeln in hohen Ständern. Ein Mann, von Kopf bis Fuß in Grün gekleidet – grüner Hut, grüne Schuhe, grüne Hose, grünes Hemd –, gab Floyd ein Zeichen, er solle sich dem Aufmarsch anschließen. Eine Frau, in gebauschten weißen Rüschenstoff gehüllt, ging neben einem Mann, auf dessen Gesicht mit Kohle Symbole gemalt waren. Andere trugen einfach etwas in den Händen: einen Blütenzweig, ein Zuckerrohr, einen gelben Vogel im Käfig.
Die Menschen schlugen Tamburine, sie läuteten mit Kuhglocken und liefen in Tanzschritten den Boulevard entlang. Einen Tanz wie diesen, bei dem man das Becken vorschob und eine Art Hühnergang in der Hocke nachahmte, sodass die Röcke der Frauen an den Oberschenkeln nach oben krochen, hatte Floyd noch nie gesehen. Ein Mann ging tief in die Knie, schnellte dann hoch und machte einen Salto. Die Menschen johlten. Der Mann tanzte umso wilder, und über die gelbe Farbe auf seiner Brust rann der Schweiß. Der Geruch von brennendem Teer erfüllte die Luft, dazu kam ein anderer süßlicher Rauchgeruch, den Floyd nicht zuordnen konnte. Ein Junge mit einem Tablett, auf dem kleine Metallbecher standen, kam auf ihn zu.
»Myrrhe? Wollen Sie Myrrhe, Mister?«, fragte er und deutete auf die Becher, aus denen süßlicher Dampf aufstieg.
»Was ist das?«, fragte Floyd.
»Seven Days!«
Der Junge mischte sich wieder unter die Menge.
Als Floyd seinen Auftritt organisiert hatte, war von einem Fest nicht die Rede gewesen. Und hier bin ich, bis oben zugeknöpft wie ein Opa, dachte er und lockerte den Knoten seiner Krawatte. Weiter vorne spielte eine Blechbläserband. An so einem Abend war alles möglich, und er hatte doch tatsächlich, wie dumm von ihm, den Whiskey bei Darla im Zimmer gelassen.
Er lehnte sich an den Türpfosten der Pension und rauchte eine Zigarette. Schwer auszumachen, wer in diesem verrückten Treiben wer war – alle machten mit, Männer und Frauen, alle in Bewegung, tänzelnd, schwingend, schlenkernd. Seine Finger zuckten in Erwartung, wie jedes Mal vor dem ersten Song bei einem Konzert. Sobald der Veranstalter ihn angesagt hatte, trat Floyd für gewöhnlich auf die Bühne und wartete. Er ließ die Menschen zappeln, während sie an den Getränken nippten und sich flüsternd unterhielten, bis die Erwartung zur Sehnsucht angeschwollen war. Erst dann hob er seine Trompete an den Mund. Er wusste immer, wann er das Publikum so weit hatte.
Zwei Frauen in blauen Kleidern und Hüten mit blauen Federn näherten sich ihm auf dem Gehweg. Eine hatte Grübchen und lächelte ihn an. Sie war ein hübsches Ding, ihre Farbe wie die von Erdnussbutter, weshalb er ihr erlaubte, ihn am Ellbogen in die Menge zu führen. »Was ist hier los?«, fragte er sie. Sie antwortete nicht. Ihm fiel auf, dass die Menschen alle eine Art Natur-Kostüm trugen, Wolken oder Blumen oder Tiere; seine Begleiterinnen waren zwei Hüttensänger. Die Hübsche trank aus einem Marmeladenglas, das sie ihm jetzt entgegenhielt – Maisbrand, der so stark war, dass er seine Trompete damit putzen könnte, vermischt mit etwas Süßlichem, das Floyd nicht erkannte. Mit Gesten gab sie ihm zu verstehen, er solle langsam trinken, aber er beachtete sie nicht und nahm drei große Schlucke. Das Getränk erregte ihn. Das Hüttensänger-Mädchen würde sich seiner vielleicht annehmen, in einer Seitenstraße oder in seinem Packard. Floyd ließ seine Hand über ihren Rücken bis zum Po hinabgleiten.
Der breite Boulevard machte eine Kurve und mündete in einen Park. Floyd wurde von der Menge mitgeschoben, von allen Seiten pressten sich Körper an ihn. Er stellte sich auf die Zehenspitzen, um zu sehen, wohin er mit seinem Hüttensänger-Mädchen entschwinden konnte, aber verschwitzte Rücken und Schultern keilten ihn ein. »Wir sollten uns aus der Menge entfernen«, flüsterte er ihr ins Ohr, »wie heiß es ist, bestimmt gibt es eine Stelle, von wo aus wir alles ansehen können, nur nicht so eingequetscht.« Sie lächelte ihn an und legte den Kopf schräg. Mann, diese Grübchen, die hatten was! Er schlang seinen Arm um ihre Taille und zog sie in eine Ecke, aber das Hüttensänger-Mädchen drohte ihm mit dem Zeigefinger und befreite sich aus seiner Umschlingung.
Um ihn herum wogte die Menge. Der Geruch von Talkumpuder, Haarcreme und Zigarettenrauch vermischte sich in der Luft. Floyd öffnete die obersten Knöpfe seines Hemds. Er bekam keine Luft. Es ist nur ein Umzug, sagte er sich, als er einen Anflug von Panik in seiner Brust spürte – einfach nur eine Ansammlung betrunkener Leute vom Lande. Aber so viele Leiber! Der Maisbrand hatte einen süßlich-klebrigen Geschmack auf seiner Zunge hinterlassen. Floyd schob sich blind durch den dicken Pulk, schaffte es endlich, den äußeren Ring zu durchbrechen, und rannte zu einer Lichtung, wo er sich an einen Baum stützte und heftig übergab.
Als er sich wieder aufrichten konnte, sah er, dass er auf einem kleinen Weg zwischen Bäumen bei einer Kirche war, in einiger Entfernung von der feiernden Menge. Ein Zweig knackte. Ein Klirren kam aus dem Dickicht vor ihm. Könnten Ketten sein, dachte er. Vielleicht ein bisschen zu leise dafür, aber in dieser verhexten Nacht war alles möglich – ein Mann in Ketten könnte aus diesem Dickicht hervortreten. In Georgia wurden Sträflinge noch aneinandergekettet, oder? Konnte doch sein, dass eine dieser armen Seelen hier herumspukte. Floyd nahm einen Ast auf und hielt ihn in der Hand wie ein Schwert. Das Klirren kam näher. Floyd stellte sich breitbeinig hin und schwenkte den Ast.
Ein junger Mann trat zwischen den Bäumen hervor. Sein rotes Halstuch leuchtete im Mondschein wie ein Edelstein. In der geschlossenen Hand schüttelte er ein paar Münzen, mit der anderen Hand lüftete er den Hut.
»Hoppla!«, sagte er. »Ich komm gerade so vorbei.«
»Eh … Entschuldigung. Ich war mir nicht sicher, was …« Floyd ließ den Stock fallen.
Der Mann war bestimmt nicht älter als achtzehn. Aber er war kein Kind mehr, denn seine Lippen waren rot und wollüstig, prall wie Kissen, leicht geöffnet. Ein Mund, reif wie eine Erdbeere. Der junge Mann war sich dessen ganz und gar bewusst.
»Scheint’s, du bist ein bisschen aufgeregt«, sagte er und lachte leise.
Ein Knallfrosch explodierte.
Floyd machte einen Satz. »Nein, nein. Bloß … ich habe so etwas noch nie erlebt.«
Der Junge musterte den Schnitt von Floyds Jackett und seine seidene Krawatte. Er musterte seinen Haarschnitt und die Schuhe.
»Ja«, sagte er, »dass du nicht von hier bist, sehe ich.«
Seine Stimme war spröde und tief wie eine Klarinette.
»Bin hier für ein Konzert«, sagte Floyd.
»Huhum«, sagte der junge Mann und wollte seines Weges gehen.
»Was ist das für ein Umzug?«, sagte Floyd eilig, weil er es wissen wollte und weil er nicht wollte, dass der junge Mann verschwand.
»Seven Days.«
Der Junge machte eine abwertende Handbewegung in Richtung der Menge. »Jedes Jahr inszenieren sie diesen Juju-Kram. Ich selbst glaube nicht daran.«
Floyd konnte Holzfeuer riechen, wie von einem Lagerfeuer.
»Ist es ein Zauberfest?«
Der junge Mann seufzte. »So könnte man es wohl nennen. Hoodoo-Volk, das feiert, wie Gott die Welt erschaffen hat, so wie sie sich das vorstellen«, sagte er, dann hielt er inne und lächelte Floyd zu. »Sie sagen, Gott hat die Welt erschaffen, falls du das da, wo du herkommst, noch nicht gehört hast.«
»Ich habe keine Kreuze gesehen, auch keine Priester«, sagte Floyd.
»Jeden Tag sind hier Kreuze und Priester. Diese Leute«, sagte er, als gehörte er selbst nicht dazu, »rufen den Zauberer, sobald sie aus der Kirche kommen. Bei Seven Days werden sie wieder zu Heiden, ganz offen.«
»Ganz schön unheimlich«, sagte Floyd. Der Junge zuckte die Schultern.
»Weißt du, wo man hier einen Schluck Wasser bekommen kann?«
Der Junge ging mit Floyd um die Kirche herum, wo eine Wasserpumpe war, an der Floyd in kräftigen Zügen trank und sich dann Hals und Gesicht besprengte. Er wunderte sich, wie in dieser schwülen und wirren Gegend das Wasser so kühl und rein sein konnte. Wasser tropfte auf sein Hemd und auf seine polierten Schuhe. Er musste ziemlich wild aussehen. Aber andererseits war der Junge, frisiert wie er war, dennoch nur einer vom Lande, und Floyd hatte es nicht nötig, Eindruck auf ihn zu machen. Floyd hatte niemals versucht auf andere, denen er durch Zufall begegnet war, Eindruck zu machen. Der Junge stand in einiger Entfernung von Floyd und hatte die Arme über der Brust verschränkt. Unter seinem roten Halstuch leuchtete ein Dreieck honiggoldener Haut im Flutlicht.
Floyd wischte sich die nassen Hände an der Hose trocken und stellte sich vor. Der Junge schüttelte Floyd die Hand, anscheinend war er das nicht gewöhnt.
»Lafayette ist der Name«, sagte er.
Sie setzten sich auf eine Bank am Rand der Rasenfläche bei der Kirche. Floyd sprach mit Lafayette wie mit einer Frau, an die er sich heranmachen wollte: Woher kam er, was machte er, wohnte er in der Stadt? Auf seine Versuche der Konversation gab Lafayette einsilbige Antworten: Von hier, er schnitt Haare, nein, er wohnte nicht in der Stadt. Er schien nicht beeindruckt, als Floyd erzählte, er spiele Trompete und sei aus Philadelphia. Lafayettes Gleichgültigkeit verärgerte Floyd; ein Mann aus einer unbedeutenden Stadt wie dieser sollte von den großen Städten des Nordens fasziniert sein. Er sprach schnell weiter und schmückte die Details seines Lebens aus: Er habe Monk bei Minton’s in New York spielen sehen – Lafayette hatte vielleicht von Minton’s gehört, ein berühmtes Lokal – und mit Duke bei einem Drink an der Bar gestanden. Beim Sprechen wurde Floyd bewusst, dass nicht nur sein Stolz und seine Eitelkeit gekränkt waren – er wollte, dass Lafayette ihn mochte.
Floyd hatte sich lange nicht mehr, das wurde ihm jetzt bewusst, so unbeholfen und linkisch verhalten. Er gab den Versuch, ein Gespräch zu führen, auf. Besser wäre es, näher an Lafayette heranzurücken und ihm, um seine Absicht klarzumachen, in die Augen zu sehen. Aber Floyd war zu nervös, er rieb sich mit der Handfläche immer wieder über das Hosenbein und bohrte die Fußspitze in den Sand. Lafayette rückte auf der Bank ein bisschen näher. Er fuhr Floyd mit seinen Fingern über den Nacken. Er atmete schnell, aber regelmäßig. Er ließ seine Hand durch den Spalt, wo die obersten beiden Knöpfe offen standen, in Floyds Hemd gleiten. Die kühle Hand des Jungen erwärmte sich an Floyds Brust, die Finger zuckten leicht. Floyd lehnte sich enger an den Jungen. Mit diesen kleinen Gesten hatten sie sich geeinigt. Sie waren im Einvernehmen. Floyd folgte Lafayette ins Unterholz. Er blickte zurück und sah einen orangefarbenen Schimmer bei der Kirche. Konnte alles Mögliche sein – ein Knallfrosch, einer der Feiernden, als Sonne verkleidet. Floyd beeilte sich Lafayette einzuholen.
Es war Vollmond, aber das Licht erreichte die beiden Männer unter dem dichten Laubdach kaum. Lafayette kannte sich aus und bewegte sich schnell. Bald schon war er mehrere Schritte voraus. Gut möglich, dachte Floyd, dass ich ein Dummkopf bin und dieser Typ mich ins Unglück locken will. Floyd war in Bars und an Tankstellen gewesen, wo Männer ihn ohne ersichtlichen Grund angingen, und er fragte sich, ob sie es erspürt hatten, so wie Lafayette jetzt, und es aus ihm herausprügeln wollten.
Sie kamen auf eine kleine Lichtung, die im hellen Mondlicht lag. Lafayette hatte es jetzt eilig, er knöpfte Floyd das Hemd auf und öffnete seine Gürtelschnalle. Floyd – wie sehr Lafayette ihn zu einem Jungen machte, wie fügsam – stand nackt im Mondschein und bebte vor Erregung und Angst. Lafayette zog sich geduldig und quälend langsam aus. Er war von oben bis unten honiggolden, die Brust haarlos, darunter ein winziger Bauchansatz. Seine Oberschenkel waren hart und muskulös und gaben unter Flodys Kniffen nicht nach. Der Junge war auf eine Art erfahren, die Floyd verlegen machte. Er stöhnte und wich einen Schritt von Lafayette zurück.
»Ich weiß nicht … ich meine, ich …«, stammelte er.
»Ist doch in Ordnung«, murmelte Lafayette und legte seinen Mund an Floyds Ohr. »Ist doch in Ordnung.«
Es fing an zu regnen. Floyds und Lafayettes Schweiß vermischte sich mit Regentropfen und perlte über ihre Haut. Floyd konnte den Blick nicht von Lafayettes Glied abwenden, das weich an seinem Oberschenkel lag, und später, so stellte er sich vor, schmiegsam an Lafayettes Hosenschritt ruhen würde, wenn sie sich wieder angezogen hatten und aus dem Waldstück kamen.
Am Rand der Lichtung war ein Baumstumpf, der die Dicke von zwei Männern zusammen hatte und mit schwarzen Markierungen und Ritzungen übersät war.
»Was ist das?«, fragte Floyd und zeigte auf den Baumstumpf.
»Manche wollen ein Zeichen hinterlassen.«
Floyd erhob sich und ging in die Hocke. »Ihren Namen?«
»Namen? He, schreib doch auch was drauf. Keinen Namen, nur ein Zeichen.«
Die Baumscheibe war voller Messerritzungen. Ein paar Herzen, Buchstaben, die vielleicht Initialen waren, die Umrisse einer Hand.
»Kommen viele hierher?«, fragte Floyd.
»Gibt sonst nirgendwo, wo man sich Zeit lassen kann«, sagte Lafayette.
»Ist es in Macon oder Atlanta anders, was meinst du?«
»Ist es anders, wo du herkommst?«, frage Lafayette scharf.
»Darüber weiß ich nichts.«
»Ach, nein?«, sagte Lafayette spöttisch. »Ich glaub nicht, dass es irgendwo anders ist.«
»Ich meine, ich bin nicht … ich gehe mit Frauen.«
»Die meisten denken das von sich.«
»Es stimmt aber.«
»Ich behaupte nicht, dass es nicht stimmt. Aber anscheinend gehst du auch mit Männern.«
Floyd hatte nichts über die wenigen Männer gewusst, mit denen er zusammen gewesen war. Es waren kurze, verstohlene Begegnungen mit sehr dürftigen Versuchen eines Gesprächs. Danach hatte Floyd diese Erlebnisse verdrängt, wie er einen Abend exzessiven Trinkens oder einen herben Verlust beim Würfelspiel oder andere Ausschweifungen verdrängte. Mit dem Versagen seiner Willenskraft wollte er sich nicht lange abgeben, sonst passierte es vielleicht öfter. Und dann wurde er vielleicht wie Lafayette. Lafayette, der nicht den Anstand besaß, Floyd seine Ehre zu lassen. Lady Boy Floyd wurde er schließlich genannt. Wer war Lafayette, das anzuzweifeln? Typen wie ihn sah man in Greenwich Village herumscharwenzeln. Warum sie nicht den Verstand hatten, normal aufzutreten, um sich vor Spott zu schützen, verstand Floyd nicht. Er sah Lafayette an. Der Junge musterte ihn mit herausforderndem, funkelndem Blick, den Floyd bei einem Menschen wie ihm nicht erwartet hätte. Etwas daran beschämte ihn.
»Spielst du manchmal mit dem Gedanken, hier wegzugehen?«, fragte er leise.
Lafayette senkte den Blick und kreuzte die Arme über der Brust. Er war nackt wie am Tag seiner Geburt, sein kleiner Bauch wölbte sich, und seine Lippen waren wie zu einem Stirnrunzeln gekraust. Am liebsten hätte Floyd gelacht. Hätte er Lafayette besser gekannt, hätte er ihn richtig gut gekannt, hätte er jetzt vielleicht gesagt: »Ach, jetzt komm«, und ihn auf die Wange geküsst.
»Ich will damit überhaupt nichts sagen. Ich frage einfach nur«, sagte Floyd.
»Meine Schwester lebt in New Orleans.«
»Warst du mal da?«
»Nein. Ich war bisher nirgends.«
»Na, für jemanden, er noch nirgends war, bist du ganz schön welterfahren.«
»Findest du?«, fragte Lafayette, und sein Lächeln war aufrichtig und offen; ein solches Lächeln hatte er sich den ganzen Abend noch nicht gestattet.