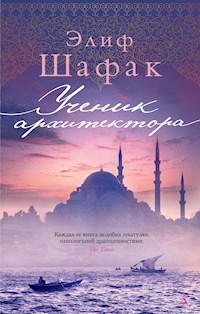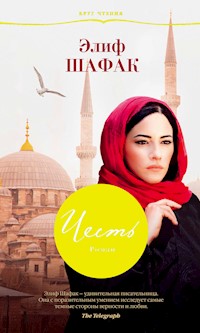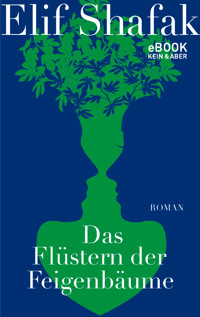Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Narin ist neun, als in dem ezidischen Dorf am Tigris Planierraupen auftauchen. Ihre Heimat soll einem Dammbauprojekt der türkischen Regierung weichen. Die Großmutter, fest entschlossen, die Enkelin an einem ungestörten Ort taufen zu lassen, bereitet alles für die Reise ins heilige Lalisch-Tal vor. Kurz vor Aufbruch stößt Narin auf das Grab eines gewissen Arthur – direkt neben dem ihrer Ururgroßmutter Leila. Wer war dieser „König der Abwasserkanäle und Elendsquartiere“, der Junge aus dem viktorianischen London, von den Ufern der verschmutzten Themse? Und was hat er mit Narins eigener Vertreibung zu tun? Meisterhaft verwebt Elif Shafak Vergangenheit und Gegenwart zu einem soghaften Roman über sich kreuzende menschliche Schicksale und die Macht jahrhundertealter Konflikte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 715
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Narin ist neun, als in dem ezidischen Dorf am Tigris Planierraupen auftauchen. Ihre Heimat soll einem Dammbauprojekt der türkischen Regierung weichen. Die Großmutter, fest entschlossen, die Enkelin an einem ungestörten Ort taufen zu lassen, bereitet alles für die Reise ins heilige Lalisch-Tal vor. Kurz vor Aufbruch stößt Narin auf das Grab eines gewissen Arthur — direkt neben dem ihrer Ururgroßmutter Leila. Wer war dieser »König der Abwasserkanäle und Elendsquartiere«, der Junge aus dem viktorianischen London, von den Ufern der verschmutzten Themse? Und was hat er mit Narins eigener Vertreibung zu tun? Meisterhaft verwebt Elif Shafak Vergangenheit und Gegenwart zu einem soghaften Roman über sich kreuzende menschliche Schicksale und die Macht jahrhundertealter Konflikte.
Elif Shafak
Am Himmel die Flüsse
Roman
Aus dem Englischen von Michaela Grabinger
Hanser
Für eine geliebte Autorin, die,
als sie gebeten wurde
über »Frauen und Literatur« zu sprechen,
sich an das Ufer eines Flusses setzte und überlegte,
was diese Worte bedeuteten.
Stein wird vom Tropfen gehöhlt.
Ovid
Komm hinfort, o Menschenkind!
Auf zu Wassern, Wildnis, Wind
Mit einer Fee an deiner Hand,
Denn auf der Welt gibt es mehr Tränen,
als je ein Kind verstand.
W. B. Yeats
Wir haben viele Brunnen in uns.
Manche füllen sich bei jedem starken Regen,
andere sind dafür viel zu tief.
Hafis
In jenen Tagen, in jenen fernen Tagen,
in jenen Nächten, in jenen lange zurückliegenden Nächten,
in jenen Jahren, in jenen entfernten Jahren,
damals zu Urzeiten …
»Die Sumerer und Akkader, hast du die gesehen?«
»Das habe ich.«
»Wie ergeht es ihnen?«
»Sie trinken das trübe Wasser des ›Schwindelorts‹.«
Gilgamesch-Epos, Tafel XII
I
Der Regentropfen
Am Ufer des Tigris, damals zu Urzeiten
Später, nach dem Sturm, werden alle über die Zerstörung sprechen, die er angerichtet hat, doch niemand, nicht einmal der König, wird sich daran erinnern, dass es mit einem einzigen Regentropfen begann.
*
An diesem Nachmittag im Frühsommer ist der Himmel über Ninive schwer vom nahen Regen. Eine seltsame, düstere Stille liegt auf der Stadt. Seit der Morgendämmerung zwitschern die Vögel nicht mehr; die Schmetterlinge und Libellen haben sich versteckt, die Frösche ihre Laichgewässer verlassen; die Gänse schweigen, sie spüren die Gefahr. Selbst die Schafe sind verstummt und lassen vor Angst ständig Wasser. Die Luft riecht anders als sonst — stechend scharf. Schon den ganzen Tag ballen sich am Horizont dunkle Schatten und sammeln Kraft, als hätte eine feindliche Armee dort ihr Lager aufgeschlagen. Aus der Ferne wirken sie reglos und ruhig, doch das täuscht, das ist Augentrug. Von einem starken Wind getrieben, wälzen sich die Wolken stetig näher, entschlossen, die Welt zu durchtränken und neu zu formen. In dieser Gegend, wo die Sommer lang und sengend heiß, die Flüsse launisch und grausam sind und die Erinnerung an die letzte Flut noch nicht fortgespült ist, gilt Wasser sowohl als Lebenskünder wie auch als Todesbote.
Ninive ist ein Ort wie kein zweiter — die größte, reichste Stadt der Welt. Errichtet auf einer weiten Ebene am östlichen Tigrisufer, so dicht am Fluss, dass die Kinder nachts nicht mit Wiegenliedern in den Schlaf gelullt werden, sondern vom Klang der ans Ufer schwappenden Wellen. Dies ist die Kapitale eines gewaltigen Reichs, eine Zitadelle mit massiven Wehrtürmen, mächtigen Zinnen, tiefen Festungsgräben, verstärkten Bastionen und immensen, mehr als fünfundzwanzig Meter hohen Mauern. Mit seinen 175.000 Einwohnern ist Ninive eine grandiose Stadt am Knotenpunkt zwischen dem wohlhabenden Hochland im Norden und den fruchtbaren Ebenen Chaldäas und Babyloniens im Süden. Es ist die Zeit zwischen 650 und 640 v. u. Z., und die uralte Region mit ihren duftenden Gärten, sprudelnden Brunnen und Bewässerungskanälen — eine Region, die von künftigen Generationen vergessen und als trockene Wüste und elendes Ödland abgetan werden wird — ist Mesopotamien.
Eine der Wolken, die sich der Stadt an diesem Nachmittag nähern, ist größer und dunkler als die anderen — und ungeduldiger. Eilig treibt sie am weiten Himmelsgewölbe ihrem Ziel entgegen. Kaum hat sie es erreicht, kommt sie zum Stillstand und verharrt Hunderte Meter hoch schwebend über einem majestätischen, mit Pfeilern aus Zedernholz, Säulengängen und kolossalen Statuen ausgestatteten Bauwerk — dem Nordpalast, wo in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit der König wohnt. Dort oben verharrt der kondensierte Dampf und wirft seinen Schatten auf die Residenz. Denn im Gegensatz zu den Menschen interessiert sich das Wasser nicht für Rang, Namen und Herrschertitel.
Am Rand der Gewitterwolke hängt ein einzelner Regentropfen — kaum so groß wie eine Bohne und leichter als eine Kichererbse. Eine Weile zittert es bedenklich, das kleine, runde, verschreckte Ding, denn es macht Angst, die Erde zu betrachten, die sich dort unten wie eine Lotusblüte öffnet. Dabei ist es wahrlich nicht das erste Mal. Der Tropfen hat die Reise schon oft gemacht — hinauf zum Himmel, hinunter zum festen Boden und wieder hinauf. Doch er fürchtet den Fall immer wieder.
Denk an den Tropfen, so unbedeutend er verglichen mit dem riesigen All erscheinen mag. Das Innere der winzigen Kugel birgt das Geheimnis des Unendlichen, ihre ureigene Geschichte. Als der Tropfen endlich Mut gefasst hat, stürzt er sich in die Luft — und fällt, wird schneller und schneller. Die Schwerkraft hilft immer. Er rast aus neunhundertachtunddreißig Meter Höhe hinunter. Nur drei Minuten vergehen, bis er den Boden erreicht.
*
Unten in Ninive durchschreitet der König eine zweiflügelige Tür und tritt auf die Terrasse. Er streckt den Kopf über die reich verzierte Brüstung und betrachtet die prächtige Stadt, die sich, so weit das Auge reicht, vor ihm ausdehnt. Gepflegte Anwesen, fantastische Aquädukte, imposante Tempel, blühende Obsthaine, zauberhafte öffentliche Parks, grüne Wiesen und eine königliche Menagerie, in der Gazellen, Hirsche, Strauße, Leoparden, Luchse und Löwen gehalten werden. Der Anblick erfüllt ihn mit Stolz. Besonders lieb sind ihm die Gärten mit ihren blühenden Bäumen und wohlriechenden Pflanzen — Mandel, Dattel, Ebenholz, Tanne, Feige, Mispel, Maulbeere, Olive, Birne, Pflaume, Granatapfel, Pappel, Quitte, Tamariske, Terebinthe, Walnuss, Weide … Der König ist nicht nur der Herrscher über Land und Volk, sondern auch über die Ströme und ihre Nebenflüsse. Seine Ahnen und er haben den Tigris durch ein komplexes Netz aus Kanälen, Stauanlagen und Gräben geführt, Wasser in Zisternen und Becken gespeichert und das Land zu einem Paradies gemacht.
Der König heißt Assurbanipal. Er hat einen wohlgestutzten lockigen Bart, eine breite Stirn, buschige Brauen und runde dunkle Augen, die mit schwarzem Kajal umrandet sind. Jedes Mal, wenn das Licht darauf fällt, leuchten die Edelsteine, mit denen sein konischer Kopfschmuck besetzt ist, wie ferne Sterne. Sein dunkelblaues Gewand, gewoben aus feinstem Leinen, ist mit goldenen und silbernen Fäden bestickt und mit Hunderten glänzender Perlen, Edelsteine und Amulette verziert. An seinem linken Handgelenk hängt ein Reif mit einem Blumenmotiv, der ihm Glück bringen und ihn beschützen soll. Das Reich des Königs ist so ungeheuer groß, dass man ihn »Herrscher der vier Weltgegenden« nennt. Später wird er auch als »der König mit der Bibliothek«, »der belesene Monarch« und »Mesopotamiens gelehrter Herrscher« im Gedächtnis und in der Achtung der Menschen bleiben — Titel, die vergessen lassen, dass er bei all seiner Bildung und Kultiviertheit nicht weniger grausam als seine Vorgänger war.
Assurbanipal dreht den Kopf zur Seite, um den Blick über die ganze Stadt schweifen zu lassen, und atmet tief ein. Das Unwetter, das sich in der Ferne zusammenbraut, bemerkt er zunächst nicht. Er ist von dem herrlichen Duft abgelenkt, der den Gärten und Hainen entströmt. Doch als er die Augen langsam zum bleigrauen Himmel hebt, durchfährt ein Schauder seine kräftige Gestalt. Düstere Warnungen und böse Omen überfallen seine Gedanken wie aus dem Hinterhalt. Ninive werde eines Tages angegriffen, geplündert und niedergebrannt werden, haben Wahrsager prophezeit; selbst die Steine würden fortgeschleppt werden. Die prächtige Stadt werde vom Gesicht der Erde getilgt, haben sie verkündet und alle inständig zur Flucht aufgefordert. Der König hat die Schwarzseher zum Schweigen bringen lassen — er hat befohlen, ihnen den Mund zu versiegeln, indem man ihre Lippen mit Katgut zusammennähte. Doch jetzt zerrt eine bange Ahnung an ihm wie die Unterströmung in einem Fluss. Was, wenn sich die Vorhersagen bewahrheiten?
Assurbanipal wischt das ungute Gefühl beiseite. Obwohl er viele Feinde hat, darunter sein leiblicher Bruder, muss er sich nicht sorgen. Solange die Götter auf seiner Seite stehen — und er hegt keinen Zweifel, dass sie Ninive immer verteidigen werden, so launisch und widersprüchlich sie die Sterblichen auch behandeln —, so lange kann nichts die ruhmreiche Hauptstadt zerstören.
Gleich wird der Regentropfen auf der Erde landen. Während er sich dem Boden nähert, fühlt er sich einen Moment lang so schwerelos und frei, als könnte er sich niederlassen, wo er will. Links steht ein hoher Baum ohne Äste — eine Dattelpalme, deren Wedel einen angenehmen Landeplatz abgäben. Rechts durchzieht ein Bewässerungskanal das Feld eines Bauern; dort wäre der Tropfen willkommen, er könnte die nächste Ernte vergrößern helfen. Aber auch die Stufen einer nahe gelegenen Zikkurat kommen infrage, eines Tempelturms, der Ischtar geweiht ist — Göttin der Natur, der Sexualität, der Liebe und Leidenschaft, aber auch des Kriegs und des Gewitters. Eine dieser Stufen wäre ein angemessenes Ziel. Der Tropfen schwankt, er weiß noch immer nicht, wohin er will, aber das macht nichts, denn so entscheidet einfach der Wind. Eine plötzlich aufkommende Bö trägt das winzige Ding direkt zu dem Mann, der ganz in der Nähe auf einer Terrasse steht.
Einen Herzschlag später spürt der König, dass ihm etwas Nasses auf den Kopf fällt und sich an sein Haar schmiegt. Verärgert versucht er es mit einer Hand wegzuwischen, doch sein kunstvoll verzierter Kopfschmuck ist ihm im Weg. Er runzelt ein wenig die Stirn und blickt noch einmal zum Himmel hinauf. Kurz bevor es zu schütten beginnt, macht er kehrt und zieht sich in den sicheren Palast zurück.
Auf seinem Weg durch die langen Gänge lauscht Assurbanipal dem Echo seiner Schritte. Die Diener fallen vor ihm auf die Knie; keiner wagt es, ihm in die Augen zu blicken. Rechts und links stecken Fackeln mit flackernden Flammen in schmiedeeisernen Halterungen. Ihr gespenstisches Licht streicht über die bunten Wandreliefs aus Gips. Manche zeigen den König, wie er gefiederte Pfeile vom Bogen schnellen lässt, wilde Tiere jagt oder Feinde niedermetzelt. Andere zeigen ihn im zweirädrigen Streitwagen auf Pferde einpeitschend, deren Geschirr mit Dreifachquasten geschmückt ist. Wieder andere stellen ihn dar, wie er Trankopfer auf Löwen gießt, um den Göttern für ihre Hilfe und ihren Schutz zu danken. Alle Reliefs zeigen die Pracht des assyrischen Reichs, männliche Überlegenheit und die Größe des Herrschers. Frauen sind nicht zu sehen — mit einer Ausnahme: Auf einem Relief trinken Assurbanipal und seine Königin Wein und erfreuen sich an einem Mahl in einem idyllischen Garten, während gleich daneben an den Ästen eines Baums der abgetrennte Kopf des feindlichen elamischen Königs Teumman zwischen reifen Früchten herabhängt.
Ohne auf den Tropfen in seinem Haar zu achten, geht der König weiter. Er eilt durch kostbar ausgestattete Gemächer und gelangt zu einer Tür mit kunstvollen Schnitzereien. Dieser Teil des Palasts ist ihm der liebste — die Bibliothek. Sie ist keine willkürlich zusammengestellte Sammlung von Schriften, sondern Assurbanipals größtes, stolzestes Werk, sein lebenslanger Traum, eine in Umfang und Ausmaß beispiellose Errungenschaft. Sie ist mehr als alles andere, was er erreicht hat, bedeutsamer als seine kriegerischen Eroberungen und politischen Siege. Sie ist sein Vermächtnis an künftige Generationen — ein auf der Welt beispielloses geistiges Denkmal.
Den Eingang zur Bibliothek säumen zwei Steinkolosse, Mischwesen, halb Mensch, halb Tier. Lamassus sind aus einem einzigen Kalksteinblock gehauene Schutzdämonen, aus dem Kopf eines Menschen, den Schwingen eines Adlers und dem massigen Körper eines Stiers oder Löwen zusammengesetzte Skulpturen. Mit der jeweils besten Eigenschaft dieser drei Arten versehen, stehen sie für die menschliche Intelligenz, die Kraft des Bullen oder Löwen und den scharfen Vogelblick. Die Lamassus sind die Hüter der Türen, die sich in andere Gefilde öffnen.
Die meisten Lamassus im Palast haben fünf Beine, sodass sie, von vorn betrachtet, wie angewurzelt zu stehen scheinen; sieht man sie von der Seite, könnte man jedoch glauben, sie würden vorwärtsstürmen und selbst den fürchterlichsten Gegner niedertrampeln. Auf diese Weise können sie sich sowohl unerwünschten Besuchern entgegenstellen als auch alles im Schatten lauernde Böse abwehren. Der König hat es nie einem Menschen erzählt, aber er fühlt sich in ihrer Nähe ruhiger und sicherer, weshalb er erst neulich Künstler damit beauftragt hat, zwölf weitere Statuen zu meißeln. Schutz gibt es nie genug.
Mit diesen Gedanken betritt Assurbanipal die Bibliothek. Ein Raum folgt auf den anderen, und jeder ist vom Boden bis zur Decke mit Regalen versehen, die Tausende akkurat nach Themen geordnete Tontafeln enthalten. Die Tafeln hat man von nah und fern in die Stadt gebracht. Einige wurden vor dem Zerfall gerettet, einige ihren Besitzern für wenig Geld abgekauft, doch die meisten wurden geraubt. Sie enthalten alle möglichen Informationen — von Verträgen und Handelsabkommen über Heilverfahren bis hin zu Sternkarten. Denn das weiß der König: Wer andere Kulturen beherrschen will, muss nicht nur ihr Land, ihre Ernten und ihr Vermögen an sich reißen, sondern auch die gemeinsame Vorstellungskraft der Menschen, die Erinnerungen, die sie miteinander teilen.
Mit raschen Schritten durchquert Assurbanipal die Abteilungen der Bibliothek, in denen Schriften über Omen, Zaubersprüche, Rituale, Arzneien und Verwünschungen aufbewahrt werden, in denen Litaneien, Klagelieder, Beschwörungsformeln, Lobgesänge, Märchen, Sprichwörter und Trauergedichte aus allen Winkeln seines Reichs zu finden sind. Er eilt durch eine umfangreiche Sammlung von Tafeln, auf denen geschrieben steht, wie man mithilfe der Eingeweide von Opfertieren das Schicksal von Menschen und die Intrigen der Götter vorhersagt. Obwohl er die Tradition des Haruspiziums ehrt und regelmäßig Schafe und Ziegen schlachten und ihre Lebern und Gallenblasen durch Orakel deuten lässt, hat er nicht vor, die Auspizien an diesem Tag einzuholen. Ihn zieht es in einen von einem schweren Vorhang halb verborgenen Raum ganz hinten. Diesen abgesonderten Teil dürfen nur der König und sein wichtigster Berater betreten, den er als seinen zweiten Vater empfindet — ein überaus gelehrter Mann, von dem der König schon als Kind betreut und unterrichtet worden ist.
In den Mauernischen vor dem Eingang zu diesem privaten Bereich stehen mit Sesamöl gefüllte Bronzelampen, aus denen sich Rauch in die Höhe schlängelt. Der König ergreift eine Lampe und schließt den Vorhang hinter sich. Drinnen ist es so gespenstisch still, als hätten die Regale mit angehaltenem Atem auf ihn gewartet.
Der Regentropfen erschauert. Weil es hier weder Fenster noch Feuerschalen gibt, ist es so kalt, dass er befürchtet, er könnte sich in Eiskristalle verwandeln. Es ist noch nicht lange her, dass er Dampf war und sich verflüssigt hat; da will er nicht jetzt schon fest werden, ohne die neue Lebensphase ausgekostet zu haben. Doch er zittert auch aus einem anderen Grund. Der Raum verunsichert ihn — er ist nicht von dieser Welt und nicht von der jenseitigen, sondern ein Spalt zwischen dem Irdischen und dem Überirdischen, irgendwo zwischen deutlich sichtbaren Dingen und solchen gelegen, die nicht nur unsichtbar sind, sondern auch unsichtbar bleiben sollen.
Zielstrebig und mit sicherem Schritt geht Assurbanipal zu einem Tisch in der Mitte des Raums, auf dem ein Kästchen aus Zedernholz steht. Der König stellt die Lampe ab. Das Licht meißelt Schatten in sein Gesicht, vertieft die Falten an den Augenwinkeln. Wie im Traum streichen seine Finger über das Holz, dem immer noch der Duft des Zedernwalds entströmt, aus dem es stammt. Nadelbäume von solcher Qualität findet man im Zweistromland kaum, deshalb werden die Zedern im Taurusgebirge gefällt und auf Flößen den Tigris hinuntergebracht.
In dem Kästchen liegt ein Gedicht, so alt und bekannt, dass man es sich in Mesopotamien und Anatolien, in Persien und in der Levante immer und immer wieder erzählt hat. Schon lange bevor sie niedergeschrieben wurde, haben die Großmütter die Geschichte an ihre Enkel weitergegeben. Sie handelt vom Helden Gilgamesch.
Assurbanipal kennt das ganze Gedicht so gut wie die Linien in seinen Händen. Er hat sich schon als Kronprinz darin vertieft. Weil er der dritte Sohn und jüngste Erbe war, hat damals niemand damit gerechnet, dass er einmal König sein würde, und während man seine älteren Brüder in Kampfkunst, Kriegsführung und Diplomatie unterwies, lehrte man ihn Philosophie, Geschichte, Wahrsagerei mithilfe von Öl, Sprachen und Literatur. Als sein Vater ihn zu seinem Nachfolger machte, überraschte das alle, auch ihn selbst, und mit ihm bestieg der belesenste und kultivierteste Herrscher den Thron, den das Reich je besessen hat. Von den vielen geschriebenen Texten, die er seit Jugendtagen studiert hat, ist ihm das Gilgamesch-Epos noch immer der liebste.
Der König öffnet das Kästchen, in dem eine einzige Tafel liegt. Im Gegensatz zu allen anderen Tafeln in der Bibliothek ist diese farbig — sie trägt das Blau rastloser Flüsse. Der Text ist nicht in rotbraunen Ton geritzt, sondern in eine Tafel aus Lapislazuli, einem ganz besonderen, den Göttern vorbehaltenen Stein. Die Schrift ist akkurat und formvollendet ausgeführt. Assurbanipal berührt die Kerben so zart und vorsichtig, als wollte er sie streicheln. Langsam senkt er den Blick auf die Verse, die ihn noch immer wie beim ersten Mal berühren, obwohl er sie schon so oft gelesen hat.
Der die Tiefe sah …
Geheimes sah er, Verborgenes tat er auf,
er brachte Kunde von der Zeit vor der Flut.
Manche Könige lieben Gold und Rubine, manche Seidenstoffe und Wandteppiche, andere die fleischlichen Freuden. Assurbanipal liebt Geschichten. Er glaubt nicht, dass man wie Gilgamesch eine gefährliche Reise antreten muss, um ein erfolgreicher Herrscher zu werden. Dass man ein siegreicher Krieger mit kräftigem, sehnigem Körper sein sollte oder Überwinder von Wäldern, Gebirgen und Wüsten, aus denen nur wenige wiederkehren. Nein, man braucht nur eine einprägsame Geschichte, in der man der Held ist.
Doch sosehr der König Geschichten schätzt, so wenig vertraut er denen, die sie erzählen. Die Fantasie dieser Leute kann nicht an einem Ort bleiben, sondern ändert wie der Tigris im Frühling unvorhersehbar die Richtung, mäandert in immer weiter ausgreifenden Windungen und biegt sich zu planlos entstehenden Schleifen, ungezähmt und wild bis zum Schluss. Als er die Bibliothek errichtete, wusste er, dass es noch andere Versionen des Gilgamesch-Epos gibt, die jahrhundertelang von Schreibern kopiert und wieder kopiert worden sind, sodass auch neue Fassungen entstanden. Er schickte Boten aus, die ihm von nah und fern Tontafeln bringen sollten, damit er seiner Sammlung jede mögliche Variante einverleiben konnte. Und diese gewaltige Aufgabe wurde erfüllt, dessen ist er sich sicher. Doch die Tafel in dem Zedernholzkästchen unterscheidet sich von allen anderen in seiner Bibliothek — nicht nur weil dieser Text in kostbaren Stein statt in Ton geschrieben wurde, sondern auch weil er gotteslästerlich ist.
Der König hält die Tafel ins Licht der Lampe und betrachtet den vertrauten Text. Der Schreiber, wer immer er war, hat seine Arbeit zwar ordentlich gemacht, am Ende allerdings eine Bemerkung hinzugefügt.
Dies ist das Werk eines kleinen Schreibers,
eines der vielen Barden, Balladensänger und Erzähler,
die auf der Erde wandeln.
Wir weben aus jedem Atemzug Gedichte, Geschichten und Lieder.
Möget ihr uns in Erinnerung behalten.
Ein sehr ungewöhnlicher Zusatz. Doch das eigentlich Verstörende ist die Widmung, die darauf folgt:
Gepriesen sei Nisaba
Heute und alle Zeit!
Die Miene des Königs wird hart, sein Blick finster. Das Blut pocht wütend in seinen Schläfen.
Nisaba, die Göttin der Erzählkunst, ist ein Numen aus der Vergangenheit, ein in Vergessenheit geratener Name. Ihre Zeit ist vorbei, auch wenn sie in abgelegenen Teilen des Reichs noch von einigen ungebildeten Frauen verehrt wird, die an der alten Überlieferung festhalten. Sie ist längst durch eine andere Gottheit verdrängt. Inzwischen sind alle Tafeln im Reich dem mächtigen männlichen Nabu gewidmet statt der ätherischen weiblichen Nisaba. So hat es zu sein, sagt sich der König. Das Schreiben ist eine männliche Arbeit und erfordert männlichen Schutz, einen männlichen Gott. Nabu ist zum amtlichen Hüter der Schreiber und zum Wächter über alles Wissen geworden, das es wert ist, aufbewahrt zu werden. In der Schule bringt man den Kindern bei, jede Tafel am Ende mit der entsprechenden Inschrift zu versehen:
Gepriesen sei Nabu!
Wäre die blaue Tafel alt, ein Relikt der Vergangenheit, würde sich niemand an dem Nachsatz stören. Doch der König ist überzeugt, dass sie aus jüngster Zeit stammt, denn die schriftliche Ausführung ist modern. Mit der Huldigung einer vergessenen und verbotenen Göttin und der Missachtung von Nabus Macht — und damit der Befehle des Königs — hat der Kopist dieses Teils des Gilgamesch-Epos bewusst die Regeln gebrochen. Assurbanipal hätte die Tafel zerstören lassen können, brachte das aber nicht über sich. Deshalb muss das blasphemische Schriftstück abgesondert vom Rest der Bibliothek in diesem Raum versteckt und den Blicken der unwissenden Massen entzogen werden. Nicht jedes geschriebene Wort ist für die Augen jedes beliebigen Lesers gedacht — so wie nicht jedes gesprochene Wort von jedem Lauscher gehört werden muss. Das Volk darf nie etwas von der Existenz der blauen Tafel erfahren, damit es nicht auf Irrwege gerät. Die Unbotmäßigkeit eines einzigen Mannes kann viele Rebellen ermutigen, wenn nichts dagegen getan wird und sie unbestraft bleibt.
*
Während der Regen weiter auf Ninive fällt, ist der König in der Abgeschiedenheit seiner Bibliothek in die blaue Tafel vertieft. Eine Zeit lang vergisst er alles — die Verschwörungen seines älteren Bruders in Babylon, mit denen sich dieser des Throns bemächtigen will, die Intrigen am Königshof, die Aufstände diesseits und jenseits der Reichsgrenzen in Anatolien, Medien, Urartu, Ägypten, Syrien, Kilikien und Elam. Das alles kann warten. Sobald er sich in Gilgameschs Abenteuern verliert, bringt ihn nichts aus der Ruhe. Und doch geschieht es an diesem Tag, ganz unerwartet.
Draußen im Gang wird es laut — schrille, verstörende Töne. Mit der einen Hand seinen Dolch, mit der anderen die Tafel umklammernd, stürzt Assurbanipal aus der Bibliothek.
»Wer wagt es, sich dem König zu nähern?«
»Mein Herr, meine Sonne, vergib die Störung.« Der Militärkommandant, ein wortkarger Mensch, senkt den Kopf.
Hinter ihm zerren vier Soldaten einen Mann mit sich, dessen grobes Gewand mit getrocknetem Erbrochenem und frischem Blut befleckt ist. Er schluchzt und heult hemmungslos in den Jutesack, der sein Gesicht verhüllt.
»Erkläre diese schwere Übertretung! Sprich!«, befiehlt der König.
»Mein Herr, wir haben den lange gesuchten Verräter gefasst. Er hat seine Übeltaten gestanden.«
Einer der Soldaten zieht dem Gefangenen den Sack vom Kopf.
Kurz zuckt Traurigkeit über das Gesicht von Assurbanipal, doch sie verschwindet so schnell, wie sie gekommen ist. Der König kneift die Augen zusammen, als würde er etwas betrachten, das rasch in die Ferne verschwindet, sieht den Gefangenen jedoch unverwandt an — seinen einstigen Berater und Lehrer, den Vertrauten, der ihm näherstand als sein eigener Vater. Man hat den Mann so heftig geschlagen und gefoltert, dass sein Gesicht entstellt ist und dort, wo seine Zähne waren, ein grässliches, mit Eiter und Blut verkrustetes Loch klafft. Er hält sich kaum auf den Beinen.
»Mein edler König«, sagt der Militärkommandant. »Bei den Göttern Asur, Ischtar, Schamasch und Nabu: Der oberste Berater ist ein Spion. Er hat deinem Bruder die wichtigen Geheimnisse zugespielt. Zunächst hat er seine Verbrechen geleugnet, doch angesichts der unanfechtbaren Beweise, die wir ihm vorgelegt haben, konnte er nicht weiterlügen.«
Der Kommandant greift in die Tasche, die er sich über die Schulter gehängt hat, zieht eine Tafel heraus und zeigt sie dem König. Es handelt sich um einen Brief des obersten Beraters an Assurbanipals Bruder, in dem der Absender Treue schwört und Unterstützung anbietet — um einen Brief, der das Ausmaß des Verrats ohne jeden Zweifel beweist.
»Wo habt ihr das gefunden?«, fragt der König. Seine Stimme klingt trocken wie Treibholz.
»Unter den Habseligkeiten eines feindlichen Soldaten, der aufgegriffen wurde, als er die Grenze überschritt. Er trug das Siegel des obersten Beraters bei sich und gestand, dass er unter dessen Befehl steht.«
Assurbanipal wendet sich langsam dem Gefangenen zu. »Wie konntest du das tun?«
»Mein König …« Der Gefesselte krächzt, sein Atem rasselt in der Brust. Das linke Auge ist zugeschwollen und das lädierte, blutunterlaufene rechte zuckt in der Höhle wie ein gefangener Vogel. »Du warst noch ein Kind, als man dich zu mir brachte, erinnerst du dich? Habe ich dir nicht gezeigt, wie man schreibt und rechnet? Habe ich dich nicht die Liebe zu den Balladen und das Dichten gelehrt? Gnade — um der alten Zeiten willen!«
»Wie du das tun konntest, habe ich dich gefragt!«
Es wird still. Das Schweigen dröhnt immer lauter.
»Wasser …«, murmelt der Gefangene. Einen Moment lang denken sie, er hätte um etwas zu trinken gebeten, doch dann spricht er weiter. »Es ist ein Geschenk der Götter, es gibt uns Leben, Freude, Wohlstand. Du aber, Herr, hast es in eine tödliche Waffe verwandelt. Im Ulai schwimmen keine Fische mehr. Du hast den Fluss mit so vielen Leichen verstopft, dass sein Wasser die Farbe rotgefärbter Wolle angenommen hat. Deine Untertanen verhungern, mein König. Die ganze Ebene ist übersät mit Toten und Sterbenden. Und nun willst du das Gleiche in Castrum Kefa tun, heißt es …«
Castrum Kefa, »die Felsenburg«. Die große, ummauerte Stadt nördlich von Ninive, am Ufer des oberen Tigris. Der König scheint sich zu erinnern und fragt:
»Kam nicht dein Vater aus einem Dorf dort in der Nähe?«
»Meine Leute … Du hast an jeden Brunnen Wachen postieren lassen, damit niemand Wasser holt. Du hast die Quellen vergiftet. Die Menschen schlachten ihr Vieh und trinken das Blut, um ihren Durst zu stillen. Die Mütter haben keine Milch mehr für ihre Kinder. Mein König, deine Grausamkeit ist grenzenlos.«
Der Militärkommandant verpasst dem Gefangenen einen Schlag unter die Rippen. Der Mann krümmt sich und hustet Blut. Doch dann richtet er sich erstaunlich schnell wieder auf, und sein eines geöffnetes Auge sieht, was der König im Arm hält.
»Ah, die blaue Tafel … die kleine Gotteslästerung«, sagt der Gefangene, und sein Mund verzieht sich zu einem matten Lächeln. »Mein König war noch ein junger Prinz, als wir sie zum ersten Mal gemeinsam gelesen haben. Mein Herr hat sie von Anfang an geliebt. Hat unsere Lektüre solcher Dichtkunst keine unvergesslichen Erinnerungen in dir zurückgelassen?«
Mag sein, dass auch dem König die friedlichen Nachmittage seiner Kindheit im Gedächtnis geblieben sind, als er gemeinsam mit seinem Lehrer Gedichte deklamierte, doch er schweigt.
»Gilgamesch …«, sagt der Gefangene. »Er reiste ans Ende der Welt, um den Tod zu besiegen — und scheiterte, weil er nicht begriff, dass man nur dann unsterblich wird, wenn man nach dem Tod in Erinnerung bleibt, und in Erinnerung bleibt man nur mit einer guten Geschichte. Warum hast du beschlossen, deine Geschichte so herzlos werden zu lassen, mein König?«
Der Militärkommandant tritt vor und wartet auf den Befehl, den Mann zu töten. Doch Assurbanipal hebt die Hand und gebietet ihm Einhalt. Mit gesenktem Kopf fragt der Militärkommandant: »Möchte mein Herr den todbringenden Hieb tun?«
Der Gefangene beginnt zu weinen. Es ist ein leiser, würdevoller Laut tief aus der Brust, den er nicht kontrollieren kann. Die Soldaten, die ihn halten, treten von einem Fuß auf den anderen, während sie gespannt auf die Entscheidung des Königs warten.
Doch Assurbanipal wird seinen alten Lehrer nicht töten. Auch auf dem Schlachtfeld führt er nur ungern den Angriff, befiehlt lieber vom sicheren Thron herunter Massaker, Zerstörung, Schändung und Raub — oder, wie es häufig vorkommt, aus der Stille seiner Bibliothek heraus. Er hat schon die Plünderung ganzer Städte und den herbeigeführten Hungertod Tausender überwacht und Menschen gezwungen, die Leichen ihrer Verwandten zu essen. Er hat Städte dem Erdboden gleichgemacht, Tempel in Schutt und Asche gelegt, Salz über frisch gepflügtes Ackerland verstreut, Rebellenführer bei lebendigem Leib gehäutet und ihre Anhänger an Pfählen aufgehängt, sodass ihr Fleisch »den Vögeln des Himmels und den Fischen der Tiefe« zur Speise wurde. Er hat seinen Gegnern die Kinnbacken mit Hundeketten durchbohrt und sie in Zwingern gehalten, hat die Gräber der Vorfahren seiner Feinde entweiht, damit nicht einmal die Geister in Frieden ruhen … All das und noch viel mehr hat er von seinem Lesekabinett aus betrieben. Er macht sich die Hände nicht schmutzig, denn schließlich ist er ein gelehrter König, ein Intellektueller, der sich mit himmlischen wie irdischen Vorzeichen auskennt. Im Gegensatz zu seinen erlauchten Ahnen liest er nicht nur akkadische Texte, sondern auch schwer verständliche sumerische, die den meisten ein Rätsel bleiben würden. Er weiß mit Orakeln, Priestern und Philosophen zu streiten. Er ist kein Mann von roher Gewalt und blindem Zorn. Er ist ein Mann des Geistes, der Ideale.
Als der Militärkommandant die Zurückhaltung seines Königs spürt, räuspert er sich und sagt: »Wenn mir mein Herr seinen edlen Dolch übergibt oder mich meine eigene Klinge benutzen lässt, durchbohre ich das Herz dieses Verräters.«
»Nicht nötig«, erwidert Assurbanipal. »Wir wollen sein Blut nicht vergießen.«
Über das misshandelte Gesicht des Gefangenen huscht einen Moment lang Hoffnung.
Assurbanipal sieht nicht seinen Lehrer an, sondern starrt über dessen Schulter hinweg auf ein Wandrelief. Er betrachtet das Bild eine Weile — eine Jagdgesellschaft in der Ebene von Ninive, angeführt vom König, der im Galopp einen fliehenden Löwen verfolgt und ihn im nächsten Augenblick auf seinen Speer spießen wird. Wie von einem unsichtbaren Faden gezogen geht der König auf das Relief zu. Dicht davor nimmt er eine Fackel aus der Halterung und führt sie an das Bild heran. Im flackernden Licht erwachen die dargestellten Figuren zum Leben — der Jäger, der Speer, die Beute.
Mit einem Blick über die Schulter — die blaue Tafel hält er noch immer in einer Hand — reicht der König dem Militärkommandanten die Fackel. Dann sagt er in einem Ton, der kein Widerwort duldet: »Verbrennen!«
Aus dem Gesicht des Kommandanten weicht alle Farbe. Er zögert, aber nur kurz.
*
Ein in Flammen gehüllter Mann läuft durch die Gänge des Nordpalasts in Ninive. Sein Körper stößt rechts und links an die Bilder, mit denen die Wände geschmückt sind. Seine schrillen Schreie hallen durch die Korridore, werden vom hohen Deckengewölbe zurückgeworfen und jagen den Dienern Schauer über den Rücken. Sein verzweifeltes Gebrüll dringt bis vor die großen Tore und ist noch auf den fernen Plantagenfeldern zu hören, wo in verschwenderischer Fülle Weizen und Gerste wachsen, und in den sandigen Buchten, wo der Tagesfang aus den Fischerbooten geholt wird. Die Möwen, die seit Stunden ruhig gewesen sind, ergreifen, von dem grausigen Lärm aufgeschreckt, alle gleichzeitig die Flucht und fliegen in wirren Kreisen über der Stadt.
Würde der Gefangene zum Chosr gelangen, dem Nebenfluss des Tigris, der sich durch die Stadtmitte schlängelt, oder zum nahe gelegenen Maschki-Tor, wo viele Wasserträger stehen, hätte er eine Chance, gerettet zu werden. Doch gefangen in seiner stetig wachsenden eigenen Hölle, stößt er an einen Lamassu, der die königliche Bibliothek bewacht, und prallt gegen den rechten Vorderhuf, während ihn das Feuer mit wachsender Wut verzehrt.
Einst brachten Gedichte und Geschichten Freude in sein Leben, und das Lesen gehörte so sehr zu ihm wie der Drang zu atmen. Nichts hat ihm mehr Vergnügen bereitet, als den jungen Prinzen zu unterrichten, auf prallen Kissen ruhend mit ihm über Literatur zu sprechen, das Gilgamesch-Epos zu lesen und die Schönheit der Welt zu bestaunen. Hat er aus jenem sanften Jungen mit dem stillen Lächeln ein Ungeheuer gemacht, oder war das Ungeheuer von Anfang an in dem Kind? Er wird es nie erfahren. Sein Körper ist jetzt ein Ofen, der Wörter verfeuert und alle Verse, die der gelehrte Mann je gelesen hat, zu Asche verbrennt.
Während Assurbanipal — Herrscher über das wohlhabendste Imperium der gesamten Welt, letzter großer Gebieter des Königreichs Assyrien, drittgeborener Sohn des Asarhaddon, dennoch zum Thronerben erkoren und Liebling seines Vaters, Gründer und Förderer einer herrlichen Bibliothek, die den Lauf der Geschichte verändern wird —, während Assurbanipal an diesem Nachmittag seinen früheren Lehrer und mit ihm seine Kindheitserinnerungen verbrennt, bleibt der Regentropfen im Haar des Königs verborgen. Allein, klein und verängstigt, wagt er es nicht, sich zu bewegen. Was er an diesem Tag gesehen hat, wird er niemals vergessen. Es hat ihn für immer verändert. Noch Jahrhunderte später wird eine Spur dieses Augenblicks in der elementaren Form des Tropfens enthalten sein.
Wellenförmig schwillt die Hitze an, nach und nach wird der Tropfen verdunsten. Doch er wird nicht verschwinden. Über kurz oder lang wird die durchsichtige kleine Wasserperle wieder zum Himmel aufsteigen und dort auf den rechten Augenblick warten, um erneut auf die gequälte Erde zu fallen … und wieder und wieder.
Das Wasser erinnert sich.
Nur die Menschen vergessen.
H2O
Wasser, die seltsamste Chemikalie, das größte Rätsel.
Zwei seitlich angeordnete Wasserstoffatome, jeweils an ein Sauerstoffatom in der Mitte gebunden. Ein gewinkeltes Molekül, kein lineares. Wäre es linear, gäbe es kein Leben auf der Erde … keine Geschichten zu erzählen.
Drei Atome binden sich aneinander und bilden Wasser: H-O-H.
Drei Figuren verbinden sich über die Grenzen von Zeit und Raum hinweg und ergeben diese Geschichte …
—O—
Arthur
Am Ufer der Themse, 1840
Der Winter kommt in diesem Jahr früh nach London, und sobald er da ist, will er nicht wieder fort. Schon im Oktober gibt es erste Schneeschauer, und von Tag zu Tag wird es kälter. Die Flechten an den Mauern, das Moos auf den Steinen und die Farne in den Ritzen sind mit Raureif überzogen und glitzern wie silberne Nadeln. Raupen und Frösche sind auf die kalte Zeit vorbereitet; sie bringen sich nach und nach zum Erstarren, um erst im nächsten Frühjahr wieder warm zu werden. Kaum ausgesprochen, verwandeln sich Gebete und Flüche in Eiszapfen, die an den kahlen Ästen hängen. Manchmal klirren sie im Wind — einzelne leise Glöckchentöne. Doch im Gegensatz zu früher friert die Themse trotz der Kälte nicht zu. Einige Jahrzehnte zuvor war die Eisdecke so dicht, dass man aus Spaß einen Elefanten darüberstapfen ließ und zwischen den Ufern Hockey spielen konnte. Diesmal gefriert sie nur an den Rändern, sodass ihr Wasser zwischen den beiden Säumen aus weißen Kristallen weiterhin fließen kann.
An dem scharfen, beißenden Gestank, der aus dem Fluss aufsteigt, ändert das Wetter — kalt oder warm, ruhig oder stürmisch — so gut wie nichts. Er dringt in die Poren, klebt an der Haut, durchströmt die Lunge. Die Themse — »Tamesis«, »Tems«, »Tamasa«, »die Dunkle« —, einst für ihr frisches Wasser und ihre wohlschmeckenden Lachse berühmt, ist mittlerweile schmutzig braun und trüb, von Industriemüll, fauligem Abfall, Chemikalien aus Fabriken, menschlichen Leichen und Rohabwasser verseucht. Niemals in seinem langen Leben war der Fluss so verwahrlost, einsam und ungeliebt.
Eine Wolke aus Staub, Ruß und Asche hängt über den Dächern und Kirchturmspitzen Londons, der bevölkerungsreichsten Stadt der Welt. Jede Woche rollt eine neue Welle von Zugereisten mit ihren Bündeln voller Träume heran, und die Kamine pusten noch mehr Albträume in die Luft. Während die Stadt wächst und ihre Grenzen sprengt, dringen ihr Unrat, ihre Ausscheidungen, ihr Geröll durch die Risse wie die Füllung, die aus einem alten Kissen quillt. Alles, was nicht mehr gebraucht wird, landet im Fluss. Treber aus den Brauereien, Faserbrei aus den Papierfabriken, Fleischabfälle aus den Schlachthöfen, Fellhaare aus den Gerbereien, Abwasser aus den Branntweindestillerien, Stoffreste aus den Färbereien, Fäkalien aus den Senkgruben und den Spülklosetts (der neuen Erfindung, die sich bei den Reichen und Privilegierten großer Beliebtheit erfreut). Alles wird in die Themse gekippt, tötet die Fische, tötet die Wasserpflanzen, tötet das Wasser.
Doch der Fluss schenkt auch, was niemand besser weiß als die toshers, unermüdliche Abfallsammler, Wildbeuter der Ufer. Unerschrocken und geduldig waten sie Kilometer um Kilometer im stinkenden Matsch. Manchmal gehen sie das Labyrinth der Kanalisation ab, das die Stadt kreuz und quer durchzieht, und stöbern in den Abwasserrinnsalen oder wühlen vom Ufer aus im Bodensatz des Flusses. Auf ihren Streifzügen durch die flüssige Welt halten sie Ausschau nach wertvollen Dingen unter und über der Erde.
Sie gehen üblicherweise bei Ebbe an die Arbeit, wenn sich der Wind gelegt hat und die Oberfläche des Stroms so matt und glatt ist wie ein blinder Spiegel, der kein Licht reflektiert. In den Tiefen des schmutzigen Wassers verbirgt sich immer etwas von Wert — Metallteile, Kupfermünzen, Silberbesteck, hin und wieder sogar eine Kristallbrosche oder ein Perlenohrring. Kostbarkeiten, die auf den Straßen und in den Parks der Stadt unbemerkt zu Boden gefallen sind, in die Gossen geschwemmt wurden und die lange, stinkende Strecke zu den Wellen der Themse zurückgelegt haben. Einige dieser Gegenstände kommen aus Oxford und reisen sogar noch weiter, andere verfangen sich im Schlamm und werden unter der dicken, glitschigen Schmiere begraben. Man weiß nie, was der Fluss gerade zu bieten hat, doch mit leeren Händen schickt er niemanden fort. Ein tüchtiger tosher verdient bis zu sechs Shillings am Tag.
Diese Tätigkeit ist nicht nur ekelerregend schmutzig, sondern birgt auch viele Gefahren — vor allem in den Abwassertunneln. Am besten arbeiten die Leute als Gruppe, denn in Londons kompliziertem unterirdischem Gangsystem verirrt man sich leicht und erreicht womöglich nie wieder die Oberfläche. Außerdem kann es immer sein, dass ohne Vorwarnung ganz in der Nähe ein Schleusentor geöffnet wird, während man herumstöbert, und eine Flutwelle durch die Tunnel rauscht. Wenn man sich dann nirgends festhalten kann oder niemanden hat, der einen am Kragen packt, wird man aller Wahrscheinlichkeit nach von dem Schwall fortgerissen, die Lunge füllt sich mit Exkrementen, und man ertrinkt. Obendrein besteht die Gefahr, in eine Gasblase zu greifen, die sich unter vielen Schichten Schmutz gebildet hat — eine unglückselige Erfahrung. Die Explosion, die dabei ausgelöst werden kann, ist so stark, als hätte Schießpulver Feuer gefangen. Man stirbt sofort oder, noch schlimmer, muss sein Leben entsetzlich versehrt zu Ende bringen. Denn der Fluss nimmt auch, und das weiß niemand besser als die toshers.
An diesem eiskalten Morgen Ende November stapft eine aus acht Menschen bestehende Gruppe in Chelsea am nördlichen Ufer der Themse entlang. Die Stiefel schmatzen im Schlick, und alle paar Schritte stechen die Leute ihre langen Stangen in den Dreck, um zu prüfen, ob etwas Brauchbares darin liegt. Die Laternen, die sie sich vor die Brust gebunden haben, werfen goldene Streifen voraus und verleihen ihren Gesichtern eine gespenstische Blässe. Die Tücher, die sie um den Mund gewickelt tragen, um den üblen Geruch abzuhalten, bewirken nichts. Außerdem tragen sie weite Mäntel aus Samt mit übergroßen Taschen und dicke Handschuhe als Schutz vor dem Unrat — und vor den Angriffen der Ratten, die groß wie Katzen sein können. Die letzte Person in der Gruppe, eine junge Frau mit scheuem Lächeln und sommersprossigen Wangen, kann ihren Mantel nur zur Hälfte über ihren dicken Bauch ziehen. Sie muss arbeiten, obwohl sie hochschwanger ist. Allerdings hat ihr die Hebamme versichert, dass das Kind frühestens in vier Wochen kommt.
Die Gruppe nähert sich einer Biegung im Fluss. An dieser Stelle ragen die Äste einer fast auf dem Boden liegenden Eiche über das Wasser. Während die anderen den Morast durchsuchen, bleibt die junge Frau stehen, um zu verschnaufen. Sie wischt die Schweißperlen weg, die sich trotz des schneidenden Winds auf ihrer Stirn gebildet haben.
Ihr Blick schweift über die Furchen und Erhöhungen in der Eichenrinde. Es ist ungewöhnlich, dass sich ein Baum so stark krümmt, als wäre er in ein trauliches Gespräch mit dem Fluss vertieft. Worüber mögen sich die beiden unterhalten? Sie muss schmunzeln. Während sie darüber nachdenkt, durchfährt es sie plötzlich wie ein Stich. Ihr Herz beginnt schneller zu schlagen, doch sie versucht, nicht auf den Schmerz zu achten. Es ist für sie bisher nicht gut gelaufen; sie hat nur einen kleinen Ring gefunden und wird erst wissen, was er wert ist, wenn sie den Schmutz entfernt hat und beim Pfandleiher war. Trotzdem hat sie ihn sich aus Angst, ihren einzigen Fund zu verlieren, an den Finger gesteckt.
Wieder ein Stich — diesmal so stark, dass sie fast keine Luft mehr bekommt. Sie schleppt sich aus dem Wasser heraus, stapft müde zu dem Baum und lehnt sich schwer atmend an den Stamm. Jetzt ist sie dankbar für seine ungewöhnliche Form. Der krampfartige Schmerz klingt ab, kehrt aber kurz darauf umso stärker zurück. Sie drückt ihre Hand an ihren Bauch und stöhnt auf.
»O Gott!«
Ein anderes Mitglied der Gruppe, eine kräftige alte Frau mit durchsichtigen blauen Tränensäcken, eilt zu ihr.
»Was hast du, Arabella? Ist dir nicht wohl?«
»Das Kind — meinst du, es könnte schon kommen? Eigentlich ist es viel zu früh.«
Sie blicken sich um — die eine in heller Panik, die andere in heimlicher Sorge. Doch nicht hier! Doch nicht jetzt! Welches Kind will an einem so feuchten, stinkenden Ort geboren werden, an einem von Kot und Abfall überquellenden Fluss!
»Soll ich nach deinem Mann schicken lassen?«, fragt die alte Frau. Sie hat es sehr leise gesagt, denn sie glaubt die Antwort zu kennen.
Arabella wohnt nicht weit weg in einem Elendsquartier in einem Teil von Chelsea, der World’s End genannt wird — Ende der Welt. Ihr Mann ist Schreiner, und ein so guter, dass er einmal im Auftrag des Buckingham Palace eine Kommode für die Königsfamilie getischlert hat. Allerdings zittern ihm die Hände inzwischen wegen seiner Trunksucht so stark, dass er kaum noch arbeiten kann.
»Nach meinem Mann?«, erwidert Arabella. »Den habe ich seit Wochen nicht gesehen.«
»Gut, dann müssen wir es selbst schaffen«, sagt die alte Frau und versucht, nicht traurig zu klingen. »Als Erstes bringen wir dich nach Hause, wo du es bequem hast.«
Arabella nickt, doch ihr Atem wird flacher und schneller. Beim Aufstehen beginnt sie zu taumeln und verliert kurz die Balance. Sie verzieht das Gesicht — mehr vor Schreck als vor Schmerz —, denn eine warme Flüssigkeit rinnt an ihren Beinen hinunter. Entsetzt starrt sie auf die Pfütze zu ihren Füßen.
»Oh nein! Viel zu früh!«
Die anderen toshers haben ihre Suche unterbrochen und beobachten die Szene vom Wasserrand aus. Einer ruft über den Lärm der Strömung hinweg:
»He! Alles in Ordnung da drüben?«
Die alte Frau schüttelt heftig den Kopf. »Es gibt ein Problem. Gott steh uns bei!«
»Was faselst du da?«
»Kommt raus und helft uns! Los, kommt, aber schnell! Unserer Arabella ist das Wasser abgegangen!«
*
Die toshers, die sofort zu Hilfe eilen und selbstlos ihre Mäntel auf das schlammige Flussufer legen, ahnen nicht, dass in diesem Augenblick auch bei einer anderen werdenden Mutter in London, die mit ihrem ersten Kind schwanger ist, die Wehen einsetzen. Queen Victoria, erst einundzwanzig, kreißt in einem behaglichen Zimmer im Buckingham Palace. Dass Ihre Majestät es verabscheut, schwanger zu sein, ist ein offenes Geheimnis. Sie kann es kaum erwarten, die harte Zeit in ihrem Leben hinter sich zu bringen, in der sie weder tanzen noch reiten durfte. Die junge Königin — von ihrem Gatten »Gutes Weibchen« genannt — hofft, einen männlichen Thronfolger zu gebären, damit sie nie wieder ein Kind auf die Welt bringen muss. Prince Albert ist bei ihr; er hält ihre Hand, redet beruhigend auf sie ein, gesellt sich aber schließlich zu den draußen vor dem Zimmer wartenden Ministern. Die Wiege in der Ecke — aus bestem Mahagoni und mit smaragdgrüner Seide ausgekleidet — hat die Form einer Muschel. Die maritime Anspielung passt perfekt zum erstgeborenen Kind der Königin der Meere und weist auf den Ruhm und Glanz Englands hin, dessen Symbol, die weiße Rose, als Stickerei die Bettdecke ziert.
Als das Königinnenkind nach qualvollen Stunden das Licht der Welt erblickt, lächelt der Arzt bedauernd.
»Leider ein Mädchen, Majestät.«
Die Königin hebt trotz ihrer Bestürzung matt die Hand. »Schon gut. Das nächste wird ein Junge.« Zum Glück stehen mehrere Kindermädchen mit hervorragenden Referenzen bereit.
Als das Themse-Kind nach qualvollen Stunden das Licht der Welt erblickt, ruft einer der toshers fröhlich:
»Arabella lebe hoch, es ist ein Junge!«
Die junge Mutter stützt sich auf die Ellbogen und reckt den Hals, um ihren Sohn zu betrachten. Seine winzigen Finger, rosigen Zehen, rundlichen Bäckchen … Er ist wunderschön. Ihr kommen die Tränen. Welche Aussichten hat ein so unschuldiges, liebes Wesen in einer Welt voller Sünde, Kummer und Leid?
»Kopf hoch, Mädchen! Warum so niedergeschlagen?«, sagt die alte Frau in tadelndem Ton. »Kannst stolz auf dich sein — das Kind lebt und ist gesund.«
Doch Arabella weint so bitterlich, dass sie kaum sprechen kann.
»Na, na, das wird schon. Sag, welchen Namen wirst du ihm geben?«
Als auch auf diese Frage keine Antwort folgt, steuern die anderen toshers Vorschläge bei.
»Nenn ihn Themse — das ist genau der richtige Name!«, sagt einer.
»Ja, dann ist er Vater Themse, wenn er erwachsen ist.«
»Und wenn er lange lebt, ist er irgendwann Großvater Themse.«
»Wie wär’s mit Thomas — das klingt fast wie Themse.«
»Unsinn, du nennst ihn einfach Jack«, wirft ein anderer ein. »Ich war mein Leben lang ein Jack — ist gar nicht schlimm.«
»Das sehe ich anders!«
»Was haltet ihr von Albert?«, fragt einer. »Wenn der Name für den Mann der Königin gut genug ist, reicht er für das kleine Kerlchen allemal.«
»Ach, halt den Mund! Was redest du da?«, fährt ihn die alte Frau an. »Ängstlich und feig ist er, dein Prince Albert, der verweichlichte Mensch. Weißt du nicht, dass er nicht um die Hand von Victoria angehalten hat? Sie hat ihm den Antrag gemacht! Wahrlich nicht der beste Mann für unsere gute Königin. Mit dem würde nicht einmal ich mich zufriedengeben!«
Alle kichern und feixen — bis Arabellas schrille Stimme den Lärm durchdringt.
»Werft ihn in den Fluss!«
Einer gluckst vernehmlich, weil er den Ausruf für einen weiteren Scherz über die Mitglieder der Königsfamilie hält, deren Leben so vollkommen anders ist als das ihre. Doch der Rest der Gruppe ist verstummt. Während nach und nach alle die Bedeutung von Arabellas Worten erfassen, wird das Entsetzen förmlich greifbar. Die toshers sehen einander so schuldbewusst an, als wären sie Teil von etwas Verdorbenem, Abgründigem geworden, nur weil sie das Unsagbare gehört haben.
»Was redest du, Mädchen?«, murmelt die alte Frau in das tiefe Schweigen hinein.
»Schmeißt das Kind ins Wasser. Ich kann es nicht großziehen. Soll sich die Themse um meinen Sohn kümmern.«
»Sch! Du versündigst dich!«
Die junge Mutter schlägt die Hände vors Gesicht und stößt einen erstickten, kehligen Schrei aus. Obwohl sie selbst kaum fassen kann, was sie gleich sagen wird, gelingt es ihr nicht, zu verhindern, dass es aus ihr hervorbricht.
»Ich kann das Kind nicht behalten. Ich finde ja kaum genug für mein eigenes Essen. Die meiste Zeit hungere ich. Mein Mann, dieser Taugenichts, hat sich mit ganz schlimmen Leuten eingelassen! Immer ist er wütend, nie nüchtern, und er arbeitet nicht. Wenn er vom Alkohol ohnmächtig wird, ist das für mich ein Segen! Meint ihr, ein Mann, der seine Frau schlägt, vergreift sich nicht auch an seinem Sohn? Mein armes Kind …«
Die alte Frau reckt das Kinn und schüttelt den Kopf. »Du hörst mir jetzt zu!«
»Du verstehst nicht, was ich — «
»Jedes Wort habe ich verstanden, und ich sage dir, dass dieser Junge dein Leben schöner machen wird — das spüre ich ganz deutlich. Gib ihm ein bisschen Essen und ein bisschen Liebe, und du wirst sehr viel mehr von ihm zurückbekommen. Er wird deine Last leichter machen, und du wirst stolz auf ihn sein. Keine Sorge, alles wird gut.«
Arabella weint jetzt lauter. Bei jedem Schluchzer beben ihre Schultern, und ihre Zähne klappern vor Kälte und Angst.
Die alte Frau seufzt. Sie hat Hebammen von einem rätselhaften Zustand erzählen hören, den sie »Kindbettwahnsinn« nannten und der angeblich frischgebackene Mütter befällt, ihnen den Verstand raubt und sie in so abgrundtiefe Verzweiflung stürzt, dass manche nie wieder herausfinden. Und sie weiß, dass die Behandlung darin besteht, der Patientin Abführmittel zu geben, sie zu schröpfen, zur Ader zu lassen und ihr große Mengen Opiate zu verabreichen.
Leise fragt sie die anderen: »Wie können wir sie aufheitern? Das arme Ding hat das heulende Elend.«
»Gib ihr davon«, sagt ein Mann und hält ihr eine Flasche mit einer trübbraunen Flüssigkeit hin.
Laudanum. Ein Mittel, das die Nerven beruhigt, Schmerzen lindert und obendrein gegen Frauenleiden helfen soll. Es schmeckt zwar schrecklich bitter, riecht aber sehr süß, denn es besteht aus Zimt, Safran, Alkohol und Schlafmohnextrakt.
Sie drängen Arabella, einen Schluck zu trinken, und dann noch ein bisschen mehr, sicherheitshalber. Sie fügt sich. Ihr Kopf sinkt auf die Brust, ihre Arme erschlaffen. Erschöpft und verzweifelt, wie sie ist, fällt die junge Frau in tiefen, traumlosen Schlaf.
Das bringt die toshers in ein unerwartetes Dilemma. Wer soll dem Kind nun einen Namen geben? Der Vater ist nicht greifbar, die Mutter halb bewusstlos, halb von Sinnen. Die Sache duldet keinen Aufschub, denn sie befinden sich in gefährlicher Nähe zum Fluss. Seit unvordenklichen Zeiten beherbergen die Strudel der Themse Geister und andere schauerliche Wesen. Teuflische Spukgestalten, die auf der Jagd nach verwundbaren Seelen über dem Wasser schweben, könnten jeden Augenblick niederfahren und sich das Neugeborene holen. Und sollten die Geister ausnahmsweise Zurückhaltung üben, würde bestimmt der Geist von William Kidd wie aus dem Nichts erscheinen. Der berüchtigte Seeräuber kocht vor Wut, seit man ihn geteert, in Ketten gelegt und an den Galgen geknüpft hat, wo seine Leiche drei Jahre lang hing und verweste. Das ist zwar mehr als hundert Jahre her, doch Kidds Zorn ist nie verraucht, und er sucht dieses Ufer noch immer heim.
Da die Lage ernst ist, beschließen die toshers, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Die alte Frau hebt das Kind in die Höhe und sieht ihm in die graublauen Augen. Seltsamerweise erwidert es ihren Blick. Es hat die ganze Zeit keinen einzigen Schrei ausgestoßen.
»Du komischer kleiner Wurm, du!«
»So könnten wir ihn nennen«, schlägt einer vor. »Ganz ausgezeichnet: Komischer wäre sein Vorname und Kleinerwurm sein Nachname. Besser geht es nicht!«
»Kommt nicht infrage!«
Das unglückliche Kind, dem sowohl ein fürsorglicher Vater als auch eine starke Mutter fehlen und dem es das Schicksal obendrein auferlegt hat, das Licht der Welt an einem Strom aus Schmutz und Kot zu erblicken, verdient in den Augen der alten Frau allen Beistand. Sie müssen ihm einen ehrwürdigen Namen geben, einen, der ihm das Dasein versüßt und ihm durch die Schwierigkeiten des Lebens hilft, anstatt es noch mehr zu entmutigen. Sie denkt eine Weile nach und sagt schließlich:
»Der Name sollte Tapferkeit und Größe ausdrücken. Ja — es muss ein Name wie für einen Adeligen sein!«
»Dann nennen wir ihn am besten Eure Majestät.«
»Eure Durchlaucht.«
»Erhabenste Eminenz!«
»Warum nicht gleich König?«
»König ist gut«, erwidert die alte Frau. Und plötzlich strahlt sie, denn sie hat eine neue Idee. »Und König Arthur ist noch besser!«
»Ja, König Arthur — das ist es!«
»Dem Himmel sei Dank!«
»Dank sei dem Herrn!«
»So wie König Arthur mit dem Schwert im Stein?«
»Eher ein König Arthur der Abwasserkanäle, würde ich sagen.«
»… und der Elendsquartiere.«
»Dann ist es also beschlossene Sache«, erklärt der Mann, der das Laudanum beigesteuert hat, und trinkt, wie um auf die Entscheidung anzustoßen, einen großen Schluck aus der Flasche Gin, die er im Mantel mit sich trägt. Dann wischt er sich über den Mund und gibt die Flasche weiter.
»Arthur, König der Abwasserkanäle und Elendsquartiere!«
Als dieser Arthur wird der Junge, der auf einem einsamen Abschnitt des Themseufers in Chelsea unter den tief liegenden Ästen einer Eiche zur Welt kam, einst allen bekannt sein. Er ist ein Kind des Flusses und wird es sein Leben lang bleiben.
*
Obwohl die Mutter noch tief schläft, legen sie ihr das neugeborene Kind an die Brust. Unter den Blicken der toshers beginnt Arthur gemächlich zu saugen, fast wie aus Höflichkeit. Ohne Wiege, die ihn trägt, ohne Dach, das ihn schützt, liegt er auf den ausgebreiteten Mänteln, die ihn vor der Kälte des schlammigen Bodens bewahren sollen, und sein Gesicht verzieht sich, aber er weint nicht, sondern lauscht still den Geräuschen rings um ihn, während ein dünnes Rinnsal Milch aus seinem Mundwinkel läuft.
Es beginnt wieder zu schneien. Dichte Flocken fallen in weiten Bahnen vom Himmel, schimmernd vor dem Hintergrund des gedämpften Lichts. Ehe sie auf dem Boden landen, werden sie bläulich und wirbeln in Kreisen, die sich nie überlappen und sie nie schwindelig machen. Ein verspielter Tanz rastloser Geister. Der Säugling sieht mit großen Augen zu, und verblüfft von der Schönheit der Welt, beginnt er zu lächeln.
Eine der Flocken dreht im Wind Pirouetten, während sie sich rasch dem Boden nähert. Wasser in fester Form. Eine schwerelose Perle aus den Tiefen einer riesigen Himmelsmuschel. Lässt sich anhand von etwas so Kleinem, Zartem ein ganzes Universum erfassen?
Diese Schneeflocke war einst in einem fernen Land ein Regentropfen. Der wurde durch einen prachtvollen Palast mit einer grandiosen Bibliothek getragen, sah erlesene Gärten, herrliche Brunnen und entsetzliche Grausamkeiten. Die Flocke bewahrt die Erinnerung an ihre früheren Leben in sich. Die Aura eines assyrischen Königs ist ihr eingeprägt wie ein unsichtbarer Fingerabdruck. Sie landet sanft auf dem Gesicht des Säuglings, zwischen seinen geöffneten Lippen.
Das Kind spürt etwas Kaltes, Sauberes auf der Zunge, etwas, das schwach metallisch schmeckt und unglaublich aufregend ist. Der kleine Junge ballt seine Finger zur Faust und schiebt sie sich in den Mund, um das Wunderding zu ergreifen, doch das gelingt ihm nicht. Daraufhin schreit er zum ersten Mal. Es ist seine erste Enttäuschung im Leben, der früheste Kummer, dass er etwas Schönes, das ihn kurz berührt hat und augenblicklich geschmolzen ist, nicht festhalten kann.
Ein Tropfen Milch und eine Schneeflocke verbinden sich im Mund des Neugeborenen — und in den hintersten Winkeln seines Gedächtnisses. Eines Tages — da ist der Junge viel älter — wird ihn ein Mensch, der nie Schnee gesehen hat, fragen, wie Schnee schmecke, und er wird, ohne zu zögern, antworten: »Schnee schmeckt wie Muttermilch.«
*
Arthur, König der Abwasserkanäle und Elendsquartiere, wird sich an seine Geburt erinnern. Er wird sich mit außergewöhnlicher Klarheit und allen Einzelheiten daran erinnern — an das Tosen des Abwassers in der Nähe, an die Rinde eines krummen Eichbaums, an die rauen Mäntel unter ihm, an den Säumen ausgefranst und von Ratten und Mäusen angenagt, an das lockige goldblonde Haar, das der Frau auf die Schulter fiel, die ihn zur Welt gebracht hatte und dann in den Fluss werfen wollte, vor allem aber an das Gefühl, als Eiskristalle auf seiner Zunge schmolzen … Erinnerungssplitter, die für ihn immer zusammengehören werden, ganz gleich, wie viele Jahre vergangen sind und wie schmerzlich es für ihn sein wird, daran zurückzudenken. Denn dieses Kind, das seinen Geburtstag mit Queen Victorias Erstgeborener teilt und von herzensguten toshers den Namen eines legendären Helden erhalten hat, ist ein ganz besonderes Kind.
Arthur Smyth besitzt ein ungewöhnlich gutes Gedächtnis für das, was er sieht, hört und spürt. So wie eine Schneeflocke oder ein Hagelkorn — wie Wasser in jeglicher Form — sich immer erinnern wird, kann auch er nicht vergessen. Was er gesehen, gehört oder gespürt hat — und sei es nur ein einziges Mal —, behält er für immer. Eine wundervolle Gabe, werden viele sagen. Ein Geschenk Gottes, werden andere hinzufügen. Doch zugleich ein schrecklicher Fluch, wie Arthur bald erfahren wird.
H—
Narin
Am Ufer des Tigris, 2014
Unter dem klaren, hellen Himmel sitzen eines Frühlingsnachmittags im Südosten der Türkei, am Ufer des Tigris, mehrere zumeist alte Eziden beieinander. Sie sitzen im Halbkreis und sehen zu, wie ein kleines Mädchen in einem weißen Kleid mit heiligem Wasser aus dem Laliş-Tal im Irak getauft wird.
Das Kind — es heißt Narin und wird in diesem Monat neun Jahre alt — hat feine Gesichtszüge: eine breite Stirn, eine gerade Nase, schön gebogene Brauen über großen, auffallend dunkelgrünen Augen. Während Narin dem Scheich lauscht, der für sie betet, schießt knapp über ihr ein Vogel auf das Gebüsch nieder. Sie weiß nicht, was für ein Vogel das ist. Sie blickt ihre Großmutter an, die stolz neben ihr steht. Die alte Frau kennt sich mit allen Vögeln der Gegend aus und kann Hunderte ihrer Stimmen perfekt imitieren, doch Narin weiß, dass jetzt nicht der Moment ist, um zu fragen. Sie konzentriert sich wieder auf die Zeremonie und wartet respektvoll schweigend. Erst als ihre Stirn mit dem heiligen Wasser besprengt wird, hebt sie den Blick aufs Neue.
Der erste Tropfen fällt auf die Braue, gleitet langsam hinunter und bleibt in den langen, dichten, geraden Wimpern hängen, deren Spitzen von der Sonne aufgehellt sind. Narin wischt ihn lächelnd weg.
»Lamm des Glaubens«, ruft der Scheich. »Möge dein Lebensweg immer gesegnet sein.«
Die Wolfsmilchstauden rings um die Versammelten erzittern im Wind, der plötzlich vom Fluss her in ihre Richtung weht. Narins Großmutter spricht in die Stille hinein, und in jedem Wort hallt ihre Liebe wider.
»Lamm des Glaubens, dilê min.«
Dilê min — mein Herz. Die Großmutter drückt ihre Zuneigung aus, indem sie ihren Körper in eine Anatomie der Liebe verwandelt. Vermisst sie Narin, sagt sie: »Komm, setz dich zu mir, Ecke meiner Leber!« Um Narin aufzuheitern, ruft sie ihr zu: »Nur Mut, Pulsschlag in meinem Hals!« Hat sie das Lieblingsessen ihrer Enkelin gekocht, heißt es: »Iss auf, mein Augenlicht! Wenn dein Bauch voll ist, freut sich meiner!« Und wenn sie Narin sagen will, dass jede Lebensprüfung etwas Gutes hat, rät sie ihr: »Vergiss nie, meine Seele: Schließt Gott eine Tür, öffnet er eine andere. Deshalb verzage nie, Luft in meiner Lunge!« Herz, Leber, Magen, Lunge, Hals, Augen, Seele … Als würde Liebe — fließend, strömend, wie sie ist — darin bestehen, Merkmale so zu vermischen, dass nicht mehr klar ist, wo das eigene Wesen endet und das eines anderen beginnt.
»Möge das Leben gut zu dir sein, mein Kind, und mögest du aus den Zeiten, in denen es nicht gut zu dir ist, stärker hervorgehen!«, ruft der Scheich.
Der zweite Tropfen fällt auf Narins Kragen; ein heller runder Schatten — er ähnelt der Mitte einer Mondblumenblüte — bildet sich auf dem weißen Stoff.
Das Mädchen tritt von einem Fuß auf den anderen und blickt sich in der Erwartung um, dass die Welt jetzt, kurz vor dem Ende der Zeremonie, verändert wäre. Doch alles sieht aus wie zuvor — das Dornengestrüpp, in dem sich der Saum ihres Kleids verfängt, die zerklüfteten Uferfelsen, das sonnenverbrannte Gras, das hier und da durch den Schotter sprießt, der Modergeruch des schlammigen Tigris. Das alles ist so, wie es sein soll — auch der Ausdruck auf den Gesichtern der Leute, die sich für sie freuen und sich zugleich um sie sorgen. Erwachsene können ihre Bedenken nicht gut verhehlen, ihre Freude und Neugier dagegen erstaunlich gut. Bei den Kindern ist es genau andersherum. Die können ihre Ängste taktvoll zum Schweigen bringen und ihren Kummer verbergen, schaffen es aber kaum, keine Freude zu zeigen. Einfach gesagt: Erwachsen werden heißt, den Ausdruck reinen Glücks und reiner Freude zu unterdrücken lernen.
Narin kann ihre Sorgen gut verstecken — und sie hat viele. Heute macht es sie traurig, dass ihr Vater nicht an der Taufe teilnehmen kann. Als beliebter und gesuchter Musiker, der in der ganzen Region bei Hochzeiten und Beschneidungsfeiern aufspielt, ist er oft mehrere Tage am Stück unterwegs. Er reist nicht nur innerhalb der Türkei, sondern auch im Irak und in Syrien, und wenn er zurückkommt, erzählt er lustige Sachen. Dann bricht er wieder auf. Narin versteht, dass er nicht lange an einem Ort bleiben kann, obwohl er sie liebt. Es heißt, dass er so ist, seit er die Liebe seines Lebens verloren hat — am selben Nachmittag, in derselben Stunde öffnete sich die Tür des Lebens für Narin und schloss sich für ihre Mutter. Von diesem Tag an hat ihr Vater sich trotz aller Versuche, ihm eine neue Frau zu finden, einer Wiederheirat verweigert, und das Kind wuchs bei der Großmutter auf.
Die Großmutter ist Narins Ein und Alles.
»Möge dieses geweihte Wasser Güte und Freundlichkeit in dein Leben bringen und dich vor Kummer bewahren.« Der Scheich hebt die Hand, um Narin mit dem dritten und letzten Tropfen zu besprengen. »Möge es — «
Ein ohrenbetäubendes Wummern, das aus dem Bauch der Erde zu kommen scheint, übertönt die letzten Gebetsformeln. Erschrocken drehen sich alle in dieselbe Richtung.
Ein Bulldozer. Ein mit Schlamm bespritztes gelbes mechanisches Ungeheuer. Nachdem der Motor dröhnend zum Leben erwacht ist, setzt sich das Gefährt in Bewegung und rollt über die Lichtung, wobei es schwarzen Rauch in die klare Luft bläst. Knarzend und ächzend bringt es sich in den Vorwärtsgang und rumpelt auf die Versammelten zu, sodass der Boden bebt. Die schwere Metallschaufel ragt in die Luft, bereit zuzuschlagen.
Diese Kolosse sieht man neuerdings überall. Seit die Gegend von der türkischen Regierung für ein großes Dammbau-Projekt ausersehen wurde, erfüllt ein unerträgliches Getöse die weiten Ebenen des Tigris. Es wird endlos gehämmert, geklopft, gebohrt, gedrillt, gemischt und gehackt. Das Vorhaben ist umstritten, Umweltaktivisten und ortsansässige Bauern protestieren dagegen. Ausländische Firmen, zunächst an der lukrativen Unternehmung interessiert, haben sich aus Sorge um den Menschenrechts-, Kulturgüter- und Umweltschutz zurückgezogen, was die Baumaßnahmen jedoch nicht aufhalten konnte. Jeden Morgen machen sich an diesem Uferabschnitt Bagger, Kipplaster und Bulldozer auf den Weg, um riesige Mengen Basalt, Lehm und Kalkstein abzutransportieren, aus denen das Fundament für das dereinst größte Wasserkraftwerk des Landes gebaut werden soll.