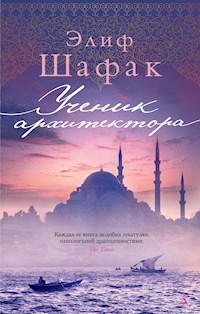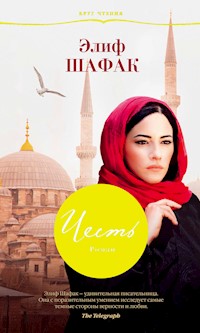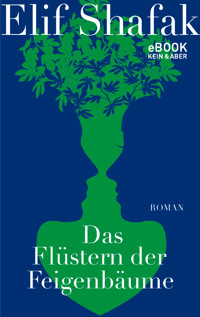14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Es ist einfacher, eine Brücke einzureißen, als eine zu bauen.« Istanbul im 16. Jahrhundert. Es ist die Blütezeit des Osmanischen Reichs, die Stadt das wimmelnde Zentrum des Orients, als Jahan auf einem Schiff im Hafen anlegt. Aus dem fernen Indien angereist, führt er einen weißen Elefanten mit sich, ein Geschenk seines Schahs für die Menagerie des Sultanspalasts. So beginnt ein episches Abenteuer, in dem sich der aus ärmlichen Verhältnissen stammende Junge plötzlich im Herzen des mächtigen Reichs wiederfindet, inmitten des Prunks und des Reichtums. Ihm begegnen hinterlistige Höflinge, falsche Freunde, Zigeuner, Tierbändiger und die schöne Prinzessin Mihrimah. Doch es ist die Begegnung mit dem Hofarchitekten Sinan – dem berühmtesten Baumeister der islamischen Welt –, welche Jahans Schicksal für immer verändern wird. Gemeinsam bauen sie Moscheen und Paläste, Mausoleen und Aquädukte, die alle Zeiten überdauern sollen. Doch hinter Jahans neuem Glück lauern Intrigen und Kriege, deren Zerstörungswut größer scheint als alles Bestreben, Neues zu schaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 716
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Glossar
» Impressum
» Weitere eBooks von Elif Shafak
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Elif Shafak, in Straßburg geboren, gehört zu den meistgelesenen Schriftstellerinnen in der Türkei. Die preisgekrönte Autorin von dreizehn Büchern, darunter Der Bastard von Istanbul (2007), Die vierzig Geheimnisse der Liebe (2013) und Ehre (2014), schreibt auf Türkisch und Englisch. Ihre in der Türkei teilweise heftig umstrittenen Werke sind in über dreißig Ländern erschienen. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in London und Istanbul.
ÜBER DAS BUCH
Istanbul im 16. Jahrhundert. Es ist die Blütezeit des Osmanischen Reichs, die Stadt das wimmelnde Zentrum des Orients, als Jahan auf einem Schiff im Hafen anlegt. Aus dem fernen Indien angereist, führt er einen weißen Elefanten mit sich, ein Geschenk seines Schahs für die Menagerie des Sultanspalasts.
So beginnt ein episches Abenteuer, in dem sich der aus ärmlichen Verhältnissen stammende Junge plötzlich im Herzen des mächtigen Reichs wiederfindet, inmitten des Prunks und des Reichtums. Ihm begegnen hinterlistige Höflinge, falsche Freunde, Zigeuner, Tierbändiger und die schöne Prinzessin Mihrimah. Doch es ist die Begegnung mit dem Hofarchitekten Sinan – dem berühmtesten Baumeister der islamischen Welt –, welche Jahans Schicksal für immer verändern wird. Gemeinsam bauen sie Moscheen und Paläste, Mausoleen und Aquädukte, die alle Zeiten überdauern sollen. Doch hinter Jahans neuem Glück lauern Intrigen und Kriege, deren Zerstörungswut größer scheint als alles Bestreben, Neues zu schaffen.
»Elif Shafaks bester Roman.« The Independent
»Wie die überwältigenden Moscheen von Sinan, ist auch dieser Roman eine präzise Schöpfung des bildhaften Denkens.«
Financial Times
Für alle Schüler dieser Welt – niemand hat uns gesagt,dass die Liebe die am schwersten zu erlernende Kunst ist.
Schon auf den ersten Blick liebte ich
dich mit tausend Herzen …
Sollen die Eiferer denken, es sei Sünde zu lieben
Das kümmert mich nicht,
Lass mich im Höllenfeuer dieser Sünde brennen.
Mihri Hatun, osmanische Dichterin des16. Jahrhunderts
Auf der ganzen Welt habe ich gesucht
und nichts gefunden, was der Liebe würdig ist,
Nun bin ich in meiner Sippe eine Fremde,
Verbannt aus ihrem Zusammensein.
Mirabai, indische Dichterin des 16. Jahrhunderts
Von allen Menschen, die Gott erschuf und Schaitan auf Abwege führte, haben nur wenige den Mittelpunkt des Universums entdeckt, wo es weder Gut noch Böse gibt, keine Vergangenheit und keine Zukunft, kein »Ich« und kein »Du«, keinen Krieg und keinen Grund, Krieg zu führen, sondern nur ein unendliches Meer der Ruhe. Was diese wenigen dort fanden, war so schön, dass sie die Gabe des Sprechens verloren.
Die Engel empfanden Mitleid mit ihnen und ließen ihnen die Wahl. Wollten sie ihre Stimme wiederhaben, müssten sie alles Gesehene vergessen, und tief in ihrem Herzen bliebe ein Gefühl des Mangels. Zögen sie es aber vor, das Schöne im Gedächtnis zu behalten, würde ihr Geist so verwirrt, dass sie Wahrheit und Trug niemals mehr unterscheiden könnten. So kehrten von der Handvoll Menschen, die auf diesen geheimen, in keiner Landkarte verzeichneten Ort gestoßen waren, die einen mit der Sehnsucht nach etwas zurück, das sie selbst nicht kannten, die anderen aber mit unzähligen Fragen. Der, welcher sich nach Vollständigkeit sehnte, wurde ein »Liebender« genannt, derjenige, der nach Wissen strebte, ein »Lernender«.
Dies pflegte Meister Sinan uns, seinen vier Schülern, zu erzählen. Er sah uns dabei eindringlich an, den Kopf geneigt, als wollte er direkt in unsere Seelen schauen. Ich wusste, dass ich selbstgefällig war und Selbstgefälligkeit einem einfachen Jungen nicht anstand, doch immer wenn mein Meister diese Geschichte erzählte, glaubte ich, seine Worte seien eher an mich als an die anderen gerichtet. Auf meinem Gesicht ruhte sein Auge immer ein Weilchen länger, als würde er etwas von mir erwarten. Dann senkte ich den Blick aus Angst, ihn zu enttäuschen, aus Angst vor dem, was ich ihm nicht geben konnte, obwohl ich nie herausfand, was das war. Ich frage mich, was er in meinen Augen erkannte. Wusste er damals schon, dass ich im Lernen alle übertreffen, in der Liebe aber ungeschickt sein und kläglich versagen würde?
Könnte ich nur in der Rückschau behaupten, ich hätte ebenso sehr zu lieben gelernt wie das Lernen geliebt! Doch wenn ich lüge, erwartet mich vielleicht morgen ein glühender Kessel in der Hölle, und wer sichert mir zu, dass mein Morgen nicht schon ganz nah ist? Alt wie ein Eichbaum bin ich und noch immer nicht dem Grab übergeben.
Wir waren zu sechst: der Meister, seine Schüler und der weiße Elefant. Wir bauten alles gemeinsam. Moscheen, Brücken, Medresen, Karawansereien, Armenhäuser, Aquädukte … Das ist so lange her, dass mein Gedächtnis die härtesten Züge weich macht, die Erinnerungen zu flüssigem Schmerz schmelzen lässt. Doch was ich in Gedanken an jene Tage sehe, wurde vielleicht auch erst später gezeichnet, um die Schuld zu mindern, diese Gesichter vergessen zu haben. An unsere Versprechen aber erinnere ich mich, an jedes einzelne; keines von ihnen konnten wir halten. Seltsam, dass sich Gesichter verflüchtigen, obwohl sie fest und sichtbar sind, während die Worte, aus Atem gemacht, bleiben.
Sie sind verschwunden, einer nach dem anderen. Warum sie zugrunde gingen, während ich, ein Greis, noch immer lebe, weiß nur Gott allein. Ich denke jeden Tag an Istanbul. In ebendiesem Augenblick gehen die Menschen durch die Höfe der Moscheen und wissen nicht und sehen nicht. Wahrscheinlich glauben sie, die Bauten rings um sie stammten aus Noahs Zeiten, doch so ist es nicht. Wir haben sie errichtet: Muslime und Christen, Handwerker und Sklaven, Mensch und Tier, Tag für Tag. Aber Istanbul ist eine Stadt, die schnell vergisst. Dort ist alles in Wasser geschrieben; nur die Werke meines Meisters, die sind in Stein geschrieben.
Unter einem Stein habe ich ein Geheimnis begraben. Viel Zeit ist vergangen, und doch ist es bestimmt noch da und wartet auf seine Entdeckung. Ob es jemals gefunden wird? Und wenn es einer findet, wird er es verstehen? Das weiß niemand zu sagen, aber am Fuße eines der Bauwerke von den Hunderten, die mein Meister errichtet hat, verbirgt sich der Mittelpunkt des Universums.
ISTANBUL, 22. DEZEMBER 1574
Nach Mitternacht ertönte in den Tiefen der Dunkelheit ein grimmiges Knurren. Er wusste sofort, dass es von der größten Katze im Sultanspalast kam, einem Kaspischen Tiger mit bernsteingelben Augen und goldenem Fell. Sein Herz klopfte heftig, während er überlegte, was oder wer das Tier aufgestört haben könnte. Zu solch später Stunde schlief alles tief und fest – die Menschen, die Tiere, der Dschinn. Auf den Beinen war zu dieser Zeit in der Stadt der sieben Hügel außer den Wächtern auf ihren Runden durch die Straßen nur mehr, wer betete oder sündigte.
Und Jahan, denn er saß bei der Arbeit.
»Die Arbeit ist unser Gebet«, sagte sein Meister oft. »Durch die Arbeit sprechen wir mit Gott.«
»Und wie spricht Gott mit uns?«, hatte Jahan einmal gefragt, als er noch viel jünger war.
»Indem er uns immer neue Arbeit gibt.«
Wenn das stimmte, dann knüpfte er gerade eine recht enge Verbindung mit dem Allmächtigen; schließlich schuftete er doppelt so schwer, übte nicht einen Beruf aus, sondern zwei, war Elefantenführer und Bauzeichner. Zwei Künsten ging er nach, doch er hatte nur einen Lehrer, den er achtete, bewunderte und insgeheim übertreffen wollte. Sein Meister war Sinan, der Hofarchitekt.
Sinan hatte Hunderte von Schülern, Tausende von Arbeitern und noch weit mehr Anhänger und Gefolgsleute, aber nur vier Schüler, die ihn ständig begleiten durften. Jahan war stolz, einer von ihnen zu sein, stolz, aber auch verwirrt. Der Meister hatte ihn erwählt, einen gewöhnlichen Diener, einen kleinen Elefantenführer, obwohl in der Palastschule mehr als genug begabte Anfänger saßen. Dieses Wissen stärkte nicht etwa sein Selbstvertrauen, sondern erfüllte ihn mit Sorge. Es quälte ihn, dass er den einzigen Menschen in seinem Leben, der an ihn glaubte, enttäuschen könnte.
Sein nächster Auftrag war der Entwurf eines hamam. Der Meister hatte klare Vorgaben gemacht: ein erhöhtes Marmorbecken, von unten beheizt, Röhren in den Wänden, durch die der Rauch abziehen konnte, eine Trompenkuppel, zwei Eingänge von zwei verschiedenen Straßen, damit sich Männer und Frauen nicht begegneten. Das war es, womit sich Jahan in dieser verhängnisvollen Nacht an einem roh gezimmerten Tisch in seiner Hütte in der Menagerie des Sultans beschäftigte.
Er lehnte sich zurück und betrachtete missfällig den Entwurf. Er fand ihn unelegant, ohne Grazie und Harmonie. Wie immer war es viel einfacher gewesen, den Grundriss zu entwerfen, als die Kuppel zu zeichnen. Er zählte nun schon über vierzig Jahre – so viele wie Mohammed, als er Prophet wurde – und beherrschte sein Handwerk, aber noch immer hätte er lieber mit bloßen Händen Fundamente ausgehoben, als sich mit Decken und Gewölben abzugeben. Am liebsten hätte er sie ganz weggelassen – könnten die Menschen doch nur offen und furchtlos unter dem freien Himmel wohnen, die Sterne betrachtend und von ihnen bewacht, ohne etwas verbergen zu müssen!
Verdrossen setzte er zu einer neuen Skizze an – das Papier hatte er den Palastschreibern stibitzt –, als er den Tiger wieder hörte. Er hielt inne, verharrte mit gerecktem Kinn und lauschte. Es klang, als wollte das Tier einen Feind auf unmissverständliche, schaurige Weise vor dem Näherkommen warnen.
Leise öffnete er die Tür und starrte in die Finsternis. Wieder ertönte ein Fauchen, nicht ganz so laut wie zuvor, aber nicht weniger bedrohlich. Und plötzlich waren alle Tiere in heller Aufregung. Der Papagei krächzte im Dunkeln, das Nashorn plärrte, der Bär brummte wütend dagegen an. Ganz in der Nähe brüllte der Löwe auf und wurde sofort vom Leoparden niedergezischt. Weiter hinten klopften die verängstigten Kaninchen ohne Unterlass hektisch mit den Hinterläufen. Die Affen machten mit ihrem Gekreisch ein Getöse wie ein ganzes Bataillon, obwohl sie nur zu fünft waren. Nun begannen auch die Pferde in den Stallungen zu wiehern und mit den Hufen zu scharren. Inmitten des Aufruhrs hörte Jahan kurz das träge Grollen des Elefanten, der offensichtlich nichts mit dem Tumult zu tun haben wollte. Irgendetwas ängstigte die Tiere. Jahan warf sich einen Umhang über, ergriff die Öllampe und schlich sich in den Hof hinaus.
In der Nachtkühle lag der schwere Duft von Winterblumen und Wildkräutern. Kaum war Jahan die ersten Stufen hinuntergegangen, sah er einige der Tierbändiger, die sich flüsternd unter einem Baum zusammendrängten. Als er auf sie zuschritt, hoben sie erwartungsvoll den Blick. Doch Jahan konnte ihnen nichts mitteilen; auch er hatte nur Fragen.
»Was ist?«
»Die Tiere sind nervös«, sagte Dara, der Giraffenführer, und klang dabei selbst ziemlich angespannt.
»Ein Wolf vielleicht«, sagte Jahan.
Zwei Jahre zuvor war es schon einmal geschehen. An einem bitterkalten Winterabend waren Wölfe in die Stadt hinuntergekommen und durch die Viertel der Juden, Muslime und Christen gestreift. Ein paar hatten, wie auch immer, das Tor überwunden, sich über die Enten, Schwäne und Pfauen des Sultans hergemacht und ein wahres Gemetzel angerichtet. Tagelang hatten sie blutgetränkte Federn unter den Büschen und Sträuchern hervorklauben müssen. Doch jetzt war die Stadt nicht mit Schnee bedeckt, und es herrschte auch keine ungewöhnliche Kälte. Die Ursache für die Erregtheit der Tiere kam nicht von außen, sie lag im Palast selbst.
»Durchsucht jeden Winkel!«, befahl Olev, der Löwenbändiger, ein Hüne mit feuerrotem Haar und ebensolchem Zwirbelbart. Ohne ihn wurde hier nichts entschieden. Der mutige, muskelbepackte Mann genoss das Ansehen sämtlicher Diener. Für einen Sterblichen, der über einen Löwen gebot, hatte selbst der Sultan ein wenig Bewunderung übrig.
Sie gingen in alle Richtungen auseinander, um in den Scheunen, Ställen, Gehegen, Teichen, Hühnerhäusern und Käfigen nachzusehen, ob auch kein Tier entlaufen war, und stellten fest, dass alle Bewohner der kaiserlichen Menagerie – Löwen, Affen, Hyänen, Elche, Füchse, Luchse, Wildziegen, Wildkatzen, Gazellen, Riesenschildkröten, Rehe, Strauße, Gänse, Stachelschweine, Eidechsen, Kaninchen, Schlangen, Krokodile, Zibetkatzen, der Leopard, das Zebra, die Giraffe, der Tiger und der Elefant – an ihrem Platz waren.
Chota, den fünfunddreißig Jahre alten, sechs Ellen hohen, ungewöhnlich weißen asiatischen Elefantenbullen, traf Jahan angespannt und unruhig an. Seine Ohren waren aufgestellt wie Segel im Wind. Mit einem Lächeln begrüßte Jahan das Tier, dessen Gewohnheiten er so gut kannte.
»Was ist? Riechst du Gefahr?« Jahan klopfte dem Elefanten auf die Flanke und bot ihm eine Handvoll Süßmandeln an, die stets griffbereit in seiner Schärpe steckten.
Chota, einem Leckerbissen nie abgeneigt, steckte sich die Mandeln mit einem Rüsselschlenker ins Maul, ohne den Blick vom Tor abzuwenden. Dann beugte er sich vor, verlagerte sein enormes Gewicht auf die Vorderbeine, stemmte die empfindlichen Füße in den Boden und versuchte reglos, etwas in der Ferne zu hören.
»Immer mit der Ruhe, alles ist gut«, sagte Jahan sanft. Aber er glaubte nicht, was er da sagte, und der Elefant ebenso wenig.
Auf dem Rückweg sah er Olev auf die anderen Bändiger einreden und darauf drängen, dass sie sich wieder zurückzogen. »Wir haben alles überprüft, da ist nichts!«
»Aber die Tiere …«, wandte einer ein.
Olev deutete auf Jahan. »Der Inder hat recht, es muss ein Wolf gewesen sein. Oder meinetwegen ein Schakal. Jedenfalls ist hier nichts mehr. Legt euch wieder schlafen!«
Diesmal erhob sich kein Widerspruch. Nickend und murmelnd trotteten die Männer zu ihren Pritschen, die zwar rau und stachelig und voller Läuse, aber ihr einziger sicherer, warmer Unterschlupf waren. Nur Jahan ließ sich etwas Zeit.
»Was ist, kommst du nicht, Mahut?«, rief Kato, der Krokodilbändiger.
»Einen Augenblick noch«, erwiderte Jahan, den Blick in den Innenhof gerichtet, von wo er gerade ein seltsames gedämpftes Geräusch vernommen hatte.
Statt nach links zu seiner Hütte ging er nach rechts, auf die hohe Mauer zwischen den beiden Höfen zu. Er bewegte sich zögerlich, als wartete er auf einen Vorwand, um sich eines anderen besinnen und zu seinen Zeichnungen zurückkehren zu können. Vor dem Fliederbaum am äußersten Ende der Mauer sah er einen Schatten, so düster und unheimlich, dass er einer Geistererscheinung glich, die Jahan weggewischt hätte, wäre der Schatten nicht zur Seite getreten und hätte sein Gesicht gezeigt – es war Taras der Sibirer. Der Mann hatte jede Krankheit und jedes Unglück überstanden und war schon länger in der Menagerie als sonst irgendwer. Er hatte Sultane kommen und gehen, mächtige Männer fallen und Köpfe, die einst die vornehmsten Turbane getragen hatten, über den schmutzigen Boden rollen sehen. »Nur zwei Dinge wird es ewig geben«, spotteten die Diener. »Liebeskummer und Taras den Sibirer. Alles andere vergeht …«
»Bist du das, Inder?«, fragte Taras. »Haben dich die Tiere geweckt?«
»Ja. Hast du eben auch etwas gehört?«
Der alte Mann brummte Unverständliches vor sich hin.
»Es kam von dort drüben«, beteuerte Jahan und reckte den Hals zu der Mauer vor ihm, einer formlosen, onyxfarbenen Masse, die sich nahtlos im Dunkel verlor. Der mitternächtliche Nebel schien voller klagender, trauernder Geister zu sein. Die Vorstellung ließ Jahan frösteln.
Dumpfes Gepolter hallte durch den Hof, gefolgt von trappelnden Schritten, als würden Leute hin- und herhuschen. Aus den Tiefen des Palasts drang der unmenschlich gellende Schrei einer Frau hervor und wurde fast sofort unterdrückt, sodass nur mehr Schluchzen zu hören war. Von einer anderen Ecke her zerriss ein weiterer Schrei die Nacht – vielleicht ein verirrtes Echo des ersten. So unvermittelt, wie es begonnen hatte, wurde es wieder still. Jahan trat unwillkürlich einen Schritt auf die Mauer zu.
»Wohin willst du?«, flüsterte Taras. Seine Augen funkelten vor Angst. »Das ist verboten.«
»Ich will wissen, was da vor sich geht«, sagte Jahan. »Bleib, wo du bist«, riet ihm der Alte.
Jahan zögerte nur kurz. »Ich sehe nach und komme sofort wieder.«
»Ich sage dir, lass es bleiben, aber du willst ja nicht hören.« Taras seufzte. »Geh wenigstens nicht zu weit hinein. Bleib im Garten, mit dem Rücken dicht an der Mauer, hast du verstanden?«
»Keine Sorge, ich beeile mich und gebe acht.«
»Ich warte auf dich. Ich schlafe erst, wenn du wieder da bist.«
Jahan grinste ihn spitzbübisch an. »Ich sage dir, lass es bleiben, aber du willst ja nicht hören.«
Erst vor Kurzem hatte Jahan mit seinem Meister an der Renovierung der kaiserlichen Küchen und der Erweiterung des Harems gearbeitet, dessen Bewohnerschaft in den Jahren zuvor merklich angewachsen war. Um nicht das Haupttor benutzen zu müssen, hatten die Arbeiter eine Öffnung in die Mauer geschlagen und eine Abkürzung geschaffen. Weil sich die Lieferung neuer Fliesen verzögerte, war das Loch behelfsmäßig mit ungebrannten Ziegeln und Lehm verschlossen worden.
In der einen Hand hielt Jahan eine Lampe, in der anderen einen Stock, mit dem er leicht an die Mauer klopfte, während er ihr folgte. Eine Zeit lang war nur der immer gleiche dumpfe Schlag zu hören, doch plötzlich klang es hohl. Jahan blieb stehen, kniete sich hin und drückte mit aller Kraft gegen die untersten Ziegel. Anfangs bewegten sie sich nicht, doch schließlich gaben sie nach. Er ließ die Lampe stehen – erst auf dem Rückweg wollte er sie wieder mitnehmen – und kroch durch die Öffnung in den angrenzenden Hof.
Der Mond warf ein gespenstisches Licht auf den Rosengarten, der jetzt ein Rosenfriedhof war. Die Sträucher, den Frühling über von leuchtendem Rot, Rosa und Gelb geziert, waren nun welk und braun und lagen wie ein Meer aus silbrigem Wasser vor Jahan, dessen Herz so laut und heftig pochte, dass er fürchtete, man könnte es hören. Ihn schauderte. Geschichten von vergifteten Eunuchen fielen ihm ein, von erwürgten Konkubinen, geköpften Wesiren und von Säcken, die ins Wasser des Bosporus geworfen wurden, während ihr Inhalt sich noch krümmte und wand. In dieser Stadt lagen manche Friedhöfe auf den Hügeln, andere aber Hunderte Faden tief im Meer.
Vor ihm stand ein über und über mit Tüchern, Bändern, Anhängern und Spitzenborten behängtes Gewächs – der Wunschbaum. Wenn eine Konkubine oder eine Odaliske des Harems ein Geheimnis hatte, in das sie nur Gott einweihen konnte, bat sie einen Eunuchen, etwas von sich an einen Ast zu binden, mitten zwischen die Schätze, die dort bereits hingen. Da die Hoffnungen der einen Frau oft denen einer anderen zuwiderliefen, ächzte der Baum unter gegensätzlichen Bitten und einander bekriegenden Gebeten. Jetzt aber wirkte er friedlich, weil eine leichte Brise durch sein Laub strich und die Wünsche vermengte – so friedlich, dass Jahan unwillkürlich darauf zuging, obwohl er Taras versprochen hatte, sich nicht allzu weit vorzuwagen.
Zu dem Steingebäude weiter hinten waren es nicht mehr als dreißig Schritte. Halb verborgen vom Stamm des Wunschbaums, spähte Jahan langsam ein wenig hervor und wich sofort wieder zurück. Erst nach einigen Sekunden fand er den Mut zu einem zweiten Blick.
Zehn, zwölf Taubstumme huschten von einem Eingang zum anderen. Manche waren mit Säcken bepackt. Die Fackeln in ihren Händen malten erdbraune Streifen in die Luft, und immer wenn sich zwei von ihnen kreuzten, wuchsen die Schatten an der Wand.
Jahan wusste nicht, was er von alldem halten sollte. Er lief zur Rückseite des Gebäudes, sog dabei den Geruch der schweren Erde ein und bewegte sich so lautlos wie die Luft, die er atmete. Er beschrieb einen Halbkreis und erreichte eine Tür ganz hinten, die seltsamerweise unbewacht war. Ohne zu überlegen, trat er ein. Hätte er bedacht, was er tat, er wäre vor Angst erstarrt.
Drinnen war es feucht und kühl. Er tastete sich durch das Halbdunkel und ging weiter, obwohl ihm die Haare zu Berge standen. Doch für Reue war es jetzt zu spät. Es gab kein Zurück, er konnte nur noch vorwärtsgehen. Immer dicht an der Wand entlang schlich er sich in eine schwach beleuchtete Kammer. Sein Atem ging schnell. Er sah sich um: mit Perlmutt ausgelegte Tische, auf denen Glasschalen standen, kissenbeladene Sofas, geschnitzte Goldrahmen mit Spiegeln, Wandteppiche und auf dem Boden ebenjene gefüllten Säcke.
Mit einem raschen Blick über die Schulter vergewisserte er sich, dass niemand folgte, und ging langsam, ganz langsam weiter, bis er etwas erblickte, das ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es war eine Hand. Bleich und schlaff wie ein herabgestürztes Vögelchen lag sie unter einem Stoffhaufen auf dem kalten Marmor. Wie von einer fremden Kraft getrieben, band Jahan einen Jutesack nach dem anderen auf und öffnete sie ein wenig. Seine Augen blinzelten benommen, wollten nicht hinnehmen, was sein Herz längst verstanden hatte. Die Hand befand sich an einem Arm, der Arm an einem kleinen Rumpf. Nein, das waren keine einfachen Säcke, es waren Leichen darin, Kinderleichen.
Fünf waren es, Jungen allesamt, der Größe nach aufgereiht. Der älteste halbwüchsig, der jüngste noch ein Säugling. Ihre prachtvollen Gewänder hatte man sorgsam drapiert, um ihre fürstliche Würde noch im Tod zu wahren. Jahans Blick fiel auf die am nächsten liegende Leiche, einen hellhäutigen Jungen mit roten Wangen. Er betrachtete die Linien in der kleinen Handfläche. Schräge geschwungene Linien, die ineinander übergingen wie Zeichen im Sand. Welche Wahrsagerin in dieser Stadt, dachte Jahan, hätte den Prinzen einen so jähen, traurigen Tod prophezeien können?
Sie wirkten friedvoll. Ihre Haut schimmerte wie von innen beleuchtet. Unwillkürlich dachte Jahan, dass sie doch nicht gestorben waren, nicht wirklich gestorben. Sie bewegten sich nicht mehr, sprachen nicht mehr und hatten sich in etwas verwandelt, das er nicht verstand, etwas, das nur sie selbst wahrnahmen. Deshalb lag dieser friedliche, beinahe heitere Ausdruck auf ihren Gesichtern.
Mit schlotternden Beinen und zitternden Händen stand Jahan da und kam nicht vom Fleck. Erst der Klang sich nähernder Schritte riss ihn aus dem Nebel seiner Fassungslosigkeit. Er fand zwar kaum die Kraft, immerhin aber die Zeit, um die Toten zu bedecken, stürzte in eine Ecke und verbarg sich hinter einem von der Decke bis zum Boden reichenden Wandteppich. Sofort darauf traten die Taubstummen mit der nächsten Leiche ein und legten sie behutsam neben die anderen.
In diesem Augenblick bemerkte einer von ihnen, dass das Tuch von der ganz hinten liegenden Leiche geglitten war. Er näherte sich ihr und sah sich um. Unsicher, ob sie selbst den Toten so zurückgelassen hatten oder ob in ihrer Abwesenheit jemand hereingekommen war, gab er seinen Gefährten ein Zeichen, und auch sie hielten inne. Gemeinsam begannen sie, den Raum zu durchsuchen.
Jahan, allein in seiner Ecke und nur durch dünnen Stoff von den Mördern getrennt, stockte der Atem. Das war es also, dachte er, nun ging sein Leben zu Ende. Lug und Trug hatten ihn an diesen Punkt geführt. Kurioserweise dachte er nicht ohne Traurigkeit an die Lampe, die an der Gartenmauer zurückgeblieben war und jetzt im Wind flackerte. Beim Gedanken an seinen Elefanten und an seinen Meister traten ihm die Tränen in die Augen. Bestimmt schliefen sie beide friedlich. Dann kam ihm die Frau in den Sinn, die er liebte. Während sie und die anderen sicher in ihren Betten lagen und träumten, würde er getötet werden, weil er war, wo er nicht sein durfte, und sah, was er nicht sehen sollte. Und alles nur wegen seiner Neugier, dieser schamlosen, unbändigen Wissbegier, die ihm sein Leben lang nichts als Scherereien eingebracht hatte. Insgeheim verfluchte er sich. Am besten, man schrieb es fein säuberlich auf seinen Grabstein:
Hier ruht ein Mann, dessen Neugier ihm zum Verhängnis wurde, Tierbändiger und Schüler eines Architekten.
Sprecht ein Gebet für seine unwissende Seele.
Bedauerlich nur, dass niemand da war, um der Nachwelt seinen letzten Wunsch zu übermitteln.
In einem herrschaftlichen Haus am anderen Ende von Istanbul war die kahya, die Oberste Dienerin des Hauses, noch wach und ließ die Perlen ihrer Gebetskette über die Hand gleiten. Ihre Wangen waren runzlig wie getrocknete Weinbeeren, den schmalen Körper beugte ein Buckel, und das Alter hatte sie blind gemacht. Doch solange sie im Wohnsitz ihres Meisters blieb, schien es, als könnte sie sehen. Jeden Winkel, jede Ritze, jede lockere Türangel, jede knarzende Stufe – keiner unter diesem Dach kannte das Haus so gut, und sicherlich war keiner dem Herrn und Meister so ergeben wie sie.
Ringsum herrschte Stille. Nur das Schnarchen der Bediensteten, die in ihren Unterkünften schliefen, war zu hören. Und hin und wieder drangen durch die geschlossene Tür zur Bibliothek leise, kaum wahrnehmbare Atemzüge. Dort schlief Sinan, nachdem er wieder einmal bis spät in die Nacht gearbeitet hatte. Üblicherweise verbrachte er die Abende mit seiner Familie und fand sich zum Essen im haremlik ein, wo seine Frau und seine Töchter wohnten und sich kein Schüler jemals hineinwagte. Heute aber war er, wie in so vielen Nächten, nach dem Fastenbrechen zu seinen Entwürfen zurückgekehrt und in dem Raum, in den die Sonne früher schien als in die anderen Zimmer des großen, weitläufigen Hauses, über seinen Büchern und Schriftrollen eingeschlafen. Die kahya hatte eine Matte auf den Teppich gelegt und ihm so sein Lager bereitet.
Er arbeitete viel zu viel, dabei war er schon fünfundachtzig. In seinem Alter musste man sich im Kreise der Kinder und Enkel ausruhen, gut essen und seine Gebete verrichten. Das wenige, was seinem Körper an Kraft geblieben war, sollte er besser auf eine Pilgerreise nach Mekka verwenden, und starb er auf dem Weg, umso besser für seine Seele. Warum war der Meister nicht bereit für das Jenseits? Und wenn er bereit war, was um alles in der Welt hatte er dann auf Baustellen zu suchen, wo seine eleganten Kaftane staubig und schmutzig wurden? Die kahya war dem Meister böse, weil er nicht besser auf sich achtete, aber sie war auch böse auf den Sultan und auf die Wesire, die kamen und gingen, weil sie den Mann so schuften ließen. Und Sinans Schülern verübelte sie, dass sie ihrem Herrn die zusätzliche Bürde nicht abnahmen. Diese faulen Burschen! Dabei waren sie gar keine Burschen mehr. Sie hatte die vier schon gekannt, als sie noch blutige Anfänger waren. Nikola, den begabtesten und schüchternsten von ihnen, Davud, eifrig und ernst, aber ungeduldig, Yusuf, stumm und voller Geheimnisse, und diesen Inder, Jahan, der ständig Fragen stellte – Warum ist das so? und Wie funktioniert das? –, ohne sich die Antworten richtig anzuhören.
Grübelnd und betend starrte die kahya eine Zeit lang in ihren inneren Abgrund, und die drei Finger, mit denen sie die Bernsteinperlen weiterschob, wurden immer langsamer. Auch das gemurmelte »Alhamdulillah, Alhamdulillah«, Gelobt sei Allah, verklang nach und nach. Ihr Kopf sank auf die Brust, der Mund öffnete sich, und sie holte tief Luft.
Gleich darauf oder eine Stunde später – das wusste sie nicht zu sagen – erwachte sie von fernem Lärm. Von klappernden Hufen und Rädern, die über Kopfsteinpflaster fuhren. Es war eine Kutsche, die, dem Geräusch nach zu urteilen, in rasendem Tempo auf das Haus zurollte. Sinans Haus war das einzige Gebäude in einer Sackgasse. Würde das Gefährt um die Ecke biegen, musste dieses Haus sein Ziel sein. Der alten Frau lief es kalt über den Rücken.
Sie stieß ein Gebet gegen böse Geister aus und erhob sich trotz ihres Alters in Sekundenschnelle. Mit kurzen, wiegenden Schritten ging sie die Treppe hinunter, durchschritt mehrere Gänge und trat ins Freie. Der Garten mit seinen vielen Terrassen, dem Bassin und den wunderbar süßen Düften erfüllte jeden Gast mit Freude. Der Meister hatte ihn selbst angelegt. Eine Sondererlaubnis des Sultans ermöglichte es ihm, Wasser zum Haus zu leiten, was den Neid und Groll seiner Feinde hervorgerufen hatte. Gleichmütig drehte sich das Wasserrad und gaukelte mit seinem steten Plätschern eine Beständigkeit vor, die dem Leben selbst fehlte.
Der Mond, eine silberne Sichel, verbarg sich hinter einer Wolke, und einen Augenblick lang verschmolzen Himmel und Erde. Am Ende des Pfads zu ihrer Rechten erstreckte sich ein steil abfallendes Wäldchen, an dessen Fuß sich ein bostan befand, in dem Kräuter und Gemüse angebaut wurden. Die kahya folgte jedoch dem anderen Pfad, der sich zum Innenhof hinaufwand. An einer Seite stand ein Brunnen mit sommers wie winters eiskaltem Wasser. In der gegenüberliegenden Ecke befanden sich die Aborte, die sie wie immer umging, weil dort die Dschinn Hochzeit hielten, und wer sie spätnachts störte, blieb ein Krüppel bis zum Jüngsten Tag. Dieser Fluch war so stark, dass er seine Wirksamkeit erst nach der siebten Generation verlor. Da sie den Nachttopf noch mehr hasste als den Gang durch die Dunkelheit zu den Aborten, aß und trank die alte kahya nach Einbruch der Dämmerung nichts mehr, um ihrem Körper nicht ausgeliefert zu sein.
Voller Angst erreichte sie das Tor zur Straße. Drei Dinge gab es im Leben, von denen ihrer Ansicht nach nichts Gutes zu erwarten war: Männer, die ihre Seele an Schaitan verkauft hatten, Frauen, die stolz auf ihre Schönheit waren, und Nachrichten, die vor dem Morgengrauen überbracht sein wollten.
Kurz darauf blieb die Kutsche auf der anderen Seite des hohen Gitters stehen. Das Pferd schnaubte, und schwere Schritte näherten sich. Schweißgeruch lag in der Luft – ob der Gestank von dem Tier oder dem Boten rührte, konnte die kahya nicht feststellen. Sie hatte es keineswegs eilig damit, dem Eindringling gegenüberzutreten. Zuerst musste die Sure Al-Falaq sieben Mal gesprochen werden. Ich suche Zuflucht zum Herrn des Morgengrauens, vor dem Übel dessen, was Er erschaffen hat, und vor dem Übel der Nacht, wenn sie sich verfinstert, und vor dem Übel der auf Knoten blasenden Magierinnen …
Die ganze Zeit über klopfte der Bote höflich, aber hartnäckig ans Tor. Das Klopfen klang, als würde es sich zu einem Hämmern steigern, wenn es auch nur einen Moment zu lang unbeachtet bliebe, und genau so kam es. Schlaftrunken eilten nach und nach die Diener mit Lampen in den Garten, legten sich im Laufen noch die Schultertücher über die Gewänder. Nun konnte es die kahya nicht länger hinauszögern und schob mit den Worten Bismillah al-Rahman al-Rahim, im Namen Allahs des Barmherzigen und Gnädigen, den Riegel zurück.
Der Mond trat hinter den Wolken hervor und beschien einen kleinen, stämmigen Fremden, einen Tataren, nach der Form seiner Augen zu schließen. An seiner Schulter baumelte eine Lederflasche. In stolzer Haltung stand er da und runzelte angesichts der vielen gaffenden Leute sichtlich verärgert die Stirn.
»Ich komme vom Palast«, verkündete er in unnötig lautem Ton.
Die Stille, die daraufhin eintrat, war alles andere als einladend.
»Ich muss mit deinem Meister sprechen.«
Er straffte die Schultern und machte Anstalten, in den Garten zu treten, doch die kahya hob ihre Hand und gebot ihm, stehen zu bleiben. »Kommst du auch mit dem rechten Fuß zuerst herein?«, fragte sie.
»Was?«
»Wer diese Schwelle überschreitet, muss es mit dem rechten Fuß voran tun!«
Der Bote blickte auf seine Füße hinunter, als befürchtete er, sie könnten ihm davonlaufen; dann tat er einen vorsichtigen Schritt. Kaum im Garten, verkündete er, von niemand Geringerem als dem Sultan selbst in einer dringlichen Angelegenheit ausgesandt worden zu sein. Er hätte sich die Mitteilung sparen können, denn dass es sich so verhielt, war allen bereits klar geworden.
»Ich soll den Hofarchitekten herbeiholen«, fügte er hinzu.
Die kahya begann zu zittern, ihre Wangen wurden aschfahl. Sie räusperte sich. Die Worte, die sie nicht auszusprechen wagte, drängten sich in ihrem Mund. Am liebsten hätte sie dem Mann gesagt, dass ihr Meister, der doch ohnehin zu wenig Schlaf fand, nicht gestört werden dürfe, doch sie stammelte nur: »Warte hier.«
Sie wandte den Kopf zur Seite und warf einen flackernden Blick ins Leere. »Komm mit, Hasan«, sagte sie schließlich zu einem Pagen, der, wie sie wusste, dort stand, weil er stark nach Fett und nach den Nelkenbonbons roch, die er sich heimlich in den Mund zu stecken pflegte.
Sie machten sich auf den Weg, die kahya voran, der Junge mit einer Lampe hinter ihr. Die Bodendielen knarzten unter ihren Schritten. Die kahya musste schmunzeln. Da errichtete der Meister nah und fern die prächtigsten Bauwerke, vergaß aber, sich im eigenen Haus um die Böden zu kümmern.
Als sie die Bibliothek betraten, schlug ihnen ein milder Wohlgeruch entgegen – der Duft von Büchern, Tinte, Leder, Bienenwachs, von Gebetsketten aus Zedern- und Regalen aus Walnussholz.
»Wacht auf, efendi«, flüsterte die kahya mit seidenweicher Stimme.
Reglos stand sie da und lauschte den Atemzügen ihres Herrn. Dann sprach sie ihn noch einmal an, lauter diesmal, doch er rührte sich nicht.
Der Junge, der seinem Herrn noch nie so nah gewesen war, nutzte die Zeit, um ihn eingehend zu betrachten. Die lange, gebogene Nase, die breite Stirn mit den tiefen Falten, den dichten, altersgrauen Bart, an dem er immer zupfte, wenn er tief in Gedanken war, die Narbe an der linken Braue, die an den Tag gemahnte, als er im Jünglingsalter in der Tischlerwerkstatt seines Vaters auf einen Keil gefallen war. Der Blick des Jungen wanderte zu den Händen seines Herrn, deren kräftige, knochige Finger und raue, schwielige Innenseiten davon zeugten, dass dieser Mann die Arbeit im Freien gewohnt war.
Nachdem die kahya seinen Namen zum dritten Mal gerufen hatte, öffnete Sinan die Augen und setzte sich auf. Als er die beiden Gestalten neben sich sah, fiel ein Schatten auf seine Züge. Niemand würde es wagen, ihn zu dieser Stunde zu wecken, es sei denn, ein Unglück war geschehen oder die Stadt bis auf die Grundmauern niedergebrannt.
»Ein Bote ist eingetroffen«, sagte die kahya. »Man erwartet Euch im Palast.«
Sinan erhob sich sehr langsam. »Möge es eine gute Nachricht sein, inşallah.«
Der Junge hielt ihm eine Schale hin und goss Wasser aus einem Krug hinein. Er kam sich ziemlich wichtig vor, weil er dem Herrn behilflich sein durfte, als der jetzt sein Gesicht wusch und sich ein helles Hemd und einen Kaftan anzog – nicht etwa einen von den neuen, sondern einen alten, dicken, braunen, der mit Pelz verbrämt war. Zu dritt gingen sie hinunter.
Als der Bote sie kommen sah, neigte er den Kopf. »Ich bitte die Störung zu verzeihen, efendi, aber ich habe den Befehl, Euch in den Palast zu bringen.«
»Man muss seine Pflicht erfüllen«, sagte Sinan.
»Kann der Junge den Herrn begleiten?«, fragte die kahya.
Der Bote zog, den Blick auf Sinan gerichtet, eine Augenbraue hoch. »Ich wurde angewiesen, Euch zu bringen, niemanden sonst.«
Der kahya schoss ein gallenbitterer Geschmack in den Mund. Fast hätte sie ihre Stimme erhoben, doch Sinan legte ihr begütigend die Hand auf die Schulter und sagte: »Es ist schon recht so.«
Der Architekt und der Bote gingen in die Nacht hinaus. Kein Lebewesen war zu sehen, nicht einmal ein streunender Hund, von denen es doch so viele gab in dieser Stadt. Als Sinan in der Kutsche saß, schloss der Bote den Schlag, sprang auf den Bock und nahm neben dem Kutscher Platz, der bisher kein Wort gesprochen hatte. Mit einem Ruck liefen die Pferde los, und kurz darauf jagten sie holpernd durch die düsteren Straßen.
Um sein Unbehagen zu verbergen, zog Sinan den dichten Vorhang zur Seite und sah nach draußen. Während der galoppierenden Fahrt unter kummervoll gekrümmten Ästen durch verwinkelte Gassen dachte er an die Menschen, die in ihren Häusern schliefen, die Reichen in ihren konaks, die Armen in ihren Hütten. Sie kamen am Judenviertel vorbei, am armenischen Viertel und an den Stadtteilen der Griechen und Levantiner. Er betrachtete die Kirchen, die keine Glocken haben durften, die Synagogen mit ihren quadratischen Höfen, die Moscheen mit ihren bleigedeckten Dächern und die Häuser aus Holz und Lehmziegeln, die sich aneinanderlehnten, als suchten sie Trost. Auch die Adeligen hatten ihre Häuser aus schlecht gebrannten Ziegeln errichtet. Zum tausendsten Mal fragte er sich, wie eine an Schönheit so reiche Stadt voller dürftig gebauter Häuser sein konnte.
Endlich erreichten sie den Palast. An der rückwärtigen Mauer des Ersten Hofs kam die Kutsche zum Stehen. Die Palastdiener eilten herbei und halfen mit raschen, geübten Bewegungen beim Aussteigen. Sinan und der Bote passierten das Mittlere Tor, das nur der Sultan zu Pferd durchqueren durfte, und gingen an einem Marmorbrunnen vorbei, der im Dunkel leuchtete wie nicht von dieser Welt. Weiter hinten, am Meer, ragten die Pavillons auf wie verdrießliche Riesen. Da Sinan erst kürzlich Teile des Harems vergrößert und die kaiserlichen Küchen renoviert hatte, kannte er sich im Palast recht gut aus. Plötzlich blieb er stehen. Aus der tiefen Dunkelheit starrte ihm ein Augenpaar entgegen. Es war eine Gazelle mit großen, glänzenden Augen tief wie ein See. Gleich darauf sah er weitere Tiere – Pfauen, Schildkröten, Strauße, Antilopen, die unverständlicherweise allesamt wach und verängstigt waren.
In der kühlen, frischen Luft lag der Duft von Myrte, Nieswurz und Rosmarin. Am Abend hatte es geregnet, das Gras gab unter den Füßen nach. Die Wachen traten zur Seite und ließen die beiden Männer passieren, die bald darauf das wuchtige Steingebäude erreichten, dessen Farbe an Gewitterwolken erinnerte, und eine Halle durchschritten, die von den im Zugwind flackernden Flammen zahlreicher Talgkerzen erleuchtet war. Nachdem sie zwei Gemächer hinter sich gelassen hatten, blieben sie im dritten stehen. Kaum waren sie eingetreten, entschuldigte sich der Bote und verschwand. Blinzelnd versuchte Sinan, seine Augen an die enorme Größe des Raums zu gewöhnen. Jeder Krug, jedes Kissen, jedes Ornament warf unheimliche Schatten an die Wände, Schatten, die sich krümmten und wanden, als wollten sie ihm etwas sagen.
In der gegenüberliegenden Ecke war das Licht etwas schwächer. Sinan erblickte die Säcke auf dem Boden und zuckte zusammen. Durch eine Öffnung war das Gesicht einer Leiche zu sehen. Als er erkannte, wie jung der Knabe war, ließ er die Schultern sinken, und seine Augen wurden feucht. Er wusste Bescheid. Dass dies geschehen könnte, war bereits gemunkelt worden; er hatte es nur nicht wahrhaben wollen. Wie betäubt vor Bestürzung lehnte er sich an die Wand. Nach einer Weile begann er, sehr langsam und immer wieder nach Atem ringend zu beten.
Er hatte noch nicht amin gesagt, noch nicht mit beiden Händen über sein Gesicht gestrichen, als hinter ihm etwas knarrte. Er sprach sein Gebet zu Ende und blickte zu dem Teppich an der Wand, von dem das Geräusch gekommen war. Mit staubtrockenem Mund schlurfte er hin, zog den Stoff zur Seite – und sah sich einer vertrauten, kreidebleichen und vor Angst bebenden Gestalt gegenüber.
»Jahan?«
»Meister!«
»Was machst du hier?«
Jahan sprang hervor und dankte seinem Schicksal, das nicht die Taubstummen geschickt hatte, damit sie ihn erdrosselten, sondern den einzigen Menschen auf der Welt, der ihn retten konnte. Er kniete nieder, küsste dem alten Mann die Hand und führte sie an seine Stirn.
»Ihr seid ein Heiliger, Meister. Ich habe es immer geahnt, jetzt weiß ich es. Wenn ich hier lebend herauskomme, werde ich es überall berichten.«
»Pst, hör auf mit dem Unsinn und schrei nicht so! Wie bist du hierhergekommen?«
Für Erklärungen blieb keine Zeit. Schritte dröhnten durch den Gang und hallten von den hohen Decken und den reich verzierten Wänden wider. Jahan erhob sich und rückte nah zu seinem Meister in der Hoffnung, unsichtbar zu werden. Einen Augenblick später betrat Murad III. den Raum, hinter sich sein Gefolge. Er war eher klein und beleibt, hatte eine Adlernase, einen langen, fast blonden Bart und kühn blickende Augen unter den geschwungenen Brauen. Er blieb stehen, um zu entscheiden, welchen Ton er anschlagen sollte – den sanften, den schärfsten oder den allerschärfsten.
Sinan gewann seine Fassung zurück und küsste den Saum des herrschaftlichen Kaftans. Sein Schüler verneigte sich tief und erstarrte, unfähig, den Blick zum Schatten Gottes auf Erden zu heben. Jahan erstaunte weniger das Aussehen des Sultans als die Tatsache, dass er sich tatsächlich in der Anwesenheit des Gebieters befand. Denn Murad war nun Sultan geworden. Sein Vater, Selim der Säufer, war im hamam auf nassem Marmor ausgerutscht und hatte den Sturz nicht überlebt. Volltrunken sei er gewesen, erzählte man sich, obwohl er seine Sünden bereut und geschworen hatte, nie wieder einen Tropfen Wein zu sich zu nehmen. Kurz vor Sonnenuntergang hatte man Murad das Schwert seines Vorfahren Osman angelegt und ihn unter Lobpreisungen, mit Pauken und Trompeten und einem Feuerwerk zum neuen Padischah ausgerufen.
Draußen, weit in der Ferne, rauschte und seufzte das Meer. Jahan, der sich immer noch nicht zu regen wagte, wartete schweigend wie ein Grab, während ihm der Schweiß auf die Stirn trat. Er lauschte der Stille, die seine Schultern niederdrückte, bis sich sein Mund so dicht über dem Boden befand, dass er ihn hätte küssen können wie eine kühle Geliebte.
»Warum liegen die Toten hier?«, fragte der Sultan, als er die Säcke am Boden sah. »Habt ihr kein Schamgefühl?«
Sofort erwiderte einer der Diener: »Wir bitten um Verzeihung, Herr, aber wir dachten, Ihr möchtet sie ein letztes Mal sehen. Wir bringen sie jetzt ins Leichenhaus und sorgen dafür, dass ihnen die geziemende Achtung zuteilwird.«
Ohne etwas zu entgegnen, wandte sich der Sultan den beiden Männern zu, die vor ihm knieten. »Ist das einer deiner Schüler, Architekt?«
»Ja, Eure Hoheit«, antwortete Sinan. »Einer von vieren.«
»Ich hatte nur nach dir schicken lassen. Hat der Bote meinen Befehl missachtet?«
»Es war meine Schuld, verzeiht mir. In meinem Alter bin ich auf Hilfe angewiesen.«
Der Sultan dachte kurz nach. »Wie heißt er?«
»Jahan ist sein Name, trefflicher Herr. Der Mahut hier im Palast, vielleicht ist er Euch bekannt. Er kümmert sich um den weißen Elefanten.«
»Tierbändiger und zugleich Architekt«, spöttelte der Sultan. »Wie kam das zustande?«
»Er hat Sultan Süleyman, Eurem ruhmreichen Großvater, gedient, Allahs Friede sei auf ihm. Als wir sein Talent für den Brückenbau erkannten, nahmen wir ihn unter unsere Fittiche und bilden ihn nun schon aus, seit er ein Knabe war.«
»Mein Großvater war ein bedeutender Herrscher«, murmelte der Sultan wie zu sich selbst.
»Nicht weniger zu rühmen als der Prophet, nach dem er benannt war, Herr.«
Süleyman der Prächtige, der Gesetzgeber, Gebieter über die Gläubigen und Beschützer der heiligen Städte, der Mann, der sechsundvierzig Winter lang regiert und mehr Zeit auf dem Pferd als auf dem Thron verbracht hatte. Obwohl er tief in der Erde begraben und sein Leichentuch längst zerfallen war, sprach man nur mit gedämpfter Stimme von ihm.
»Möge Allahs Gnade auf ihm sein. Heute Nacht habe ich an ihn gedacht und mich gefragt, was er an meiner Stelle täte«, sagte Sultan Murad, und zum ersten Mal brach seine Stimme. »Mein Großvater hätte dasselbe getan, es blieb keine Wahl.«
Jahan schwante, dass er von den Toten sprach, und wurde von Entsetzen ergriffen.
»Meine Brüder sind nun beim Erhalter des Universums«, sagte der Sultan.
»Möge der Himmel ihre Wohnstatt sein«, fügte Sinan leise hinzu.
Eine Weile herrschte Schweigen. Dann ergriff der Sultan wieder das Wort. »Architekt, mein ehrwürdiger Vater Sultan Selim hat dir befohlen, ihm ein Mausoleum zu bauen, nicht wahr?«
»Sehr wohl, Hoheit. Er wollte neben der Hagia Sophia begraben werden.«
»Nun, dann baue es. Fang unverzüglich mit der Arbeit an. Du hast die Erlaubnis, alles Nötige zu veranlassen.«
»Sehr wohl, Herr.«
»Ich will meine Brüder neben dem Vater begraben. Die türbe soll so prachtvoll werden, dass die Menschen noch in Jahrhunderten dort für ihre unschuldigen Seelen beten können.« Nach kurzem Zögern fügte er hinzu: »Allzu pompös soll sie aber auch nicht geraten – sie soll genau die richtige Größe haben.«
Aus den Augenwinkeln sah Jahan seinen Meister erbleichen. Er nahm einen Geruch wahr, vielmehr ein Gemisch von Gerüchen, Wacholder und Birkenzweige mit einem stechenden Unterton, der an verbranntes Ulmenholz erinnerte. Ob es vom Herrscher kam oder von Sinan, wusste er nicht zu sagen. Angstvoll verbeugte er sich noch einmal so tief, dass seine Stirn den Boden berührte. Er hörte den Sultan Luft holen, als wollte er noch etwas sagen. Doch der Herrscher schwieg und ging auf ihn zu, kam immer näher, bis sein Körper das Kerzenlicht verdeckte. Jahan erschauderte unter dem Blick, und ihm stockte das Herz. Hegte der Sultan den Verdacht, dass er heute Nacht in den Innenhof eingedrungen war? Jahan spürte den kaiserlichen Blick noch einen Moment länger auf sich ruhen; dann schritt der Herrscher hinaus, dicht gefolgt von Wesiren und Wachleuten.
So geschah es, dass an einem frühen Tag im Ramadan, im Dezember des Jahres 1574, Sinan in seiner Eigenschaft als Hofarchitekt und sein Schüler Jahan, der bei dieser Besprechung nichts zu suchen hatte und doch anwesend war, den Auftrag erhielten, in den Gärten der Hagia Sophia ein Mausoleum zu errichten, das in Größe und Ansehnlichkeit fünf Prinzen geziemte, den Brüdern von Sultan Murad, aber mit seiner Größe und Ansehnlichkeit nicht daran erinnern durfte, dass man sie in der Nacht seiner Thronbesteigung auf sein Geheiß erdrosselt hatte.
Keiner der Anwesenden ahnte, dass Jahre später, als Sultan Murad starb, in einer ebensolchen Nacht, als der Wind ächzte und die Tiere in der Menagerie brüllten, seine eigenen Söhne – alle neunzehn – mit einer Bogensehne aus Seide erdrosselt wurden, um nicht ihr edles Blut zu vergießen, und man sie, wie es das Schicksal wollte, in dem Mausoleum begrub, das der Architekt und sein Schüler gebaut hatten.
Vor dem Meister
Der Prophet Jakob hatte zwölf Söhne, der Prophet Jesus zwölf Apostel. Der Prophet Joseph, dessen Geschichte in der zwölften Sure des Korans erzählt wird, war das Lieblingskind seines Vaters. Zwölf Laibe legten die Juden auf den Schaubrottisch. Zwölf goldene Löwen bewachten Salomons Thron. Sechs Stufen führten zu diesem Thron, und da jeder Aufstieg auch einen Abstieg bedeutete, waren es zugleich sechs nach unten führende Stufen, zwölf insgesamt. Zwölf Religionen gab es im Land Hindustan. Gemäß der Schia folgten zwölf Imame auf den Propheten Mohammed. Zwölf Sterne zierten Marias Krone. Und ein Junge namens Jahan hatte kaum sein zwölftes Lebensjahr vollendet, als er zum ersten Mal Istanbul sah.
Er war dünn, braungebrannt, rastlos wie ein Fisch in der Strömung und eher klein für sein Alter. Als versuchte er, die mangelnde Körpergröße auszugleichen, wuchs seine schwarze Mähne senkrecht in die Höhe und saß ihm auf dem Kopf wie ein Wesen mit eigenem Leben. Wer ihn erblickte, sah zuerst seine Haare. Dann die Ohren, jedes groß wie eine Männerfaust. Doch seine Mutter sagte immer, eines Tages würden sich die Mädchen verzaubern lassen von seinem strahlenden Lächeln und dem Grübchen in seiner linken Wange, das der Delle glich, die der Daumen des Bäckers im weichen Teig hinterließ. Das hatte sie gesagt, und das glaubte er.
Rosarote Lippen, seidig schimmerndes Haar, die Taille schmaler als ein Weidenast. Flink wie eine Gazelle, stark wie ein Ochse, gesegnet mit der Stimme einer Nachtigall. Mit dieser Stimme würde sie ihren Kindern Schlaflieder vorsingen, sie würde sie jedoch niemals für leeres Geschwätz benutzen oder um sich gegen ihren Mann aufzulehnen. Eine solche Braut hätte seine Mutter für ihn gewollt, wäre sie noch am Leben gewesen. Doch sie war tot – gestorben an der Schwermut, hatten die Ärzte gesagt. Jahan aber wusste, dass es die Schläge gewesen waren, die ihr sein brutaler Stiefvater, der zufälligerweise auch sein Onkel war, täglich versetzt hatte. Bei ihrem Begräbnis hatte sich der Mann die Seele aus dem Leib geweint, als wäre ein anderer an ihrem frühen Tod schuld gewesen. Seither hatte Jahan ihn aus tiefstem Herzen gehasst. Als er an Bord des Schiffs gegangen war, tat es ihm leid, die Heimat zu verlassen, ohne die Mutter gerächt zu haben. Doch ihm war klar gewesen, dass, wäre er geblieben, entweder er seinen Onkel oder sein Onkel ihn getötet hätte. Wahrscheinlich Letzteres, denn er war noch sehr jung und nicht stark genug. Wenn die Zeit gekommen war, würde er zurückkehren und Vergeltung üben. Und seine Liebste finden. Vierzig Tage und vierzig Nächte lang würden sie Hochzeit feiern, sich mit Zuckerwerk vollstopfen und immer nur lachen. Ihrer ersten Tochter würde er den Namen seiner Mutter geben. Von diesem Traum erzählte er keinem.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!