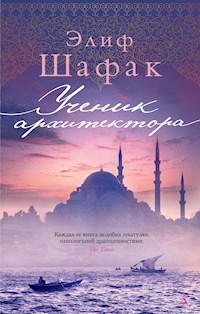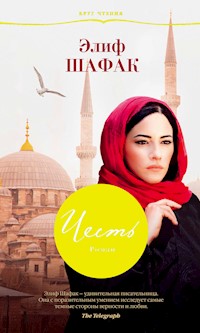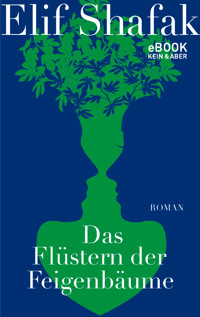Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BONNEVOICE Hörbuchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Elif Shafak, eine der bedeutendsten Stimmen für Gleichberechtigung und freiheitliche Werte in Europa, zeigt mit viel Einsicht Wege auf, wie wir Demokratie, Einfühlungsvermögen und unseren Glauben an eine bessere und weisere Zukunft fördern können. Ihr Ansatz: Wir müssen endlich anfangen, uns gegenseitig Gehör zu schenken.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks der Autorin
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Elif Shafak, in Straßburg geboren, gehört zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen der Gegenwart. Ihre Werke wurden in über fünfzig Sprachen übersetzt. Die preisgekrönte Autorin von siebzehn Büchern, darunter Die vierzig Geheimnisse der Liebe (2013) und Ehre (2014), schreibt auf Türkisch und Englisch. Mit Unerhörte Stimmen (2019) stand sie auf der Shortlist des Man Booker Prize. Elif Shafak lebt in London. www.elifshafak.com
ÜBER DAS BUCH
Elif Shafak, eine der bedeutendsten Stimmen für Gleichberechtigung und freiheitliche Werte in Europa, zeigt mit viel Einsicht Wege auf, wie wir Demokratie, Einfühlungsvermögen und unseren Glauben an eine bessere und weisere Zukunft fördern können. Ihr Ansatz: Wir müssen endlich anfangen, uns gegenseitig Gehör zu schenken.
Es war mein erster Tag in Istanbul, ein windiger Septemberabend vor vielen Jahren. Ich war damals eine junge Frau und angehende Schriftstellerin und war, einer Eingebung folgend, die ich weder erklären noch ignorieren konnte, in die Stadt gezogen, in der ich niemanden kannte. Nahe dem Taksim-Platz, im lebendigsten, weltoffensten Viertel, hatte ich mir eine winzige Wohnung gemietet. Sie lag in einer schmalen Straße, und tagsüber hörte ich das Geklapper der Backgammonwürfel auf den hölzernen Spielbrettern vom Teehaus gegenüber und das Geschrei der Möwen, die durch die Luft schossen, um ahnungslosen Passanten das Sandwich aus der Hand zu schnappen. Doch jetzt war es spät in der Nacht. Das Teehaus hatte geschlossen, und die Möwen hockten auf den Dachfirsten. Ich saß auf einem Karton voller Bücher und Unterlagen im fahlen Licht der Straßenlampe – an den Fenstern meiner Wohnung waren weder Vorhänge noch Jalousien angebracht – und lauschte den Geräuschen der niemals schlafenden Stadt. Dabei musste ich eingedöst sein, denn plötzlich wurde ich von lautem Gejammer geweckt.
Ich blickte aus dem Fenster, und da war sie: eine groß gewachsene Transfrau in kurzem Rock und Seidenbluse. Sie hielt einen High Heel mit abgebrochenem Stöckel in der Hand und humpelte wütend durch die Gasse, während sie den anderen Schuh verbissen anbehielt. Ich wusste, dass in dem relativ liberalen Stadtteil viele Angehörige sexueller Minderheiten wohnten, deren Leben und finanzielle Existenz jedoch ständig von gesellschaftlichen Vorurteilen und systematischer Diskriminierung überschattet waren. Da es für diese Menschen keine anderen Arbeitsmöglichkeiten gab, verdienten viele von ihnen ihr Geld entweder als Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter auf der Straße oder waren in den Bars, Klubs und Kneipen des Istanbuler Nachtlebens beschäftigt. Obwohl die Polizei sie aus einigen rasant gentrifizierten Ecken ganz in der Nähe brutal vertrieben hatte, bildeten sie in meiner Straße, der »Straße der Kesselflicker«, nach wie vor eine eng verbundene, stolze Community.
Während die Transfrau unter meinem Fenster vorbeiging, bekam ich einige Satzfetzen ihres Selbstgesprächs mit. Irgendwer – vielleicht ein geliebter Mensch, vielleicht die ganze Stadt – hatte sie ungerecht oder schlecht behandelt. Sie war traurig, doch ihre Traurigkeit wurde noch übertroffen von ihrer Wut.
Es begann zu regnen, und die Tropfen fielen immer schneller,
tropf, tropf, tropf.
Ein einzelner Stöckel hallte auf dem Kopfsteinpflaster,
klack, klack, klack.
Ich blickte ihr nach, bis sie am Ende der Straße um die Ecke gebogen war. Nie zuvor hatte ich eine Frau gesehen, die so beharrlich weitermachte, obwohl sie am Boden zerstört war. Ich hätte das Fenster öffnen und mit ihr reden, sie fragen sollen, ob alles in Ordnung sei, dachte ich mit schlechtem Gewissen und schämte mich, weil ich reflexhaft ein Stück tiefer in meine Wohnung zurückgewichen war, als könnte mich ihre Traurigkeit anstecken. Beides, die Ähnlichkeiten und die Unterschiede, brannte sich in mein Gedächtnis ein: ihre Einsamkeit, die mir meiner Einsamkeit ganz ähnlich zu sein schien, doch auch meine Ängstlichkeit im Gegensatz zu ihrer Tapferkeit. Sie hatte längst genug von Istanbul, der Stadt, die ich noch nicht einmal zu entdecken begonnen hatte. Am allerwichtigsten aber: Sie war eine Kämpferin, ich nur eine Beobachterin.
Seither sind viele Jahre vergangen, und ich lebe nicht mehr in Istanbul. Doch während ich hier an meinem Schreibtisch in London sitze und über unsere polarisierte, krisengeschüttelte Welt schreibe, erinnere ich mich an jenen Moment. Ich erinnere mich an die Frau, und denke nach über Einsamkeit, Wut und Schmerz.
Die Pandemie. Als das Coronavirus über den Globus fegte und Hunderttausende tötete, Millionen arbeitslos machte und unser Leben von Grund auf veränderte, sah man in den öffentlichen Parks in London hier und da Holzschilder stehen. »Wie soll sich die Welt verändert haben, wenn all das vorbei ist?«, stand darauf. Was mit »all das« gemeint war, mussten sich die Passanten offenbar selbst erklären – der abrupte Zusammenbruch unseres gewohnten Alltags, die wachsende Ungewissheit und die Angst vor der Zukunft, die weltweite Gesundheitskrise mit ihren langfristigen wirtschaftlichen, sozialen und möglicherweise politischen Konsequenzen oder der Tunnel, durch den die Menschheit gehen muss, ohne vorhersehen zu können, wie und wann sein Ende erreicht sein wird und ob nicht schon in naher Zukunft der Ausbruch einer weiteren ansteckenden Krankheit droht.
Auf den Schildern war der Platz unter der Frage bewusst leer gelassen worden, damit die Leute Antworten aufschreiben konnten, was tatsächlich viele getan hatten. Von allen hastig hingekritzelten Bemerkungen ist mir eine ganz besonders in Erinnerung geblieben: die in Großbuchstaben geäußerte Bitte »Ich möchte gehört werden«.
Wenn all das vorbei ist, möchte ich in einer Welt leben, in der ich gehört werde.
Dieser Aufschrei eines einzelnen Menschen klang gleichzeitig wie ein kollektiver Aufschrei.
»Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen?«, schrieb der Lyriker und Romanautor Rainer Maria Rilke in seinen Duineser Elegien1, verfasst und veröffentlicht im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts, in einer völlig anderen Zeit. Heute, im 21. Jahrhundert, in einer tief gespaltenen und immer unübersichtlicher werdenden, nach Würde und Gleichstellung lechzenden Welt, überwältigt von rapidem Wandel und beschleunigter Technik, lautet die allgegenwärtige Frage: »Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Menschen Ordnungen?«
Menschen, die viel zu sagen hätten, die eine eigene Geschichte erzählen könnten, unterlassen dies oft, weil sie befürchten, auf taube Ohren zu stoßen. Sie fühlen sich ausgeschlossen von politischer Macht und auch weitgehend von politischer und gesellschaftlicher Teilhabe. Ihrer Überzeugung nach könnten sie nicht einmal dann politisch etwas bewirken, wenn sie ihren Unmut von den Dächern Westminsters hinunterbrüllen würden – oder von den Dächern Brüssels, Washingtons oder Neu-Delhis. Nicht nur Unternehmensführung und Amtsgewalt, Macht und Reichtum, sondern auch Daten und Wissen konzentrieren sich zunehmend in den Händen einiger weniger. Dem Empfinden dieser Menschen nach hat man sie nicht vergessen, sondern von Anfang an nicht gesehen. Mit der wachsenden Ernüchterung nimmt auch der Argwohn gegenüber den wichtigsten Institutionen zu. Mehr als die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner demokratischer Länder gibt an, ihre Stimme werde »nie« oder »selten« gehört.2