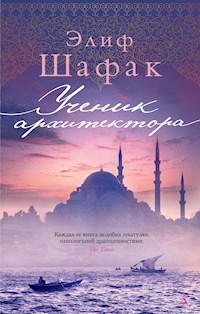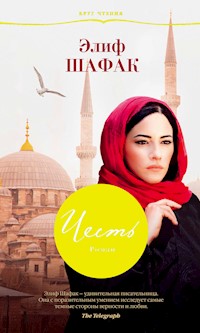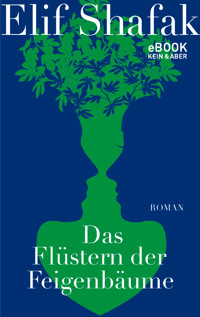13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Zwillingsschwestern Pembe und Jamila sind ein Herz und eine Seele. Doch während Jamila ihre Zukunft in einem kleinen kurdischen Dorf sieht, strebt Pembe nach mehr und zieht mit ihrem Mann und ihren drei Kindern nach London. Sie ahnt noch nicht, dass über ihrer
Familie ein unfassbares Unheil schwebt. Ein bewegender Roman über Hoffnung und Verlust, Vertrauen und Verrat, Liebe und Ehre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 607
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Danksagung,Glossar
» Impressum
» Weitere eBooks von Elif Shafak
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Elif Shafak, in Straßburg geboren, gehört zu den meistgelesenen Schriftstellerinnen in der Türkei. Sie studierte Internationale Beziehungen an der Technischen Universität des Nahen Ostens in Ankara, erhielt einen »Master of Sciences in Gender and Women›s Studies« und promovierte an derselben Universität. Die preisgekrönte Autorin von zwölf Büchern schreibt auf Türkisch und auf Englisch. Ihre Bücher sind in über 30 Ländern erschienen. Elif Shafak lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in London und Istanbul. 2013 erschien bei Kein & Aber ihr Roman Die vierzig Geheimnisse der Liebe.
ÜBER DAS BUCH
Niemals hätte Pembe gedacht, dass es in London, fernab ihrer türkischen Heimat, so schwierig werden könnte: Ihr Mann verfällt dem Glücksspiel, ihre Kinder gehen eigene Wege, und sie selbst findet keinen Anschluss an diese fremde Welt. Erst eine unverhoffte Begegnung lässt sie wieder aufblühen. Doch als sie die Gefahr ihrer neuen Gefühle realisiert, kann sie die Katastrophe nicht mehr verhindern …
Ein bewegendes Familienepos über Hoffnung und Verlust, Vertrauen und Verrat, Liebe und Ehre.
• Ein monumentaler Generationenroman• Startauflage: 50000 Exemplare• Erscheint in 24 Ländern
»Ein prachtvoller Diamant von einem Roman!« The Times
»Elif Shafak ist der Star der türkischen Literaturszene.« Der Spiegel
Als ich sieben Jahre alt war, wohnten wir in einem grünen Haus. Ein Nachbar von uns, ein tüchtiger Schneider, schlug oft seine Frau. Abend für Abend hörten wir das Geschrei, das Schluchzen, die Flüche. Am nächsten Morgen machten wir weiter im alten Trott. Alle Nachbarn taten, als hätten sie nichts gehört und nichts gesehen.Dieser Roman ist denen gewidmet, die hören und sehen.
So weit seine Erinnerung reicht, hat er sich als Prinz des Hauses gefühlt und seine Mutter als seine fragwürdige Gönnerin und besorgte Beschützerin.J.M. Coetzee: Der Junge. Eine afrikanische Kindheit
Esma
LONDON, 12. SEPTEMBER 1992
Meine Mutter starb zwei Mal. Ich habe mir geschworen, ihre Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, habe aber nie die Zeit oder den Willen oder den Mut aufgebracht, sie niederzuschreiben. Bis vor Kurzem. Ich glaube nicht, dass jemals eine echte Schriftstellerin aus mir wird, aber das ist in Ordnung. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich meine Grenzen und Fehler besser akzeptieren kann. Aber ich musste die Geschichte erzählen, und sei es nur einem einzigen Menschen. Ich musste sie in die Welt hinausschicken, damit sie losgelöst von uns frei davonschweben konnte. Diese Freiheit war ich Mum schuldig. Und ich musste noch dieses Jahr fertig werden, noch vor seiner Entlassung aus dem Gefängnis.
In ein paar Stunden werde ich das Sesamhalwa vom Herd nehmen und neben dem Spülbecken abkühlen lassen, ich werde meinem Mann einen Kuss geben und so tun, als sähe ich seinen besorgten Blick nicht. Dann werde ich meine Zwillingstöchter – sieben Jahre alt, im Abstand von vier Minuten geboren – zu einem Kindergeburtstag fahren. Sie werden unterwegs streiten, aber ich werde ausnahmsweise nicht schimpfen. Es wird darum gehen, ob bei der Party ein Clown oder, noch besser, ein Zauberer auftritt.
»Wie Harry Houdini«, werde ich sagen.
»Wer?«
»Huu-diini hat sie gesagt, Blödfrau!«
»Wer ist das, Mummy?«
Es wird wehtun. Ein Schmerz wie nach einem Bienenstich. Äußerlich nicht viel zu sehen, aber innen brennt es und brennt. Wie so oft wird mir bewusst, dass sie ihre eigene Familiengeschichte nicht kennen, weil ich ihnen kaum etwas erzählt habe. Irgendwann, wenn sie so weit sind. Wenn ich so weit bin.
Nachdem ich die Mädchen abgesetzt habe, werde ich mich noch ein bisschen mit den anderen Müttern unterhalten. Ich werde die Gastgeberin daran erinnern, dass eine meiner Töchter eine Nussallergie hat, dass sie aber, weil sie so schwer auseinanderzuhalten sind, besser bei allen zweien aufpassen und keiner von ihnen etwas mit Nüssen zu essen geben soll, auch nichts vom Geburtstagskuchen. Das ist zwar meiner anderen Tochter gegenüber ein bisschen ungerecht, aber so geht es eben manchmal zu zwischen Geschwistern – ungerecht.
Dann werde ich mich wieder ins Auto setzen, einen roten Austin Montego, den sich mein Mann und ich teilen. Die Fahrt von London nach Shrewsbury dauert dreieinhalb Stunden. Kurz vor Birmingham werde ich wohl einen Boxenstopp einlegen müssen. Die ganze Zeit über wird das Radio laufen – die Musik wird die Gespenster vertreiben.
Ich habe oft daran gedacht, ihn zu töten. Ich habe ausgeklügelte Pläne geschmiedet, in denen Pistolen, Gift oder, am allerbesten, ein Schnappmesser vorkamen – eine symbolische Gerechtigkeit gewissermaßen. Ich habe auch daran gedacht, ihm ganz und aus vollem Herzen zu verzeihen. Letztlich habe ich beides nicht geschafft.
In Shrewsbury werde ich den Wagen vor dem Bahnhof parken und nach fünfminütigem Fußmarsch den heruntergekommenen Gefängnisbau erreichen. Ich werde auf der Straße auf und ab gehen oder mich an die Mauer gegenüber dem Haupteingang lehnen und warten, dass er herauskommt. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Und ich weiß auch nicht, wie er reagieren wird, wenn er mich sieht. Ich habe ihn seit über einem Jahr nicht mehr besucht. Früher bin ich regelmäßig zu ihm, doch als der Entlassungstermin näher rückte, habe ich einfach aufgehört.
Irgendwann wird man die massive Tür von innen öffnen, und er wird heraustreten. Er wird in den bewölkten Himmel blicken, weil er die riesige Weite über sich nach vierzehn Jahren Haft nicht mehr gewohnt ist. Ich stelle mir vor, dass er ins Tageslicht blinzelt wie ein Nachttier. Ich werde mich die ganze Zeit über nicht vom Fleck rühren und bis zehn oder bis hundert oder bis dreitausend zählen. Wir werden uns nicht umarmen. Wir werden uns nicht die Hand geben. Nur ein kurzes Nicken und eine knappe Begrüßung mit leiser, belegter Stimme. Am Bahnhof wird er schwungvoll ins Auto steigen. Ich werde erstaunt feststellen, wie athletisch er ist. Er ist eben immer noch ein junger Mann.
Wenn er rauchen möchte, werde ich nichts dagegen haben, obwohl ich den Geruch widerlich finde und meinen Mann weder im Wagen noch im Haus rauchen lasse. Wir werden durch die englische Landschaft fahren, vorbei an sanften Wiesen und weiten Feldern. Er wird sich nach meinen Töchtern erkundigen. Ich werde ihm sagen, dass es ihnen gut geht, dass sie schnell wachsen. Er wird lächeln, obwohl er nicht die leiseste Ahnung von Kindern hat. Ich dagegen werde ihm keine Fragen stellen.
Ich werde eine Musikkassette dabeihaben. Die größten Hits von ABBA – die Songs, die meine Mutter beim Kochen oder Putzen oder Nähen vor sich hin summte. Take a Chance on Me, Mamma Mia, Dancing Queen, The Name of the Game … Denn sie wird uns zusehen, ich bin mir ganz sicher. Mütter kommen nicht in den Himmel, wenn sie gestorben sind. Sie erhalten eine Sondererlaubnis von Gott und dürfen noch ein bisschen bleiben und über ihre Kinder wachen, egal, was sich in ihrem Leben zwischen ihnen abgespielt hat.
Wenn wir dann wieder in London und in der Nähe des Barnsbury Square sind, werde ich leise murrend einen Parkplatz suchen. Es wird anfangen zu regnen – winzige, kristallklare Tropfen. Irgendwann werden wir eine Lücke finden, in die ich den Wagen nach endlosem Manövrieren hineinzwänge. Ich kann mir zwar meistens einreden, eine gute Autofahrerin zu sein, aber beim Einparken funktioniert das nicht. Ob er sich über die in seinen Augen typisch weibliche Fahrweise lustig machen wird? Früher hätte er es getan.
Wir werden durch die stille, helle Straße, die sich vor und hinter uns erstreckt, zum Haus gehen. Einen Moment lang werden wir die Umgebung mit unserer alten Wohngegend in Hackney vergleichen, mit dem Haus in der Lavender Grove, und darüber staunen, wie sehr sich alles verändert hat, wie sehr die Zeit vorangeschritten ist, auch als uns selbst das nicht gelang.
Drinnen werden wir unsere Schuhe ausziehen und in Pantoffeln schlüpfen – er in klassische dunkelgraue, die meinem Mann gehören, ich in burgunderrote mit Pompons. Bei ihrem Anblick wird er das Gesicht verzerren. Damit er sich wieder beruhigt, werde ich sagen, dass meine Töchter sie mir geschenkt haben. Sobald ihm klar wird, dass es nicht ihre sind, wird er sich entspannen. Die Ähnlichkeit ist reiner Zufall.
Von der Tür aus wird er beim Zubereiten des Tees zusehen, den ich ohne Milch, aber mit viel Zucker servieren werde, es sei denn, seine Gewohnheiten haben sich im Gefängnis geändert. Dann werde ich das Sesamhalwa aus dem Kühlschrank nehmen. Wir werden, jeder mit einer Porzellantasse und einem Teller in der Hand, am Fenster sitzen wie vornehme Fremde und zusehen, wie der Regen auf die Veilchen im Garten fällt. Er wird meine Kochkünste loben und sagen, wie sehr er Sesamhalwa vermisst hat, eine zweite Portion aber höflich ablehnen. Ich werde ihm erklären, dass ich mich zwar immer strikt an Mums Rezept halte, mein Halwa aber trotzdem nie so gut ist wie ihres. Das wird ihn zum Schweigen bringen. Wir werden uns anstarren, und die Stille wird schwer auf uns lasten. Dann wird er sich mit der Bemerkung, er sei müde und würde sich gern ausruhen, entschuldigen. Ich werde ihm sein Zimmer zeigen und langsam die Tür schließen.
Ich werde ihn dort allein lassen. In einem Zimmer in meinem Haus. Nicht zu nah und nicht zu fern. In diese vier Wände werde ich ihn einsperren, zwischen dem Hass und der Liebe, die ich empfinde, ob ich will oder nicht, und die für immer in einem Kästchen in meinem Herzen verschlossen sind.
Er ist mein Bruder.
Er, der Mörder.
Namen wie Zuckerwürfel
EIN DORF AN DEN UFERN DES EUPHRAT, 1945
Nach Pembes Geburt war Naze so traurig, dass sie alles vergaß, was sie in den sechsundzwanzig Stunden davor durchlitten hatte, auch das Blut, das zwischen ihren Schenkeln hervorgequollen war, und aufstehen und weggehen wollte. Jedenfalls erzählten das alle – alle, die an jenem stürmischen Tag im Geburtszimmer waren.
Doch sosehr es Naze auch fortzog, sie konnte nirgendwohin. Zum Erstaunen sowohl der Frauen im Zimmer als auch ihres Mannes Berzo, der im Hof wartete, wurde sie von neuerlichen Presswehen auf das Bett zurückgezwungen. Drei Minuten später erschien das Köpfchen eines zweiten Babys. Dichtes Haar, gerötete Haut, nass und verrunzelt. Wieder ein Mädchen, nur kleiner.
Diesmal versuchte Naze nicht wegzulaufen. Sie stieß einen winzigen Seufzer aus, vergrub den Kopf im Kissen und drehte sich dem offenen Fenster zu, als lauschte sie auf das sanfte Flüstern des Schicksals im Wind. Wenn sie aufmerksam hinhörte, dachte sie, bekäme sie vielleicht Antwort vom Himmel. Denn es musste doch einen Grund geben, den nur Allah kannte, weswegen Er Berzo und ihr zwei weitere Töchter geschenkt hatte, obgleich sie schon sechs Töchter hatten und keinen einzigen Sohn.
Und Naze schürzte ihre Lippen, denn sie war entschlossen, so lange kein Wort mehr zu sprechen, bis Allah ihr das Motiv Seines Handelns vollständig und überzeugend dargelegt hatte. Selbst im Schlaf presste sie die Lippen fest zusammen. In den folgenden vierzig Tagen und vierzig Nächten kam kein Wort aus ihrem Mund. Nicht, wenn sie Kichererbsen mit Schafsschwanzfett kochte, nicht, wenn sie ihre anderen sechs Töchter in einem großen runden Blechkübel badete, nicht einmal, wenn sie Käse mit Bärlauch und Kräutern machte und nicht einmal, als ihr Mann sie fragte, welche Namen sie den Neugeborenen geben wolle. Sie blieb stumm wie der Friedhof in den Bergen, auf dem alle ihre Vorfahren begraben lagen und wo man auch sie eines Tages zur letzten Ruhe betten würde.
Es war ein karges, entlegenes kurdisches Dorf ohne Straßen, ohne Elektrizität, ohne Arzt, ohne Schule, in dessen Abgeschiedenheit kaum je eine Nachricht von außen drang. Die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs, die Atombombe – von all dem hatten die Dorfbewohner nie etwas gehört. Dennoch waren sie davon überzeugt, dass es Seltsames gab in der Welt, also jenseits des Euphrat. Da aber die Welt nun einmal war, wie sie war, hatte es keinen Sinn, diese Seltsamkeiten entdecken zu wollen. Alles, was je gewesen war, und alles, was je sein würde, gab es schon hier und jetzt. Dem Menschen war es bestimmt, sesshaft zu sein wie die Bäume und Felsen. Es sei denn, man war ein Wandermystiker, der seine Vergangenheit, ein Narr, der den Kopf, oder ein Madschnun, der seine Liebste verloren hatte.
Doch wenn man von Derwischen, Sonderlingen und Liebenden absah, war für den Rest der Leute nichts erstaunlich und alles so, wie es sein sollte. Was sich in irgendeinem Winkel zutrug, bekamen alle anderen sofort mit. Geheimnisse waren ein Luxus, den sich nur die Reichen leisten konnten, und in diesem Dorf, in Mala Çar Bayan, »Haus der vier Winde«, war keiner reich.
Die Dorfältesten, drei schmächtige, gebrechlich wirkende Männer, saßen die meiste Zeit im einzigen Teehaus und sannen über die Rätsel des göttlichen Willens und die Beschränktheit der Politiker nach, während sie Tee aus Gläsern tranken, die so dünn wie Eierschalen, so zerbrechlich wie das Leben waren. Als sie von Nazes Schweigegelübde erfuhren, beschlossen sie, ihr einen Besuch abzustatten.
»Wir sind gekommen, weil wir dich davor warnen wollen, einen Frevel zu begehen«, sagte der Erste, der so alt war, dass ihn der kleinste Lufthauch zu Boden werfen konnte.
»Wie kannst du erwarten, dass Allah der Allmächtige dir Seine Vorhaben offenbart, wenn Er doch bisher nur zu Propheten gesprochen hat?«, warf der Zweite ein, der nur noch ein paar Zähne im Mund hatte. »Und zu denen gehörte ganz sicher keine Frau!«
Der Dritte fuchtelte mit seinen steifen, knorrigen Händen durch die Luft. »Allah will, dass du sprichst, denn sonst hätte Er dich als Fisch auf die Welt kommen lassen.«
Naze hörte zu und tupfte sich hin und wieder mit den Zipfeln ihres Kopftuchs die Augen trocken. Sie stellte sich vor, ein Fisch zu sein – eine dicke, braune Forelle im Fluss, mit Flossen, die im Sonnenlicht glänzten, mit Punkten, die von hellen Höfen umgeben waren. Sie konnte nicht wissen, dass ihre Kinder und Enkel und alle folgenden Generationen ihrer Familie eine innere Nähe zum Reich unter Wasser spüren würden.
»Sprich!«, sagte der erste Alte. »Für deinesgleichen ist es wider die Natur zu schweigen. Und was wider die Natur ist, ist wider Allahs Willen.«
Doch Naze sagte nichts.
Nachdem die ehrwürdigen Gäste gegangen waren, trat sie an die Wiege, in der die Zwillingsmädchen schliefen. Der Lichtschein aus dem Herd färbte den Raum goldgelb und verlieh der Haut der Kinder einen sanften, beinah engelsgleichen Schimmer. Nazes Herz wurde weich. Sie wandte sich an ihre sechs anderen Töchter, die von der größten bis zur kleinsten neben ihr aufgereiht standen, und sagte mit heiserer, dumpfer Stimme: »Ich weiß, wie ich sie nennen werde.«
»Sag es uns, Mama!«, riefen die Mädchen voller Freude darüber, dass ihre Mutter wieder sprach.
Naze räusperte sich und sagte, als hätte sie eine Niederlage erlitten: »Die da soll Bext heißen und die andere Bese.«
»Bext und Bese«, wiederholten die Mädchen wie mit einer Stimme.
»Ja, meine Kinder.«
Sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, als hätten die Namen dort einen säuerlich-salzigen Geschmack hinterlassen. Bext und Bese auf Kurdisch, Kader und Yeter auf Türkisch, Schicksal und Genug in jeder anderen Sprache. Damit wollte sie Allah mitteilen, dass sie sich zwar als gute Moslemin in ihr Schicksal fügte, jetzt aber genug hatte von Töchtern, und Er ihr mit der nächsten Schwangerschaft – sicherlich die letzte, da sie inzwischen einundvierzig Jahre alt war und die besten Jahre hinter sich hatte –, einen Sohn würde schenken müssen, einen Sohn und nichts als einen Sohn.
Die Mädchen eilten ihrem Vater entgegen, als er am Abend heimkam, und überbrachten ihm die gute Nachricht: »Papa, Papa! Mama redet wieder!«
Sosehr sich Berzo darüber freute, sosehr verdüsterte sich seine Miene, als er hörte, welche Namen seine Frau für die Neugeborenen gewählt hatte. Eine ganze Weile stand er schweigend da und schüttelte den Kopf.
»Schicksal und Genug«, murmelte er schließlich wie zu sich selbst. »Aber das sind doch keine richtigen Namen, das ist eine Bitte an den Himmel.«
Naze blickte auf ihre Füße und betrachtete den Zeh, der aus einem Loch in ihrer Wollsocke hervorlugte.
»Namen, die auf Verärgerung gründen, könnten den Schöpfer beleidigen«, fuhr Berzo fort. »Warum lenkst du Seinen Zorn auf uns? Begnüg dich mit gewöhnlichen Namen, dann kann nichts passieren.«
Und er verkündete auf der Stelle, welche Namen ihm vorschwebten: Pembe und Jamila – Rosarot und Schön. Namen wie Zuckerwürfel, die im Tee zergingen, süß und geschmeidig und ohne scharfe Kanten.
Berzos Entscheidung war unwiderruflich, doch die Namen, die Naze gewählt hatte, ließen sich nicht einfach auslöschen. Sie blieben allen in Erinnerung, hingen im Stammbaum wie zwei dünne, in den Zweigen verfangene Papierdrachen. Und so wurden die Zwillinge bei jeweils beiden Namen gerufen: Pembe Kader und Jamila Yeter – Rosarotes Schicksal und Genug Schönheit. Wer hätte vorhersagen können, dass einer dieser Namen später einmal überall auf der Welt in den Zeitungen stehen würde?
Farben
EIN DORF AN DEN UFERN DES EUPHRAT, 1953
Schon als kleines Mädchen war Pembe verrückt nach Hunden. Sie liebte es, wie sie den Menschen ins Herz schauten, selbst in tiefem Schlaf mit geschlossenen Augen. Die meisten Erwachsenen hielten Hunde für nicht sehr verständig, doch Pembe dachte anders. Sie verstanden alles. Sie konnten verzeihen.
Einen bestimmten Schäferhund liebte sie ganz besonders. Schlappohren, lang gezogene Schnauze, schwarz-weiß-braunes Zottelfell. Er war ein gutmütiges Wesen, jagte gern hinter Schmetterlingen und fliegenden Stöcken her und fraß so gut wie alles. Er wurde Kitmir gerufen, aber auch Quto oder Dodo. Ständig wechselten seine Namen.
Eines Tages benahm sich das Tier plötzlich so merkwürdig, als wäre es von einem bösen Dschinn besessen. Als Pembe ihm die Brust tätscheln wollte, sprang er sie knurrend an und biss sie in die Hand. Mehr Anlass zur Sorge als die oberflächliche Wunde gab die Wesensänderung des Hundes. Einige Zeit zuvor war in der Gegend die Tollwut ausgebrochen, und die drei Dorfältesten bestanden darauf, dass Pembe einen Arzt aufsuchte. Das Problem war nur: Es gab im Umkreis von hundert Kilometern keinen einzigen.
Deshalb fuhren Pembe und ihr Vater Berzo erst mit einem Kleinbus, dann mit einem Reisebus in die große Stadt, Urfa. Bei der Vorstellung, den ganzen Tag von ihrer Zwillingsschwester Jamila getrennt zu sein, lief es ihr kalt über den Rücken, aber gleichzeitig freute sie sich sehr, ihren Vater einmal ganz für sich zu haben. Berzo war ein stämmiger, grobknochiger Mann mit markantem Gesicht und mächtigem Schnurrbart, mit den Händen eines Bauerns und grau melierten Schläfen. Seine tief liegenden dunkelbraunen Augen blickten freundlich, und solange er keinen Wutausbruch hatte, war er ein ruhiger Mensch, auch wenn es ihn überaus traurig machte, keinen Sohn zu haben, der seinen Namen bis ans Ende der Welt trug. Obwohl er wenig sprach und noch weniger lächelte, war er mit seinen Kindern enger verbunden als seine Frau. Seine acht Töchter vergalten es ihm, indem sie um seine Liebe wetteiferten wie Hühner, die in eine Handvoll Körner pickten.
Die Fahrt in die Stadt war lustig und aufregend gewesen, was man von der Warterei im Krankenhaus nicht behaupten konnte. Vor der Tür zum Behandlungszimmer standen dreiundzwanzig Patienten. Pembe kannte die genaue Zahl, weil Jamila und sie im Gegensatz zu den anderen achtjährigen Mädchen im Dorf die Schule besuchten – ein baufälliges einstöckiges Gebäude in einem anderen, vierzig Minuten Fußmarsch entfernten Dorf. In der Mitte des Klassenzimmers stand ein Ofen, der mehr Rauch als Wärme verbreitete. Die kleineren Kinder saßen links davon, die größeren rechts. Da nur selten ein Fenster geöffnet wurde, war die Luft im Raum abgestanden und dick wie Sägemehl.
Bevor sie in die Schule kam, hatte Pembe selbstverständlich angenommen, alle Menschen auf der Welt sprächen Kurdisch. Nun erfuhr sie, dass es sich anders verhielt. Es gab Menschen, die kein einziges kurdisches Wort kannten – ihr Lehrer beispielsweise. Er hatte kurz geschnittenes, schütteres Haar und blickte immer so trübsinnig drein, als würde er das Leben in Istanbul vermissen und wäre niemals darüber hinweggekommen, an diesen verlassenen Ort geschickt worden zu sein. Es brachte ihn sehr auf, wenn ihn die Schüler nicht verstanden oder auf Kurdisch über ihn scherzten. Vor Kurzem hatte er folgende Regel eingeführt: Wer auch nur ein einziges kurdisches Wort aussprach, musste mit dem Rücken zur Klasse auf einem Bein vor der Tafel stehen. Die meisten Schüler wurden nach wenigen Minuten unter der Bedingung begnadigt, dass sie ihr Vergehen nicht wiederholten, doch hin und wieder wurde einer vergessen und musste stundenlang in derselben Stellung verharren. Bei den Zwillingen hatte die Regel unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Während Jamila überhaupt nichts mehr sagte, egal, in welcher Sprache, gab sich Pembe größte Mühe, eine gute Türkischschülerin zu werden. Sie wollte die Sprache des Lehrers unbedingt lernen, um sich bei ihm beliebt zu machen.
Naze konnte nicht verstehen, warum Pembe und Jamila sich so anstrengten, völlig nutzlose Wörter und Zahlen zu lernen, da sie früher oder später ohnehin heiraten würden. Aber ihr Mann bestand darauf, dass seine Töchter die Schule besuchten.
»Jeden Tag gehen sie den weiten Weg hin und zurück. Ihre Schuhe sind schon ganz abgelaufen«, murrte Naze. »Und wofür?«
»Damit sie die Verfassung lesen können«, erwiderte Berzo.
»Was ist das, eine Verfassung?«, fragte Naze argwöhnisch.
»Das Gesetz, du ungebildetes Weib! Das große Buch, in dem steht, was erlaubt und was verboten ist, und wer den Unterschied nicht kennt, bekommt gewaltige Schwierigkeiten.«
Naze war immer noch nicht überzeugt. Sie schnalzte mit der Zunge. »Und wie soll das meinen Töchtern helfen, einen Mann zu finden?«
»Was weißt du denn schon! Wenn sie von ihren Männern einmal schlecht behandelt werden, müssen sie sich das nicht gefallen lassen. Dann können sie ihre Kinder nehmen und gehen.«
»Und wohin, bitte schön?«
Das hatte Berzo nicht bedacht. »Sie können sich ins Haus ihres Vaters flüchten.«
»Ach so – also deshalb gehen sie jeden Tag so weit und stopfen sich die Köpfe mit diesem Kram voll? Damit sie dann in ihr Geburtshaus zurückkehren?«
»Bring mir meinen Tee«, fauchte Berzo. »Du redest zu viel.«
»Gott bewahre!«, murmelte Naze auf dem Weg in die Küche. »Meine Töchter werden niemals ihre Männer verlassen. Und wenn es doch eine wagt, schlage ich sie grün und blau, selbst wenn ich dann schon tot bin. Dann komme ich eben als Geist zurück!« Diese Drohung sollte, so leer und unbedacht sie war, zur Prophezeiung werden. Noch lange nach ihrem Ableben kehrte Naze zurück und suchte ihre Töchter heim, die einen mehr, die anderen weniger. Sie war eben stur und vergaß nie. Und im Gegensatz zu den Hunden verzieh sie auch nicht.
Während sie nun im Krankenhaus warteten, starrte Pembe mit ihren Kinderaugen die im Gang aufgereihten Männer und Frauen an. Einige rauchten, einige aßen Fladenbrot, das sie von zu Hause mitgebracht hatten, einige versorgten ihre Wunden oder schrien vor Schmerz. Es stank durchdringend nach Schweiß, Desinfektionsmitteln und Hustensaft.
Das Mädchen studierte eingehend den Zustand jedes einzelnen Patienten, und seine Bewunderung für den Arzt, den es noch gar nicht gesehen hatte, wuchs. Pembe kam zu dem Schluss, dass der Mann, der so viele Krankheiten heilen konnte, ein außergewöhnlicher Mensch sein musste. Ein Seher. Ein Zauberer. Ein altersloser Hexer mit übernatürlichen Kräften. Als sie an die Reihe kam, platzte Pembe fast vor Neugier und folgte ihrem Vater gespannt ins Behandlungszimmer.
Dort war alles weiß. Nicht wie der Schaum auf dem Brunnenwasser beim Wäschewaschen, nicht wie der Schnee, der sich in einer Winternacht vor dem Haus häufte, oder wie die Molke, die sie mit Bärlauch vermischten und zu Käse machten. Ein solches Weiß hatte sie noch nie gesehen – so hart und unnatürlich. Dieses Weiß war so kalt, dass sie zu frösteln begann. Die Stühle, die Wände, die Bodenfliesen, die Untersuchungsliege, selbst die Schalen und Skalpelle erstrahlten in dieser Farbe, die keine war. Nie wäre Pembe auf den Gedanken gekommen, dass Weiß derart unangenehm, kühl und dunkel sein konnte.
Noch mehr erstaunte sie, dass der Arzt eine Frau war – aber eine andere Frau als ihre Mutter, ihre Tanten, ihre Nachbarinnen. So wie der ganze Raum in die Abwesenheit von Farbe getaucht war, besaß auch die Ärztin keine weiblichen Eigenschaften, die Pembe vertraut waren. Unter dem langen Kittel lugte ein bis zu den Knien reichender braungrauer Rock hervor; darunter waren Strümpfe aus feinster, weichster Wolle und Lederstiefel zu sehen. Mit ihrer eckigen Brille ähnelte sie einer verdrießlichen Eule. Nicht, dass das Kind je eine verdrießliche Eule gesehen hätte, aber wenn es eine gab, dann musste sie so aussehen. Wie sehr sich die Ärztin von den Frauen unterschied, die von früh bis spät auf den Feldern arbeiteten, vom Blinzeln in die Sonne Falten bekamen und so lange Kinder zur Welt brachten, bis sie genügend Söhne hatten! Diese Frau war es gewohnt, dass ihr die Leute, sogar Männer, aufmerksam zuhörten. Selbst Berzo hatte vor ihr die Mütze abgenommen und ließ die Schultern hängen.
Die Ärztin begrüßte Vater und Tochter mit einem unwilligen Blick, als empfände sie deren Existenz als lästig, ja geradezu schmerzlich. Die beiden waren wohl die Letzten, die sie am Ende dieses anstrengenden Tages behandeln wollte. Sie selbst sagte nicht viel, sondern überließ es der Krankenschwester, die wichtigen Fragen zu stellen. Um was für einen Hund hat es sich gehandelt? Hatte er Schaum vor der Schnauze? Hat er merkwürdig auf Wasser reagiert? Hat er auch andere im Dorf gebissen? Ist er hinterher untersucht worden? Die Schwester sprach so schnell, als würde irgendwo eine Uhr ticken und die Zeit knapp werden. Pembe war heilfroh, dass ihre Mutter nicht mitgekommen war. Naze hätte dem Gespräch gar nicht folgen können und, ängstlich und gereizt, völlig falsche Schlüsse aus den Fragen gezogen.
Während die Ärztin ein Rezept ausstellte, verpasste die Schwester dem Kind eine Spritze in den Bauch. Pembe schrie wie am Spieß. Sie weinte auch dann noch bitterlich, als sie mit ihrem Vater in den Gang hinaustrat, wo die gaffenden Fremden das Leid noch vergrößerten. Da beugte sich ihr Vater – wieder ganz der alte Berzo – mit erhobenem Kopf und gestrafften Schultern zu ihr hinunter und flüsterte ihr ins Ohr, dass er, wenn sie Ruhe gebe und so brav wie sonst immer sei, mit ihr ins Kino gehen werde.
Pembe verstummte schlagartig, und die Vorfreude ließ ihre Augen strahlen. »Kino« – das klang wie ein bunt verpacktes Bonbon; sie wusste zwar nicht, was darin war, aber es musste etwas Köstliches sein.
Die Stadt besaß zwei Theater. Das größere wurde eher für Gastauftritte von Politikern genutzt als für Darbietungen ortsansässiger Schauspieler und Musiker. Vor und nach Wahlen kamen dort immer viele Männer zusammen, dann wurden hitzige Reden gehalten, und Versprechungen und Propagandasprüche schwirrten durch die Luft wie summende Bienen.
Der zweite Veranstaltungsort war wesentlich kleiner, aber nicht weniger beliebt. Dort wurden Streifen unterschiedlicher Qualität gezeigt, denn der Besitzer schätzte das Abenteuer mehr als politische Tiraden und zahlte Schmugglern hohe Provisionen für die Lieferung neuer Filme, nebst Tabak, Tee und anderer Bannware. So kam es, dass die Bewohner von Urfa bereits mehrere John-Wayne-Western, Der Mann aus Alamo, Julius Caesar, aber auch Goldrausch und Filme gesehen hatten, in denen dieser witzige kleine Mann mit dem dunklen Bärtchen auftrat.
An diesem Tag lief ein türkischer Schwarz-Weiß-Film, den Pembe von der ersten Szene an mit leicht geöffnetem Mund verfolgte. Die Heldin war ein armes, hübsches, in einen sehr reichen und sehr verwöhnten Jungen verliebtes Mädchen. Doch der Junge änderte sich – durch den Zauber der Liebe. Während alle, insbesondere die Eltern des Jungen, die beiden Liebenden verächtlich behandelten und sich verbündeten, um sie voneinander zu trennen, trafen sich diese heimlich unter einer Weide am Flussufer, hielten sich an den Händen und sangen todtraurige Lieder.
Pembe gefiel alles im Kino – das verschnörkelte Foyer, der schwere, drapierte Vorhang, die dichte, einladende Dunkelheit. Sie konnte es kaum erwarten, Jamila von dem neuen Wunder zu erzählen. Auf der Heimfahrt im Bus sang sie immer wieder die Titelmelodie des Films.
Dein Name ist in mein Schicksal gemeißelt,
Deine Liebe fließt in meinen Adern.
Wenn du jemals einer andern ein Lächeln schenkst,
Wird der Schmerz mich schneller töten als meine eigene Hand.
Pembe wiegte sich in den Hüften und schwenkte die Arme, und die anderen Fahrgäste klatschten und johlten. Als sie endlich aufhörte – mehr aus Müdigkeit als aus Anstand –, lachte Berzo so herzhaft, dass sich in seinen Augenwinkeln Fältchen zeigten.
»Mein begabtes Mädchen!«, sagte er mit einem Hauch von Stolz in der Stimme.
Pembe schmiegte das Gesicht an die breite Brust ihres Vaters und atmete den Duft des Lavendelöls ein, mit dem er seinen Schnurrbart parfümiert hatte. Sie konnte es noch nicht wissen, aber es war einer der glücklichsten Momente ihres ganzen Lebens.
Bei ihrer Rückkehr trafen sie Jamila in einem grauenhaften Zustand an. Ihre Augen waren geschwollen, das Gesicht aufgedunsen. Sie hatte den ganzen Tag am Fenster gewartet, an ihrem Haar herumgespielt und sich auf die Unterlippe gebissen. Und plötzlich hatte sie ganz ohne Grund einen entsetzlichen Schrei ausgestoßen und nicht mehr aufgehört zu weinen, obwohl ihre Mutter und ihre Schwestern alles taten, um sie zu beruhigen.
»Wann genau war das?«, wollte Pembe wissen.
Naze dachte kurz nach. »Am Nachmittag. Warum?«
Pembe antwortete nicht. Sie hatte erfahren, was sie wissen wollte. Ihre Zwillingsschwester und sie hatten, viele Kilometer voneinander entfernt, gleichzeitig in dem Augenblick aufgeschrien, als Pembe die Spritze bekam. Zwillinge, sagte man, seien zwei Körper und eine Seele. Doch Jamila und sie waren noch mehr: ein Körper und eine Seele. Schicksal und Genug. Schloss die eine die Augen, wurde die andere blind. Tat sich die eine weh, blutete die andere. Und hatte eine von ihnen Albträume, pochte der anderen das Herz in der Brust.
Am Abend zeigte Pembe ihrer Schwester die Tanzschritte, die sie in dem Film gesehen hatte. Abwechselnd ahmten sie die Heldin nach, wirbelten kichernd herum und küssten und umarmten sich wie ein Liebespaar.
»Was soll der Lärm?«
Es war Naze. Sie verlas gerade Reis auf einem Tablett und stellte die Frage in kaltem, verächtlichem Ton.
Pembe riss verärgert die Augen auf. »Wir tanzen doch nur.«
»Und wozu?«, gab Naze zurück. »Habt ihr etwa beschlossen, Dirnen zu werden?«
Pembe wusste nicht, was eine Dirne war, traute sich aber nicht zu fragen. Sie spürte Groll in sich aufsteigen – warum hatte ihre Mutter nicht dieselbe Freude an den Liedern wie die Fahrgäste im Bus? Warum waren völlig fremde Menschen nachsichtiger als die engste Verwandte? Während Pembe noch darüber nachdachte, trat Jamila einen Schritt auf die Mutter zu und sagte leise, wie um ihre Schuld einzugestehen: »Es tut uns leid, Mama. Wir machen es nie wieder.«
Pembe starrte ihre Schwester an. Sie fühlte sich verraten.
»Es ist nur zu eurem Besten. Wer heute zu viel lacht, wird morgen weinen. Besser jetzt ein schlechtes Gefühl als irgendwann später.«
»Warum können wir denn nicht jetzt und morgen und übermorgen lachen?«, fragte Pembe.
Nun machte Jamila ein finsteres Gesicht. Pembes Unverfrorenheit hatte sie nicht nur überrascht, sondern auch in eine unangenehme Lage gebracht. Pembe hielt die Luft an, denn sie hatte Angst vor dem, was jetzt unweigerlich kam: das Rollholz. Wenn eines der Mädchen eine Grenze überschritten hatte, schlug Naze alle beide mit der dünnen Holzstange aus der Küche. Niemals ins Gesicht – die Schönheit war die Mitgift der Mädchen –, sondern auf Rücken und Hinterteil. Die Zwillingsschwestern fanden es erstaunlich, dass man mit dem Utensil, das sie so hassten, auch dieses luftige Gebäck zubereitete, das sie so liebten.
Doch an diesem Abend bestrafte die Mutter keine von beiden. Sie rümpfte die Nase, schüttelte den Kopf und wandte den Blick ab, als wünschte sie sich an einen anderen Ort. Schließlich ergriff sie noch einmal das Wort und sagte in ruhigem Ton: »Die Sittsamkeit ist der einzige Schild einer Frau. Denkt immer daran: Wenn ihr ihn verliert, seid ihr keinen angeschlagenen Kuruş mehr wert. Die Welt ist grausam. Ich werde jedenfalls kein Mitleid mit euch haben.«
Pembe warf im Geist eine Münze in die Luft und sah sie auf ihrer Hand landen. Es gab immer zwei Seiten, und nur zwei. Gewinnen oder verlieren. Würde oder Schande. Und wer die falsche erwischte, konnte nicht auf Trost hoffen.
Es liege daran, dass Frauen aus ganz hellem Batist gemacht seien, fuhr Naze fort, Männer dagegen aus dickem, dunklem Stoff. So hatte Gott beide geschneidert: den einen der anderen überlegen. Warum Er es so gemacht hatte – diese Frage zu stellen war nicht Sache der Menschen. Wichtig war nur, dass man auf der Farbe Schwarz keinen Schmutz sah, während die Farbe Weiß noch das kleinste Staubkörnchen erkennen ließ. Deshalb wurden befleckte Frauen sofort entdeckt und von den anderen getrennt, wie man die Spelze vom Korn entfernt. Gab sich eine Jungfrau einem Mann hin – und sei es der Mann, den sie liebte –, hatte sie alles zu verlieren, er dagegen nichts.
In der Heimat von Rosarotes Schicksal und Genug Schönheit war »Ehre« also mehr als ein Wort. »Ehre« war auch ein Name. Man konnte sein Kind »Ehre« nennen, sofern es ein Junge war. Männer besaßen Ehre. Greise, Männer mittleren Alters, ja selbst kleine Schuljungen, die noch nach der Milch ihrer Mutter rochen. Frauen besaßen keine Ehre, sie besaßen Scham. Und »Scham«, das wusste jeder, wäre ein ziemlich schlechter Name.
Während Pembe ihrer Mutter lauschte, erinnerte sie sich an das grelle Weiß des Arztzimmers, und das Unbehagen, das sie dort befallen hatte, kehrte zurück – diesmal aber war es noch stärker. Sie dachte über all die anderen Farben nach – Lavendelblau, Pistaziengrün, Haselnussbraun – und all die anderen Stoffe – Samt, Gabardine, Brokat. Es gab doch so viel Verschiedenes auf der Welt, ganz sicher mehr, als auf einem Tablett mit verlesenem Reis zu finden war.
Auch das war eine der vielen Ironien in Pembes Leben, dass sie die Ermahnungen ihrer Mutter, die sie sich nur widerwillig angehört hatte, Jahre später in England ihrer Tochter Esma gegenüber wortwörtlich wiederholte.
Askander… Askander…
EIN DORF AN DEN UFERN DES EUPHRAT, 1962–1968
Pembe steckte voller haltloser Ansichten und unbegründeter Ängste. Dieser Teil ihrer Persönlichkeit hatte sich jedoch nicht im Laufe der Jahre entwickelt. Abergläubisch geworden war sie ganz plötzlich, sozusagen über Nacht: in der Nacht von Iskenders Geburt.
Pembe war siebzehn, als sie Mutter wurde– jung, schön und empfindsam. Sie lag im Dämmerlicht des Zimmers und betrachtete die Wiege, als wäre sie immer noch nicht völlig überzeugt, dass dieser Säugling mit den zarten rosigen Fingern, der durchsichtigen Haut und dem unregelmäßig geformten violetten Mal auf der Stupsnase entgegen allen Erwartungen überlebt hatte und von nun an ihr Kind sein würde, ganz allein ihr Kind. Es war ein Sohn– der Sohn, den ihre Mutter ihr ganzes Leben lang herbeigesehnt und herbeigebetet hatte.
Naze hatte nach der Geburt von Rosarotes Schicksal und Genug Schönheit noch ein Kind ausgetragen. Diesmal musste es ein Junge sein, alles andere war undenkbar. Allah schuldete es ihr: Er stehe in ihrer Schuld, sagte sie, obwohl sie wusste, dass das schiere Gotteslästerung war. Es gab ein Geheimabkommen zwischen ihr und dem Schöpfer. Nach den vielen Töchtern würde Er jetzt alles wiedergutmachen. Sie war so überzeugt davon, dass sie monatelang kleine Decken, Söckchen und Leibchen in einem Blau strickte, das dunkler war als eine Sturmnacht, alles für ihren wunderschönen kleinen Jungen. Sie wollte auf niemanden hören, nicht einmal auf die Hebamme, die sie untersuchte, nachdem die Fruchtblase geplatzt war, und ihr mit kaum vernehmbarer Stimme mitteilte, dass das Kind nicht richtig liege und sie besser in die Stadt fahren sollten. Noch sei Zeit dafür. Wenn sie gleich aufbrächen, würden sie noch vor dem Einsetzen der Wehen im Krankenhaus sein.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!