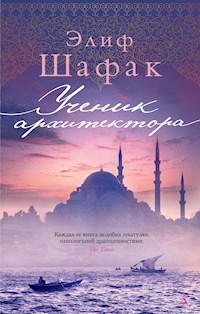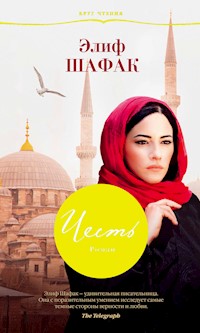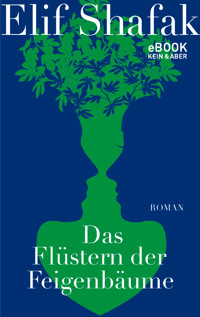13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im heutigen Istanbul teilt die neunzehnjährige Asya Kazanci ihr Zuhause mit ihrer Großfamilie, einer bunten Ansammlung eigenwilliger Charaktere. Als Armanoush, Asyas armenisch- amerikanische Cousine, die Familie besucht, geraten jedoch die Grundmauern des Hauses
ins Wanken. Denn sie hat keine Scheu, sich dem Familiengeheimnis zu widmen, das eng mit einem der dunkelsten Kapitel des Landes verbunden ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Vorwort
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Elif Shafak
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Elif Shafak gehört zu den meistgelesenen Schriftstellerinnen in der Türkei und ist die preisgekrönte Autorin von dreizehn Büchern, darunter Die vierzig Geheimnisse der Liebe (2013), Ehre (2014) und Der Architekt des Sultans (2015). Infolge der Veröffentlichung von Der Bastard von Istanbul (2007) wurde sie, weil der Roman den Völkermord an den Armeniern zum Thema hat, wegen »Beleidigung des Türkentums« angeklagt und später freigesprochen. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in London und Istanbul.
ÜBER DAS BUCH
Armanoush ist neunzehn Jahre alt, intelligent und schön – doch sehnt sie sich danach, mehr über ihre Wurzeln zu erfahren. Sie, die ihr ganzes Leben bei ihrer Mutter und ihrem türkischen Stiefvater in den USA verbracht hat und deren richtiger Vater Armenier ist, entschließt sich schließlich zu einer Reise nach Istanbul. Dort angekommen weiß sie jedoch bald nicht mehr, worüber sie sich mehr wundern soll: über die herzliche Gastfreundschaft im Haus der Verwandten ihres Stiefvaters, die skurrilen Charaktere der ausschließlich weiblichen Bewohner oder die völlige Ignoranz gegenüber der türkisch-armenischen Geschichte. Nur das jüngste Mitglied der Familie, die vaterlos aufgewachsene Asya, kann verstehen, warum Armanoush so viele Fragen stellt. Gemeinsam ergründen sie ein Geheimnis, das die Familie bereits seit hundert Jahren belastet und eng mit einem der dunkelsten Kapitel des Landes verbunden ist.
VORWORT
Berlin ist eine Stadt, in der Erinnerung sichtbar gemacht wird. Istanbul ist das genaue Gegenteil. Während es in Berlin ein Gespür für kulturelle Kontinuität und eine zunehmende Weltoffenheit gibt, herrschen in Istanbul Diskontinuität und Zusammenhanglosigkeit, und leider schwindet auch die Weltoffenheit. Gewiss, das geliebte und schöne Istanbul ist sehr alt und mithin voller Geschichten, aber bei einem Spaziergang durch die Stadt fällt einem auf, dass es fast keine Anzeichen urbaner Erinnerung gibt. Hier ist alles in Wasser geschrieben – ausgenommen die Werke der großen Architekten, die in Stein, und die Werke der großen Dichter, die tief in unsere Herzen geschrieben sind.
Die Türkei ist eine Gesellschaft, die unter kollektiver Amnesie leidet. Zukunftsorientiert zu sein macht ein Land dynamisch, schnelllebig. Der Mangel an Geschichtsbewusstsein, ja die Unfähigkeit, sich der Vergangenheit zu stellen, ist jedoch die Kehrseite. Nur mit Mühe lassen sich die Menschen darauf ein – sowohl auf die Freuden und Schönheiten als auch auf die Schmerzen und Schrecken der Vergangenheit.
Ich bin eine Geschichtenerzählerin. Seit meiner frühen Kindheit verspüre ich eine irrationale Liebe zu Wörtern und Geschichten. Doch genauso zieht mich Stille an, denn auch ihr lausche ich gerne. Von meinem Wesen, meiner Persönlichkeit her interessieren mich weder die Menschen in der Mitte noch die Menschen an der Macht, sondern diejenigen, die unterdrückt, mundtot gemacht und vergessen wurden. In meinen Romanen stelle ich den künstlichen Gegensatz zwischen »uns« und »denen« infrage. Ich schreibe weitgehend über Minderheiten – ethnische, kulturelle oder sexuelle. Ich unterhalte mich mit den Geistern derer, denen durch die Jahrhunderte hindurch eine Stimme verwehrt wurde. Wobei es genau genommen keine »Unterhaltung« ist, denn normalerweise sprechen sie, und ich höre zu.
Meine erste Begegnung mit der »armenischen Frage«, wie wir sie in der Türkei nennen, hatte ich als Zehnjährige in Madrid. Ich wurde in Straßburg geboren; bald darauf trennten sich meine Eltern. Ich kam mit meiner Mutter nach Ankara und verbrachte meine ersten Lebensjahre bei meiner Großmutter mütterlicherseits. Als geschiedene und alleinerziehende Frau in einer patriarchalen Gesellschaft musste meine Mutter hart arbeiten. Als ich neun Jahre alt war, wurde sie Diplomatin, und wir zogen nach Spanien. Es waren die frühen Achtzigerjahre, die Zeit, als eine armenische Terrororganisation namens Asala türkische Diplomaten ins Visier nahm und dabei unschuldige Menschen verletzte und tötete. So war meine erste Assoziation mit dem Wort »armenisch« ausgesprochen negativ; es bezeichnete jemanden, der meiner Mutter potenziell Schaden zufügen konnte.
Nach und nach erinnerte ich mich aber auch wieder an die Geschichten, die meine Großmutter mir immer erzählt hatte, und die Traurigkeit in ihrem Gesicht bei der Erwähnung ihrer armenischen Nachbarn in der Stadt Sivas. »Sie haben so hart gearbeitet, waren so gute, ehrliche Leute ... Sie haben ihre Häuser, ihre Möbel, sogar ihre Kleider und Schuhe zurückgelassen und sich auf den Weg gemacht«, erzählte Großmutter.
Bruchstücke. Fragmente von Geschichten wie Teile eines Puzzles. Jahre vergingen. Bücher waren, wie immer in meinem Leben, meine Weggefährten. Durch Bücher fing ich an, Dogmen zu hinterfragen, und ich begann, mich für die Momente des Schweigens in der offiziellen Geschichtsschreibung, die Dinge, über die wir nicht sprachen, zu interessieren. Als Nomadin lebte ich an verschiedenen Orten: Köln, Amman, Istanbul, Boston, Michigan, Arizona. In Tucson beschloss ich, einen Roman über eine armenische und eine türkische Familie zu schreiben und darin die Deportationen, Massaker und Tötungen von 1915 anzuerkennen. Ich wollte einen Roman über Generationen armenischer und türkischer Frauen schreiben, über Frauen, die einander so ähnelten, dass man sie als Schwestern im Geiste bezeichnen könnte. Aus dieser Perspektive hatte bis dahin noch niemand die Geschichte erzählt.
Erinnerung, so schmerzvoll sie sein mag, ist auch Verantwortung. Und trotz der fortdauernden kollektiven Amnesie erinnern sich ältere Frauen nach wie vor.
Als mein Buch erschien, wurde es in der Türkei viel gelesen und offen diskutiert. Von zahlreichen Leserinnen und Lesern, solchen, die Geschichten mögen, erhielt ich erstaunlich freundliche Reaktionen. Heftige Angriffe kamen dagegen von der Presse, und ich fühlte mich zunehmend allein. Gegen mich wurde Anklage wegen »Beleidigung des Türkentums« nach Artikel 301 erhoben, der eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren vorsieht. So surreal es auch war, vor Gericht musste mein Anwalt die fiktiven armenischen Charaktere aus meinem Roman verteidigen. Nach anderthalb Jahren wurde das Verfahren eingestellt.
In der Türkei finden Schriftsteller und Künstler sich schnell in einer bizarren Rolle wieder. Wir gelten als Personen des öffentlichen Lebens, aber der öffentliche Raum wird von der Tagespolitik beherrscht. Und in der Türkei ist Politik aggressiv, polarisierend, männlich. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich kein Geschichtenerzähler aus der Türkei (oder Pakistan oder Ägypten oder irgendeinem anderen Land, in dem eine reife Demokratie noch eine Idealvorstellung ist) den Luxus erlauben kann, apolitisch zu sein. Wonach ich mich aber sehne, ist eine tiefgreifende Veränderung in der politischen Sprache und im literarischen Stil. Eine Stimme voller emotionaler Empathie, intellektueller Neugier und, ja, auch Bescheidenheit. Statt zu rufen, möchte ich flüstern. Statt Gegensätze aufzubauen, möchte ich das polarisierende Denken an sich überwinden. Statt über den anderen zu urteilen, ihn zu hassen und misszuverstehen, möchte ich durch meine Geschichten zeigen: »Der andere bist in Wahrheit du selbst.«
Elif Shafak, Februar 2015
Es war einmal; es war keinmal.
Gottes Kreaturen waren so zahlreich
wie Getreidekörner.
Und zu viel zu reden war eine Sünde …
Beginn einer türkischen Geschichte … und einer armenischen
1.ZIMT
Du sollst nicht verfluchen, was vom Himmel fällt. Dazu gehört auch der Regen.
Egal was herabregnet, egal wie heftig der Wolkenbruch oder wie eisig der Schneeregen, du sollst niemals Flüche aussprechen gegen egal was der Himmel für uns bereithält. Jeder weiß das. Auch Zeliha.
Und dennoch ging sie an diesem ersten Freitag im Juli fluchend auf einem Bürgersteig, der eine hoffnungslos verstopfte Straße entlangführte; sie hastete zu einem Termin, zu dem sie jetzt schon spät dran war, fluchte wie ein Kutscher und ließ eine Schimpfkanonade nach der anderen los, über das kaputte Pflaster, ihre Stöckelschuhe, den Mann, der ihr folgte, über jeden dieser Autofahrer, die wie wild hupten, obwohl doch jeder wusste, dass Lärm die Auflösung von Verkehrsstaus nicht befördert, über die ganze Dynastie der Osmanen, weil die vor langer Zeit die Stadt Konstantinopel erobert und aus Versehen geblieben war, und ja, über den Regen …, diesen verdammten Sommerregen.
Hier ist Regen eine Qual. In anderen Teilen der Welt gilt ein Wolkenbruch wahrscheinlich als Segen für nahezu alles und jedes – gut für die Landwirtschaft, gut für Flora und Fauna und, mit einem Extraschuss Romantik, gut für Verliebte. In Istanbul ist das nicht so. Für uns hat Regen nicht unbedingt mit Nasswerden zu tun. Ja nicht einmal mit Schmutzigwerden. Wenn überhaupt, dann mit Wütendwerden. Er bedeutet Schlamm und Chaos und Zorn, als hätten wir nicht schon genug von all dem. Und Kämpfen. Er hat immer mit Kämpfen zu tun. Wie Kätzchen in einem Eimer Wasser kämpfen alle fünf Millionen von uns vergeblich gegen die Tropfen. Man kann nicht sagen, dass wir dabei ganz alleine wären, betroffen sind auch die Straßen mit ihren vorsintflutlichen Namen, die mit Schablonen auf Blechschilder geschrieben sind, die überall verstreuten Grabsteine aller möglichen Heiligen, die Müllhaufen, die an fast jeder Ecke warten, die überdimensionalen Baugruben, die sich bald in moderne Prachtbauten verwandeln sollen, und die Seemöwen … Uns alle macht es wütend, wenn der Himmel sich auftut und uns auf die Köpfe spuckt.
Wenn aber die letzten Tropfen den Erdboden erreichen und noch viele weitere unsicher auf den nun vom Staub befreiten Blättern balancieren, in diesem ungeschützten Augenblick, wenn man nicht ganz sicher ist, ob der Regen endlich aufgehört hat, ja nicht einmal er selbst es weiß, genau in diesem Moment wird alles heiter. Eine ganze Minute lang scheint der Himmel sich für das zu entschuldigen, was er da angerichtet hat. Und wir, immer noch Tröpfchen im Haar, Matsch im Hosenaufschlag und Trostlosigkeit im Blick, starren in den Himmel, der jetzt in einem etwas helleren Tiefblau und klarer denn je erstrahlt. Wir blicken auf und lächeln unwillkürlich zurück. Wir vergeben ihm; das tun wir immer.
Im Augenblick schüttete es allerdings noch, und Zeliha empfand wenig bis gar keine Versöhnlichkeit in ihrem Herzen. Sie besaß keinen Schirm, denn sie hatte sich geschworen, dass es ihr, wenn sie so blöd wäre, noch einmal einem Straßenhändler Geld für noch einen weiteren Schirm hinzublättern, den sie, sobald die Sonne herauskäme, wieder irgendwo liegen ließe, ganz recht geschähe, bis auf die Haut nass zu werden. Im Übrigen wäre es jetzt sowieso zu spät. Sie war bereits triefnass. Hierin glich Regen der Traurigkeit: Man tat alles, um unberührt, sicher und trocken zu bleiben, aber wenn einem das nicht gelang, kam ein Punkt, wo man das Ganze nicht mehr als Problem einzelner Tropfen, sondern als unaufhörlichen Schwall betrachtete und beschloss, dass man dann genauso gut auch richtig nass werden konnte.
Regen tropfte von ihren dunklen Locken auf ihre breiten Schultern. Wie alle Frauen in der Familie Kazancı war Zeliha mit rabenschwarzem krausem Haar zur Welt gekommen, aber im Gegensatz zu den anderen mochte sie es so. Von Zeit zu Zeit verengten sich ihre normalerweise weit geöffneten und eine messerscharfe Intelligenz ausstrahlenden jadegrünen Augen zu zwei Strichen unverhohlener Gleichgültigkeit, die nur drei Gruppen von Leuten zu eigen ist: den hoffnungslos Naiven, den hoffnungslos Zurückhaltenden und den hoffnungslos Hoffnungsvollen. Da sie zu keiner dieser Gruppen gehörte, war es schwer, diese Gleichgültigkeit zu verstehen, selbst wenn es eine so flüchtige war. Plötzlich war sie da und umgab ihre Seele mit narkotisierter Gefühllosigkeit, dann war sie weg und ließ ihre Seele allein in ihrem Körper zurück.
So fühlte sie sich an diesem ersten Freitag im Juli abgestumpft, als stünde sie unter Drogen, ein außerordentlich quälender Zustand für einen so energiegeladenen Menschen wie sie. Konnte das der Grund sein, weshalb sie heute absolut keine Lust gehabt hatte, es mit der Stadt oder gar dem Regen aufzunehmen? Während die Gleichgültigkeit sich wie ein Jo-Jo im ganz eigenen Rhythmus auf und ab bewegte, schwang ihr Stimmungspendel zwischen erstarren und kochen hin und her.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!