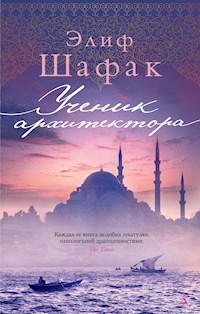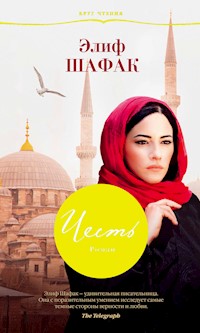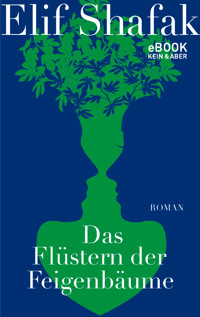
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1974 befindet sich das idyllische Zypern kurz vor dem Bürgerkrieg. Eine Taverne, betrieben von einem schwulen Paar, ist der einzige Ort, an dem sich der Grieche Kostas und die Türkin Defne treffen können. Der prachtvoller Feigenbaum im Innenhof der Taverne ist Zeuge ihrer glücklichen Begegnungen und ihrer stillen Abschiede. Der Feigenbaum ist auch da, als der Krieg ausbricht, als die Hauptstadt in Schutt und Asche gelegt wird, als Menschen auf der ganzen Insel spurlos verschwinden.
In der Gegenwart steht der Baum im Garten von Kostas und seiner 16-jährigen Tochter Ada in London. Ada weiß nichts von ihrer Heimat, Kostas hüllt sich in Schweigen, wenn es um seine Vergangenheit geht und die seiner verstorbenen Frau, Defne. Nur die Wurzeln des Baums stellen noch eine Verbindung dar zu dem, was geschehen ist. Doch Ada forscht nach: Was verbirgt sich hinter dem Schweigen ihres Vaters? Warum musste ihre Mutter sterben? Während Ada die dunklen Schatten ihrer Familie ausleuchtet, erwartet die Feige im Garten den kältesten Wintereinbruch seit Jahrzehnten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Glossar
» Impressum
» Weitere eBooks der Autorin
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Elif Shafak, in Straßburg geboren, gehört zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen der Gegenwart. Ihre Werke wurden in mehr als fünfzig Sprachen übersetzt. Die preisgekrönte Autorin zahlreicher Romane, darunter Die vierzig Geheimnisse der Liebe (2013), Ehre (2014) und Der Geruch des Paradieses (2016), schreibt auf Türkisch und Englisch. Mit Unerhörte Stimmen (2019) stand sie auf der Shortlist des Booker Prize. Ihre Artikel und Auftritte machten sie zum viel beachteten Sprachrohr für Gleichberechtigung und freiheitliche Werte zunächst in der Türkei, später in ganz Europa. Elif Shafak lebt in London. www.elifshafak.com
ÜBER DAS BUCH
Die jungen Liebenden Defne und Kostas dürfen sich nur heimlich treffen – sie ist Türkin, er Grieche, es herrscht Bürgerkrieg auf Zypern. Als sie durch die Unruhen getrennt werden, ahnen sie nicht, dass sie Jahre später wieder vereint werden. In einem neuen Leben, auf einer neuen Insel.
Für die Immigranten und Exilanten überall auf der Welt,
die Entwurzelten, Neuverwurzelten, Wurzellosen.
Und für die Bäume, die wir zurückließen.
Sie wurzeln in unseren Erinnerungen …
Wer den chilenischen Wald nicht kennt, kennt diesen Planeten nicht.
Von dieser Erde, diesem Lehm, von dieser Stille bin ich ausgezogen, um zu singen für die Welt.
PABLO NERUDA: ICH BEKENNE, ICH HABE GELEBT
Es fordert Blut, sagt man: Blut fordert Blut.
Man sah, dass Fels sich regt’ und Bäume sprachen …
WILLIAM SHAKESPEARE: MACBETH
PROLOG
Die Insel
Es war einmal, verborgen in der Erinnerung, eine Insel weit draußen im Mittelmeer. Sie war so schön und blau, dass die vielen Reisenden, Pilger, Kreuzfahrer und Händler, die sich in sie verliebten, entweder nie wieder von ihr fortgehen wollten oder sie am liebsten mit Hanftauen in ihre fernen Heimatländer gezogen hätten.
Das mögen Legenden sein.
Doch Legenden gibt es, damit wir erfahren, was die Geschichte vergessen hat.
Vor vielen Jahren floh ich in einem Koffer aus weichem schwarzem Leder an Bord eines Flugzeugs von dieser Insel und kehrte nie zurück. Seitdem bin ich in einem neuen Land, in England, heimisch geworden, bin dort gewachsen und gediehen, aber kein Tag vergeht, an dem ich mich nicht nach ihr sehne. Nach Hause. In meine Heimat.
Sie ist bestimmt noch dort, wo ich sie zurückließ, hebt und senkt sich mit den Wellen, die sich schäumend an ihrer zerklüfteten Küste brechen. An der Kreuzung dreier Kontinente – Europa, Afrika, Asien – und der Levante, jener weiten, undurchdringlichen Region, die heute von allen Karten verschwunden ist.
Eine Landkarte ist eine zweidimensionale Darstellung mit willkürlich gewählten Symbolen und eingezeichneten Linien, die darüber entscheiden, wer Feind und wer Freund ist, wer unsere Liebe, wer unseren Hass verdient und wer uns gleichgültig zu sein hat.
Kartografie ist eine andere Bezeichnung für die Geschichten der Sieger.
Für die Geschichten der Besiegten gibt es keine Kartografie.
So sehe ich die Insel in der Erinnerung: goldene Strände, türkisblaues Wasser, der Himmel klar. Jedes Jahr kamen Meeresschildkröten an Land und legten ihre Eier in den pudrigen Sand. Spätnachmittags trug der Wind den Duft von Gardenien, Zyklamen, Lavendel und Geißblatt herbei. Blauregen rankte sich an weiß getünchten Wänden empor, als wollte er zu den Wolken hinauf; hoffnungsvoll, wie nur Träumende sind. Wenn die Nacht die Haut wie immer mit Küssen bedeckte, roch ihr Atem nach Jasmin. Der Mond war der Erde hier näher. Hell und sanft stand er über den Dächern und warf seinen klaren Schein in die engen Gassen und Kopfsteinpflasterstraßen. Doch auch Schatten bahnten sich Wege durchs Licht. Geflüsterter Argwohn und verschwörerisches Gemurmel wogten im Dunkel. Denn die Insel war in zwei Teile gespalten, einen nördlichen und einen südlichen. Zwei Sprachen, zwei Schriften, zwei Gedächtnisse. Und die Gebete der Inselbewohner galten nur selten demselben Gott.
Die Hauptstadt war von einer Absperrung geteilt, die sich wie ein Schnitt ins Herz mitten durch sie hindurchzog. Entlang der Demarkationslinie – der Grenze – reihten sich verfallene, von Einschusslöchern durchsiebte Häuser und leere, nach Granateinschlägen vernarbte Innenhöfe aneinander; heruntergekommene, verbarrikadierte Läden, verschnörkelte Eisentore, die schief in herausgebrochenen Angeln hingen, unter dickem Staub rostende Luxuskarossen aus einer anderen Ära. Stacheldrahtrollen, aufgehäufte Sandsäcke, Fässer mit gehärtetem Zement, Panzergräben und Wachtürme dienten als Straßenbarrieren. Gassen endeten abrupt wie ein nicht zu Ende geführter Gedanke, ein ungeklärtes Gefühl.
Soldaten mit Maschinengewehren standen Wache, wenn sie nicht gerade patrouillierten – einsame, gelangweilte junge Männer aus allen Teilen der Welt, die bis zu ihrer Stationierung in dieser fremden Umgebung kaum etwas über die Insel und ihre komplizierte Geschichte gehört hatten. An den Häuserwänden und Mauern hingen amtliche Schilder in kräftigen Farben, auf denen in Großbuchstaben zu lesen war:
BETRETEN VERBOTEN!
SPERRGEBIET! KEIN ZUGANG FÜR UNBEFUGTE!
FILMEN UND FOTOGRAFIEREN STRENG UNTERSAGT!
Ein Stück weiter die Straßensperre hinunter hatte ein Passant mit Kreide unerlaubterweise einen Zusatz auf ein Fass geschmiert:
WILLKOMMEN IM NIEMANDSLAND
Die von UN-Soldaten bewachte Pufferzone, die Zypern vom einen zum anderen Ende durchtrennte, war etwa hundertachtzig Kilometer lang und an manchen Stellen bis zu sechseinhalb Kilometer breit, an anderen nur ein paar Meter. Wie der Geist eines uralten Flusses wand sie sich durch die unterschiedlichsten Szenerien – verlassene Dörfer, schmale Küstenstriche, Sumpfgebiete, Brachland, Pinienwälder, fruchtbare Ebenen, Kupferminen und archäologische Ausgrabungsstätten. Doch hier, in der Hauptstadt und rings darum, war sie sichtbarer, greifbarer und deshalb noch bedrückender.
Nikosia, die einzige geteilte Hauptstadt der Welt.
So klang das fast positiv. Es hatte etwas Besonderes, ja Unvergleichliches, etwas Schwereloses, wie das eine Korn, das sich beim Drehen der Sanduhr nach oben bewegt. In Wahrheit aber war Nikosia kein Einzelfall. Es war nur ein weiterer Name auf der Liste gespaltener Orte und voneinander getrennter Menschen, ob sie nun der Vergangenheit angehörten oder noch gar nicht entstanden waren. Zu diesem Zeitpunkt aber stellte die Stadt etwas Außergewöhnliches dar. Die letzte geteilte Hauptstadt Europas.
Meine Heimatstadt.
Auch eine so klar gezogene und gut bewachte Grenze wie diese lässt sich von vielem überwinden. Zum Beispiel von dem trotz seiner sanften Namen erstaunlich kräftigen etesischen Wind meltémi oder meltem. Von Schmetterlingen, Grashüpfern, Eidechsen. Schnecken, so quälend langsam sie auch sind. Ab und zu entschwindet ein Geburtstagsballon in die Höhe, der dem Griff eines Kindes entkam und sich auf die andere Seite verirrt – Feindesland.
Und von den Vögeln natürlich. Graureiher, Kappenammern, Wespenbussarde, Schafstelzen, Laubsänger, Maskenwürger und meine Lieblinge, die Pirole. Sie kommen von weit im Norden geflogen – meist in der Nacht, wenn sich die Dunkelheit an ihren Flügelspitzen sammelt und ihnen rote Kreise um die Augen zeichnet – und unterbrechen die lange Reise nach Afrika auf halbem Weg. Für sie ist die Insel ein Rastplatz, eine Lücke in der Erzählung, ein Dazwischen.
Auf einer dicht mit Gestrüpp, Brennnesseln und Heidekraut bewachsenen Anhöhe in Nikosia finden sich auf der Suche nach Futter bunt gefiederte Vögel ein. Mitten in der wild wachsenden Vegetation steht ein alter Brunnen mit einem Flaschenzug, der bei der kleinsten Berührung ächzt, und einem Blecheimer an einem zerfransten, mit Algen bewachsenen Seil. Tief unten in diesem Brunnen ist es immer pechschwarz und eisig kalt, sogar wenn die glühende Mittagssonne direkt daraufbrennt. Er ist ein hungriges Maul, das nach der nächsten Mahlzeit giert; er schluckt jeden Lichtstrahl, jeden Hitzehauch, reißt noch das kleinste Stäubchen in seinen langen steinernen Schlund.
Sollten Sie je in diese Gegend kommen und sich, aus Neugier oder einem inneren Drang heraus, über den Rand beugen, hinunterblicken und warten, bis Ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt sind, könnten Sie am Grund etwas schimmern sehen, das an die aufblitzenden Schuppen eines Fischs erinnert. Doch lassen Sie sich nicht täuschen. Es gibt dort unten keine Fische. Auch keine Schlangen und Skorpione. Keine an seidigen Fäden hängenden Spinnen. Der Glanz kommt nicht von einem lebenden Wesen, er kommt von einer alten Taschenuhr – Perlmutt, umschlossen von achtzehnkarätigem Gold, mit einer Gravur, die aus zwei Zeilen eines Gedichts besteht:
Dort anzukommen ist dir vorbestimmt.
Doch eile nicht auf deiner Reise.
Und auf der Rückseite stehen zwei Initialen, genauer gesagt zweimal der gleiche Buchstabe:
Y&Y
Der Brunnen ist zehn Meter tief, eineinhalb Meter weit. Eine sanft gerundete Mauer aus Quadern, die sich in immer gleichem horizontalem Verlauf zum stummen, modrigen Wasser hinabziehen. Dort unten liegen zwei Männer, die Wirte einer beliebten Taverne. Beide sind schlank und mittelgroß, mit abstehenden Ohren, über die sie immer gewitzelt haben. Beide sind auf der Insel geboren und aufgewachsen. Beide waren Mitte vierzig, als man sie entführte, zusammenschlug und ermordete. Man hat sie aneinandergekettet, mit einem Drei-Liter-Olivenölkanister voller Beton beschwert, um sicherzugehen, dass sie nie wieder auftauchen würden, und in den Schacht gestoßen. Die Taschenuhr, die der eine am Tag der Verschleppung trug, blieb um genau acht Minuten nach Mitternacht stehen.
Die Zeit ist ein Singvogel und lässt sich wie jeder Singvogel fangen. Man kann sie in einem Käfig halten, sogar länger, als man denkt. Doch ewig lässt sie sich nicht bändigen.
Keine Gefangenschaft ist für immer.
Eines Tages wird das Metall im Wasser durchgerostet sein, die Ketten werden zerfallen, und das harte Herz des Betons wird weich werden wie selbst die härtesten Herzen im Lauf der Zeit. Dann treiben die beiden Leichen, endlich frei, im gebrochenen Sonnenlicht leuchtend dem Stückchen Himmel entgegen, steigen auf zu dem herrlichen Blau, erst langsam, dann in hektischer Eile wie Taucher im Ringen nach Luft.
Früher oder später wird der marode alte Brunnen auf der abgelegenen schönen Insel weit draußen im Mittelmeer einstürzen. Und sein Geheimnis wird, wie jedes Geheimnis, ans Tageslicht kommen.
TEIL EINS
Wie man einen Baum vergräbt
EIN MÄDCHEN NAMENS INSEL
England, Ende der 2010er-Jahre
In der Brook Hill Secondary School in Nordlondon fand die letzte Unterrichtsstunde des Jahres statt. Elfte Klasse, Geschichte. Nur noch fünfzehn Minuten bis zum Gong. Die Schülerinnen und Schüler wurden unruhig, sehnten die Weihnachtsferien herbei. Alle bis auf eine.
Ada Kazantzakis, sechzehn Jahre alt, saß still an ihrem Fensterplatz in der hintersten Reihe. Ihr mahagonifarbenes Haar war im Nacken zu einem Pferdeschwanz gebunden; die feinen Züge wirkten angespannt, ja verkniffen, und die großen rehbraunen Augen zeugten von wenig Schlaf in der Nacht zuvor. Sie freute sich weder auf die Feiertage noch wartete sie gespannt auf den ersten Schnee. Hin und wieder schielte sie aus dem Fenster, doch ihre Miene blieb starr.
Mittags hatte es gehagelt. Milchweiße Eiskügelchen hatten die letzten Blätter an den Bäumen zerfetzt, hatten auf das Blechdach des Fahrradschuppens getrommelt und waren in einem wilden Stepptanz auf dem Boden herumgesprungen. Inzwischen hatte sich alles wieder beruhigt, doch dass das Wetter schlechter geworden war, ließ sich nicht übersehen: Ein Wintersturm war im Anmarsch. Am Morgen hatte das Radio einen Polarwirbel gemeldet, der Großbritannien innerhalb von achtundvierzig Stunden mit rekordverdächtig tiefen Temperaturen, Eisregen und Schneestürmen heimsuchen würde. Rohrbrüche, Wasser- und Stromausfälle drohten große Teile Englands, Schottlands und Nordeuropas lahmzulegen. Die Menschen hatten Dosenfisch, Baked Beans, Nudeln und Klopapier gehortet, als stünde eine Belagerung bevor.
Unter den Schülern war das Wetter den ganzen Vormittag Gesprächsthema Nummer eins gewesen. Alle fürchteten um ihre Ferien- und Reisepläne. Nur Ada nicht. Sie hatte weder Familienbesuche noch exotische Urlaubsorte in Aussicht. Ihr Vater plante nicht wegzufahren. Er musste arbeiten. Musste er immer. Er war seit jeher ein unheilbarer Workaholic – alle, die ihn kannten, konnten das bezeugen –, doch seit dem Tod ihrer Mutter vergrub er sich in seine Forschung wie ein Maulwurf, der tief in den Gängen Wärme und Schutz sucht.
Ada hatte zwar irgendwann in ihrem jungen Leben eingesehen, dass ihr Vater anders war als andere Väter, aber seine fanatische Pflanzenliebe störte sie noch immer. Alle anderen Väter arbeiteten in Büros, Läden oder Behörden, trugen entsprechende Anzüge, weiße Hemden und glänzende schwarze Schuhe. Ihr Vater hingegen lief meist in Regenjacke, olivgrüner oder brauner Baumwollhose und klobigen Stiefeln herum. Statt mit dem Aktenkoffer verließ er das Haus mit einer Schultertasche, die ein Sammelsurium aus einer Stiellupe, einem Sezierbesteck, einer Pflanzenpresse, einem Kompass und Notizbüchern enthielt. Andere Väter sprachen ständig übers Geschäft oder über ihre Altersvorsorge; ihren Vater interessierten die toxische Wirkung von Pestiziden auf die Samenkeimung und die ökologischen Schäden durch Abholzung wesentlich mehr. Über die Auswirkungen der Entwaldung sprach er mit einer Leidenschaft, die andere Väter nur für die Fluktuationen innerhalb ihrer Aktienportfolios aufbrachten. Und er sprach nicht nur, er schrieb auch darüber: Bereits zwölf Bücher über Evolutionsökologie und Botanik hatte er verfasst. Eines trug den Titel Das geheimnisvolle Königreich: Wie Pilze unsere Vergangenheit formten, verändert unsere Zukunft. Eine andere Monografie behandelte Hornmoose, Lebermoose und Laubmoose. Auf dem Cover spannte sich eine Steinbrücke über einen Bach, der zwischen kleinen, samtig grün bewachsenen Felsen munter dahinplätscherte. Über der traumähnlichen Szenerie stand in goldenen Lettern: Ein Naturführer zu den häufigsten Moosarten Europas. Darunter war in Großbuchstaben sein Name gedruckt: KOSTAS KAZANTZAKIS.
Ada hatte keine Ahnung, wer die Leser dieser Bücher waren. In der Schule hatte sie jedenfalls niemandem etwas darüber erzählt. Warum hätte sie den anderen einen weiteren Grund liefern sollen, sie und ihre Familie für schräg zu halten?
Ihr Vater zog die Gesellschaft von Bäumen der von Menschen stets vor. So war er schon immer gewesen, doch Adas Mutter hatte es früher zumindest geschafft, seine Verschrobenheit etwas abzuschwächen – wahrscheinlich, weil sie selbst ihre Eigenheiten besaß. Seit dem Tod ihrer Mutter spürte Ada, dass sich ihr Vater von ihr entfernte, aber es konnte auch umgekehrt sein. In einem Haus voller Trauer war schwer zu erkennen, wer wem aus dem Weg ging. Nun würden sie beide nicht nur während des Sturms, sondern die ganze Weihnachtszeit daheim sein. Ada konnte nur hoffen, dass er eingekauft hatte.
Sie senkte den Blick auf ihr Heft und zog die zarten, zerbrechlichen Flügel des Schmetterlings nach, den sie unten an den Seitenrand gezeichnet hatte.
»Hey, hast du ’nen Kaugummi?«
Ada schreckte aus ihrer Träumerei auf und sah zur Seite. Sie saß zwar gern in der letzten Reihe, aber der Preis dafür war Emma-Rose als Nachbarin: ein Mädchen mit den lästigen Angewohnheiten, die Knöchel knacken zu lassen, einen Kaugummi nach dem anderen zu kauen, was in der Schule verboten war, und sich über Themen auszulassen, die niemanden interessierten.
»Nein, sorry«, antwortete Ada und schielte nervös zur Lehrerin.
»Geschichte ist etwas Faszinierendes«, sagte Mrs Walcott gerade. Ihre Budapester waren wie festgewachsen auf dem Boden hinter dem Pult, als hätte sie das Bedürfnis, ihre neunundzwanzig Schüler hinter einer Barrikade hervor zu unterrichten. »Wie sollten wir auch unsere Zukunft gestalten, wenn wir unsere Vergangenheit nicht verstehen?«
»Ich kann sie einfach nicht ab«, flüsterte Emma-Rose.
Ada erwiderte nichts. Sie war sich nicht sicher, ob Emma-Rose die Lehrerin oder sie gemeint hatte. Falls Ada selbst die Angesprochene war, hatte sie zu ihrer Ehrenrettung nichts vorzubringen. Hatte Emma-Rose die Lehrerin im Sinn gehabt, würde Ada in die Schmähung nicht einstimmen. Sie mochte Mrs Walcott, die es immer gut meinte, der es aber schwerfiel, die Klasse zu disziplinieren. Soweit Ada wusste, war der Mann der Lehrerin vor einigen Jahren gestorben, und sie hatte sich schon oft ausgemalt, wie das Leben dieser Frau wohl aussah: wie sie ihren rundlichen Körper morgens aus dem Bett stemmte, unter die Dusche lief, bevor das heiße Wasser ausging, im Schrank nach einem geeigneten Kleid suchte, das sich kaum von dem geeigneten Kleid des Vortags unterschied, ihren Zwillingen auf die Schnelle ein Frühstück machte und sie kurz darauf, rot im Gesicht und mit schlechtem Gewissen in der Stimme, bei den Erzieherinnen der Kita ablieferte. Auch wie sich Mrs Walcott nachts berührte, hatte Ada sich schon vorgestellt, wie ihre Hände unter dem Baumwollnachthemd kreisende Bewegungen vollführten; und wie sie hin und wieder Männer zu sich einlud, die nasse Fußabdrücke auf dem Teppichboden und in ihr ein schales Gefühl hinterließen.
Sie wusste natürlich nicht, ob ihre Gedanken der Realität entsprachen, aber sie hielt es für sehr wahrscheinlich. Das war ihr Talent, vielleicht ihr einziges: Sie nahm die Traurigkeit anderer wahr, so wie ein Tier den Artgenossen aus zwei Kilometern Entfernung riecht.
Mrs Walcott klatschte in die Hände. »Eine Sache noch, bevor ihr geht. Ab Januar beschäftigen wir uns mit Migration und Generationenwechsel. Das ist ein unterhaltsames Thema, bevor wir uns reinknien und den Stoff für den Abschluss wiederholen. Zur Vorbereitung bitte ich euch, in den Weihnachtsferien ein älteres Familienmitglied zu interviewen. Am besten eure Großeltern, aber es kann auch jemand anderes sein. Fragt, wie es in der Jugend eures Interviewpartners war, und schreibt einen Bericht darüber, vier bis fünf Seiten.«
Die Klasse reagierte mit einem einzigen genervten Seufzer.
»Der Bericht muss historische Fakten enthalten«, fuhr Mrs Walcott fort, ohne auf die Unmutsbekundung einzugehen. »Ich erwarte eine fundierte, ordentlich belegte Recherche, keine Spekulationen!«
Wieder wurde geseufzt und geächzt.
»Und fragt nach Familienerbstücken – alte Ringe, Brautkleider, in Ehren gehaltenes Porzellan –, Andenken, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurden.«
Ada schlug die Augen nieder. Sie hatte weder die Verwandten ihrer Mutter noch die ihres Vaters jemals kennengelernt. Dass sie in Zypern lebten, wusste sie, aber nicht viel mehr. Was für Leute waren das? Wie sah ihr Alltag aus? Würden sie Ada auf der Straße oder im Supermarkt erkennen? Die einzige nahe Verwandte, von der sie gehört hatte, war eine gewisse Tante Meryem. Von ihr kamen bunte Ansichtskarten mit sonnigen Stränden und Blumenwiesen, die überhaupt nicht zu Meryems gänzlicher Abwesenheit im Leben von Ada und ihrem Vater passten.
Waren schon ihre Verwandten ein großes Rätsel, so galt das noch mehr für Zypern selbst. Ada hatte im Internet Fotos gesehen, war aber noch nie an den Ort gereist, nach dem sie benannt war.
In der Sprache ihrer Mutter bedeutete ihr Name »Insel«. Als kleines Kind hatte sie immer gedacht, damit wäre Großbritannien gemeint, die einzige Insel, die sie damals kannte. Erst später war ihr klar geworden, dass es um eine andere, ferne Insel ging, weil sie dort gezeugt worden war. Diese Erkenntnis hatte sie ziemlich verwirrt, ihr sogar Unbehagen bereitet. Erstens, weil sie Ada daran erinnerte, dass ihre Eltern miteinander geschlafen hatten – und daran wollte sie niemals denken; und zweitens, weil die Erkenntnis sie unweigerlich mit einem Ort verband, der nur in ihrer Fantasie vorhanden war. Damals hatte sie ihren Namen in die Sammlung nicht englischer Wörter aufgenommen, die sie mit sich herumtrug; Wörter, die sich seltsam und schillernd anhörten, kühl und fremd. Sie waren wie schön geformte Kieselsteine am Strand, die man mitnahm und dann nichts mit ihnen anzufangen wusste. Inzwischen hatten sich einige angesammelt. Auch Redewendungen. Und Lieder, fröhliche Melodien. Aber das war es auch schon. Adas Eltern hatten ihre Herkunftssprachen nicht an die Tochter weitergegeben, da sie sich zu Hause nur auf Englisch unterhalten hatten. Ada beherrschte weder das Griechisch ihres Vaters noch das Türkisch ihrer Mutter.
Wenn sie als Kind gefragt hatte, warum sie noch nie auf Verwandtenbesuch in Zypern gewesen waren und warum die Verwandten nie zu ihnen nach England kamen, war sie von ihren Eltern mit allen möglichen Ausflüchten abgespeist worden. Der Zeitpunkt sei ungünstig, es stünden zu viel Arbeit oder zu hohe Ausgaben an … Nach und nach keimte in ihr der Verdacht, die Verwandten könnten gegen die Heirat der Eltern gewesen sein und so auch gegen sie, das Produkt dieser Ehe. Sie hatte lange an der Hoffnung festgehalten, es müsste nur ein einziger Verwandter aus dem weiteren Familienkreis ein bisschen Zeit mit ihr und ihren Eltern verbringen, und ihnen würde nachgesehen, was immer man ihnen zuvor nicht verziehen hatte.
Doch seit dem Tod ihrer Mutter fragte sie nicht mehr nach den Verwandten. Leute, die nicht zum Begräbnis eines Familienmitglieds erschienen, hegten wahrscheinlich auch keine Liebe für das Kind der Verstorbenen; ein Mädchen, das sie noch nie gesehen hatten.
»Haltet euch während des Interviews mit Urteilen über die ältere Generation zurück«, sagte Mrs Walcott. »Hört genau zu und versucht, das, was sie schildern, mit ihren Augen zu sehen. Und natürlich nehmt ihr die Gespräche auf.«
»Wenn ich einen Nazi-Verbrecher interviewe, soll ich also nett zu ihm sein?«, rief Jason in der ersten Reihe.
Mrs Walcott seufzte. »Das ist ein ziemlich extremes Beispiel. Nein, zu so jemandem müsst ihr nicht nett sein.«
Jason grinste triumphierend.
»Miss, wir haben zu Hause eine alte Geige. Zählt die als Erbstück?«, fragte Emma-Rose.
»Natürlich, wenn sie seit Generationen in der Familie ist.«
»Ja, die haben wir schon ewig«, verkündete Emma-Rose strahlend. »Meine Mutter sagt, dass sie im neunzehnten Jahrhundert in Wien gebaut worden ist. Oder im achtzehnten? Auf jeden Fall ist sie wahnsinnig wertvoll, aber wir verkaufen sie trotzdem nicht.«
Zafaar meldete sich. »Wir haben eine Aussteuertruhe von meiner Oma, die hat sie aus dem Pandschab mitgebracht. Geht die auch?«
Adas Herz setzte einen Schlag aus. Die Antwort der Lehrerin und den weiteren Wortwechsel nahm sie gar nicht mehr wahr. Ihr ganzer Körper erstarrte, so krampfhaft bemühte sie sich, nicht zu Zafaar hinüberzusehen, aus Angst, sie könnte ihre Gefühle verraten.
Einen Monat zuvor hatte man Zafaar und sie für ein Biochemie-Projekt zu einem Zweierteam zusammengespannt. Sie sollten ein Gerät zur Messung des Kalorienwerts verschiedener Nährstoffe bauen. Nachdem es ihr mehrere Tage lang nicht gelungen war, ein Treffen mit ihm zu vereinbaren, hatte sie aufgegeben und das meiste allein gemacht – Artikel gesucht, den Bausatz gekauft und das Kalorimeter zusammengesetzt. Am Ende hatten beide eine Eins bekommen, und Zafaar hatte ihr mit einem angedeuteten Lächeln gedankt. Ada hatte seine Zurückhaltung als Zeichen seines schlechten Gewissens interpretiert, aber vielleicht beruhte sie auch nur auf Gleichgültigkeit. Seitdem hatten sie kein Wort gewechselt.
Sie hatte noch nie einen Jungen geküsst. Alle Mädchen in ihrem Jahrgang konnten vor und nach dem Sportunterricht in der Umkleide, ob nun wahr oder erfunden, immer etwas erzählen – nur sie nicht. Ihr anhaltendes Schweigen war nicht unbemerkt geblieben und sorgte für viel Spott und Hänselei. Einmal hatte sie in ihrem Schulranzen ein von unbekannter Hand hineingeschmuggeltes Pornoheft gefunden, das sie wohl schockieren sollte. Sie bibberte den ganzen Tag vor Angst, ein Lehrer könnte es entdecken und ihren Vater informieren. Dabei hatte sie nicht so viel Angst vor ihm wie einige Mitschüler vor ihren Vätern – es ging nicht um Angst und, nach ihrer Entscheidung, das Heft zu behalten, auch nicht um Schuld. Nicht deshalb hatte sie ihm von dem Vorfall wie auch von weiteren Vorfällen nie erzählt. Sie vertraute ihm überhaupt nichts mehr an, seit sie tief im Inneren spürte, dass sie ihm keinen weiteren Schmerz zumuten durfte.
Hätte ihre Mutter noch gelebt, hätte Ada ihr das Heft wahrscheinlich sogar gezeigt. Sie hätten es gemeinsam durchgeblättert und viel gekichert. Vielleicht hätten sie bei einer heißen Schokolade darüber gesprochen und den Dampf aus den Tassen genüsslich eingeatmet. Ihre Mutter hatte Verständnis für ungehörige, unanständige Gedanken gehabt, für die dunkle Seite des Mondes. Einmal hatte sie halb im Scherz gesagt, sie sei zu rebellisch, um eine gute Mutter zu sein, und zu mütterlich für eine gute Rebellin. Erst seit ihrem Tod war Ada bewusst, dass sie ihr nie gesagt hatte, welch gute Mutter sie trotz allem gewesen war – und welch gute Rebellin. Genau elf Monate und acht Tage war es jetzt her. Dieses Weihnachten würde das erste ohne sie sein.
»Und was meinst du, Ada? Siehst du das auch so?«, fragte Mrs Walcott.
Es dauerte ein, zwei Sekunden, bis Ada, die wieder in die Zeichnung vertieft war, von ihrem Schmetterling aufsah und den Blick der Lehrerin bemerkte. Sie lief sofort rot an, und ihr Rücken wurde so steif, als hätte ihr Körper eine Gefahr wahrgenommen, die ihr Geist noch nicht ganz begriff. Als sie die Sprache wiederfand, klang ihre Stimme zittrig. Hatte sie überhaupt etwas gesagt? Sie war sich nicht sicher.
»Wie bitte?«
»Ich habe dich gefragt, ob du das auch so siehst wie Jason.«
»Entschuldigung … Ob ich was auch so sehe?«
Im Klassenzimmer ertönte Gekicher.
»Wir haben gerade über Familienerbstücke gesprochen«, erwiderte Mrs Walcott müde lächelnd. »Zafaar hat von der Aussteuertruhe seiner Großmutter erzählt, und dann hat Jason gefragt, warum immer nur Frauen an solchen Andenken und Krimskrams von früher hängen. Daraufhin habe ich dich gefragt, ob du das auch so siehst.«
Ada schluckte. In ihren Schläfen pochte das Blut. Rings um sie bildete sich ein zähes, klebriges Schweigen. Sie stellte es sich als dunkle Tinte vor, die sich auf weiße Häkeldeckchen ergoss – Deckchen, wie sie sie einmal in der Schminktisch-Schublade ihrer Mutter entdeckt hatte. In winzige Stücke geschnitten, zerstört, hatten sie zwischen Seidenpapier gelegen, als hätte ihre Mutter sie nicht behalten können, wie sie gewesen waren, aber auch nicht das Herz gehabt, sie wegzuwerfen.
»Fällt dir dazu etwas ein?«, fragte Mrs Walcott freundlich, aber bestimmt.
Ohne zu wissen, warum, stand Ada langsam auf, sodass ihr Stuhl laut über den Fliesenboden schrammte, und räusperte sich, obwohl sie keine Ahnung hatte, was sie sagen sollte. In ihrem Kopf herrschte vollkommene Leere. Erschrocken ergriff der Schmetterling die Flucht und flog von ihrem Heft auf; seine unfertigen, an den Rändern verwischten Flügel kaum stark genug, um ihn zu tragen.
»Ich … ich glaube nicht, dass das nur Frauen machen. Mein Vater macht das auch.«
»Wirklich?«, sagte Mrs Walcott. »Inwiefern?«
Alle Mitschüler starrten sie an und erwarteten eine vernünftige Antwort. In einigen Blicken lag leises Mitleid, in anderen unverhohlene Gleichgültigkeit, die ihr wesentlich lieber war. Die kollektive Erwartungshaltung der anderen machte sie einsam. Weil der Druck auf ihre Ohren immer größer wurde, hatte sie das Gefühl, unter Wasser zu sein und tiefer und tiefer zu sinken.
»Kannst du uns ein Beispiel nennen?«, fragte Mrs Walcott. »Was sammelt dein Vater?«
»Mein Vater … Also, mein Vater …«, sagte Ada gedehnt. Dann schwieg sie wieder.
Was sollte sie über ihren Vater erzählen? Dass er manchmal zu essen oder sogar zu sprechen vergaß, ganze Tage am Stück nichts Ordentliches zu sich nahm oder auch nur einen einzigen ganzen Satz von sich gab? Oder dass er sein restliches Leben am liebsten im Garten oder, noch besser, in einem Wald verbringen würde, die Hände tief in der Erde, umgeben von Bakterien, Pilzen und all den ständig wachsenden und verrottenden Pflanzen? Wie sollte sie den anderen ihren Vater beschreiben, wenn sie ihn selbst kaum wiedererkannte?
Sie sagte nur: »Pflanzen.«
»Pflanzen«, wiederholte Mrs Walcott und verzog fragend das Gesicht.
»Mein Vater liebt Pflanzen«, fügte Ada hastig hinzu und bereute augenblicklich ihre Wortwahl.
»Ach, wie süß … ihr Vater mag Blümchen!«, rief Jason in vor Sarkasmus triefendem Ton.
Die Klasse brach in Gelächter aus. Selbst Adas Freund Ed vermied es, sie anzusehen, und gab mit gesenktem Kopf und hängenden Schultern vor, er würde in seinem Geschichtsbuch lesen. Als sie zu Zafaar hinüberschielte, sah sie, dass seine glänzenden schwarzen Augen, die sonst nur selten auf sie gerichtet waren, sie neugierig, fast besorgt musterten.
»Das ist schön«, sagte Mrs Walcott. »Aber fällt dir kein Gegenstand ein, der ihm am Herzen liegt? Etwas von emotionalem Wert?«
Ada wünschte sich nichts so sehr, wie die richtigen Worte zu finden. Warum versteckten sie sich vor ihr? Ihr Magen zog sich so schmerzhaft zusammen, dass sie kurz weder atmen, geschweige denn sprechen konnte. Dann tat sie es doch und hörte sich sagen: »Er verbringt viel Zeit mit seinen Bäumen.«
Mrs Walcott deutete ein Nicken an und lächelte wieder.
»Vor allem mit dem Feigenbaum, den mag er am liebsten.«
»Gut, du kannst dich wieder setzen«, sagte Mrs Walcott.
Doch Ada gehorchte nicht. Der Schmerz, der ihr zwischen die Rippen gefahren war, suchte sich einen Weg nach draußen. Ihre Brust fühlte sich wie von unsichtbaren Händen zusammengedrückt an. Ihr wurde schwindelig, der Boden unter ihren Füßen schwankte.
»Wie cringey ist die denn!«, sagte jemand leise, doch Ada hörte es trotzdem.
Sie kniff die Augen fest zusammen. Die Bemerkung tat so weh, als hätte sie sich verbrannt. Doch schlimmer als alles, was die anderen taten oder sagten, war der Selbsthass. Was war los mit ihr? Warum war sie nicht imstande, eine simple Frage zu beantworten? Alle anderen konnten es doch auch!
Als Kind hatte sie oft auf dem türkischen Teppich Pirouetten getanzt, bis sich in ihrem Kopf alles drehte, und sich schließlich zu Boden fallen lassen, um der kreisenden Welt zuzusehen. Das handgewebte Teppichmuster hatte sich in tausend Funken aufgelöst, und die Farben waren ineinandergeflossen, Rot und Grün, Weiß und Safrangelb. Aber der Taumel, der sie in diesem Moment ergriff, war anders. Sie fühlte sich in der Falle. Gleich würde hinter ihr eine Tür ins Schloss fallen und ein Riegel vorgeschoben werden. Sie war wie gelähmt.
Dass die Traurigkeit in ihr nicht ihre eigene war, vermutete sie schon lange. In Biologie hatten sie gelernt, dass jeder Mensch ein Chromosom vom Vater und eines von der Mutter erbte – lange DNA-Stränge mit Tausenden Genen, die Milliarden Neuronen bildeten und billionenfach miteinander verbunden waren. Die Eltern gaben die genetische Information an ihr Kind weiter. Das Überleben, das Wachstum, die Fortpflanzung, die Haarfarbe, die Nasenform, ob man Sommersprossen hatte oder niesen musste, wenn man in die Sonne schaute – all das steckte darin. Doch die eine Frage, die sie so umtrieb, war unbeantwortet geblieben: Konnte man auch etwas so Ungreifbares, nicht Messbares wie Kummer erben?
»Du darfst dich setzen«, wiederholte Mrs Walcott.
Ada regte sich nicht.
»Ada …? Hörst du nicht, was ich sage?«
Sie versuchte die Angst wegzuschlucken, die ihre Kehle füllte und in ihre Nase stieg. Sie erinnerte an den Geschmack des Meers unter der grell brennenden Sonne. Ada ertastete sie mit der Zungenspitze. Aber da war kein Salzwasser, sondern warmes Blut. Sie hatte sich in die Wange gebissen.
Ihr Blick wanderte zum Fenster, hinter dem der Sturm nahte. Zwischen den dichten Wolken hindurch zog sich ein purpurrotes Band wie eine alte, nie ganz verheilte Wunde über den schiefergrauen Himmel.
»Bitte setz dich.«
Auch diesmal ließ sich Ada nicht dazu bewegen.
Später, als das Schlimmste schon passiert war, als sie nachts hellwach in ihrem Bett lag und ihren Vater, der auch keinen Schlaf fand, im Haus hin und her gehen hörte, kehrte Ada Kazantzakis in Gedanken zu diesem Moment zurück – zu dem Riss in der Zeit –, als sie den Befehl noch hätte befolgen, sich hinsetzen und für ihre Mitschüler mehr oder weniger unsichtbar bleiben können, unbemerkt, aber auch unbehelligt. Alles wäre beim Alten geblieben, hätte sie nicht getan, was sie dann tat.
DER FEIGENBAUM
Während sich an diesem Nachmittag Sturmwolken auf London senkten und der Welt die Farbe der Melancholie verliehen, vergrub mich Kostas Kazantzakis im Garten hinter dem Haus. Normalerweise behagte es mir zwischen den üppigen Kamelien, dem süß duftenden Geißblatt und den Zaubernusssträuchern mit ihren spinnenartigen Blüten. Doch dies war kein normaler Tag. Ich versuchte heiter zu sein und das Positive zu sehen, aber vergeblich. Ich war nervös, angespannt. Schließlich hatte man mich noch nie vergraben.
Kostas war seit dem frühen Morgen im Garten zugange. Bei jedem Spatenstich in die harte Erde glänzte der Schweißfilm auf seiner Stirn. Im Dunkel hinter ihm ragte das Holzspalier auf, an dem sich im Sommer Kletterrosen und Waldreben rankten, das jetzt aber nur als durchsichtige Barriere unseren Garten von der Terrasse der Nachbarn trennte. Zu seinen Füßen, die in Lederstiefeln steckten, lag ein Haufen kalter, krümeliger Erde, der langsam höher wurde und um den eine Schnecke ihre silbrig glänzende Spur zog. Kostas’ Atem bildete Wölkchen vor seinem Gesicht, während er die Schultern in seinem dunkelblauen Parka – erstanden in einem Vintageladen in der Portobello Road – ein ums andere Mal straffte. Dass die Haut an seinen Fingerknöcheln rot und aufgerissen war und an einigen Stellen blutete, bemerkte er nicht.
Ich fror, und ich hatte Angst, auch wenn ich mir das nicht eingestand. Ich hätte ihm gern von meinen Bedenken erzählt, doch selbst wenn ich der Sprache mächtig gewesen wäre, hätte er mich nicht gehört. Er buddelte vor sich hin und war zu sehr mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, um auch nur einen Blick in meine Richtung zu werfen. Sobald er fertig wäre und den Spaten zur Seite gelegt hätte, würde er mich mit seinen klugen grünen Augen betrachten, die so viel Schmerz und Freude gesehen hatten, und mich in die Grube stoßen.
Weihnachten stand vor der Tür, im ganzen Viertel funkelten Lichterketten und Lametta. Aufblasbare Weihnachtsmänner und Rentiere mit Plastikgrinsen in den Vorgärten. An den Markisen der Geschäfte hingen bunte Blinkgirlanden, und die Sterne, die in den Fenstern der Häuser leuchteten, luden zu heimlichen Blicken in das Leben anderer Menschen ein, das immer weniger kompliziert, immer aufregender – immer glücklicher – als das eigene zu sein schien.
In der Hecke begann eine Dorngrasmücke abgehackte, heisere Töne zu singen. Ich fragte mich, was ein nordafrikanischer Vogel um diese Jahreszeit in unserem Garten zu suchen hatte. Warum war er nicht unterwegs an einen wärmeren Ort, gemeinsam mit all den anderen, die jetzt gen Süden und, nach einem kleinen Schlenker auf ihrer Route, vielleicht gerade nach Zypern flogen und mein Heimatland besuchten?
Allerdings wusste ich, dass sich Sperlingsvögel in seltenen Fällen verirrten oder die Reise – den Jahr um Jahr gleichen und doch nie gleichen Flug durch meilenweite Leere – nicht mehr schafften und manche deshalb blieben, trotz der Tatsache, dass sie dann Hunger, Kälte und nur allzu oft der Tod erwartete.
Dieser Winter zog sich schon so lang hin und war so anders als das milde Wetter im vergangenen Jahr mit dem ständig bedeckten Himmel, den vereinzelten Schauern, schlammigen Böden – ein einziges Grau in Grau. Nicht ungewöhnlich für »good old England«. Dieses Jahr hatte die Witterung seit dem Frühherbst ständig gewechselt. Nachts heulte der Wind und brachte ungezähmte, ungerufene Dinge in Erinnerung – Dinge in uns, denen wir noch nicht ins Auge blicken, geschweige denn sie verstehen konnten. Wenn wir morgens erwachten, waren die Straßen oft mit Eis überzogen und die Grashalme zu smaragdgrünen Scherben erstarrt. Für kaum ein Viertel der vielen Tausenden, die auf Londons Straßen lebten, stand Obdach bereit.
Diese Nacht drohte die bisher kälteste des Jahres zu werden. Schon jetzt durchstach die Luft wie Glassplitter alles, was sie berührte. Deshalb beeilte sich Kostas so sehr. Er wollte fertig sein, bevor der Boden gefroren war.
Sturm Hera, so hieß der heranrückende Orkan. Auf George, Olivia, Matilda oder Charles folgte nun ein mythologischer Name. Er war als der schlimmste seit Jahrhunderten angekündigt – schlimmer als der Große Sturm von 1703, der die Schindeln von den Dächern geweht, den Damen die Fischbeinkorsetts vom Leib gerissen, die Herren ihrer gepuderten Perücken und die Bettler ihrer auf den Rücken geschnallten Lumpen beraubt hatte. Der große Fachwerkhäuser ebenso zerstörte wie elende Behausungen aus Lehm, Schoner wie Papierschiffchen zerdrückte und den in der Themse treibenden Unrat ans Ufer spülte.
Erfundene Geschichten, mag sein, aber ich glaubte ihnen, so wie ich auch den Legenden glaubte und den Wahrheiten, die sie vermittelten.
Wenn alles nach Plan läuft, sagte ich mir, bleibe ich höchstens drei Monate unter der Erde. Wenn der Löwenzahn an den Wegrändern blüht und die Glockenblumen den Wald wie ein Teppich bedecken, wenn die ganze Natur neu belebt ist, komme ich wieder raus. Putzmunter und kerzengerade. Doch sosehr ich mich auch bemühte, es gelang mir nicht, an diesem Hoffnungsschimmer festzuhalten, während der grimmige, unerbittliche Winter nie zu enden schien. Optimismus war sowieso noch nie meine Stärke. Das liegt mir wohl in den Genen – ich entstamme einem alten Pessimistengeschlecht. Deshalb tat ich, was ich sehr oft tat: Ich stellte mir vor, was alles schiefgehen könnte. Was, wenn der Frühling diesmal nicht käme und ich für immer dort unten bliebe? Was, wenn der Frühling sich endlich blicken ließe, aber Kostas Kazantzakis vergessen würde, mich auszugraben – was dann?
Eine heftige Bö wehte daher und fuhr wie ein gezacktes Messer in mich.
Kostas hatte es bemerkt, denn er hörte auf zu graben und sagte: »Meine Güte, du armes Ding frierst ja!«
Ich war ihm immer wichtig gewesen. Immer wenn es kalt geworden war, hatte er alles getan, um mein Überleben zu sichern. Einmal stellte er an einem frostigen Januarnachmittag rings um mich einen Windschutz auf und packte mich in dicke Juteschichten, damit ich nicht zu viel Feuchtigkeit verlor. Ein anderes Mal bedeckte er mich mit Mulch. Er stellte Wärmelampen im Garten auf, die die ganze Nacht und – das war besonders wichtig – bis kurz vor dem Morgengrauen brannten, der dunkelsten und oft auch kältesten Tageszeit. Das ist die Stunde, in der die meisten von uns ein Schlaf überkommt, aus dem wir nicht wieder erwachen – die Obdachlosen auf der Straße und wir …
… die Feigenbäume.
Ich bin eine Ficus carica, bekannt als Gewöhnlicher Feigenbaum mit essbaren Früchten, wobei an mir als stolzem Mitglied der Familie der Maulbeergewächse, Moraceae genannt, und aus dem Reich der Plantae stammend, nichts Gewöhnliches ist, wie ich Ihnen versichern kann. Ursprünglich aus Kleinasien, bin ich in einem riesigen Gebiet heimisch geworden, das sich von Kalifornien bis Portugal und in den Libanon erstreckt, von der Schwarzmeerküste bis zu den Gebirgen Afghanistans und den Tälern Indiens.
Feigenbäume in harten Wintern zu vergraben und sie im Frühling wieder hervorzuholen, ist eine seltsame, aber weit verbreitete Tradition. Nicht nur Italiener, die sich in frostigen Gegenden Amerikas und Kanadas niederließen, sind damit wohlvertraut, sondern auch Spanier, Portugiesen, Malteser, Griechen, Libanesen, Ägypter, Tunesier, Marokkaner, Algerier, Israelis, Palästinenser, Iraner, Kurden, Türken, Jordanier, Syrer, sephardische Juden … und wir Zyprer.
Den Jungen ist der Brauch womöglich nicht mehr vertraut, aber die Älteren kennen ihn noch sehr gut. Die Menschen, die als Erste von den milderen Küsten des Mittelmeers in die tosenden Städte des Westens zogen. Leute, die noch nach vielen Jahren davon träumen, ihre Lieblingsspeise – würzigen Käse, geräuchertes Pastrami, gefüllten Schafsdarm, Tiefkühl-mantı, selbst gemachtes Tahini, Johannisbrotsirup, karydáki glykó, Kuttelsuppe, Milzwurst, Thunfischaugen oder Widderhoden – über Grenzen zu schmuggeln. Würden sie sich auf die Suche begeben, könnten sie zumindest einiges davon in einem Supermarkt ihrer Wahlheimat in der Abteilung »Internationale Spezialitäten« finden.
Allerdings würden sie immer behaupten, es schmecke irgendwie anders.
Einwanderer der ersten Generation sind ein ganz eigener Menschenschlag. Sie tragen fast nur Beige, Grau und Braun, unauffällige Farben. Farben, die flüstern, nicht schreien. Sie neigen zur Förmlichkeit und wollen mit Würde behandelt werden. Ihre Bewegungen wirken leicht linkisch, so als fühlten sie sich etwas unwohl in ihrer neuen Umgebung. Sie sind auf ewig dankbar für die Chancen, die ihnen das Leben eröffnet hat, und zugleich gezeichnet von dem, was es ihnen nahm. Immer fehl am Platz und durch eine unausgesprochene Erfahrung von den anderen getrennt, wie die Überlebenden eines Autounfalls.
Einwanderer der ersten Generation sprechen mit ihren Bäumen – aber natürlich nur, wenn niemand dabei ist. Sie schütten uns Bäumen ihr Herz aus, schildern ihre Träume und Sehnsüchte, auch die zurückgelassenen – Wollfäden, die beim Übersteigen von Zäunen im Stacheldraht hängen blieben. Doch meistens genießen sie einfach nur unsere Gesellschaft, plaudern mit uns wie mit alten, lange vermissten Freunden. Sie behandeln ihre Pflanzen liebevoll und fürsorglich, besonders die aus der verlorenen Heimat mitgebrachten. Denn tief im Inneren wissen sie: Wer einen Feigenbaum vor dem Sturm in Sicherheit bringt, rettet die Erinnerung an einen Menschen.
DAS KLASSENZIMMER
»Bitte setz dich, Ada«, sagte Mrs Walcott noch einmal. Ihre Stimme klang hart und angespannt.
Auch diesmal blieb Ada stehen. Nicht weil sie die Lehrerin nicht gehört hatte. Sie wusste genau, wozu sie aufgefordert war, und wollte sich auch gar nicht weigern, doch ihr Geist schaffte es einfach nicht, ihren Körper zum Gehorchen zu bringen. Aus dem Augenwinkel sah sie einen tanzenden Fleck – der Schmetterling, den sie ins Heft gezeichnet hatte, flatterte durch das Klassenzimmer. Ihr wurde mulmig zumute. Auch wenn sie spürte, dass das nicht geschehen würde, war sie besorgt, noch jemand könnte ihn sehen.
Nachdem er im Zickzack durch den Raum geflogen war, setzte er sich auf die Schulter der Lehrerin und hüpfte von dort auf einen der herabhängenden, wie kleine Kronleuchter geformten Silberohrringe, um gleich danach wieder abzuheben, zu Jason hinüberzukreiseln und auf den schmalen Schultern des Jungen zu landen. Als er unter das T-Shirt kroch, sah Ada die blauen Flecken auf Jasons Haut bildlich vor sich, die meisten alt und verblichen, einer aber ganz frisch, ziemlich groß und satt violett. Dieser Junge, der in der Schule ständig Witze riss und vor Selbstvertrauen strotzte, wurde daheim von seinem Vater verprügelt. Ada hielt vor Schreck die Luft an. So viel Schmerz überall und in jedem. Nur dass die einen ihn verbergen konnten, während die anderen das nicht mehr schafften.
»Ada?« Mrs Walcotts Stimme war eine Nuance lauter geworden.
»Vielleicht ist sie taub«, spöttelte einer der Schüler.
»Oder behindert.«
»Solche Ausdrücke will ich hier nicht hören!«, rief Mrs Walcott wenig überzeugend und richtete den Blick wieder auf Ada. Im breiten Gesicht der Lehrerin spiegelten sich abwechselnd Hilflosigkeit und Besorgnis. »Stimmt etwas nicht?«
Ada stand wie angewurzelt da und schwieg.
»Wenn du mir etwas sagen möchtest, kannst du das nach der Stunde tun. Lass uns später reden.«
Auch jetzt fügte sich Ada nicht. Ihre Glieder schienen einen eigenen Willen zu haben und verweigerten den Gehorsam. Ihr Vater hatte ihr einmal erzählt, dass manche Vögel, die Schwarzkopfmeise zum Beispiel, bei sehr niedrigen Temperaturen in eine kurze Starre verfielen, um ihre Energie für noch schlimmeres Wetter aufzusparen. Genau so fühlte sie sich – wie in Reglosigkeit gefangen, um sich gegen etwas zu wappnen, was ihr bevorstand.
Setz dich endlich hin, Idiotin, du bist ja oberpeinlich!
Hatte ihr das ein Mitschüler zugezischt oder eine gehässige Stimme in ihrem eigenen Kopf? Sie würde es nie erfahren. Mit aufeinandergepressten Lippen und zusammengebissenen Zähnen hielt sie sich krampfhaft an der Pultkante fest, so sehr fürchtete sie, das Gleichgewicht zu verlieren und zu stürzen. Bei jedem Atemzug wirbelte und wogte die Panik durch ihre Lunge, sickerte in jeden Nerv, jede Zelle, und kaum hatte sie den Mund endlich geöffnet, ergoss sich daraus wie ein unterirdischer Bach, der die Oberfläche durchbricht, ein Laut, den sie kannte und der ihr zugleich so fremd war, dass er nicht von ihr kommen konnte, und schwoll von innen her an – schrill, heiser, gellend, falsch.
Sie schrie.
Ihre Stimme platzte so unerwartet aus ihr heraus und war so ohrenbetäubend, dass alles im Raum sofort verstummte. Beide Hände an die Brust gepresst stand Mrs Walcott wie versteinert da, und die Falten um ihre Augen vertieften sich. Sie hatte so etwas in ihrer gesamten Zeit als Lehrerin niemals erlebt.
Vier Sekunden vergingen, acht, zehn, zwölf … Der Zeiger der Wanduhr rückte enervierend langsam weiter. Die Zeit dehnte und verzog sich wie trockenes, brennendes Holz.
Dann stand Mrs Walcott plötzlich neben ihr und redete auf sie ein. Ada spürte die Finger ihrer Lehrerin am Arm und wusste, dass die Frau etwas sagte, doch sie verstand nichts, denn sie schrie weiter. Fünfzehn Sekunden vergingen. Achtzehn, zwanzig, dreiundzwanzig …
Ihre Stimme war jetzt ein fliegender Teppich, der sie in die Luft hob und gegen ihren Willen davontrug. Sie glaubte zu schweben und alles von einer Lampe an der Decke aus zu betrachten, und gleichzeitig sah sie alles von außen. Als würde sie aus sich selbst herausfallen, weder der Gegenwart noch dieser Welt angehören.
Sie dachte an eine Predigt, die sie einmal gehört hatte. Es konnte in einer Kirche gewesen sein, aber auch in einer Moschee, denn als Kind hatte sie für kurze Zeit beides besucht. Wenn die Seele den Körper verlassen hat, steigt sie zum Firmament auf und hält auf dem Weg dorthin inne, um alles, was unter ihr liegt, ungerührt, unbewegt und unversehrt zu betrachten. Waren das Bischof Vasilios’ Worte gewesen oder die von Imam Mahmoud? Ikonen aus Silber, Bienenwachskerzen, Gemälde mit den Gesichtern von Heiligen und Aposteln, der Erzengel Gabriel mit einem aufgestellten und einem eingeklappten Flügel, ein abgenutztes Exemplar der orthodoxen Bibel mit zerlesenen Seiten und eingerissenem Rücken, seidene Gebetsteppiche, Gebetsketten aus Bernstein, eine Ausgabe der Hadithen, ein abgegriffener Band des Buchs Islamische Traumdeutung, nach jedem Traum und jedem Albtraum zu Rate gezogen … Beide Männer hatten versucht, Ada auf jeweils ihre Seite zu ziehen. In Ada wuchs das Gefühl, sich am Ende für die Leere entschieden zu haben. Für das Nichts. Für eine hauchzarte Schale, die sie umschloss und von anderen trennte. Doch während sie in der letzten Unterrichtsstunde des letzten Schultags schrie und schrie, empfand sie etwas fast Transzendentales. Sie fühlte sich, als wäre sie nicht mehr in den Grenzen ihres Körpers gefangen, als wäre sie es nie gewesen.
Dreißig Sekunden vergingen. Eine Ewigkeit.
Ihre Stimme wurde brüchig, doch sie hielt stand. Es hatte etwas zutiefst Demütigendes, aber auch Elektrisierendes, sich selbst schreien zu hören – sich loszureißen, auszubrechen, unkontrolliert, ungehindert, ohne zu wissen, wie weit diese aus ihrem Inneren aufsteigende Kraft tragen würde. Es war animalisch. Wild. Nichts von ihr hatte in diesem Moment etwas mit der Ada von früher zu tun. Am allerwenigsten ihre Stimme. Man hätte darin das hohe Gickern des Habichts, das schaurige Heulen des Wolfs, das heisere mitternächtliche Gebell des Rotfuchses hören können, aber nicht den Schrei einer sechzehnjährigen Schülerin.
Fassungslos, mit weit aufgerissenen Augen starrten die anderen sie an, gebannt von diesem Ausbruch des Wahnsinns. Einige hatten den Kopf zur Seite geneigt, als ließe sich dadurch besser begreifen, wie ein so verstörender Schrei aus dem Mund eines so schüchternen Mädchens kommen konnte. Ada spürte die Angst der anderen und genoss es, einmal nicht die zu sein, die sich fürchtete. Sie drängten sich am verschwommenen Rand ihres Blickfelds, ununterscheidbare ratlose Mienen und hilflose Gesten, eine Papiermenschenkette, zu der sie nicht gehörte. Sie gehörte zu nichts und niemandem. Ihre ungebrochene Einsamkeit machte sie vollständig. Sie hatte sich noch nie so ungeschützt und gleichzeitig so mächtig gefühlt.
Vierzig Sekunden vergingen.
Ada Kazantzakis schrie weiter, und dieses Gefühl – war es Wut? – schraubte sich wie durch einen Treibstoff beschleunigt immer höher, ohne je nachzulassen. Rote Flecken überzogen ihre Haut, ihre Kehle war heiser und schmerzte, die Halsvenen pulsierten mit dem pochenden Blut. Sie hielt die Hände, die jetzt nichts mehr umgriffen, weiterhin verkrampft vor sich. Kurz tauchte das Bild ihrer Mutter auf, und zum ersten Mal seit deren Tod kamen ihr beim Gedanken an sie nicht die Tränen.
Der Gong ertönte.
In den Gängen draußen vor dem Klassenzimmer waren hastige Schritte, lebhaftes Stimmengewirr zu hören. Freudige Anspannung. Gelächter. Ein kleines Gerangel. Die Weihnachtsferien hatten begonnen.
Im Klassenzimmer bot Adas irres Geschrei ein so faszinierendes Schauspiel, dass sich keiner vom Fleck bewegte.
Als zweiundfünfzig Sekunden vergangen waren, versagte Ada die Stimme. Ihre Kehle fühlte sich trocken und hohl wie ein verdorrtes Schilfrohr an. Ihre Schultern sackten nach unten, ihre Knie zitterten, und in das Gesicht kam wieder Bewegung, als hätte man sie aus dem Schlaf gerissen. Sie verstummte. So plötzlich, wie sie begonnen hatte, hörte sie auf.
»Scheiße, was war das?«, murmelte Jason und bekam von niemandem eine Antwort.
Kraftlos und außer Atem ließ sich Ada auf ihren Stuhl fallen, ohne jemanden anzusehen; wie eine Marionette, deren Fäden mitten im Stück auf offener Bühne gerissen waren. Emma-Rose würde es später bis ins kleinste Detail beschreiben. Doch vorerst schwieg sogar sie.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte Mrs Walcott mit schreckverzerrtem Gesicht, und diesmal hörte Ada, was die Lehrerin sagte.
Während sich am fernen Himmel Wolken zusammenballten und ein Schatten wie von einem vorbeifliegenden Riesenvogel auf die Wände fiel, schloss Ada die Augen. In ihrem Kopf hallte ein Laut, ein schwerer, steter Rhythmus – knack, knack, knack –, und sie hatte nur den einen Gedanken, dass an einem Ort außerhalb dieses Raums, in unerreichbarer Ferne, genau in diesem Moment Knochen brachen.
DER FEIGENBAUM
»Wenn du vergraben bist, komme ich jeden Tag und rede mit dir«, sagte Kostas, während er den Spaten in den Boden trieb, sich auf den Stiel stemmte, einen Brocken Erde aushob und auf den wachsenden Haufen neben sich warf. »Du wirst bestimmt nicht einsam sein.«
Ich hätte ihm so gern erklärt, dass Einsamkeit eine Erfindung der Menschen ist. Bäume sind niemals einsam. Die Menschen glauben, sie wüssten genau, wo sie selbst enden und der andere beginnt. Bäume mit ihren verschlungenen und verflochtenen Wurzeln und ihrem engen Kontakt zu Pilzen und Bakterien hegen diese Illusion nicht. Für uns hängt alles mit allem zusammen.
Trotzdem freute mich Kostas’ Ankündigung, er werde mich oft besuchen, und ich streckte ihm dankbar die Äste entgegen. Er stand jetzt so nah, dass ich sein Parfüm roch – Sandelholz, Bergamotte, Ambra. Ich hatte mir jede Einzelheit seines schönen Gesichts eingeprägt – die hohe, glatte Stirn, die schmale, spitze, sehr markante Nase, die klaren Augen mit den wie Mondsicheln geschwungenen Wimpern, die einzelnen Wellen in seinem noch immer dichten, noch immer dunklen Haar, das nur an manchen Stellen silbrig glänzte und an den Schläfen grau zu werden begann.
Fast wie der außergewöhnliche Winter hatte sich in diesem Jahr die Liebe behutsam an mich herangeschlichen, sodass ich mich nicht mehr wehren konnte, als ich endlich spürte, was geschah. Ich hatte mich ebenso dumm wie sinnlos in einen Mann verguckt, der niemals innige Nähe zu mir suchen würde. Meine plötzliche Bedürftigkeit, die tiefe Sehnsucht nach etwas Unerreichbarem, war mir peinlich. Ich sagte mir zwar, dass das Leben kein Handelsabkommen ist, kein kalkuliertes Geben und Nehmen, und dass nicht jedes Gefühl im selben Maß erwidert wird. Doch gleichzeitig fragte ich mich, was passieren würde, wenn Kostas Kazantzakis eines Tages wider aller Wahrscheinlichkeit Zuneigung für mich empfände – wenn ein Mensch sich in einen Baum verliebte.
Ich weiß, was Sie jetzt denken. Wie um alles in der Welt kann ich, eine gewöhnliche Ficus carica, in einen Homo sapiens verliebt sein! Dass ich keine Schönheit bin, ist mir klar. Ich sehe bestenfalls unscheinbar aus, bin alles andere als eine japanische Kirsche mit ihrer sakura, der Pracht der gewinnenden, strahlenden rosa Blüten voller Glanz und lässigem Glamour. Auch mit dem Zuckerahorn kann ich mich nicht vergleichen, dessen Blätter in allen Nuancen von Rubinrot, Safrangelb und goldenem Orange erglühen und obendrein perfekt geformt sind – wahre Verführerinnen. Und am allerwenigsten bin ich eine Glyzinie, habe nichts von dieser herrlich gebauten lila Femme fatale. Mit dem berauschenden Duft und dem satt glänzenden Laub der immergrünen Gardenie kann ich ebenso wenig dienen wie mit dem violetten Prunk der Bougainvillea, die unter sengender Sonne an Lehmziegelmauern emporwächst und sich darüber ergießt. Und nichts an mir erinnert an den Taubenbaum, der viel Geduld abverlangt, bis er seine bezaubernden, romantischen Hochblätter endlich wie parfümierte Taschentücher im Wind flattern lässt.
Alle diese Reize gehen mir vollständig ab. Wer auf der Straße an mir vorbeieilt, wirft eher keinen zweiten Blick auf mich. Dennoch halte ich mich auf meine eigene, entwaffnende Art durchaus für attraktiv. Was mir an Schönheit und Beliebtheit fehlt, mache ich durch das Geheimnisvolle, das mich umgibt, und durch innere Stärke wett.
Ich habe im Lauf der Geschichte Scharen von Vögeln, Fledermäusen, Bienen, Schmetterlingen, Ameisen, Mäusen, Affen und Dinosauriern unter mein Laubdach gelockt und nicht zuletzt ein ziemlich verwirrtes Pärchen, das ziellos und mit abwesendem Blick den Garten Eden durchstreifte. Lassen Sie sich nicht täuschen – da war kein Apfel im Spiel! Höchste Zeit, diesen gravierenden Irrtum endlich geradezurücken. Adam und Eva verfielen der Anziehungskraft eines Feigenbaums, der Frucht der Versuchung, des Verlangens, der Leidenschaft, und nicht einem knackigen Apfel. Es liegt mir fern, eine Pflanzenkollegin herabzusetzen, aber welche Chance hat ein fader Apfel gegen eine sinnliche Feige, die bis heute, Jahrtausende nach dem Sündenfall, wie das verlorene Paradies schmeckt?
Bei allem Respekt für die Gläubigen: Es ist schlicht absurd anzunehmen, der erste Mann und die erste Frau wären zur Sünde verleitet worden, indem sie einen langweiligen Apfel verspeisten, hätten daraufhin nackt, frierend, schamerfüllt und trotz der Furcht, jeden Moment von Gott erwischt zu werden, einen langen Spaziergang durch den Zaubergarten unternommen und wären auf einen Feigenbaum gestoßen, mit dessen Blättern sie ihre Blöße bedeckten. Eine interessante Geschichte, an der aber etwas nicht stimmt – meine Rolle! Denn es ging von Anfang an um mich, den Baum des Guten und des Bösen, des Lichts und der Dunkelheit, des Lebens und des Todes, der Liebe und des Liebeskummers.
Adam und Eva teilten sich eine zarte, reife, verführerische, herrlich duftende Feige, brachen sie in der Mitte auf und sahen, während die verschwenderisch fleischige Süße auf ihren Zungen zerging, ihre Umgebung plötzlich in einem ganz neuen Licht. Denn genau das geschieht, wenn man an Wissen und Klugheit gewinnt. Und dann bedeckten sie sich mit den Blättern des Baums, unter dem sie standen. Der Apfel kommt, so leid es mir tut, nicht vor.
Ganz egal welche Religion, welches Glaubensbekenntnis – ich finde mich in jeder Schöpfungsgeschichte, bezeuge das Verhalten der Menschen und ihre endlosen Kriege, und habe meine DNA so vielfältig kombiniert, dass ich heute auf beinahe jedem Erdteil zu finden bin. Die Zahl meiner Bewunderer und Verehrer ist riesig. Schon mancher wurde so verrückt nach mir, dass er alles andere vergaß und bis zum Ende seines kurzen Lebens bei mir blieb – meine kleinen Feigenwespen zum Beispiel.
Natürlich weiß ich, dass all das mich nicht dazu berechtigt, einen Menschen zu lieben und auf Gegenliebe zu hoffen, und ich räume die Unvernunft dieser Haltung jederzeit ein. Nein, es ist nicht vernünftig, sich in jemanden zu verlieben, der nicht der eigenen Art angehört, der das Leben nur komplizierter machen, die Gewohnheiten durcheinanderbringen und die innere Stabilität und Verwurzelung erschüttern wird. Andererseits hat man wahrscheinlich nie geliebt, wenn man von der Liebe Vernunft erwartet.
»Du wirst es schön warm haben unter der Erde, vertrau mir, Ficus«, sagte Kostas.
Die vielen Jahre in London hatten nichts daran geändert, dass er ein Englisch mit starkem griechischem Akzent sprach. Sein raues »R«, sein zischendes »H«, das verwaschene »Sch« und die gestutzten Vokale waren vertraut und beruhigten mich. Wenn er sich aufregte, purzelten die Laute nur so aus seinem Mund; wenn er nachdenklich oder unsicher war, kamen sie stockend. Ganz gleich, ob sie plätscherte oder brauste – ich kannte jede Nuance seiner Stimme, wenn sie wie klares Wasser um mich floss.
»Außerdem ist es nur für ein paar Wochen.«
Ich war es gewohnt, dass er mit mir sprach, aber an diesem Tag sagte er mehr als sonst, und ich überlegte, ob er wegen des Wintersturms ein schlechtes Gewissen hatte. Immerhin hatte er mich in einem schwarzen Lederkoffer von Zypern in dieses sonnenlose Land gebracht, mich, um ehrlich zu sein, nach Europa geschmuggelt.
Als Kostas den Koffer in Heathrow am Blick eines stämmigen Zollbeamten vorbeizog, war ich schrecklich angespannt, denn ich befürchtete, dass man ihn jeden Augenblick anhalten und durchsuchen würde. Defne, seine Frau, ging mit forschen Schritten vor uns, zielstrebig und ungeduldig wie immer. Sie war schwanger mit Ada, doch das wussten sie damals noch nicht. Sie dachten, sie brächten nur mich nach England, dabei hatten sie auch das ungeborene Kind dabei.
Als sich die Türen für die ankommenden Passagiere öffneten, rief Kostas mit hemmungsloser Begeisterung: »Wir haben es geschafft – wir sind da! Willkommen in deiner neuen Heimat!«
Galt das seiner Frau oder mir? Ich hoffe, dass ich die Angesprochene war. Wie es auch gewesen sein mag, das Ganze liegt mehr als sechzehn Jahre zurück. Ich war seitdem nie wieder auf Zypern.
Doch ich trage die Insel noch immer in mir. Der Ort unserer Geburt ist der Umriss unseres Lebens, auch wenn wir nicht mehr dort sind – gerade dann! In manchem Traum stehe ich wieder unter der vertrauten Sonne in Nikosia. Mein Schatten fällt auf die Felsen und greift nach dem dornigen Ginster, der von Blüten überquillt, jede einzelne so schön und glänzend wie die Goldmünzen in einem Kindermärchen.
Ich weiß noch alles von der Vergangenheit, die wir hinter uns ließen: Küstenlinien, in den sandigen Grund gefräst wie Falten in eine Handfläche, die darauf wartet, gelesen zu werden, der Chor der Zikaden in der steigenden Hitze, summende Bienen über Lavendelfeldern, Schmetterlinge, die bei der ersten Verheißung von Licht die Flügel ausbreiten. Viele versuchen es, doch an Optimismus übertrifft keiner die Schmetterlinge.
Die Menschen halten Optimismus und Pessimismus für eine Frage der Persönlichkeit, aber ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt ist die Unfähigkeit zu vergessen. Je besser das Gedächtnis, umso kleiner die Wahrscheinlichkeit, optimistisch zu sein. Womit ich nicht behaupten will, dass Schmetterlinge keine Erinnerung hätten. Ganz im Gegenteil. Jeder Falter weiß, was er als Raupe gelernt hat. Doch ich und meinesgleichen, wir sind mit einem ewigen Gedächtnis geschlagen – und ich spreche nicht von Jahren oder Jahrzehnten, ich spreche von Jahrhunderten.
Ein Gedächtnis, das ewig zurückreicht, ist ein Fluch. Wenn auf Zypern alte Frauen jemandem Böses wünschen, bitten sie nicht offen um etwas Schlimmes, das ihm zustoßen soll. Sie beten nicht dafür, dass ihn der Blitz trifft, ein Unfall ereilt, ein plötzlicher Schicksalsschlag aus der Bahn wirft. Sie sagen nur: »Mögest du niemals vergessen können. Mögest du dich noch im Grab an alles erinnern.«
Deshalb glaube ich, dass mich die Melancholie nie ganz verlässt, weil sie mir in den Genen liegt. Sie ist mit einem unsichtbaren Messer in meine Baumhaut geritzt.
»So, das dürfte genügen«, sagte Kostas, begutachtete die Aushebung und wirkte zufrieden mit ihrer Länge und Tiefe.
Er streckte seinen schmerzenden Rücken und wischte sich mit einem Taschentuch die Hände ab.
»Ich muss dich ein bisschen stutzen, dann geht es besser.«
Er nahm eine Baumschere und kürzte mit routinierten, geschickten Bewegungen meine eigensinnigen Seitenzweige. Dann band er mit einem Nylonseil die dickeren Äste ringsum zusammen, zog es behutsam straff und machte einen Doppelknoten. Das Seil umfing mich locker genug, um keinen Schaden anzurichten, aber so fest, dass ich in der Grube Platz fand.
»Gleich ist es geschafft. Jetzt muss ich mich beeilen. Bald geht der Sturm los.«
Ich kannte ihn allerdings gut genug, um zu spüren, dass ihn nicht der heraufziehende Sturm allein zur Eile drängte. Er wollte fertig sein, bevor seine Tochter aus der Schule zurückkam. Die kleine Ada sollte nicht noch ein Begräbnis erleben.