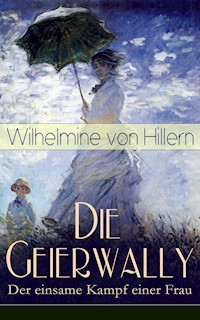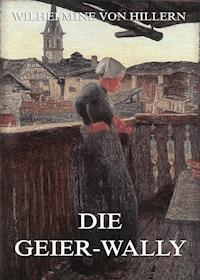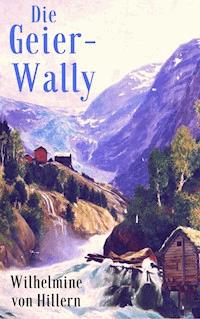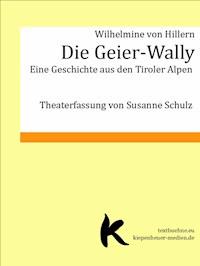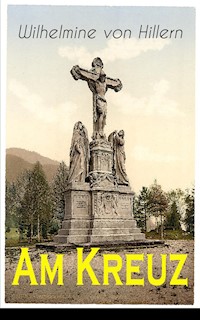
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Am Kreuz" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Wilhelmine von Hillern (1836-1916) war eine deutsche Schriftstellerin, deren erfolgreichstes Werk Die Geier-Wally bis heute vielfach verfilmt wurde. Aus dem Buch: "Im Garten zu Gethsemane war es, wo der wiederauferstandene Gottessohn sich als schlichter Gärtner der büßenden Sünderin zeigte. Das Wunder ist zur frommen Legende geworden – lange, zu lange ist es her, er ist dahin, kein Auge hat ihn je wieder gesehen. Selbst da der Auferstandene unter den Zeitgenossen wandelte, sahen ihn nur die, die ihn sehen wollten. Aber die, welche ihn sehen wollen – sehen ihn auch heute noch, und die ihn suchen wollen – finden ihn heute noch."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 869
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Am Kreuz
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Im Garten zu Gethsemane war es, wo der wiederauferstandene Gottessohn sich als schlichter Gärtner der büßenden Sünderin zeigte. Das Wunder ist zur frommen Legende geworden – lange, zu lange ist es her, er ist dahin, kein Auge hat ihn je wieder gesehen. Selbst da der Auferstandene unter den Zeitgenossen wandelte, sahen ihn nur die, die ihn sehen wollten.
Aber die, welche ihn sehen wollen – sehen ihn auch heute noch, und die ihn suchen wollen – finden ihn heute noch.
Der Garten von Gethsemane ist versunken und verschüttet, die heiße Sonne des Orients hat ihn vertrocknet. Alles ist dem Wechsel unterworfen. Die Erdrinde verändert sich, und wo einst der Oelbaum gegrünt und die Zeder ihr Laubdach über dem Haupt des Erlösers und der Büßerin gewölbt, da ist jetzt totes, verdorrtes Land.
Aber er ist wieder erblüht an einem anderen Ort in einem der kühlen, schattigen Täler deutscher Berge – Oberammergau, so heißt das moderne Gethsemane. Wie die Sonne ihren Kreislauf von Morgen gen Abend macht, so hat das Heil, das vom Morgenland kam, seinen Weg über die Erde genommen zum Abendland. Dort fließen noch in jugendkräftigen Völkern die lebendigen Ströme, die Glaubenssaat zu tränken, aus der sich das Wunder nährt, und die dürftige Bergtanne, die dem harten Gestein des Ettaler Gebirgs entsprossen, verwandelt sich zur Palme, der arme Bewohner des kleinen Bergdorfs zum Gott. Es ist ein Wechsel und dennoch das ewig Stetige in diesem Wechsel.
Auch die Welt und ihre Geschicke wandeln sich im Lauf der Jahrhunderte. Das erschütternde Ereignis, vor dem die Menschheit sich überwältigt niederwarf, wie einst die Wächter taten, als der Auferstandene sein Grab sprengte, es tritt zurück und verblaßt allmählich. Der Donner, mit dem der Vorhang des Tempels zerrissen, er verhallt grollend in nebelhafter Ferne, der Himmel hat sich hinter dem Aufgefahrenen geschlossen für immer, die Sterne gehen ihren alten Gang in ungestörter Gesetzlichkeit, die Offenbarungen schweigen. Und die Menschen reiben sich, wie aus einem Traum erwachend, die Augen und fangen an, darüber zu streiten, wie es gewesen, was Wahrheit und was Täuschung war. Jahrhunderte schleppt sich der Streit hindurch. Eine Tradition stößt die andere um, ein Bekenntnis verdrängt das andere. Mit dem Schwert in der Hand und der Posaune des Weltgerichts muß die Ecclesia militans das Dogma feststellen, die Glaubenseinheit erzwingen. Aber nicht lange währt der Friede unter der Herrschaft der Kirche. Die Reformation zerspaltet die Christenheit aufs neue, der Dreißigjährige Krieg, der furchtbarste Religionsstreit, den die Erde je gesehen, beginnt. Und in der Wut des Kampfes vergessen die Streitenden, um was sie streiten: in Strömen Blutes, in Wolken Rauches verbrannter Städte und Dörfer, unter Trümmern gestürzter Altäre verschwindet das heilige Wahrzeichen, um das der Kampf entbrannte, das Kreuz, und wo es erhöhet wird, da ist es nur noch ein Kriegszeichen, kein Symbol des Friedens mehr!
Ein einziger Fleck Erde ist es, wo, unberührt von der Welt Händeln, hinter dem schützenden Wall eines hohen unwirtlichen Berges der Gedanke des Christentums in seiner ganzen Einfalt und Reinheit sich erhalten: Oberammergau! Wie einst Gott den Weltbezwinger in der Krippe unter armen Hirten geboren werden ließ, so ist es, als habe er seine schützende Hand über diesen Fleck Erde gehalten, und sich das armselige Bergvolk aufgespart, das Wunder in ihm zu erneuern. Tief versteckt hinter dem steilen Ettaler Berg lag ein Kloster, in dem von alters her der schönen Künste eifrig gepflogen worden.
Da ging es einem der Mönche schwer zu Herzen, wie draußen in der Welt die Bilderstürmerei an der althergebrachten Form rüttle und im blinden Eifer selbst die religiöse Kunst, als »römisch«, verwerfe! Wie kein frommes Abbild mehr geduldet werde, so daß der Erlöser und seine Heiligen der Menschheit ganz aus den Augen kommen müßten! Und es ward ihm in seiner Trübsal eingegeben, daß mehr denn Wort und Bild ein frommes Schauspiel in lebendiger Aktion wirken könne. Also ward's beschlossen im Konvent, ein solches aufzuführen.
Das sinnige Volk der Umgegend, längst durch den bildenden Einfluß der gelehrten Mönche zum Schönen gewöhnt, war bald eingeschult zur Darstellung von Legenden und biblischen Dichtungen. Immer kühner wurden sie mit der wachsenden Uebung. Und endlich wagte es der fromme Eifer, ihn selbst auferstehen zu lassen, den Herrn der Welt, in eigener leibhaftiger Gestalt, um der irrenden Menschheit zu zeigen: »Seht her, so ist er gewesen und so wird er ewig sein!«
Und während in den Kirchen die Gemälde und Reliquien von den Wänden gerissen, die Kruzifixe zerstört werden, findet unter freiem Himmel auf dem Friedhof Oberammergaus – denn dies ist um seines Ernstes willen der rechte Ort für das heilige Werk – Anno 1634 das erste Passionsspiel statt. Dort ersteht es wieder in seiner reinen Schönheit, das geschändete, mit Blut und Brand besudelte Bild der Liebe! Lebend, atmend! Die jahrtausendealten Wundenmale brechen wieder auf, neu rinnt der Blutstropfen von der dornumwundenen Stirn, neu ertönt das: »Bleibet in meiner Liebe!« von den bleichen Lippen des Gotteslammes und was der Puritanismus vernichtet in der toten Form, das gebiert sich neu in der lebendigen!
Aber durch das Gewühl und Tosen der Schlachten, durch das Wutgeheul des Hasses, hört keiner die sanfte Stimme, da drüben im fernen Winkel hinter den Bergen.
Das Friedenswort verhallt, der Gekreuzigte verblutet still – ungesehen.
Jahre ziehen darüber hin, immer größer wird die Not, die Länder sind verwüstet, die Reihen der Streiter lichten sich mehr und mehr.
Die Kämpfer beginnen endlich zu erlahmen, der brausende Sturm legt sich und bleiches Entsetzen stiert den zur Besinnung Gekommenen entgegen: die Pest, die furchtbare ägyptische Sphinx, angelockt von dem Verwesungsduft des langen Krieges, schleicht über die Erde, und wen sie anblickt mit dem schwarzen Glutauge ihrer heißen Zone, der sinkt dahin, wie der verbrannte Grashalm, wenn der Samum über die Wüste weht.
Und Stille verbreitet sich ringsumher, Grabesstille, denn wo das Gespenst wandelt, da ist der Tod.
Und die Angst treibt die Feinde zusammen und läßt sie den Groll vergessen gegenüber dem gemeinsamen Feind, dem grauenhaften, nicht zu besiegenden. Und sie sehen sich um nach der rettenden Hand, und es fällt ihnen wieder ein, um was sie so lange gekämpft. Da, in der Todesruhe der verdorrten Felder, der ausgestorbenen Häuser, der entgötterten Kirchen und verödeten Lande, da hören sie es endlich, das Glöcklein hinter dem Ettaler Berg, das unablässig von zehn zu zehn Jahren die Christenheit zusammenruft zum heiligen Spiel, denn so haben es die Ammergauer gelobt, zur Abwendung der Seuche und des göttlichen Zorns. Und da steht er wieder, der ewig Geduldige, breitet seine Arme aus und ruft: »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid –!« Und sie kommen, sie werfen sich ihm zu Füßen, die Müden, Gehetzten, Schweiß- und Blutbedeckten und er tröstet und erquickt sie und sie erkennen ihn wieder und lernen wieder seines Opfers Sinn verstehen.
Und die, welche ihn so gesehen, neuerstanden, und solche Offenbarung empfangen, verkünden es den anderen, und sie strömen herbei von nah und fern, der kleine Friedhof Oberammergaus wird zu eng, er kann die Scharen nicht mehr in seinen Mauern fassen, das weite Feld wird zum heiligen Theater, um die Pilger aufzunehmen, die nach dem Antlitz des Erlösers schmachten.
Und seltsam ist es, alle die, welche am heiligen Spiele teilnahmen, sie sind wie gefeit, die Seuche schleicht an ihnen vorüber, Ammergau allein bleibt von der Pest verschont!
So wächst die fromme Saat fort, langsam, oftmals stockend, aber das wachsame Auge kann sie verfolgen in der Geschichte.
Der Friede kommt endlich wieder über die Erde. Reinere Lüfte wehen. Die ägyptische Hyäne hat sich gesättigt und die verödeten Gauen verlassen, neues Leben erblüht auf den Gräbern, und dies neue Leben weiß nichts mehr von den Schmerzen und Leiden des alten. Aus der Roheit und Verwüstung des langen Krieges sehnt sich die neue Generation heraus nach feineren Sitten, nach Kultur und Lebensgenuß. Aber wie immer nach solchen Epochen der Entbehrung und Trübsal, führt ein Extrem zum anderen. Das Bedürfnis nach feinerer Sitte und Kultur führt zur Hyperkultur, der Lebensgenuß artet aus zur Genußsucht und Ueppigkeit, die Anmut zur Koketterie, die Fröhlichkeit zur Frivolität. So bricht das sogenannte galante Zeitalter an. An die Stelle des Schwertes tritt die Fleuretteklinge, an Stelle des Lederkollers der Spitzenjabot, an Stelle des Pulverdampfes Wolken von Puder, den die ewig nickenden, winkenden Köpfe um sich streuen.
Auf den Gräbern der versunkenen, alten Generation tanzen maskenhafte Schäfer und Schäferinnen, ein neues Arkadien wird in äffischer Nachahmung geschaffen und mit äffischen Wesen bevölkert, die auf Zehenspitzen tänzeln und den Fuß mit hohen Absätzen unterlegen.
An Stelle der mittelalterlichen Darstellungen geopferter Märtyrer und abgezehrter Heiligen treten die nackten Götter und Amoretten eines Watteau und seiner Schule. An Stelle des Erhabenen tritt die Grazie. An Stelle der Sittengesetze treten die Gesetze der Konvenienz, und alles ist erlaubt, was nicht gegen diese verstößt. So bildet sich ein Geschlecht gedankenlosen Genusses, ein Geschlecht des Augenblicks, das eine moralische Pest in sich trägt, die im Gegensatz zum »schwarzen Tod« der »rosige Tod« genannt werden könnte, denn wen sie ergreift, dem haucht sie den rosigen Schimmer eines Fiebers auf die Wangen, das langsamer, aber ebenso sicher verzehrt.
Und durch dies geschminkte, tänzelnde, singende, springende Zeitalter, mit den klappernden Stöckelschuhen, den rauschenden Reifröcken, den lüsternen Blicken und wogenden Busen, schreitet wieder und wieder über die Bühne Ammergaus die keusche Schmerzensgestalt mit dem furchtbaren Ernst auf der bleichen Stirn, und wer sie sieht, dem entfällt der volle Becher des Genusses, und das Lachen erstirbt ihm auf der Lippe!
Und weiter schreitet die Geschichte und das Weltgericht! Der »rosige Tod« hat alle gesunden Säfte der Gesellschaft zersetzt und vergiftet und eine Auflösung herbeigeführt bis in das Herz der Menschheit hinein – Sittlichkeit, Glaube und Philosophie, alles was den Menschen zum Menschen macht, ist allmählich in dem gedankenlosen Treiben unbemerkt untergegangen. Der Flitterkram und die äffische Kultur reicht nicht mehr aus, die Bestie in der Menschennatur zu verhüllen, sie schüttelt sich, wirft ihn ab, und steht da in ihrer ganzen Nacktheit! Die moderne Sündflut, die französische Revolution, bricht herein! Das ist ein Morden und Würgen, ein Fieberwahnsinn, der nun in jeder Gestalt des Greuels über die Erde rast!
Abermals eine Wandlung, eine Umwälzung bis in die tiefsten Schlünde der Verworfenheit hinab!
Die Grazie weicht nun wieder der Brutalität, das Schöne dem Häßlichen, das Göttliche dem Cynismus. Die Altäre werden gestürzt, der Glaube wird abgeschworen, die Erde bebt unter dem Schutt zerstörter Traditionen.
Aber aus dem Gewühl der sich zerfleischenden Meute, aus dem Qualm und Brodem des Weltenbrandes, dort in dem deutschen Garten von Gethsemane, hebt sich wieder siegreich, wie der Phönix aus der Asche, der verleugnete, tausendmal verbrannte Gott empor, und die unentweihte Sonne Ammergaus webt die Siegesglorie um die erhabene Gestalt, die da schwebt hoch am Kreuze!
Es ist ein stiller Sieg, von dem die Rasenden nichts wissen, denn sie sehen nur den Feind, den sie vor sich haben, nicht den, der über ihnen kämpft. Dieser ist längst abgetan. Er ist abdekretiert und damit fertig! Das Volk in seiner Souveränität kann Götter einsetzen und absetzen, wie es ihm beliebt, und sind sie abgesetzt, so sind sie nicht mehr, so sind sie hinabgestürzt in den Orkus. Und da die Menschen nun einmal nicht ohne Gott sein können, so schaffen sie sich einen Abgott –!
Dröhnend erzittern die Lande vom Eisenschritt des Imperators, und ohne es zu wollen und zu wissen, wird er der Rächer des Gottes, an dessen Stelle er sich setzt! Denn wie der Dreißigjährige Krieg zu Ende ging unter der Geißel der Pest und das lustige Zeitalter unter der Geißel der Revolution, so geht auch die Revolution unter an der dritten Geißel, dem selbstgeschaffenen Gott!
Er, der eine Mann, mit den geschlossenen Lippen und der brütenden Stirn, er gebietet den entfesselten Elementen, er wird Herr der Anarchie und schreibt einer Welt Gesetze vor. Aber mit eisernem Finger ritzt er die Adern der Menschheit auf, um ihr sein Sklavenzeichen einzuprägen. Die Welt blutet aus tausend Wunden und jeder einzelnen brennt er den Namen »Napoleon« ein.
Da, – blaß wie der Mond am Himmel steht, wenn der volle Brand der Abendsonne am Horizont aufflammt, tritt dem Weltherrscher in seiner blutigen Pracht der fahle Schatten des Gegeißelten gegenüber, auch in einem Königsmantel, doch überströmt vom eigenen freiwillig vergossenen Blut und sie messen sich stumm Auge in Auge, – der Usurpator, aber, erbleicht!
Endlich stürzt Gott den Gegengott im Augenblick, da er sich ihm am ähnlichsten dünkt, hinab in tiefstes Elend und tiefste Schmach. Der Weltfeind ist bezwungen und der lange verhaltene Völkerhaß, befreit von dem unerträglichen Druck, sprüht hoch auf und wälzt noch über das einsame Büßergrab auf Sankt Helena seinen Gischt von Verwünschungen und Flüchen hin. Da breitet der Sieger in Oberammergau verzeihend die Arme aus und ruft auch ihm sein großes Gnadenwort zu: »Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein!« –
Eine Zeit des Friedens bricht nun an, das Jahrhundert des Gedankens! Nach den großen Anstrengungen der Befreiungskriege tritt im politischen Leben ein Stillstand ein und diesen benutzten die Völker, um nachzuholen, was sie während den Zeiten der Welthändel in der Kulturentwickelung versäumt. Eine Flut von Ideen überströmt die Welt. Der neuen langentbehrten Geistesarbeit froh, regen sich alle Fähigkeiten. Das ist ein Wettkampf und ein Ringen um den Preis auf jeglichem Gebiet! Im Gefühl der neuerwachenden Kraft wagt sich das junge Geschlecht von Aufgabe zu Aufgabe, und mit jeder wird es größer. Mit der wachsenden Produktion steigert sich auch das Assimilationsvermögen. Was Großes in anderen Jahrhunderten geschaffen, es wird hereingezogen in den eigenen nationalen Kreis, es ist, als wäre es jetzt erst entdeckt worden. Woran die erleuchteten Geister früherer Epochen sich vergeblich gemüht, verzehrt, verblutet hatten, jetzt geht es auf in vollen Halmen, und das Jahrhundert setzt den Verkannten Monumente und schmückt sie mit dem Erntekranz dessen, was sie unter Tränen gesäet.
Was Galvani, was Salomon de Caüs unverstanden und ungehört vorbereitet, als schnaubendes Dampfroß, als blitzender Bote, macht es jetzt den Triumphzug über die Erde, vom Gedanken getragen, und den Gedanken tragend!
Das Jahrhundert, das einen Schiller und Goethe reifte, versteht erst einen Shakespeare. Sophokles und Euripides steigen aus ihren tausendjährigen Gräbern, die Archäologie schaufelt die versunkene Welt Homers aus dem Schacht der Erde, ein Canova, ein Thorwaldsen, ein Cornelius, Kaulbach und wie sie alle heißen, die großen Meister der Renaissanceperiode unserer Zeit, sie nehmen die Meißel und Pinsel Phidias' und Michelangelos, Raphaels und Rubens' wieder auf, die so lange geruht. Was vor Jahrtausenden Aristoteles und vor einem Jahrhundert Winckelmann und Lessing gelehrt: die Kenntnis der Kunstgesetze, das Verständnis des Schönen, es ist kein totes Kapital mehr in den Händen der Fachgelehrtheit, es zirkuliert in den pulsierenden Adern lebenskräftiger Kulturentwickelung, es fordert das Höchste und leistet das Höchste!
Der Ring zwischen alter und neuer Kultur hat sich geschlossen, jede Kluft ist überbrückt. Es ist ein Wechselwirken alter und neuer Kräfte, eine Gemeinsamkeit der Arbeit aller Völker und aller Jahrhunderte, als gäbe es keine Trennung von Raum und Zeit mehr, als gäbe es nur noch eine einzige ewige Kunst, eine einzige ewige Wissenschaft. Die Materie ist unter die Füße der aufsteigenden Menschheit getreten, die Wissenschaft hat sie bewältigt, die Industrie sie nutzbar gemacht und die Kunst hat sie verklärt.
Aber auch dies Licht, das so plötzlich die Welt durchflammt, wirft seine Schatten. Der Fortschritt in Kunst und Wissenschaft reift das Urteil, das Urteil aber wird zur Kritik und die Kritik zur Negation. Der Dualismus, der durch die ganze Schöpfung geht, das schaffende und das zerstörende, das bejahende und das verneinende Prinzip, es kann auch jetzt, auch hier nicht ausbleiben, es muß auch hier den alten nie ausgefochtenen Kampf kämpfen. Gegenüber dem Glauben tritt die kritische Analyse, gegenüber dem Idealismus der Materialismus, gegenüber dem Optimismus der Pessimismus! Die Menschheit ist an der äußersten Grenze der Erkenntnis angekommen, aber das genügt ihr nicht in ihrem unaufhaltsamen Siegeslauf, sie will sie durchbrechen und den Gott ergründen, der sich dahinter verbirgt. Denn, dem alles zerlegenden Seziermesser, dem nichts widerstand, darf sich das Herz eines Gottes nicht entziehen! Aber die Grenze ist undurchdringlich. Und der eine Teil, satt der vergeblichen Mühe, zerrt die Aufwärtsstrebenden zurück: »Hinab zur Materie, der ihr entstammt, was sucht ihr noch? Die Wissenschaft hat das Höchste erreicht, sie hat das Protoplasma gefunden, aus dem alle Organismen hervorgegangen sind. Was ist nun der zeugende Gott? Ein physiologisch-chemischer Lebensprozeß in einer Zellsubstanz! Und zu diesem wollt ihr beten, für diesen wollt ihr leiden, ihr Toren?«
Ein anderer Teil wendet sich, angewidert, von dieser cynischen Ausbeutung wissenschaftlicher Ergebnisse ab und wirft sich der Schönheit in die Arme, in ihr das Göttliche suchend, ein dritter Teil aber harrt aus und kämpft zwischen Himmel und Erde, in der dunklen Ahnung, dem Ziele am nächsten zu sein! Es ist ein gewaltiges Ringen, als müsse die Welt zerspringen von dem Hochdruck nach Raum verlangender Kraft, unvereinbarer Gegensätze!
Da, mitten durch die Schwüle der Hörsäle, durch die Fülle der Gesichte in Kunst und Wissenschaft, tönt eine längst vergessene Stimme aus der Kinderzeit! Und die gespannten Blicke wenden sich plötzlich ab von den Lehrern und Seziertischen, ab von den glänzenden Erscheinungen der Kunst und Sinnenwelt, der Bretterbühne Oberammergaus, dem Passionsspiel, zu.
Da steht sie wieder, die unscheinbare Gestalt mit der Dornenkrone und dem wehmütig fragenden Blick. Und mit einem Schlage fliegen ihr die Herzen zu, und wie der ausgewanderte, reich gewordene Sohn, nachdem er alles genossen und besessen, sich immer wieder zurücksehnt nach der Armut der Heimat und dem verlassenen Vater reuig zu Füßen sinkt, so wirft sich die Menschheit mitten aus diesem Rausch des Erkennens und Genießens heraus, schluchzend nieder vor der blassen Pflanze des Nazarenertums und streckt sehnsüchtig die Arme nach dem rohen hölzernen Kreuz aus, an dem sie blüht!
Max Müller, der gewaltige Denker, sagt in seinen vergleichenden Religionsstudien: »Nie empfinden wir die Vorzüge unserer Heimat lebhafter, als wenn wir aus der Fremde zurückkehren, und dasselbe ist bei unserer Religion der Fall.« Das zeigt sich hier! Leugne es, wer kann! Es ist eine unbestreitbare Tatsache, daß gerade in einer Zeit, wo Kunst und Wissenschaft die höchsten Stufen der Entwickelung erreicht haben, das Oberammergauer Passionsspiel eine Würdigung findet wie nie zuvor, – daß gerade in diesem kritischen Zeitalter, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, die Menschen dem Passionsspiel zuströmen in immer wachsenden Scharen. Und nicht etwa die Ungebildeten und Unwissenden, nein, die Gebildeten: Künstler und Gelehrte, Staatsmänner und Monarchen. So, daß das arme Dorf nicht mehr Raum hat, die Gäste alle zu beherbergen, daß es erschütternd ist, zu sehen, wie sich die Völkerwoge brausend hereinwälzt am Vorabend des Spiels, erstickend, alles überflutend! Und wie sie dann am Morgen der Handlung stille wird, und buchtet in dem schmucklosen Raum, den sie das »Theater« nennen, wie sie sich gleichsam glättet, als schweige jeder Sturm im Innern und Aeußern unter dem Hauch der einfältigen, bald zweitausend Jahre alten Worte! Wie sie mit angehaltenem Atem der schlichten Handlung lauscht, sieben Stunden lang, ohne der Zeit zu achten, die weit über das Maß dessen geht, was unsere leicht ermüdeten Nerven zu ertragen gewohnt sind.
Was ist es denn, daß der Höchste wie der Niedrigste, der Reichste wie der Aermste, der Fürst wie der Tagelöhner ohne Murren auf Stroh schläft, wenn kein Bett mehr vorhanden? Daß sich der Verwöhnteste Hunger und Durst, der Zarteste Hitze und Kälte gefallen läßt, der Aengstlichste unerschrocken den beschwerlichen Wanderzug über den Ettaler Berg mitmacht? Wäre es nur die Neugier, eine Schar armer Schnitzer, Bauern und Holzfäller die alte, tausendmal abgeleierte Geschichte in einem schlechteren Deutsch, als wir es in der Schule gehört, unter freiem Himmel, unter Sonnenbrand und Regen, noch einmal herunterleiern zu hören, wie die Gegner des Passionsspiels sagen? Kämen dafür die Menschen der halben bewohnten Erde, alle zehn Jahre, von nah und fern, von Süden und Norden, von den Bergen und aus den Tälern, aus Palästen und Hütten, über Meere und Länder? – – – Sicher nicht! Was also ist es? Ein Wunder?
Wer das Passionsspiel sah, dem ist es offenbar, wer es aber nicht gesehen, dem ist es schwer zu erklären!
Die Gottheit bleibt unserem irdischen Sinn verborgen und unerreichbar, wie das verschleierte Bild zu Sais. Jeder Versuch, den Schleier gewaltsam zu lüften, rächt sich bitter.
Was gewinnen jene modernen Socinianer und Adoranten, die mit schlecht geheuchelter Pietät das Geheimnis ans Licht ziehen wollen und den Gott zum Menschen machen, um in der elenden Puppe sich selbst anzubeten? Und wenn sie ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstünden, sie würden immer nur sich selbst sehen und er würde ihnen zurufen: »Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir!«
Und wiederum, was gewinnen unsere Pantheisten, die sich den Menschen zum Gott machen, um in ihm das Unerreichbare zu umfangen? Sie werden später oder früher erkennen, daß sie die Wirkung für die Ursache nahmen und die Form für das Wesen! Ekel und Enttäuschung ist ihr Los, wie das Los aller, die nichts haben als – den Menschen!
Aber die, welchen das Sichtbare nur das Symbol des Unsichtbaren ist und sie lehrt, von der Wirkung auf die Ursache zu schließen, diese werden mit unausbleiblicher Folgerichtigkeit von der Form zum Wesen, von der Täuschung zur Wahrheit gelangen!
Das ist das Wunder des modernen Gethsemane, wovon dies Buch erzählen will.
Erstes Kapitel. Ein Phantom
Groß und ernst ragt der Kofel, das Wahrzeichen und schützende Felsenbollwerk Oberammergaus, mit seinem einsamen Kreuz in den Abendhimmel empor; wie eine drohend erhobene Hand, die einem andrängenden Feind das bannende Siegeszeichen entgegenhält.
Es ist Abend und weithin über das stille Tal fällt der dunkle Schatten des gewaltigen Schirmers. Im verglimmenden Abendschein erglänzt fahl das einfache Kreuz, das seit Jahrhunderten dort oben steht, oftmals erneut, aber immer in derselben Größe, daß es weithin gesehen wird von den Scharen, die aus der Tiefe heraufpilgern, sehnsüchtig ausschauend nach dem Endziel der beschwerlichen Fahrt über die steilen und unwirtlichen Gebirge.
Es ist Freitag. Eine lange Wagenreihe wälzt sich wie eine große Schlange den Ettaler Berg herauf. Zwei hochelegante Landauer zeichnen sich von dem Troß besonders aus. Der vordere mit vier Pferden bespannt, und diese prachtvoll aufgeschirrt, eine geschlossene Krone auf dem Riemenzeug, übermütig tänzelnd in dem langsamen Zug, als wäre der Aufstieg über den Ettaler Berg für Tiere dieser Rasse ein Spaß. Im ersten Wagen, der aufgeschlagen ist, lehnt ein Herr und eine Dame, stumm, blasiert, teilnahmlos gegen die Umgebung und anscheinend auch gegeneinander; im zweiten sitzt eine Kammerfrau, ein Kammerdiener und hoch oben auf dem Bock der Reisemarschall mit der vornehmen Amtsmiene, die der Welt verkündet, daß es ein großes Haus sei, dem er die Ehre habe zu dienen, und diesem überall die teuersten Preise zu sichern! Die Gebieterin dieses stolzen Gefolges ist trotz ihrer gesenkten Wimpern und ihrer fast leblosen Miene von so eigenartiger Schönheit, daß sie auch aus dem Gewirr von Schleiern und Shawls heraus auffallen muß. Dunkelblondes, seidenweiches Haar umspinnt wie ein duftiges Gewebe ihre Stirn und breitet einen warmen Schimmer über ein Gesicht, bleich wie eine Teerose, durchgeistigt und doch von wunderbarer Weichheit und Sinnlichkeit der Formen. Und als wolle die Sonne neugierig die niedergeschlagenen Wimpern durchdringen, um die Augen zu grüßen, die dahinter verborgen, so flammt sie noch einmal aus dem zerrissenen Abendgewölk auf und wirft mit ihren Strahlen goldene fliegende Brücken von Berg zu Berg. Und jetzt hebt sich auch die geschlossene Wimper, den Strahlengruß zu erwidern und ein dunkelschimmerndes Auge von rätselhafter Farbe, die in jeder Sekunde wechselt, blickt empor und folgt, unwillkürlich angezogen, den zitternden Lichtern, die an der Felswand emporgleiten. Aber da winkt etwas aus einer halb verborgenen Höhle heraus und die Lichter verweilen einen Augenblick auf einem bleichen Gesicht: es ist ein Christus, von Holz geschnitzt, der mit der erhobenen Hand den Ankömmlingen den Willkomm bietet. Aber die, welche da ankommt, versteht seine Sprache nicht, der Gruß bleibt unerwidert.
Und weiter gleiten die Sonnenstrahlen, als wollten sie sagen: »Ist's dieser nicht, – so ist's vielleicht dieser, den du suchst?« Und jetzt – machen sie Halt! – Auf schroffer Höhe, ganz übergossen von einer Glorie von Licht, steht ein Wanderer, halb versteckt von grünem Gezweige, und blickt ruhig überlegen auf das bunte ängstliche Gewühl da unten herab. Den Hut hat er abgenommen und sich, von raschem Gehen erhitzt, die Stirn getrocknet. Lange schwarze Locken, in der Mitte gescheitelt, umwallen rechts und links ein majestätisch ernstes Gesicht mit schwarzem Bart und schwarzen, seltsam schwermütigen, weithin schauenden Augen. Das vom Wind verwehte Haar verfängt sich in einem Dornenzweig, der um die früh gefurchte Stirn schwankt. Rötlich erglänzen die scharfen Stacheln in dem grellen Abendschein, als wären sie gefärbt vom Blut des Hauptes, das traumversunken an ihrem Stamme lehnt. Die Pilgerin da unten durchzuckt es, sie richtet sich plötzlich auf, als sei sie aus einem Schlaf erwacht! Die wandernden Strahlen, die ihren Blick hinaufführten, – führen aber auch den Blick des einsamen Mannes da oben herunter – und auf der goldenen Brücke begegnen sich zwei leuchtende Augenpaare. Wie zwei Wanderer, die sich auf schmalem Stege nicht ausweichen können, so blicken sie sich an, so bleiben sie voreinander stehen. – Sie fassen sich, sie halten sich, – eines muß im andern vergehen – denn keines läßt das andere vorbei!
Da erlischt der Sonnenstrahl, die Brücke ist versunken und die Erscheinung im Waldesschatten entschwunden.
»Sahen Sie das?« fragt die Fremde ihren Begleiter, der ebenfalls an der Bergwand emporgeblickt hatte.
»Was soll ich gesehen haben?«
»Nun – den – den –« die Fremde unterbricht sich – sie weiß nicht, wie sie's bezeichnen soll, sie wollte sagen, »den Mann da oben«, das Wort ist ihr aber zu prosaisch, sie findet kein anderes und vollendet nur: »den da oben!« Der Begleiter blickt kopfschüttelnd gen Himmel.
» Den da oben? Ich glaube, Gräfin,« sagt er lächelnd, »die Luft Ammergaus fängt schon an, auf Sie zu wirken! Sie haben bereits, wie es scheint, religiöse Hallucinationen – oder sagen wir, um uns der Sprache dieses geheiligten Bodens zu bedienen, – himmlische Gesichte!«
Die Gräfin lehnt sich verstummt in ihre Ecke zurück, der alte harte Zug von vorhin verbreitet sich wieder um den eben noch so lieblich geöffneten Mund.
»Aber ich bitte Sie, was sahen Sie denn? So erzählen Sie mir es doch wenigstens, da ich nicht so glücklich bin, solcher Visionen gewürdigt zu werden,« spricht der Begleiter mit gutmütiger Ironie; »wie, oder war es zu erhaben, um einem so profanen Weltmenschen wie ich mitgeteilt zu werben?«
»Ja!« sagt sie kurz und legt die Hand über die Augen, als wolle sie den fahlen Dämmerschein von außen abschließen, um die Sichterscheinung desto heller im Innern zu sehen. Dann spricht sie kein Wort mehr.
Es wird allmählich dunkel, der keuchende Zug hat das Dorf erreicht. Jetzt wird Trab gefahren und der feierlichen Gelegenheit gemäß von den Kutschern ein gewaltiger Lärm gemacht. Furchtbar schwanken die Wagen in den ausgefahrenen Geleisen – Peitschengeknall, Rädergerassel, Geschrei entfliehender Kinder und Hühner, Hundegebell – und damit nichts fehle, um das verworrene Treiben zu vervollständigen, rast jetzt auch eine heulende Windsbraut darüber hin und jagt das zerrissene Abendgewölk zur Wetterwolke geballt vor sich her.
»Das fehlte nur – auch noch Regen!« murrt der Herr im Wagen, »soll ich schließen lassen?«
»Nein!« sagt die Gräfin und spannt den Schirm auf: »wer hätte das gedacht, vor zehn Minuten noch schien die Sonne!«
»Ja, in den Bergen geht das rasch – ich sah es übrigens kommen! – Während Sie Gott weiß was für einen biederen Holzfäller da oben als himmlische Erscheinung bewunderten, beobachtete ich das herannahende Gewitter.« Er zieht die herabgeglittenen Reisedecken über die Gräfin und sich herauf und streckt sich behaglich darunter aus: »Wie Gott will – ich halte still! Mit gefangen, mit gehangen! heißt es da – und wer ginge für Sie nicht durch Wasser und Feuer, Gräfin?« Er sucht die Hand der Dame, die er aber in dem Gewirr von Decken und Shawls nicht findet. Verstimmt beißt er sich die Lippen; er hatte erwartet, daß ihm die gesuchte Hand dankbar für so liebenswürdig bewährte Treue entgegen käme! Der Regen klatscht ihm in großen Tropfen in das Gesicht.
»Nicht einmal eine Hand für diese Höllenfahrt in das Bauernnest!« murrt er in sich hinein.
Die Wagen donnern an der hochgelegenen Kirche vorbei, die Blumen und Kreuze auf den Gräbern des stillen Friedhofs erzittern von der Erschütterung des Bodens. Im Pfarrhof ist bereits Licht angezündet, der Geistliche tritt ans Fenster und blickt ruhig auf das längst gewohnte Schauspiel: »Die armen Reisenden bei dem Wetter!«
Ein Wagen um den andern biegt da und dort in eine Straße ab, oder hält vor einem Hause.
Nur die Gräfin und ihre Begleiter sind noch immer nicht am Ziel. Indessen ist es völlig Nacht geworden. Es muß gehalten werden, um den Wagen zu schließen und die Laternen anzuzünden, denn Regen und Dunkelheit sind zu dicht, die Reisenden sind völlig durchnäßt. Ein eisiger Wind, wie er im Gebirge bei Gewittern nicht ausbleibt, zerpeitscht ihnen das Gesicht, daß sie kaum die Augen öffnen können. Der Diener ist in der Finsternis ungeschickt, das Dach aufzuschlagen, alles Handgepäck fällt übereinander und den Insassen auf den Kopf, – der Kutscher kann die Pferde kaum mehr zum Stehen bringen, sie scheuen in dem Gewimmel nach Wohnung herumirrender Leute. Er ist des Ortes unkundig und, mühsam das stampfende Viergespann in Ordnung erhaltend, fragt er in abgebrochenen Worten vom Bock herab nach dem Wege und vernimmt mit halbem Ohr in dem Getöse undeutliche Antworten. – Indessen ist das Gefolge herangekommen. Die Gräfin befiehlt dem Reise-Marschall, mit dem zweiten Wagen vorzufahren und einstweilen in dem bezeichneten Hause Quartier zu machen. Der Reise-Marschall vermißt sich, den Weg in dem kleinen Ort leicht zu finden und fährt voraus. Die Gräfin unterdrückt kaum mehr ihren Unmut.
»Eine abscheuliche Fahrt – die erhitzten Pferde den Berg herauf und jetzt dieses Wetter. – Nicht einmal die Laternen wollen brennen, der Wind löscht sie immer wieder aus! Sie hatten recht, Prinz, wir hätten einen Miet–« Sie vollendet das Wort nicht – denn das Licht der mühsam entzündeten Wagenlaternen fällt auf eine rasch vorüberschreitende Gestalt, die in der unsicheren Beleuchtung fast übernatürlich groß erscheint. Langes schwarzes Haar wallt durchnäßt im Winde unter dem breitkrempigen Hut hervor. Der Wanderer ist ohne Schirm offenbar auch vom Regen überrascht worden und eilt heim, – aber nicht ängstlich, hastig wie einer, dem es auf ein paar Tropfen Regen mehr oder weniger ankommt, sondern nur wie einer, der von niemand angesprochen sein will. – Die Gräfin kann das Gesicht nicht sehen, denn er ist schon vorüber, aber sie sieht noch die Umrisse der schlanken gebieterischen Gestalt in der dunkeln Kleidung, sie bemerkt mit raschem Blick den auffallend elastischen edeln Gang und ein unwillkürliches: »Da ist er wieder!« entschlüpft laut ihren Lippen. Einem plötzlichen Impuls folgend, ruft sie dem Diener zu: »Fragen Sie doch schnell den Herrn dort, wo das Haus des Andreas Groß ist, in das wir sollen.«
Der Diener folgt auf ein paar Schritte der enteilenden Gestalt und ruft: »Sie –!« Der Wanderer stutzt einen Augenblick, wendet halb das Haupt, dann aber, als könne er mit dem »Sie –!« nicht gemeint sein, geht er stolz, ohne sich ein zweites Mal umzusehen, weiter. Der Diener bleibt schüchtern zurück. Die Gräfin überkommt ein beschämendes Gefühl, als habe sie die Bevüe gemacht, irgend eine hochgestellte Person inkognito, durch ihren Bedienten anreden zu lassen.
»Der Herr wollte nicht hören,« entschuldigt sich dieser, verlegen zurückkommend.
»Es ist gut,« sagt die Gräfin, froh, daß die Dunkelheit ihr Erröten verbirgt. Ein Blitz zuckt herab und ein jäher Donnerschlag erschreckt die Pferde, der Kutscher mahnt.
»Fort!« ruft die Gräfin, der Lakai springt auf den Bock, man fährt weiter – ein paar Schritte, da taucht die dunkle Gestalt noch einmal neben dem Wagen auf, ruhig dahinschreitend unter dem Donner und Blitz, nur leicht den Kopf nach dem rasselnden Vierspänner umwendend.
Man saust vorbei, – die Gräfin lehnt sich still in die Polster zurück und zeigt nun kein Verlangen mehr, hinauszublicken.
»Sagen Sie mir, Gräfin Madeleine,« fragt der vorhin mit »Prinz« Angeredete plötzlich, »was haben Sie heute?«
Die Gräfin lacht. »Mein Gott, wie ernst Sie das fragen! Was soll ich denn haben?«
»Ich werde nicht klug aus Ihnen,« fährt der Prinz fort, »Sie sind kalt gegen mich und begeistern sich für irgend ein Phantasiegebild, welches Ihnen bereits den ehrenvollen Ausruf: ›Da ist er wieder‹ entlockt! Ich kann nicht umhin, darüber nachzudenken, welch unsicherer Besitz die Gunst einer Frau mit so leicht entzündlicher Phantasie ist!«
»Das ist reizend,« versucht die Gräfin zu scherzen: »Mein Prinz eifersüchtig – auf ein Phantom?!«
»Das ist es eben, wenn ein Phantom schon solche Schwankungen in der Temperatur Ihres Herzens gegen mich hervorbringen kann – wie muß es da um meine Hoffnungen stehen?«
»Bester Prinz, Sie wissen, daß ich diese Frage, welche Ew. Hoheit mir öfters zu stellen geruhen, noch nie beantworten konnte, ob mit oder ohne Phantom!«
»Ich glaube, Gräfin, ein solches ist es immer, was sich zwischen uns stellt! Sie jagen irgend einem unbekannten Ideal nach, das Sie in mir, dem Realisten, nicht finden, der Ihnen nichts zu bieten hat, als prosaische Güter – wie seine Hand, sein Fürstentum und eine Neigung, für welche ihm leider die poetischen Phrasen fehlen.«
»Sie übertreiben, Prinz, und werden bitter. Il y a un brin de vérité – ich bin immer ehrlich! – Sie sind mir, Sie wissen es, von allen meinen Bewerbern der liebste! Aber es ist richtig, daß ein Unbekannter Ihnen den Rang streitig macht! Das ist nichts anderes als ein Mensch – wie ich ihn mir denke – einen solchen gibt es aber nicht, und darum haben Sie auch nichts zu fürchten.«
»Aber, Gräfin, was für ein Ideal verlangen Sie denn eigentlich, daß man es nicht sollte erreichen können?«
»Ach, ein so einfaches und dennoch, ihr konventionellen Naturen, ihr werdet es nie verstehen: Es ist die Einfalt des verlorenen Paradieses, in das ihr nie zurückkehren könnt! Ich bin eine Natur der Ideale – ich bin überschwenglich und bedarf der Ueberschwenglichkeit; Ihr aber nennt mich eine Phantastin, wo es mir heiliger Ernst ist! Ich verlange nach einem Menschen, der an meine Ideale glaubt, ich will keinen Mann, vor dem ich sie verbergen muß, um sie nicht belächelt zu sehen und mich so im Besten, was ich bin, nicht wahr geben darf. Der, den meine Seele sucht, der müßte zugleich ein Mann und ein Kind sein – ein Mann im Charakter und ein Kind im Gemüt! Aber – wo findet sich das in unseren modernen Kreisen? Wo ist da Weichheit ohne schwächliche Sentimentalität? Wo Schwärmerei ohne phantastische Verschwommenheit, wo Herzenseinfalt ohne Beschränktheit? Wer heutzutage männlichen Charakters und starken Geistes ist, der kann sich den Anforderungen, die Wissenschaft und Politik an den Mann stellen, nicht entziehen, und das beeinträchtigt das Gemütsleben, entwickelt vorherrschend das konkrete Denken, macht realistisch und kritisch. Aber von allen, die an diesem Fehler unserer Zeit leiden, sind Sie immer noch der Beste, mein Prinz!« setzt sie lächelnd hinzu.
»Das ist ein leidiger Trost!« sagt der Prinz vor sich hin, »es ist ein eigenes Ding, solch einen unsichtbaren Nebenbuhler zu haben! – Wer steht mir dafür, daß nicht einmal eine Persönlichkeit kommt, auf die das Signalement paßt?«
»Deshalb, mein Prinz,« sagt die Gräfin ernst, »habe ich Ihnen auch mein Jawort noch nicht gegeben!«
Der Prinz seufzt tief aus und erwidert nichts. Er schaut in das tosende Regenwetter hinaus. Nach einer Weile sagt er leise: »Wenn ich Sie nicht so liebte, Gräfin Madeleine!«
»So ließen Sie sich nicht so lange von mir hinhalten, nicht wahr?« fragt die Gräfin und reicht ihm, wie um Vergebung bittend, die Hand. – Diese eine, halb unbewußte Freundlichkeit entwaffnet den erbitterten Freund. Er biegt sich über die kleine schmale Hand und zieht sie mit »Empressement« an die Lippen. »Sie muß doch mein werden!« sagt er sich zum Trost, wie alle Männer, deren Hoffnungen zweifelhaft sind, »ich werde wohl den Kampf mit einem Phantom aufnehmen können!«
Zweites Kapitel. Alt-Ammergau
Endlich nach einer langen Irrfahrt und häufigen Erkundigungen ist das Ziel erreicht. Der triefende, entsetzlich geschüttelte Wagen hält mit zwei Rädern in einem Graben, der von Regenwasser gefüllt den Weg bis zum Hause überschwemmt. – Der Reisemarschall und die Dienerin scheinen den Weg auch verfehlt zu haben, denn der zweite Wagen ist noch nicht da. Aus der niederen Haustür eilen dienstbeflissen Leute heraus, unsicher flackernde, dünne Kerzen mit der Hand schützend. Die Gräfin erschrickt – was für Gesichter! Ein alter Mann mit einer entsetzlich konfiszierten Physiognomie, langem grauem Haar und einem spitzen Judenbart, scharfgeschnittener gebogener Nase und lebhaft blitzenden Augen. Desgleichen zwei ältliche Frauengestalten, eine kleine rundliche mit etwas vorstehenden Augen und schwarzem krausem Haar und eine große hagere, ebenfalls unheimlich aussehende Person mit wirrem kohlschwarzem Haar, starkgebogener Nase und glitzernden schwarzen Augen.
In dem unheimlichen Schatten, welchen die wehenden Lichter noch auf die scharf markierten Gesichter warfen, sieht die ganze Gesellschaft allerdings zum Erschrecken einer Zigeunerbande ähnlich!
»Mein Gott, so sehen die Ammergauer aus!« flüstert die Gräfin enttäuscht.
»Sind wir hier recht bei dem Schnitzer Groß?« fragt der Prinz.
»Zu dienen,« ist die Antwort: »Bildhauer Groß! Haben Sie bei uns bestellt?«
»Man hat von Tegernsee aus um Wohnung an Sie geschrieben. Reichsgräfin von Wildenau, Erlaucht!« erklärt der Prinz.
»Ach ja – jawohl! Alles in Ordnung! Die Herrschaften logieren bei uns, für Wagen und Dienerschaft besorgte ich Unterkommen in der alten Post. Hab' die Ehr', einen recht guten Abend zu wünschen!« sagt der Alte wie zum Hohn auf die Schrecken dieser Fahrt. »Es tut mir nur leid, daß Sie so schlechtes Wetter getroffen haben. Wir haben aber auch heuer alleweil Regen!«
Der Prinz steigt aus – das Wasser spritzt hoch an ihm hinauf.
»O Sephi, hol doch schnell ein Brett, die Frau Gräfin können ja nicht aussteigen!« ruft der Alte mit lebhaftem Schmerz über die der Frau Gräfin bevorstehenden Leiden. Sephi, das lange hagere der beiden weiblichen Individuen, schleppt flink ein Brett aus dem Garten herbei, während ein einäugiger Hund, hierüber aufgebracht, ein wütendes Gebell anschlägt.
Das Brett wird angelegt, geht aber sogleich unter in der Flut und die Gräfin muß wohl oder übel durch das Wasser waten. Beim Aussteigen hat sie ein Gefühl, als stieße sie mit der Stirn an die Kante des weit überhängenden Hausdaches – so nieder ist die Baracke. Uralte, nachgedunkelte Freskomalereien dehnen und recken sich fratzenhaft in dem unruhigen Schein der Lichter. Der Gräfin wird es immer unheimlicher.
»Soll ich Sie hinübertragen?« fragt der Prinz.
» Je vous en prie!« sagt sie abweisend und strafend, während ihr kleiner Fuß in der Lache Grund sucht. Eiskalt läuft ihr das Wasser in die feinen Stiefel bis zum Knöchel. Sie war so voll Erwartung und in so poetischer Stimmung und jetzt schlägt ihr die nackte Wirklichkeit mit schmutziger kalter Faust ins Gesicht! Ein Schauer von Frost überrieselt sie, während sie schweigend durch das Wasser schreitet.
»Treten Sie nur hier ein, Ihre Zimmer sind gerichtet!« sagt der Alte tröstend. »Zimmer!« das nennen die Ammergauer Zimmer!
Sie treten an einer, von Miriaden Fliegen geschwärzten, Küche vorbei in einen Raum, der sonst die Schnitzerwerkstatt, jetzt als drawing-room benutzt wird. Auf einem alten zerrissenen Sofa schlafen zwei Kinder, in den Ecken liegen für die Nacht gerüstete Strohsäcke, denn die Leute vom Haus finden es selbstverständlich, daß sie in der Passionszeit keine Betten haben. Eine rauchende Petroleumlampe hängt von der dunkeln verwitterten Holzdecke herab und verbreitet mehr Qualm als Sicht. Das »Zimmer« ist so nieder, daß die Gräfin kaum glaubt aufrecht stehen zu können und zum Ueberfluß hat sich die Decke auch noch gesenkt; das Gebälk, vom Alter nach abwärts gebogen, droht in der bangen qualmigen Atmosphäre jeden Augenblick herabzustürzen.
Ein erstickendes Gefühl befällt die Eintretende. Sie ist zum Tode erschöpft, durchfroren, nervös-unleidlich bis zu Tränen. Die weißen Zähne klirren ihr aneinander. Frost und Unbehagen schütteln sie. Der Hausherr öffnet eine niedere Tür zu einem Verschlage, in dem zwei Betten, ein Tisch, ein uralter dunkler Schrank und zwei Stühle stehen.
»So,« sagt er zufrieden, die Fremden so gut beherbergt zu wissen, »das ist Ihr Zimmer! Nun ruhen Sie sich aus und wenn Sie etwas wünschen, so rufen Sie nur, dann kommt gleich eine von meinen Töchtern und bedient Sie.«
»Ja, aber bester Mann, wo logiere denn ich?« fragt der Prinz.
»Ja so – gehören Sie nicht zusammen? Ja, dann müssen die Frau Gräfin eben mit einer anderen Dame zusammen schlafen und der Herr hier oben!«
Er zeigt nach einer kleinen Treppe in der Ecke, wo man nach der Sitte alter Bauernhäuser von einem Zimmer durch eine Falltür direkt in ein darüber gelegenes hinaufsteigt.
»Aber ich bitte Sie, da kann ich doch nicht wohnen, das würde ja die Dame inkommodieren,« sagt der Prinz. »Haben Sie denn weiter keine Zimmer?«
»Ja, gewiß, aber die sind für morgen bestellt!« sagt Andreas Groß, während die zwei Schwestern in Ehrfurcht erstarrt ratlos dabeistehen.
»So geben Sie mir die Zimmer und schicken Sie die anderen Leute fort.«
»O das geht nicht, lieber Herr. Sie hören doch, daß sie versprochen sind.«
»Mein Gott, ich zahle Ihnen das Doppelte, das Zehnfache –«
»Aber, lieber Herr, wenn Sie mir das Zwanzigfache bezahlten – ich könnte es nicht tun, ich darf doch mein Wort nicht brechen!« sagt der Alte mit sanfter Bestimmtheit.
»Aha,« denkt der Prinz, »der will mich schrauben – nun erst recht nicht! Gräfin, Sie gestatten, daß ich mich auf eine Viertelstunde verabschiede, um mir eine andere Wohnung zu suchen!«
» Je vous prie au nom de Dieu, cherchez aussi pour moi – il vaudrait mieux passer la nuit en voiture que de loger ici!« klagt die Gräfin.
» Oui, c'est affreux! Voyons, il ne sera pas difficile d'attraper quelque chose de plus convenable! Adieu!«
» Ne me laissez pas trop longtemps seule avec ces brigands. Retournez vite, cher ami, j'ai peur!«
» Vraiment –?« lächelt der Prinz und ein Strahl süßer Empfindung blitzt im Forteilen aus seinen Augen.
Indessen ist das kleine Mädchen, das auf dem Sofa schlief, wach geworden und auch herbeigekommen.
Die Gräfin bittet die Leute, sich zu entfernen, um endlich auszuruhen. Diese ziehen sich bescheiden zurück. Als sie aber die Tür schließen will, ist weder Schloß noch Riegel daran, nur ein Drahthäkchen, welches in ein lottriges Ringchen eingehängt wird.
»Ich bitte Sie,« sagt die Gräfin entsetzt, »da kann man ja nicht einmal schließen!«
»O Sie brauchen sich nicht zu fürchten,« tröstet der Alte, »wir schlafen ja neben Ihnen!« Das ist's aber eben, was die Gräfin fürchtet, neben diesen unheimlichen Gesichtern wohnen und nicht schließen können!
Sie hängt den jämmerlichen Draht ein und setzt sich auf eines der Betten, welche keine Matratzen, – nur Roste haben. Sie legt die Hand über das Gesicht und läßt ihren unmutigen Tränen freien Lauf. Sie sitzt immer noch in Hut und Mantel, die sie nicht abzulegen wagt, in dem dunkeln Gefühl, von Gefahren umringt zu sein und jeden Augenblick entfliehen zu müssen! In solcher Lage ist man doch sicherer, wenn man Hut und Mantel anhat. Schlimmsten Falls will sie die Nacht über so aufsitzen bleiben. Zu Bett zu gehen, wäre in einem Hause, wo die Decke einbrechen kann und solche verdächtige Gestalten herumschleichen, doch zu riskant! Neben dem Bett, auf dem die Gräfin sitzt, ist eine Tür, die sie in all diesen Schrecken nicht bemerkt hat. Aber jetzt ist ihr, als höre sie durch diese Tür ein Schaben, wie wenn Eisen durchgefeilt wird. Dann wieder dumpfe Schläge, ein eigentümliches Röcheln. Grauenhafte unerklärliche Töne. – Jetzt tut es einen Schlag wider die Tür, die kaum besser als die andere verriegelt ist – und noch einen.
»Hier ist die Hölle los!« jammert die Gräfin und springt auf. Ihre kalten, nassen Füße sind wie gelähmt, die Sinne drohen ihr zu schwinden. Und kein Mensch bei ihr in dieser trostlosen Lage. Wo bleibt das Gefolge? Vielleicht sind sie in die Irre gelockt, ermordet und ausgeraubt worden – und dazu tobt das Unwetter mit voller Wut fort.
Erneuter Versuch von außen, die Tür zu sprengen – ein paar schmetternde Stöße bringen sie schon zum Weichen. Die Gräfin hat wie im Traum die Werkstatt erreicht und ruft nun fast ohnmächtig die unheimlichen Gestalten da draußen – ein Schrecknis gegen das andere – zu Hilfe. Mit bleichen Lippen berichtet sie, daß eingebrochen wird – oder daß ein Wahnsinniger, oder einer, der verfolgt wird, herein wolle.
»O, das macht nichts,« sagte der Alte mit einem, wie es der Bedrängten erscheint, teuflischen Lachen, geht geradeswegs hinein, macht unter einem Schreckensschrei der Gräfin die fragliche Tür auf und – herein streckt sich ein Kopf! – Ein liebes, dummes, großes Gesicht glotzt mit verwunderten Augen in die Helle und pustet aus weiten, rosenroten Nüstern die fremde Umgebung an. Ein Brauner – ein gutmütiger Fuhrmannsgaul ist Wand an Wand der Schlafkamerad der Reichsgräfin von Wildenau!
»Sehen Sie, das ist der Uebeltäter, es ist ein Luftkopper, daher die schrecklichen Töne, die Sie gehört haben.«
Die Geängstigte betrachtet das gute dumme Pferdegesicht wie eine himmlische Erscheinung, – aber wie erleichtert sie sich auch fühlt, in dem Bewußtsein dieser Nachbarschaft, und wie sehr sie auch Pferde liebt, so möchte sie sie doch nicht gerade im Bett haben, und da die Tür von dem breiten Elefantenhuf des biederen Tieres bereits halb eingetreten ist, liegt die Vermutung nahe, daß der Braune heute nacht, von dem Geruch des aromatischen Seegrases in den Bettrosten angelockt, das Lager der Gräfin als eine Krippe betrachten möchte, und sie etwas unsanft unter einer schnüffelnden Pferdenase erwachen werde.
»O, das wollen wir gleich haben!« beruhigt der alte Andreas. »Wir legen ihn an, daß er nicht mehr loskommt, und morgen früh um Vier spannt ihn der Fuhrmann schon wieder ein, dann haben Sie Ruhe!«
»Nachdem man die ganze Nacht kein Auge zugetan hat!« murmelt die Gräfin und folgt dem Alten, um zu sehen, ob er auch das Pferd sicher anlege. Es ist richtig, das Zimmer, welches mit dem ihren durch eine Tür ohne Schwelle und Schloß verbunden, – ist ein Stall! Ein paar Hühner fliegen erschreckt aus dem Stroh auf – auch das noch! »Wenn der Gaul aus dem Stall ist, werden die Hühner anfangen zu krähen! Welch eine Nacht wird das auf die heutige Strapaze!« Der Alte lächelt wieder mit einer beleidigenden Ueberlegenheit und sagt:
»Ja, dafür ist man auf dem Lande!«
»Nein, hier bleibe ich nicht – lieber übernachte ich im Wagen! Wie ist es möglich, daß Menschen hier einen Tag existieren können?« denkt die Gräfin bei sich.
»Befehlen denn Frau Gräfin nichts zu essen? Soll vielleicht meine Tochter einen Schmarren machen?«
»Einen Schmarren! In dieser Küche, mit diesen Fliegen.« – Der Gräfin wird es übel. »Nein, ich danke!« und wenn sie verhungern müßte – hier könnte sie nie einen Bissen essen.
Der Braune ist endlich angebunden und fährt in Ermangelung anderer Beschäftigung fort, auf das intensivste an seiner Krippe zu beißen und Luft zu fangen. Ein entsetzlich nervenerregendes Geräusch für die Nachbarin dadrin im »Nebenzimmer«! – Jetzt – o Hilfe, Rettung – jetzt rasselt der andere Wagen vor das Haus: die Kammerjungfer und der Reisemarschall!
»Herein, nur schnell herein!« ruft ihnen die Gräfin durchs Fenster zu. »Alles aufgepackt lassen – ich bleibe nicht hier!«
Die Jungfer und der Reisemarschall kommen mit sehr erhitzten Gesichtern herein.
»Wo, in aller Welt, bleiben Sie denn so lange?« herrscht die Gräfin sie an, froh, endlich ihre üble Laune an jemand auslassen zu können.
»Der Kutscher – hat den Weg – verfehlt –« stottert verlegen der Reisemarschall und streift verstohlen das glühende Gesicht der Jungfer. – Die Gräfin überschaut mit einem Blick die Situation. Jetzt ist sie wieder sie selbst. – Furcht und Zagen, die ganze nervöse Schwäche verschwindet vor dem Gefühl der beleidigten Gebieterin, die man eine Stunde lang warten zu lassen wagte und dann mit Gesichtern vor sie hintritt, auf denen der unerlaubte Grund der Verzögerung nur zu deutlich geschrieben steht.
Sie richtet sich hoch auf, sie ist ganz Herrin in dem Augenblick: »Herr Reisemarschall – Sie sind entlassen – kein Wort weiter!«
»Dann bitte ich Ew. Durchlaucht auch um meine Entlassung,« sagt die erregte Kammerjungfer, sich selbst verratend. Ein verächtlicher Blick aus dem Auge der Gräfin trifft die Schuldige, aber ohne sich zu besinnen, sagt sie ruhig:
»Gewährt! Lassen Sie sich beide vom Rentmeister die Löhne ausbezahlen. Adieu!«
Die beiden Gerichteten verlassen bleich und stumm das Zimmer. Das hatten sie nicht erwartet, aber sie kennen den Charakter ihrer Gebieterin und wissen, daß hier kein Wort weiter gestattet wäre – und kein Bitten und Flehen etwas helfen würde. Auch der Gräfin ist nicht wohl zu Mute. – Da steht sie nun – ohne Kammerjungfer! Zum erstenmal in ihrem Leben soll sie sich selbst bedienen, auspacken – die großen Koffer und Taschen! »Mein Himmel, wie wird das gehen,« und sie ist so müde und erkältet – und sie weiß nicht einmal, in welcher der vielen Taschen trockene Schuhe und Strümpfe zu finden wären! Soll sie alles herausreißen, jetzt, wo sie es doch wieder einpacken müßte? Denn jetzt muß sie unter allen Umständen in ein anderes Haus, zu zivilisierten Menschen, wo sie eine Bedienung hat und nicht so verlassen ist! O, wäre sie nur nicht in dieses Ammergau gereist – das ist ja ein schrecklicher Ort! Das Heil der Welt möchte man ja nicht mit einem solchen Abend erkaufen! Es ist eine furchtbare Situation in dieser Umgebung – ohne Kammerjungfer!
Und wie das Kleine auch die größte Frau immer klein findet, weil dies Nervensache und nicht Charaktersache ist, so setzt sich die ihrer Dienerschaft gegenüber eben noch so imponierende Frau wieder auf die dürftige Bettstatt und weint wie ein Kind.
Da klopft es leise an die Tür zur Werkstatt. Die Gräfin öffnet und die kleine dicke von den beiden Schwestern tritt schüchtern ein.
»Erlaucht Frau Gräfin, entschuldigen, wir haben erfahren, daß Frau Gräfin die Fräulein Kammerjungfer und den andern Herrn entlassen haben, und da wollt' ich fragen, ob ich oder meine Schwester nichts helfen könnten? Vielleicht ein wenig auspacken?«
»Ich danke Ihnen – ich wünsche nicht, hier zu übernachten, und hoffe, mein Begleiter wird mir Nachricht bringen, daß er etwas für mich gefunden hat. Ich werde Sie entschädigen, wie Sie es verlangen, aber ich kann hier unmöglich bleiben! Fragen Sie Ihren Vater, was er fordert, ich will Ihnen geben, was Sie nur wollen – aber lassen Sie mich fort.«
Der Alte wird gerufen.
»Ja, Frau Gräfin, da können Sie ganz ruhig sein, wenn es Ihnen bei uns nicht gefällt, da genieren Sie sich nur nicht! Sie brauchen auch gar keine Entschädigung zu zahlen – nur müssen Sie bald dazutun, sonst bekommen Sie keine andere Wohnung mehr, es geht heuer streng mit den Wohnungen.«
»Ja, aber Sie müssen in jedem Fall von mir eine Entschädigung nehmen, sagen Sie doch nur, was darf ich Ihnen anbieten?«
»Nichts, Frau Gräfin! Was nicht genossen ist, lassen wir uns auch nicht bezahlen!« sagt der Alte mit einer so imponierenden Bestimmtheit, daß die Gräfin ihn erstaunt anblickt.
»In Ammergau macht man aus dem Vermieten kein Geschäft, Frau Gräfin, das tun nur die fremden Spekulanten, die hier um diese Zeit einen Schnitt machen wollen und, Gott sei's geklagt, Ammergau in den Ruf der Blutsaugerei bringen! Wir echten Ammergauer tun's jeder für die Sache, damit möglichst viele Gäste das Spiel sehen können, und sind froh, wenn wir unsere Kosten herausschlagen! Mehr braucht's nicht.«
Die Gräfin sieht auf einmal das konfiszierte Gesicht in einem ganz anderen Licht! Es muß die schlechte Beleuchtung vorhin gewesen sein. Jetzt findet sie auf einmal, daß es ein durchgeistigter und bedeutender Kopf ist. Ja, das gefurchte Gesicht, umwallt von den grauen Haaren, mit den klaren, durchdringenden Augen, hat etwas patriarchalisch Rührendes und Würdevolles. Es kommt ihr auf einmal zur Erkenntnis, daß diese Leute die Masken, die ihre Rollen fordern, von Natur an sich tragen müssen, da nicht geschminkt werden darf, und sich so unwillkürlich der Charakter der Rolle den Zügen aufprägt. Wie man ja auch bei den Schauspielern im Leben sogleich den Charakterspieler und den Liebhaber auseinander kennt.
»Sie spielen mit?« fragt sie jetzt mit Interesse.
»Ich spiele den Dathan, den jüdischen Oberhändler,« sagte er stolz. »Ich spiele jetzt schon seit sechzig Jahren mit. Denn als Bub von drei Jahren habe ich in den lebenden Bildern der Eva auf dem Schoß gesessen!«
Die Gräfin kann ein Lächeln nicht unterdrücken, und auch der Alte wird von einer edlen Heiterkeit verklärt.
Das kleine Mädchen, die Tochter der runden, dicken Schwester, schaut durch die Türspalte und hängt mit leuchtenden Augen an der schönen Frau.
»Wem gehört die Kleine?« fragt die Gräfin, das Kind mit seinen weichen Locken und den glänzenden Augen betrachtend.
»Es ist meine Enkelin, das Kind meiner Tochter Anna. Der Vater war ein Fremder, er ist durchgegangen und ließ die Frau und zwei Kinder im Elend zurück. Da nahm ich sie alle drei wieder zu mir.«
Die Gräfin blickt auf die hagere, abgezehrte Gestalt des Alten und auf die wohlgenährte von Mutter und Kind.
»Und wer ernährt sie?«
»O – wir helfen uns so durch,« sagt der Alte, bescheiden ablenkend. »Wir arbeiten alle zusammen. Und mein Sohn, der Zeichenlehrer, der tut auch viel für uns, ohne den könnten wir freilich nicht durchkommen,« er unterbricht sich erschrocken, als könne es der Betreffende gehört haben. »Aber man darf's nicht sagen – wenn er das wüßte, er wäre außer sich!«
»Sie scheinen Ihren Sohn ein wenig zu fürchten?« fragt die Gräfin.
»Ja, o ja – er ist streng, sehr streng und stolz, aber gut!«
Und in den Augen des alten Mannes leuchtet es auf in Liebe und Stolz.
»Wo ist er denn, dieser Sohn?« fragt die Gräfin gespannt.
»Ach, wissen Sie, der läßt sich nie vor Fremden sehen, wenn er nicht muß!«
»Spielt er auch mit?«
»Nein, er stellt die lebenden Bilder, und das ist eine Aufgabe, wie ein Feldherr, denn er muß da zwei- bis dreihundert Menschen kommandieren, und er hält sie zusammen und sie parieren ihm wie einem General!«
»Das muß ja ein sehr interessanter Mensch sein!«
In diesem Augenblick ertönt der Tritt des Prinzen in der Wohnstube.
» Peut on entrer?«
» Oui mon Prince!«
Der Prinz tritt ein, triefend vor Nässe.
» Rien trouvé, excepté une petite chambre pour moi-même dans une chaumière encore plus pauvre que celle-ci! Toutes les grandes maisons remplies jusqu'au grenier. C'est le diable qui nous a entrainé chez ces maudits paysans!«
» Ne dites pas cela!« spricht die Gräfin ernst. » Ils sont des saints!«
Da sagt das kleine Mädchen leise etwas zu seiner Mutter.
»Wenn es die Herrschaften nicht übelnehmen wollten, mein Kind versteht etwas Französisch und sagt mir eben, Sie hätten kein Logis für die Dame gefunden,« sagt die Mutter schüchtern, »ich weiß eines in einem sehr hübschen Hause nicht weit von hier. Ich will doch schnell hinüberspringen und sehen, ob es noch zu haben ist. Wenn Sie das bekämen – da ist es viel schöner als bei uns.« Und sie eilt nach der Tür.
»Halt, Frau,« ruft der Prinz, »Sie können nicht hinaus, es ist ein wahrer Wolkenbruch, und ein zweites Gewitter zieht soeben herauf.«
»Ja, bleiben Sie,« ruft die Gräfin, »warten Sie das Wetter ab.«
»Ja, nein, – bei Wohnungen kommt es hier auf die Minute an, – da darf man keinen Augenblick versäumen.« Und im Nu hat sie ein Tuch übergeworfen und ist zum Haus hinaus. Schon springt sie an dem niederen Fenster vorbei, – ein flammender Blitz erleuchtet das Zimmer und läßt die kleine gebückte Gestalt draußen sich wie eine Silhouette abheben. Ein Donnerschlag folgt rasch.
»Das Gewitter steht gerade über uns,« sagt der Prinz gutmütig besorgt. »Wir hätten die Frau nicht hinauslassen sollen.«
»O, das macht nichts,« lächelt der Alte, »das tut sie gern!«
» Dites-moi quels drôles de gens,« will der Prinz beginnen, aber die Gräfin winkt ihm, da das Kind Französisch versteht. Der Prinz sieht sie mit einem komischen Ausdruck an, als wollte er sagen: »Das sind aber sonderbare ›Briganten‹, die ihren Kindern eine so gute Erziehung geben.« – Die Gräfin geht ans Fenster und blickt unruhig in das tosende Unwetter hinaus. Ein Gefühl inneren Vorwurfs beschleicht sie, daß sie das gute Geschöpf in diesem Aufruhr der Elemente fortließ! – Noch dazu, wo die Leute keine Entschädigung annehmen und also um einen Verdienst kommen, wenn sich eine andere Wohnung findet.
»Es ist ihr Schaden und dafür diese Bereitwilligkeit!«
Die kleine Gesellschaft hat sich jetzt ins Wohnzimmer gezogen. Die Gräfin sitzt auf der Fensterbank, während Blitz um Blitz und Schlag auf Schlag herunterschmettert. Jetzt denkt sie nicht mehr an sich, nur noch an das arme Wesen da draußen. Das kleine Mädchen weint leise um die Mutter, in diesem Wetter! Und schleicht hinaus, unter der Haustür auf sie zu warten. Der Prinz hat sich frierend auf die Ofenbank gesetzt. Als der alte Groß das bemerkt, geht er still hin und heizt ein, »damit der Herr sich trocknen kann«. Bald knistert ein wärmendes Feuer in dem riesigen grünen Kachelofen, dem Hauptträger der gesunkenen Decke.
»Bitte, schreiben Sie mir die Heizung auf,« sagt der Prinz beschämt.
Der Alte lächelt:
»Daß doch die Herrschaften alles bezahlen wollen! Wir hätten ja für uns auch Feuer gebraucht!« Damit verläßt er das Zimmer. Die hagere Schwester findet es nun auch angemessen, die Herrschaften nicht zu stören und geht hinaus.
»Sagen Sie mir, Gräfin,« beginnt der Prinz, sich behaglich an den warmen Ofen lehnend, »darf ich Ihnen diese wenig genußreiche Atmosphäre mit einer Zigarette parfümieren?«
»Ach gewiß, ich dachte gar nicht mehr daran, daß es überhaupt Zigaretten in der Welt gibt!«
»Scheint mir so,« sagt der Prinz kaltblütig und bietet der Gräfin sein porte-cigarettes an. Sie mag heute nicht rauchen. Der Prinz kehrt wieder auf seine Ofenbank zurück: »Sagen Sie mir, chère amie, nachdem Sie nun alle Schauer dieser romantischen Situation durchgekostet haben – wie wäre es mit einer Tasse Tee?«
»Tee!« sagt die Gräfin und sieht ihn wie aus einem Traum erwachend an, »Tee!«
»Ja, Tee,« persifliert der Prinz; »arme Freundin, Sie müssen ja eine Ewigkeit in der einen Stunde unter diesen ›Wilden‹ durchlebt haben, daß Ihnen schon die Erinnerung an die besten Errungenschaften der Zivilisation verloren gegangen ist.«
»Tee,« sagt die Gräfin, die jetzt erst fühlt, daß sie am Verschmachten ist, »das wäre etwas, aber ich weiß nicht, wo ich ihn habe! Ich schickte ja die Kammerfrau fort.«
»Jawohl, ich traf das entlassene Paar in voller Verzweiflung! Und ich kann mir denken, daß meine angebetete Gräfin Madeleine – das verzogenste und verwöhnteste aller Kinder des Glückes und der großen Welt – sich jetzt nicht zu helfen weiß. Ich bin darüber keineswegs ungehalten, car j'en profite! Ich darf mich nun als liebende Vorsehung bei Ihnen insinuieren – quelle chance pour un adorateur! N'est-ce pas? Gestatten Sie mir daher, Ihnen die Kammerjungfer – soweit tunlich – zu ersetzen! Ich habe Tee bei mir und mein Kammerdiener, den ich gottlob nicht wegzuschicken brauchte, weil er bei dem schuldigen Paar nur als Elefant funktionierte, harrt draußen Ihres Befehls zum Angießen!«
» Que vous êtes bon, mon prince! Aber ich bitte Sie, diese Küche mit den Fliegen.«
»O, das braucht Sie nicht zu beunruhigen. Man sieht, daß Sie noch wenig im Gebirge waren. Ich kenne diese Gebirgsfliegen, sie sind anders als unsere Stadtfliegen, sie besitzen eine eigene Geschicklichkeit, nicht ins Essen zu fallen! Wagen Sie es einmal daraufhin!«
»Ja, aber zuerst müssen wir doch wissen, ob ich die andere Wohnung bekomme!« sagt die Gräfin wieder kleinlaut.
»Teuerste Gräfin, hindert uns denn das, eine Erquickung zu uns zu nehmen? Seien Sie doch nicht so mutlos,« lacht der Prinz.
»Ach, Sie haben gut lachen – ich versichere Sie, die Situation ist tragisch genug –«
»Tragisch genug, um der Mühe zu lohnen, eine gewisse Seelengröße dabei zu entwickeln, nicht aber, um echt weiblich alle Fassung zu verlieren.« Der Prinz schüttelt die Zigarettenspitze aus und geht, um dem Kammerdiener Anweisung wegen des Tees zu geben. Als er wieder eintritt, kommt ihm die Gräfin plötzlich entgegen, streckt ihm die Hand hin und spricht mit einem berückenden Lächeln: »Prinz, Sie sind heute reizend und ich bin unausstehlich! Ich danke Ihnen für die Geduld, die Sie mit mir haben!«