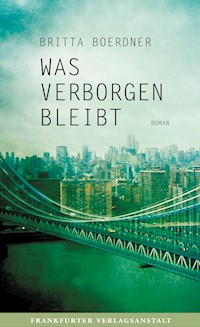Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Wie ein Blitz schlägt Frank Z., ein Musiker aus Kalifornien, an einem heißen Sommerwochenende des Jahres 1969 in den beschaulichen Ort in der Wetterau ein. Aus der Dorfdisko hört man zwar schon Beatmusik, aber der Alltag in Randstetten ist von den wilden Sechzigern noch weit entfernt. Als der amerikanische Hippie mit seinem VW Käfer wegen einer Panne liegenbleibt, gerät das Leben der Ortsbewohner in Unordnung. In der Pension "Zum Grünen Baum" begegnet er Ev, der siebzehnjährigen Tochter des Hauses. Ev verliebt sich in ihn und eine bislang verschwiegene Geschichte droht sich zu wiederholen. Doch die Veränderungen, die das plötzliche Auftauchen des Amerikaners in Gang gesetzt hat, sind längst nicht mehr aufzuhalten. Aufbruch und Umbruch bestimmen dieses Sommerwochenende in der Wetterau. Mit sicherem Gespür für Stimmungen und die Seelenzustände ihrer Figuren gelingt es Britta Boerdner, die Atmosphäre der Zeit einzufangen und durch ihre präzise Sprache in flirrendes Schwingen zu bringen. "Besser kann die Liebe nicht anfangen als mit Frank Z. im Grünen Baum – Britta Boerdner erzählt von der Herzensprovinz in uns allen und eröffnet den Lesern damit eine Welt: die kleine Welt ihrer Heldin Ev, in die die große weite Welt samt E-Gitarre und Schnauzer einbricht, geschrieben in einer Sprache, die das Unglaubliche mühelos glaubhaft macht." (Bodo Kirchhoff)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wie ein Blitz schlägt Frank Z., ein Musiker aus Kalifornien, an einem heißen Sommerwochenende des Jahres 1969 in den beschaulichen Ort in der Wetterau ein. Aus der Dorfdisko hört man zwar Beatmusik, aber der Alltag in Randstetten ist von den wilden Sechzigern weit entfernt. Als der amerikanische Hippie mit seinem VW Käfer wegen einer Panne liegenbleibt, gerät das Leben der Ortsbewohner in Unordnung. In der Pension »Zum Grünen Baum« begegnet Frank Ev, der siebzehnjährigen Tochter des Hauses. Ev verliebt sich in ihn, und eine bislang verschwiegene Geschichte droht sich zu wiederholen. Doch die Veränderungen, die das plötzliche Auftauchen des Amerikaners in Gang gesetzt hat, sind längst nicht mehr aufzuhalten.
»Besser kann die Liebe nicht anfangen als mit Frank Z. im ›Grünen Baum‹ – Britta Boerdner erzählt von der Herzensprovinz in uns allen und eröffnet den Lesern damit eine Welt: die kleine Welt ihrer Heldin Ev, in die die große weite Welt samt E-Gitarre und Schnauzer einbricht, geschrieben in einer Sprache, die das Unglaubliche mühelos glaubhaft macht.« Bodo Kirchhoff
Inhalt
Going Up the Country
1. – Vom Taunus aus betrachtet …
2. – Sie heißt Evelyn …
3. – Sie schließt die Vordertür auf …
4. – Im Fünfliterboiler …
Gangster of Love
1. – Die Liebe kommt, die Liebe geht …
2. – Ungefähr zur gleichen Zeit …
3. – Auf dem Land beginnt ein Tumult …
4. – Ev auf dem Fahrrad …
5. – Seine Kiste kann nicht …
6. – Es geht schon auf sieben zu …
7. – Der Bruder, die Mutter …
In-A-Gadda-Da-Vida
1. – Ev ist spät dran …
2. – Und Rudi? Hat den Abend …
3. – Und da, die Mechanik …
4. – Der Mittag ein Traum …
5. – Ein Samstagmittag …
6. – Das Sunnyside steht am Ortsausgang…
Here Comes My Baby
1. – Hat sie ihn richtig verstanden …
2. – Manni allein unter dem Fenster …
3. – Fast noch im Traum …
World Keep On Running
1. – Es sind die Alltagsrituale …
2. – Es ist falsch, alles absolut falsch …
3. – Hey, sagt er leise …
4. – Die Hauptstraße liegt leer …
Going Up the Country
1.
Vom Taunus aus betrachtet ist die Wetterau ein stilles Land, weite Ebenen mit sanften Hügeln, im Vordergrund vielleicht ein ausgefahrener Feldweg, gesäumt von Apfelbäumen, Butterblumen, Kornblumen. Es sind die gegeneinander verkanteten Felder, erdfarben und grün, die Baumreihen und die Ortschaften, die den jungen Mann mit ihrer Sanftheit anziehen. Die Straße ist abschüssig, in unübersichtlichen Kurven führt sie auf ein Dorf zu. Im Schatten der Bäume lässt er den VW Käfer in die Mündung eines Feldwegs rollen, mit dem Anziehen der Handbremse bleibt auch die Landschaft stehen. Schottersteinchen, eben noch unter den Reifen, knirschen beim Aussteigen unter seinen Schuhen. Sein Körper ist noch betäubt vom Flug und der Fahrt. Kurz wird ihm schwindelig in der Nachmittagshitze.
Zu Hause hat er sich nur knapp verabschiedet, I need a breather, eine Verschnaufpause brauche er, hatte er denen gesagt, die es anging, und einen Flug nach Deutschland gebucht. Im Jahr zuvor war er bereits dort gewesen, eine Tournee zum Test, außer regennassen nächtlichen Straßen, Scheinwerfern und trüben Backstage-Bereichen hatte er nichts gesehen. Die nüchterne Atmosphäre seiner Hotelzimmer, er alleine, die anderen in einem separaten Hotel, darauf hatte er bestanden. Niemand konnte ihm etwas vormachen auf der Bühne, er hörte alles, erahnte die Fehler, noch bevor sie passierten. Es erschöpfte ihn, er brauchte die Trennung von den anderen, den Raum für sich nach einem Gig.
Viele Jahre zuvor hatte er in Darmstadt ein paar Wochen am Musikinstitut verbracht, auf der Suche nach neuen Tönen, einem Klang, der ihn etwas lehrte. Die deutschen Studenten führten mit bleichen Gesichtern erbitterte Diskussionen, die er nicht verstand. In der Innenstadt, am Tresen eines Schallplattengeschäfts, hatte er damals Gary kennengelernt, sie standen nebeneinander mit Kopfhörern am Ohr und sahen an den Plattencovern, dass sie beide zur gleichen Musik wippten. Gary war Soldat in der U. S. Army, zehn Jahre älter als er und der einzige Mensch, mit dem er über Musik reden konnte. Jeden Abend war er bei ihm zu Hause eingeladen, fast immer gab es Chicken Wings, die Garys Frau zubereitete, während sie auf der Stereoanlage Edwin Starr hörten. Gary hatte Musik studiert und spielte Klarinette im Corps-Orchester. Sie hielten sich fern von den amerikanischen Soldaten, die wie eine fremde Spezies waren und eine andere Sprache sprachen.
I need a breather, hatte er auch zu ihm gesagt, als er ihn drei Tage zuvor anrief. Es war nicht schwierig, Gary nach all den Jahren ausfindig zu machen, er hatte inzwischen einen Bürojob in der Army. Ich hab dein Konzert letztes Jahr in Frankfurt gesehen, gute Musik, sie haben mich nicht Backstage gelassen, komm rüber, sagte Gary, tauch ab, find your freedom. Er habe in den letzten Jahren eine lange Reise hinter sich gebracht, aus Deutschland zurück in die Staaten, nach der Scheidung von seiner Frau wieder back to good old Germany. Nicht schlecht hier, sagte Gary auch, und das gab den Ausschlag.
Spätabends hatte er seine Reisetasche gepackt, ein paar Sachen zum Anziehen, Musikkassetten, seinen tragbaren Rekorder, seine dunkelbraune Fransentasche zum Umhängen. Seit Jahren war er nicht mehr für sich gewesen, und sei es auch nur für einen Tag. Im Morgengrauen, der einzigen Stunde, in der Stille im Haus herrschte, war er hinunter ins Wohnzimmer gegangen. Vor der breiten Fensterfront dümpelten zwei Plastikluftmatratzen im Pool, rot und blau leuchteten sie über den Unterwasserstrahlern, man hätte sofort einen Song daraus machen können, der den frühen Morgen pries, der vom Springen ins Wasser und der amerikanischen Flagge in Form dieser beiden Luftmatratzen erzählte. Aus den Augenwinkeln sah er ein Paar, das auf der geschwungenen Sitzlandschaft schlief. Mehr als dreißig Leute hatten noch Stunden zuvor dort gesessen oder gelegen. Eine schmale Männerhand in den Haaren der Frau; Cocktailgläser, Stanniolpapier, Bierflaschen auf den Tischen. Über allem lag ein tiefer Summton und darüber ein Pfeifen, das in seiner Geradlinigkeit alles Ungeordnete der vergangenen Nacht noch verstärkte. Vorbei an Kleidungsstücken, die über Mikrofonständern hingen, ging er zum Kamin, schaltete zuerst die beiden Monitorboxen ab, die davorstanden, dann den Verstärker, schulterte seine Tasche und verließ das Haus. Unten wartete bereits der Fahrservice, der ihn zum Flughafen bringen sollte, eine schwarze Limousine, zwischen den Bäumen hindurch hatte er sie heranrollen sehen. Bougainvillea, feucht vom Tau, Wasserperlen auf seinem Jackenärmel. Die Luft war kühl. Auf dem Laurel Canyon Boulevard kroch der Nebel, der allmorgendlich vom Meer heraufzog, bis in die Wipfel der Eichen und Platanen. Der Fahrer nahm die engen Kurven langsam, es ging bergab, der Motor war kaum zu hören, niemand begegnete ihnen. In wenigen Minuten würden sie auf den La Cienega abbiegen, dann über den La Tijera und den Sepulveda Boulevard zum Flughafen kommen. Er stellte sich vor, wie die dunklen Wellen des Pazifiks über den Grund sogen und gegen den Strand rollten, sofort hatte er das Unterwassergeräusch im Kopf, es verband sich mit der Farbe der Luftmatratzen, eine Nation im Brandungssog, daraus könnte tatsächlich ein neuer Song entstehen, die Mädchen aus dem Haus würden dazu tanzen, als Wellen oder Nixen verkleidet, die Show würde weitergehen, irgendwoher musste das Geld kommen. Eines der Häuser hinter dem Country Store an der Ecke zum Kirkwood Drive war hell erleuchtet, jedes Fenster war geöffnet, und mit dem künstlichen Licht, das durch den Morgennebel drang, hallte Musik über die kleine Kreuzung, She’s Leaving Home von den Beatles, gerade so, als wäre etwas Unvorhersehbares geschehen in der Nacht.
Und tatsächlich geschah in jeder Nacht etwas Unvorhergesehenes, es war ein Sommer der Sessions, der Partys, der Drogen, die alle sanft und unbeherrscht zugleich werden ließen, ein Sommer, in dem man den Kindern morgens bunte Schuhe mit Fingerfarben an die nackten Füße malte, ein Sommer, in dem alles mit Musik zu tun hatte. Man hörte sie aus jedem Garten, von jeder Terrasse im Canyon; Wochen zuvor hatten sich alle Anwohner telefonisch verabredet, ihre Fenster zu öffnen und zur selben Sekunde die Nadel des Plattenspielers auf Sympathy for the Devil von den Stones zu setzen, und wer die kleine, enge Laurel Canyon Road entlangfuhr, fühlte sich wie in einem Traum, der sich wiederholte und doch zeitlich versetzt war, eine manchmal übersteuerte, lauter und leiser werdende Klangcollage, die aus der Natur selbst zu kommen schien. Eine neue Zeit war angebrochen und bereits am Verglühen, man konnte es spüren in jeder Nacht, in der sie improvisierten bis in den Morgen. Ihre Musik, die Songs, die entstanden, wenn es kein Zeitgefühl mehr gab, trieb sie durch die dunklen Stunden in die Tage hinein. Sie lebten im Flow wie dieses ganze, sich die Küste entlangziehende Kalifornien, und an jedem verdammten Tag nach diesen Nächten fragte er sich, wie lange Love and Peace noch halten würden, überhaupt ernst zu nehmen sei. Er nahm Einfluss, er hielt sein Haus offen, er produzierte, er ging auf Tournee, er hatte es weit gebracht. Doch so viel Freiheit der Canyon auch gewährte, seit Wochen spürte er ein inneres Vibrieren, als würden sich die Straßen, würde sich ganz Kalifornien künstlich verengen.
Gary hatte ihm sein Auto geliehen, Go for a ride, hatte er gesagt. Über Land solle er fahren, an Frankfurt vorbei durch den Taunus. Sich treiben lassen. Mit den Unterarmen auf das Wagendach gelehnt, schaut er sich jetzt um, sein helles Gesicht scharf konturiert im Schatten der Apfelbäume. Kein anderes Auto ist zu sehen. Sein Blick, der diejenigen einschüchtert, die sich selbst nichts zutrauen, wird weicher vor der weiten Landschaft. In sanftem Schwung ziehen sich die Felder und Wiesen vor ihm hinab, weit unten stehen Scheunen nahe bei den Häusern, er ist anderes gewohnt, seine Vorstellung von Landschaft besteht aus den Weiten der Mojave-Wüste, dem Himmel über dem nächtlich glühenden Los Angeles, den Wäldern Connecticuts. Hinter ihm singt ein Vogel, hebt seine Strophe zum Ende hin an, als stellte er eine Frage. Der Käfermotor knackt beim Abkühlen, in der Motorhitze steigt Sommerstaub vom Feldweg auf. Zirruswolken stehen hoch am Himmel, ein seidiges Versprechen. Das hat immer etwas mit Sehnsucht zu tun, denkt er gerade, da scheint das Blau hinter den Wolken zu verblassen. Der Vogel setzt erneut an, bricht ab. In der Ferne zuckt ein Lichtstrahl auf, etwas bewegt sich mit großer Geschwindigkeit auf ihn zu und schiebt dabei ein Rauschen vor sich her, das die ganze Landschaft niederdrückt. Er nimmt die Arme vom Wagendach, öffnet die Fahrertür und wartet, mit einem Fuß schon auf dem Trittbrett, bereit, sich auf den Sitz fallen zu lassen, da sieht er, was auf ihn zukommt. Ein Starfighter. Eine Lockheed, die er seit seiner Kindheit kennt, aber hier nicht erwartet hat. Wie ein Messer durchschneidet sie im Vorbeiziehen das Blau. Er ist aufs höchste angespannt. Und da kommt er auch schon, der Knall, mit dem sie die Schallmauer durchbricht. Sein Körper wird zusammengepresst wie die Luft selbst. Erst dann zieht auch der Ton hinterher, ein metallenes Pfeifen, das keine Gegenwehr zulässt, mit seinem Sog alle Gedanken außer Kraft setzt, die weite Landschaft hin zum Horizont schiebt und in eine Fläche verwandelt, aus der alle Farben weichen. Zu spät, sich die Ohren zuzuhalten, die Lockheed ist das einzig Lebendige in diesem Augenblick, und als er kurz an den Vogel denkt, ist sie schon ein weit entfernter silbriger Punkt. Ein Dröhnen in seinen Ohren ist alles, was sie zurücklässt, die hohen Wolken bleiben unberührt. Eine Biene fliegt vorbei, schwer beladen. Er drückt die Fahrertür bis zum Anschlag auf, löst sich vom Wagen, bückt sich nach einem Stein, und schleudert ihn, so fest er kann, hoch über die Straße hinweg zu den gegenüberliegenden Feldern, sieht ihm hinterher, wie er dem Himmel entgegenfliegt, im Flug rotiert und auf seinem Zenit stehen zu bleiben scheint. In der Ferne ist die Sichel des Mondes zu sehen, auf den in etwas mehr als einer Woche ein Mensch seinen Fuß setzen wird, der Stein davor wie ein Artefakt, eine Vorstufe der Raumkapsel. Zum ersten Mal seit seinem Abflug aus Los Angeles atmet er tief durch.
Nur ein paar Schritte sind es zurück zum Auto, er drückt die Kassette ins Fach des Rekorders, der auf dem Beifahrersitz liegt, dreht am Lautstärkeknopf. Der Sound zieht über ihn hinweg in die Kronen der Apfelbäume, dehnt sich in beide Richtungen an den Butterblumen vorbei über die Landstraße. Jetzt ein Stück den Feldweg bergan, die Beine steif, seine Schritte auf dem trockenen Weg ein Pendant zum Takt der Musik, die hinter ihm zurückbleibt. Ein Schwarm winziger Mücken begleitet ihn, und als er den Schatten der Baumreihe hinter sich lässt, spürt er in der Sonne die Schweißperlen auf seiner Oberlippe. Er wendet sich um, richtet sich wieder nach der Musik aus, die immer noch aus dem VW fließt und sich für ihn nun mit dem Bild des Dorfes vermischt, das inmitten der Felder weit unten als helles Würfelspiel vor ihm liegt. Als Miniaturausgabe einer Siedlung, so stellt er es sich vor, bei der man den Fehler begangen hat, zu kleinteilig zu bauen, zu viele Häuser und Unterstände in geringem Abstand nebeneinanderzusetzen, mit Familien aus kleinen Menschen, die zum Leben nicht viel brauchen. Vielleicht sind auch die Lücken zwischen den Häuschen von einem kunterbunten Durcheinander einzelner Kühe, Hühner und Hasen durchzogen. Eventuell gibt es sogar Zwerge dort, winzige Menschen malt er sich aus, die eine Kakophonie flacher Stimmen über und zwischen dem Würfelspiel produzieren, begleitet vom dumpfen Gepolter aus den Ställen. Er lächelt. Kaum etwas stimmt ihn so vergnügt wie die gedankliche Verwandlung dessen, was er sieht in Musik.
Er wirft dem Stein einen zweiten hinterher, schaut dabei nicht mehr in den Himmel, sondern auf die Dächer in der Talsenke. Versucht, sie zu treffen, verstärkt den Schwung zu einer Drehung seines ganzen Körpers um die eigene Achse. Zurück am Auto, zieht er seine Wildlederjacke aus, in der Armbeuge ist ein dunkler Fleck, er lässt sich auf den Fahrersitz fallen, blickt in den Rückspiegel, fährt sich mit den Fingern durch die langen Haare, zieht die Wagentür zu und löst die Handbremse. Der Käfer rollt auf den Asphalt. Morgen Abend will er mit Gary nach Frankfurt, im Jazzkeller spielt Mangelsdorff, welcher von beiden hat er vergessen, Posaune oder Saxophon, ihm ist alles recht gegen die Mittelmäßigkeit. Wie hatte Gary gesagt? Jazz is not dead.
Sein Kopf ist frei, das kommt selten vor. Ein Traktor hat Erde auf der Straße hinterlassen, die Brocken sind hart wie Stein, werden zur Seite oder gegen den Wagenboden gesprengt. Für einen Moment sieht es so aus, als würde der Käfer keine Fahrt aufnehmen, doch dann wechselt die Spur des Traktors schlingernd auf die andere Straßenseite und verliert sich in einer Fortsetzung des Feldwegs. Seit er gelernt hat, Wagen mit Schaltgetriebe zu fahren, übt er sich im Schalten ohne Kupplung, schon immer mochte er es, alles anders zu machen, er konzentriert sich jetzt auf den Moment, in dem er Zwischengas geben muss, schiebt den dritten Gang ein. Untertourig rollt der Käfer zwischen den Baumreihen über den unregelmäßigen Straßenbelag, die Sonne brennt durch das Seitenfenster auf seinen Arm, auf seine Beine, sie wirkt hier größer als zu Hause, wo sie als weißer Nadelkopf über dem Los-Angeles-Becken steht. Am Ende der nächsten Kurve weist ein Straßenschild in Richtung Randstetten. Zu den schwarzen Buchstaben auf gelbem Grund hat er einen Sound im Kopf, der dem Nachgeben der Erdklumpen unter seinen Reifen gleicht. Er hat es nicht eilig, vielleicht fährt er erst nachts zurück, mit heruntergekurbelten Fenstern, wie schon den ganzen Tag, der Sommer riecht gut, schon lange war er nicht mehr so allein, so weit draußen. Die Welt ist ein Haufen, ein Konglomerat aus parallelen und asynchronen Geschehnissen, sie ist undurchschaubarer, als alle denken, das zumindest weiß er, und das ist es auch, was ihm an dieser Welt so gefällt.
Drei Tage zuvor war ein Unbekannter in seinem Haus aufgetaucht, hatte ihm eine mit Blut gefüllte Plastiktüte in die Hand gedrückt und einen Revolver vor die Brust gehalten. Er konnte den Mann überreden, mit ihm zum Teich hinter dem Haus zu gehen, wer gerade in der Nähe war, lief lachend mit, als wäre es ein neuer Spaß, der frühe Auftakt zur abendlichen Session, und es gelang ihm, tatsächlich eine Art Spiel daraus zu drehen, bei dem die Kindsköpfe mitmachten; er zog sein Hemd aus und warf es ins Wasser, sie warfen ihre T-Shirts hinterher, Stöcke, Schuhe, auch der Typ zog sich aus, doch als es darum ging, ihn zu überzeugen, seine Waffe in den Teich zu werfen, wurde es den anderen zu anstrengend, und sie verschwanden im Haus. Schließlich war er allein mit dem Verrückten und seiner Knarre, die der auch dann noch erschreckend silbern in der Hand hielt, als sie sich ohne Hemden auf dem Boden gegenübersaßen und ihnen die Sonne auf die Schultern brannte. Es gab ein Wortgefecht, wirres politisches Zeug in jedem Satz, den der Fremde von sich gab, von der Nachmittagshitze sofort erstickt. Sie stach herunter wie verrückt, diese weiße Sonne, und der Typ, ein großer, weicher Junge mit runden Schultern, Vollbart und so langen Haaren wie er selbst, fing an, mit der Waffe herumzufuchteln. Versuchte, auf ihn zu zielen. Es war einfach, ihm den Arm zur Seite zu drücken, bevor sein letzter Satz zu Ende war. Hier hätte er eigentlich aufhören können. Es war überflüssig, zuzuschlagen, das sagte er sich immer wieder, doch er hatte sich geärgert und wollte es zeigen.
Der Fremde war so zugedröhnt, dass er seine Bewegungen nicht mehr koordinieren konnte, sein erschrockener Blick und die Langsamkeit, mit der er sich die Hand vor sein Gesicht hielt, um sie anzuschauen, und dann über Nase und Mund legte, zeigte ihn als einen, der erstarrt war, Bedeutung und Größenverhältnisse nicht mehr zuordnen konnte, weggelaufen aus einem Elternhaus im Mittleren Westen oder sonst woher, wie so viele, denen man begegnete. Anders sollte das Leben sein, erzählten sie jedem, der es hören wollte oder auch nicht, frei von Zwängen, aktivistisch und voller brüderlicher und schwesterlicher Liebe, und so war er den Verheißungen dieses anderen Lebens bis nach San Francisco gefolgt, die Küste hinuntergetrampt über Big Sur, hatte Nächte unter dem Himmel von Esalen verbracht, die magisch waren (Believe me, man, ich konnte spüren, wie der Kosmos aus mir entsprungen ist), bis er schließlich in L. A. gestrandet war, wo er sich durchschlief und durchbettelte. So oder so ähnlich konnte man es sich vorstellen, eine Geschichte wie Tausende.
Die Waffe und der Blutbeutel fielen zu Boden, und der Junge blickte erschrocken auf, als er ihm Let the sunshine in zuflüsterte, ihm dabei tief in die Augen sah und beides, Beutel und Waffe, in den Teich warf. Ohne Widerstand ließ sich der Junge hochziehen und durch das Gestrüpp zu einer Tür im Holzzaun und von dort auf den Weg stoßen, der am Grundstück vorbeiführte.
Mit einer Waffe bedroht zu werden und jemandem ins Gesicht zu schlagen, zwei Geschehnisse in Zeitlupe und im Nachhinein in Zeitraffer, alle Handlungen folgerichtig in ihrer Verrücktheit, doch am unwirklichsten und doch gültigsten war das Blut, das dem Jungen aus der Nase über den Mund gelaufen war. Als er ins Haus zurückkam, hatten die anderen die Szene am Teich bereits vergessen. Alles dauert immer nur einen Augenblick, das ganze Leben.
Nur dreißig oder ein paar mehr Stunden zuvor, er war des Stundenzählens müde, bekam die Verschiebung sowieso nicht berechnet, die Lücke nicht geschlossen, als hätte der Flug seinen Körper und seine Denkfähigkeit fragmentiert, nur dreißig oder mehr Stunden zuvor also hatte er diesen verwirrten Jungen auf die Straße gesetzt. Saß anschließend auf der Terrasse des Laurel Canyon Country Store vor einer Tasse Kaffee und sprach mit jemandem, den er vom Sehen kannte. Über die Veränderungen im Canyon, darüber, dass sich das Geld hier langsam einkaufte, die Häuser ummodelte und Swimming Pools in die Grundstücke grub. They paved paradise to put up a parking lot, wie Joni es ein paar Abende zuvor auf ihrer Terrasse gesungen hatte, einer, vor der es keinen Swimming Pool gab.
Im Laurel Canyon waren die Straßenkreuzung und der kleine Platz vor dem Country Store ein Flickwerk an Straßenasphaltierung, dahinter zogen sich die Mauern aus groben, übereinandergeschichteten Steinen vor den schroff ansteigenden Grundstücken nach oben. Gehwege gab es nicht, weil es keine Fußgänger gab, und wenn, musste man sich seinen Weg erkämpfen, um an sein Ziel oder zumindest an sein Auto zu kommen. Die efeuumrankten Bäume dicht an der Straße, hinter jeder Kurve ein kurzer Blick auf die steil ansteigenden Erdaufwürfe der Santa Monica Mountains mit ihren zerklüfteten Canyons. Raues, uraltes Land, übereinandergeschobene Krusten, die an ihren Oberflächen in den trockenen Sommern zu pulverisierter Erde wurden, entstanden aus den tektonischen Verschiebungen der pazifischen und der nordamerikanischen Platte, am Mount Lee kurzfristig bezwungen durch das Hollywood Sign; und zur anderen Seite, vorbei an Santa Clarita und Agua Dulce in das weite Land der Mojave-Wüste hinein, die hinter allem liegt, in der ein Wunsch nichts gilt. Durch diese Landschaften werden seine Gedanken geformt, und zwischen den Bergen und der Wüste, der Rauheit und dem Streben nach Auflösung, verbringt er seine Tage und Nächte. Der Laurel Canyon ist sein liebster Ort auf dieser Welt.
Mit ruhigem Blick drosselt er das Tempo seines Käfers, vorbei an den ersten Häusern. Schon von weitem sieht er den Knick im Straßenverlauf, er sieht auch die Ursache dafür, ein Fachwerkhaus, das sich mit einer Ecke spitz in die Fahrbahn schiebt. Er stellt sich vor, wie es wäre, direkt auf den Kaugummiautomaten zuzuhalten, der an der Hauswand hängt, und erst im letzten Moment auszuweichen, nimmt sich sogar noch die Zeit, kurz in den Rückspiegel zu schauen, eine Fingerkuppe, die einen Tabakkrümel aus einem schwarzen Oberlippenbart entfernt, Haare, wild, wie sie keine Wetterauerin zu tragen gewagt hätte, vom Mittelscheitel geteilt, in schwarzen Locken auf Stirn und Schultern liegend; und ein schwarzes Auge, das sich jetzt schon wieder auf die Straße richtet, um noch einen Blick auf die Radfahrerin zu riskieren, die an ihm vorbeisaust, ein blondes Babe mit langen Beinen. Er zieht gerade an seiner Zigarette, da fängt der Käfermotor an zu stottern. Manchmal sind es nur wenige Sekunden, die Wohlbefinden von drohender Gefahr trennen, und so sitzt er jetzt auch ganz aufrecht, sogar leicht nach vorn gebeugt. Drei Fehlzündungen lassen einen Hund aus einem der Höfe auf den Bürgersteig rennen und ihm bellend hinterherschauen. Was gerade noch so sanft vor sich hin glitt, ist außer Kontrolle, er kann sich auch nicht mehr daran erinnern, wie der Ort heißt, in dem ihm vielleicht das Auto verreckt, kann sich die deutschen Ortsnamen sowieso nicht merken. Der Rauch seiner Zigarette beißt ihm in den Augen, dafür ist jetzt keine Zeit, er kneift die Lider zusammen und lässt die Kupplung schleifen, pumpt mit dem Fuß, das wirkt, der Käfer nimmt Vollgas an. Er sieht die Hausecke auf sich zukommen, den Kaugummiautomaten, sogar einen Riss im Bordstein sieht er, aus dem ein Grasbüschel sprießt. In einer Art vorweggenommenen Unfallgefühls hört er das Geräusch, mit dem der Gummi vom Vorderrad abgeschliffen und die Radkappe weggesprengt würde, wenn er nicht sofort ausweicht. Er reißt das Steuer in die andere Richtung, der Käfer schießt über die Mitte der Straße hinaus, aber er schafft es nicht, die Anspannung der Hände vom Fuß zu trennen, sondern klammert und gibt dabei noch mehr Gas, das Klammern unüblich für ihn, er ist ein Freigeist, das Gasgeben entspricht ihm eher, doch diesmal in der falschen Situation. Der Bürgersteig zu seiner Linken kommt näher, er weiß, wenn er jetzt das Gas nicht wegnimmt, wird er ihn anschneiden. An einer Hauswand leuchtet die Sonne durch einen schwarz beschrifteten Milchglaskasten; Zum Grünen Baum, die Punkte über dem Ü kann er selbst jetzt gut leiden, two funny dots at the back of my head, zwei lustige Punkte in seinem Hinterkopf. Genau darunter prallt auch schon der Reifen auf den hohen Bordstein; Metall auf Kante, es kracht erbärmlich, schleift. Er bremst heftig. Vergisst die Kupplung, der Motor springt ein letztes Mal. Und ist dann still. Jetzt endlich rollt auch die Radkappe vorbei, kreiselt, bleibt liegen und reflektiert die Sonne.
Er öffnet die Tür und wirft die Zigarette hinaus, zieht sich am Rahmen aus dem kleinen Wagen und steht nun aufrecht in Randstetten. Die Stiefelspitze genügt, mit einer Drehung ist der Stummel ausgemerzt, er schlägt mit der Faust aufs Dach, einmal, zweimal und ein drittes Mal, und sagt im Takt mit lauter Stimme: Fuck. Ein Wort, das Randstetten noch nie zuvor gehört hat.
2.
Sie heißt Evelyn. Evi in der Schule, das Evschen im Dorf, Ev nennt sie sich selbst. Mit fünfzehn hatte sie sich ihren Namen gegeben, während einer Erdkundestunde, der letzten Schulstunde des Tages und einer der letzten ihrer Schulzeit. Im Klassenzimmer roch es nach feuchter Erde und Haarspray, vorne an der Tafel wurde die Flurbereinigung erklärt. Einige gähnten, sie waren bereits in Lehrstellen untergebracht, andere gaben sich den Anschein von Aufmerksamkeit, um zu zeigen, sie wüssten nun, worum es im Leben ging. Ein kleiner Rest, vielleicht drei oder vier, blieb auf dem elterlichen Hof und würde bald morgens noch ein wenig früher aufstehen, zwei davon hatten alle Träume begraben und jetzt schon ihre Köpfe auf den Oberarm gelegt, träge blickten sie auf die eingeritzten Herzen und Schimpfworte vor sich auf dem hölzernen Schultisch. Die Zeiten des Zettelchenschreibens unter den Bänken waren vorbei.
Den Kopf in die Hand gestützt, schrieb sie ihren Vornamen hintereinanderweg. Seit der vierten Klasse neigte sich ihre Schrift nach links, das E war ein Pummelchen und alles, was danach folgte, seine halbwüchsigen Geschwister, vom Umfallen nur abgehalten durch das Ypsilon, das mit seinem Arm die Zeile unterhakte. Immer mehr Evelyns reihten sich aneinander und verschwammen nach der dritten Reihe vor ihren zusammengekniffenen Augen zu einer Spitzenbordüre, die ihrem Namen nicht mehr ähnelte, sooft sie auch blinzelte. In der fünften Zeile begann sie, die Evelyn aufrechter zu stellen. Die Buchstaben besaßen ihre eigene Trägheit und ließen sich nur beugen, wenn sie das nach rechts geneigte Heft beim Schreiben langsam drehte, so lange, bis es waagerecht vor ihr lag. Da standen sie gerade, wackelig zwar noch, aber sie hielten sich. Die Sache war ernst, auch sie selbst saß jetzt ganz aufrecht. Runde Buchstaben, die nach links kippten, ließen auf ein kindliches Gemüt schließen, hatte sie irgendwo gelesen, wahrscheinlich in einem Reader’s Digest ihrer Mutter. Ihr Handgelenk schmerzte. An der Tafel ging es um Raumordnung und Landschaftsbild, mit steifem Rücken sorgte sie nun dafür, dass sich ihr Name nach rechts neigte. Immer flüssiger schrieb sie ihre Evelyn, und als sie am Ende der Seite müde wurde, verschrieb sie sich, die Buchstaben rutschten ihr nach oben weg, das kleine e ging verloren, aus dem Rest war zuletzt sogar eine Milchzahnreihe geworden. Was blieb, war Ev. Ein Name, der klang wie die Namen im Fernsehen, spätabends im Dritten Programm. So war sie an einem Julimittwoch im Jahr 1967, kurz bevor die sechste Stunde zu Ende ging, ihren fünfzehn Jahren entwachsen.
Zwei Jahre später, mit siebzehn, macht sie täglich ihre Gänge, hat ihre Wege, mit dem Fahrrad durch den Ort, eine Besorgung für die Oma hier, einen Abstecher in den Feldweg dort, um allein zu sein, nur kurz, und sich im Sommer barfuß auf die trockene Erde zu stellen. Täglich fährt sie mit Bus und Zug nach Friedberg, von dort nach Hanau und wieder zurück. Fremdspracheninstitut Dr. Erna Hecker – staatlich anerkannt –, mit Sprachlabor, dafür hat die Oma gesorgt, sie bezahlt die Sprachschule. Und wenn ich von trocken Brot lebe, das Kind macht seinen Abschluss. In Hanau tippt Ev ihre Sätze, übt englische Korrespondenz nach Stichwort, Dear Sir or Madam, Yours faithfully, Evelyn Böhm. Sie spricht Business-Englisch nach Band, Wiederholung/Stopp, Wiederholung/Stopp, und holt sich mittags ein Mohnbrötchen mit Butter im Café Weiermann am Marktplatz. Hin und wieder schaut sie schnell noch nach den Schnäppchen auf einem Wühltisch. Jeden Samstag war sie mit ihrer Mutter in die Stadt gefahren, die Brötchen mit Butter spendiert hat und für Ev manchmal einen Haarreif oder eine Sommerbluse. Einmal kaufte sie Strumpfhosen, ein Paar für sich, eines für Ev. Für Ev waren es die ersten Nylons, für ihre Mutter besiegelte das eingearbeitete Höschen das Ende ihrer Strumpfhalter. Mutter und Tochter mit zwei Größen Unterschied, zum Abschluss gönnten sie sich noch zwei Stück Schwarzwälder Kirsch. Es war ihre letzte gemeinsame Stadtfahrt, seit einem Jahr kauft Ev sich ihre Feinstrumpfhosen selbst, seit sie auf der Sprachschule ist, darf sie ihre Trinkgelder aus dem Grünen Baum behalten. Vor Hertie, wenn sie nach Schulschluss auf den Bus zum Bahnhof wartet, tufft sie mit einem Blick in das Schaufenster noch etwas ihre Haare am Hinterkopf auf, kurz sieht sie ihr Leben Wirklichkeit werden gegen den hellen Platz in ihrem Rücken, dann fährt der Bus ein, verschluckt ihre Spiegelung im Fenster, das Cromargan von WMF auf der Tischdecke mit den aufgedruckten Tomaten rückt wieder in den Vordergrund. Zischend gleiten die Bustüren auf. Drei Monate hat sie noch. Sechs Stunden am Tag ist sie eine Frau in der Stadt, das ist ihre Mutter nicht. Nachmittags um fünf ist sie wieder zu Hause im Grünen Baum.
3.
Sie schließt die Vordertür auf und teilt den Vorhang im Windfang mit beiden Händen, dunkelbrauner Filz, kunstledergesäumt. Sieht aus wie Hund, ihr immer gleicher Gedanke, der Vorhang riecht auch so, und trotzdem bleibt sie stehen, bis er sich hinter ihr schließt und ihre Haare berührt. Und schon umgibt sie der Kneipengeruch wie eine Altersschwäche, eine Mischung aus abgestandenem Nikotin und Bier, das in den Ausguss gespült wurde. Aus Küchenfett, das sich, gleich nach dem Mittagstisch während des Lüftens mit beidem verbunden hat, als gelte es, die Welt anzuhalten. Riecht nach zu Hause, hat Rudi einmal gesagt, da war er noch gesprächiger, ihr Onkel, der große schwache Bruder ihrer Mutter, der Angst hat vor Veränderungen. Der Geruch ist nur durch eine angezündete Zigarette, frisch gezapfte Biere, durch Stimmen und Stühlerücken zu vertreiben. Die Kneipe muss wieder warmgetrunken werden, sagt die Oma fast jeden Nachmittag.
Es ist still im Raum, wie immer um diese Zeit. Die Oma und die Mutter sind in ihren Zimmern im zweiten Stock, was Rudi treibt, weiß niemand genau, wahrscheinlich hält auch er noch seinen Mittagsschlaf. Die Julisonne hat sich auf den Fensterbänken breitgemacht und sticht mit aller Kraft durch die Ritzen der halb heruntergelassenen Rollläden, bringt die Riffelglaseinsätze in den Oberschränken in einem hellen Braun zum Leuchten, Ev weiß nie, ob sie bernsteinfarben oder nikotinbeschlagen sind. An den Wänden hängen die alten Schwarz-Weiß-Fotografien, Jahrzehnte verschiedener Stammtischbesetzungen gerahmt über dem Stammtisch, sie kennt sie alle in- und auswendig. Über der Durchreiche zur Küche ist die Theke zu sehen, aufgenommen noch vor dem Krieg, der dunkelbraune Sockel auf dem Foto schwarz. Auch der Hof ist abgebildet, bis die Oma ihn übernahm, wurde er noch bewirtschaftet, auf dem Kopfsteinpflaster, eng beieinander, Frauen mit schweren Beinen unter wadenlangen Röcken. Die Männer – Tagelöhner vielleicht, auf jeden Fall fremd – stehen in eigenen Gruppen mit verschränkten Armen und Bauernmützen über ratlosen Augen. Auf einem Bild ist sie selbst als Baby im Arm ihrer Mutter zu sehen, auf der obersten Treppenstufe vom Grünen Baum, die Mutter in einem dünnen Kleid, ohne ein Lächeln. Rudi hatte es geschossen, die Agfa-Synchro-Box wurde angeschafft, als etwas Geld im Hause war. Mittlerweile hat er eine Kodak und knipst wie wild. Ein anderes Bild zeigt Bobby, ein echter Deutsch-Drahthaar, wie Rudi immer betont; schokofarben steht er vor dem Misthaufen, seine Zunge hängt heraus, zutraulich schaut er aus seinen hellbraunen Augen in die Kamera. Niemand kann sich daran erinnern, wer dieses Bild aufgenommen hat, es muss jemand gewesen sein, der Hunde liebte und einen guten Blick hatte. Immer schon stach es heraus aus der Galerie verschlossener Menschen, Bilder, die von der Oma hängen gelassen wurden, weil die Dorfgemeinschaft darin ihre verwinkelten Stammbäume ablas, der Hund war größer als jeder Mensch auf den anderen Fotos und das einzige Lebewesen, das zu lächeln schien. Bobby wurde mit dem Grünen Baum übernommen, er starb, als Ev vier Jahre alt war, ihm war ein weiterer Bobby gefolgt, auch er schon tot.
Sie stellt ihre Tasche auf die Sitzbank in der Stammtischecke und legt den Haustürschlüssel auf den Tisch, sorgsam auf das Webdeckchen, der Schlüsselanhänger darf keinen Lärm machen, niemand soll vor der Zeit von oben herunterkommen. Mit der Hand fährt sie am Rand des Deckchens entlang und nimmt die Fussel auf, ihre Haut fein gegen das Gewebe. Ein halbleeres Glas, vergessen auf der Fensterbank, nah am Usambaraveilchen, das Bier darin von einem unsauberen Gelb, schon lange ohne Schaum. Der Scherz eines Mittagsgasts. Sie nimmt es mit zur Theke und zapft sich dort eine Cola. Die Bild-Zeitung auf dem Tresen ist ganz zerlesen von Oma und Mutter, beide lecken sich immer über den Zeigefinger vorm Seitenumschlagen, sie wird nur die oberen Ecken anfassen.
Es ist die Zeit am Tag, in der sich alles ausdehnt. Für eine halbe Stunde gehört der Raum ihr allein. Gegen halb sechs wird die Oma die Küche für den Abend richten. Ev hilft in der Kneipe, sooft es geht. Sie säubert die Fremdenzimmer, wenn es passt, das ist sie der Oma schuldig. Heute ist nichts zu tun, keines der Zimmer ist belegt. Später wird es voll werden, wie immer freitagabends, nur wer Tiere im Stall hat, muss noch arbeiten. Appetit holt man sich draußen, gegessen wird zu Hause, so heißt es im Ort in vielerlei Hinsicht, trotzdem wird bald Jupp auftauchen, Kleinerts Jupp, den sie auch Eier-Jupp nennen, weil er sich schon früh mehr Hühner zulegte, als das Dorf gebrauchen konnte, gutes Geld verdiente damit als fahrender Eiermann bis runter nach Hanau und Offenbach, wo er mit Ständen voller Gemüse, braunen und weißen Eiern – Frisch aus der Wetterau auf Ihren Tisch! – auf den Wochenmärkten zu einer festen Größe wurde. Jupp wird also als einer der Ersten auftauchen und seinen Teller leerputzen, ab freitags zeigt er seiner Schwiegertochter das ganze Wochenende hindurch, was er von ihrer Kocherei hält. Am Stock wird er auf seinem Aussiedlerhof die Treppe vom Obergeschoss herunterkommen, die Krakeelerei hinter sich lassen, die er während der Woche durch Schweigen anstachelt, bis sie sich am Freitagabend schließlich erschöpft hat. Grimmig wischt seine Schwiegertochter den Flur feucht durch, während Wilhelm, sein Sohn, im Hof den neuen Wagen mit dem Gartenschlauch absprengt. Nicht ohne zuvor Rex oder Hasso noch ruppig hinter dem Ohr zu kraulen, so, dass eine Wolke Hundehaare durch den feuchten Hausflur weht. Dann wird er wortlos die Haustür hinter sich zufallen lassen und sich mit seinem Fahrrad auf den Weg in die Wirtschaft machen. Ev kennt alles, schon als sie als kleines Mädchen an der Hand der Mutter den Gartenzaungesprächen zuhörte, waren es die gleichen Klagen.
Um kurz nach sieben werden die Skatbrüder mit ihrem Stühlerücken am Stammtisch beginnen. Und, Rosi, wie?, werden sie ihrer Mutter mit roten Gesichtern zurufen, und einer wird gegen die kleine Kuhglocke über dem Stammtischaschenbecher schlagen, ein Zeichen für die erste Runde, von Evs Mutter schon so gut wie gezapft. Wenn der Tisch freigeräumt ist und die Karten gemischt werden, hat auch die freiwillige Feuerwehr ihre Übung beendet und die Tür wird sich erneut öffnen. Aufgekratzt und mit Tränensäcken unter den Augen werden die Männer ihre Bestellung schon in Richtung Theke rufen, bevor sie sich setzen, die Stimmen noch laut von den Zurufen beim Auf- und Abrollen der Löschschläuche. Ein Schnäpschen in Ehren.
Gegen halb neun gibt es nichts mehr zu sagen am Bushäuschen, dann poltern die Dorfjungs durch die Tür und verziehen sich in ihre Ecke, der Tisch vor dem Kegelautomaten ist ihrer, weit entfernt vom Stammtisch. Der Kegelautomat ist vorsintflutlich, werden sie wie immer sagen, eine Minikegelbahn auf einem Tisch, statt der Kugel Holzscheiben, die Kegel selbst aus Vollholz an Schnüren, das ist was für alte Leute oder kleine Kinder. Warum nicht gleich einen Flipper hinstellen, da wäre endlich mal was los, und man käme nicht um vor Langeweile, in der Ecke gibt es sogar eine Steckdose.
In der Kneipe haben sie eine große Klappe, haben mit ihren Eltern nichts zu tun, hier gelten andere Regeln als zu Hause, manch einer stützt später den Vater auf dem Weg die Hauptstraße entlang. Mit hochgezogenen Schultern hocken sie da und bestellen sich jeder ein kleines Bier, sogar einen Asbach können sie sich erlauben, wenn das Lehrgeld reicht, manchmal auch ein kleines Gematschel, Pommes in Jägersoße in einem Suppentopf, von der Oma für sie erfunden, eine Mark fuffzig. Vom Ortsausgang her werden ein paar Langhaarige aus dem Sunnyside auf ein Bier kommen, weil es im Grünen Baum billiger ist als in der Dorfdisko, weil sie hin- und herziehen müssen am Freitag und am Samstag, böse Blicke ernten und den Dorfdeppen zeigen, wie kleinkariert sie sind, und weil auch das Sunnyside nicht die Welt ist. Gelangweilt werden sie im Weg herumstehen, ein paar Witze machen, abschätzig beobachtet von der Stammmannschaft, die sich darüber beschwert, wenn die Straße mit Nauheimer und Friedberger Autos zugeparkt ist. Und überhaupt, die Kreischmusik, die man bis auf die Straße hört, die Autotüren, der Krach in der Nacht. Volk und Studentengesocks, Gammler, man weiß auch gar nicht, woher die das Geld haben für den Schuppen, man ahnt es aber, sie liegen ihren Eltern auf der Tasche, und wenn nicht ihnen jetzt, dann später dem Steuerzahler. Ev rollt mit den Augen, wenn sie das Geschimpfe anhören muss, es ist ihr peinlich, wie die Leute keifen im Selbstverständnis, Randstetten sei der Nabel der Welt, weil sie ein paarmal in ihrem Leben im Urlaub waren und im Sommer mit dem Verein nach Rüdesheim zum Saufen fahren. Manchmal regt sie sich sogar abends im Bett noch über alles auf, jeden Klang, jede Stimme, selbst auf den farbbeklecksten Griff ihres Fensters, den sie im Dunkeln ahnt, wird sie dann wütend.
Manni wird da sein, zwischen Bushäuschen und Beatschuppen wird er im Grünen Baum seinen Stuhl herumdrehen und breitbeinig wie ein Cowboy darauf sitzen, die Lehne vor der Brust, in der Kneipe ist man mehr Mannsbild als auf der Kreidler Florett. In der letzten Woche hat er sich spitze Stiefel gekauft, Ev mag seine enge Lederjacke und wie er darauf besteht, von ihr sein Bier gebracht zu bekommen, der liebt dich, werden die anderen feixen, und sie weiß, alle außer Manni schauen verstohlen hinter ihr her, wenn sie zur Theke geht. Es tut ihr leid, wenn die Jungs sich über den Kegelautomaten lustig machen, es tut ihr weh für die Oma, die ihn vor Jahren angeschafft hat im Glauben, etwas Gutes zu tun, ihre Oma, deren Oberarme immer kalt sind und die auch im heißesten Sommer keine Wärme abstrahlt. Manchmal denkt sie, die ganze Welt ist unzufrieden. Und doch, die lauten Stimmen, die Musik, das honigweiße Licht über den Tischen, spät am Abend nimmt sie alles mit hinauf in ihr Bett. Schon als Kind ist sie immer gut eingeschlafen.
Sie holt die Bravo aus ihrer Tasche und die Petra. Sie ist zu alt für die Bravo, kauft sie hin und wieder aber doch, blättert sie kurz durch, Kinderkram, wird sie später Rudi zustecken, damit er nicht spürt, wie sie sich verändert. Irgendwann vielleicht nicht mehr da ist. Vielleicht muss sie gar nicht mehr so tun, als gehörte die Bravo zu ihrem Leben, vielleicht kann sie Rudi einfach jeden Donnerstag eine kaufen und mitbringen?
Barry Ryan am Bravo-Telefon, ernst blickt er in die Kamera. Uschi Glas, mit dem Kopf auf den Unterarmen. Ev schaut ihr in die Augen, dann legt auch sie ihre Schläfe auf ihre Unterarme, ihr Handgelenk auf das von Uschi.
Wie ruhig die Stühle dastehen, vornüber gegen die Tischkanten gelehnt. Die geraden Rückenstreben, das Henningerbraun, an den Lehnen schon ganz abgegriffen, sie mag es, wenn die Dinge so aussehen, wie sie sind. Niemand, der jetzt vielleicht durch die Hoftür von hinten in den Schankraum tritt, würde wagen, sich auf einen dieser Stühle zu setzen. Hinter der Theke hängt die Dreiliter-Asbachflasche verkehrt herum, doch der Aufkleber mit der Schrift ist richtig, da wurde endlich einmal mitgedacht, sagen die Männer manchmal, wenn noch nichts los ist und ihnen nichts Besseres einfällt. Mitgedacht, mitgelacht, sagen sie auch in der Sprachschule immer, wenn einer einen Fehler macht. Ein Asbach-Uralt-Witz. Ihr fallen die Augen zu, sie kann nichts dagegen tun. Sie riecht die Bravo, jede Woche der gleiche aufregende Geruch nach den Dingen, die niemand versteht, der nicht mehr zur Schule geht. Ihre Arme kleben am Papier. Die Hintertür zum Hof wird geöffnet und fällt zu. Gleich nachher wird sie mit der Mutter darüber reden, was alles rausmuss aus der Musikbox. Sie kommen beide nicht an der Oma vorbei, die will keine Urwaldmusik in ihrer Gaststätte. Abends singt die Mutter, die den alten Kram ebenfalls nicht leiden kann, trotzdem leise mit beim Gläserspülen, aber nicht bei Heintje und nur während der Woche, dann sind die Fernfahrer da. Die essen manchmal zwei Schnitzel hintereinander, damit alle lachen, und werfen die Markstücke reihenweise in den Schlitz, Das Mädchen Carina, Es wird Nacht, Señorita, Sind Sie der Graf von Luxemburg. Eloise, die Beatles und noch ein paar andere, dafür hat Ev gesorgt. Ihre Mutter kennt auch die Fernfahrer auswendig, und wen sie nicht kennt, der lernt sie kennen. Sie flirtet zu viel, redet zu viel nach rechts und links, Ev möchte sie so nicht sehen. Wenn sie für jeden da ist. Dabei ist sie doch sonst nicht so. Aber man muss die Oberhand behalten, das hat ihr die Mutter erklärt, weil es vom Scherz, bei dem man nicht das letzte Wort hat, zum Spott ein kurzer Weg ist im Gastraum. Verarscht werden, das kennt Ev auch, dabei denkt sie an Rudi. Nein, das will man nicht.
Wenn sie jetzt aufhört zu denken und es schafft, ihre Augen hinter den Lidern ganz ruhig zu halten, sich auf ihn zu konzentrieren und doch auch nicht, taucht der Vater wieder auf. Er kommt nur zu dieser Stunde, eine schwarz-weiße Figur wie von einem der Fotos, doch schlank und jung und in einer Bewegung, die sich aus der Ferne nähert; das Gesicht aber nie zu erkennen. Sie weiß nur, wie er nicht sein soll. Nicht so wie die Männer im Dorf, die beim Skat so laut werden, dass die Oma den Kopf in die Küchendurchreiche hält und Na! Also! Geht’s noch? ruft. Männer mit breiten Hüften, über denen während der Woche die blauen Arbeitshosen festgezurrt sind, und beigefarbenen Garbardinehosen, die sie bei einem Krankenhausbesuch tragen oder wenn sie mit der Familie nach Frankfurt in den Zoo fahren, wo sie schon nach wenigen Minuten die Hände ihrer Kinder loslassen, um abseits eine Zigarette zu rauchen. Sie versucht, vom Körper der Mutter und von ihrem eigenen auf den Körper des Vaters zu schließen. Im Unterschied muss der Vater erkennbar sein, doch sie hat die Merkmale noch nicht gefunden, bestimmt wäre es einfacher, wenn sie ein Junge wäre.
Die Hände der Mutter sind fest, mit breitem Handrücken, ihre Handgelenke kräftiger als die eigenen, aber sie steht auch täglich hinter dem Tresen und spült die Gläser, immer eines in jeder Hand, das sie rasch über die Spülbürsten stülpt. Nimmt ein Tablett mit fünf Pils vom Tresen und hat schon zwei große Schnitzelteller auf dem anderen Arm. Zapft den Asbach mit einer geübten Drehbewegung. Ev schafft von all dem nur die Hälfte, sie hat andere Hände und Arme als die Mutter und ist auch weicher in der Bewegung, das hat die Oma ihr einmal gesagt, als sie allein mit ihr war, aber mehr auch nicht.
War der Vater ein Schaffer, wie man diejenigen hier nennt, die sich auf dem Hof oder im Betrieb nichts schenken lassen und die deshalb auch ein bisschen lauter sein dürfen als die anderen und ein bisschen mehr saufen; oder war er ein Bürohengst, ein Sesselpupser, vielleicht sogar einer dieser Vertretertypen, wie sie im Grünen Baum oft absteigen, Gebiet Frankfurt bis Fulda? Vielleicht ein Künstler. Und ein Künstler, ein sensibler Künstler, hat dunkle Haare; dunkelbraun. So sehen die Schriftsteller im Reader’s Digest aus. So sehen die Musiker in der Bravo aus, die das mit den Gitarren machen, was keiner leiden kann. Die Beach Boys sind fast alle blond, die Schauspieler auch, die anderen sind dunkel. Bis Ev in der Mittelschule die Mendel’schen Gesetze auswendig lernen musste, hatte sie ihre Zweifel an der dunklen Haarfarbe des Vaters, denn sie selbst ist blond. Das Haarteil der Mutter ist auch blond, von einem künstlichen Goldblond, so färbt sie sich auch die richtigen Haare, Tel-Aviv-Blond, wie es einer der Fernfahrer einmal nannte, aber auch gleich noch hinterherrief, Du bist eine rassige Frau, Rosi, so oder so, ob dunkel oder blond. Denn die Mutter ist ja von Natur aus dunkel, noch auf Evs Kommunionfoto war sie es, und genau das ist der Haken. Aber seit Mendel und seit sie die Großmutter nach deren früherer Haarfarbe fragte, weiß sie, dass es gehen könnte: die Mutter dunkel, der Vater dunkel, das Kind blond. Er kann sogar Locken gehabt haben, obwohl Ev selbst so stracke Haare hat wie ein Pony. Aber aus der Mutter etwas rauszukriegen ist so unmöglich wie Mäusemelken, denn die Mutter spricht nicht von dem, was sie weiß. Sie spricht lieber von Dingen, von denen sie keine Ahnung hat.
Nur einen Moment noch, bis Rudi die Treppe herunterkommt, zögernd, die Stufen werden weniger knarren als bei der Mutter oder bei ihr selbst. Dann muss sie wieder zu sich kommen. Rudi sieht schwerer aus, als er ist, mit seinen hängenden Schultern und dem runden Gesicht. Mit seiner rechten Hand, ganz rot marmoriert, wird er das Treppengeländer abwärtstasten, Ev sieht es vor sich, wie sich seine grauen Nägel weiß verfärben, weil er sich zu sehr festhält. Er hat so große Angst zu fallen. Im letzten Jahr war er gestürzt, spätabends am Hinterausgang zum Hof lag er, die Kneipe war schon geschlossen und alles dunkel. Die Mutter und die Oma hatten ihn ins Bett gehievt und geflüstert dabei. Bestimmt eingeschlafen auf dem Klo. Und dann hingeknallt im Suff. Am nächsten Nachmittag waren seine Zeige- und Mittelfinger vom Nikotin noch brauner als sonst. Seitdem nennt Ev ihn nicht mehr Onkel und auch nicht Rudi und auch sonst nichts, aber sie zieht ihm Zigaretten aus dem Automaten neben der Kellertreppe, wenn er es nicht mehr schafft.
Kurz vor der Oma wird er in die Küche kommen, sich auf die Küchenbank setzen und warten, bis die einen Kaffee vor ihm auf den Tisch stellt. Schon siebenunddreißig und immer noch der Oma ihr Kind. Auf der Flucht immer langsamer geworden, nicht nur in den Bewegungen, auch im Kopf. Wie ein König auf seinem Schatz wird er auf der kurzen Seite der Eckbank thronen und den Kopf langsam zur Durchreiche wenden, wenn die ersten Gäste da sind. Die ganze Eckbank war ja nur für ihn angeschafft worden, damit er nicht vorne im Kneipenraum rumhockt, damit es überhaupt einen Platz für ihn gibt. Im langen Teil sind seine Asterixhefte und Evs Bravos unter der Sitzbank vergraben, im kurzen Teil seine Landserhefte, sein großer Stolz, doch nur heimlich hervorgeholt. Als Kind durfte Ev sie nicht sehen, die Oma hatte verboten, dass die Hefte jemals auf den Küchentisch gelegt wurden. Die Stahlhelme, die jungen Männer, die in die Knie sanken auf den Titelblättern und den Kopf in den Nacken warfen, alles Lüge, sagte sie, dieses Mensch hat uns alle um den Verstand gebracht.
In der Küche rumort es, eine Pfanne wird auf dem Herd hin- und hergeschoben, vielleicht hört Ev auch den Starfighter über das Dorf hinwegrollen. Was sie jedoch nicht hört, ist seine Auflösung durch die Schallmauer hindurch, stattdessen lässt die Oma ihre Pfanne auf einen der gusseisernen Herdringe knallen. Uschi Glas bleibt vor Schreck mit dem halben Gesicht an Evs Unterarm hängen, dann reißt die ganze Seite. Ein wenig Uschimund hat ihren Unterarm bedruckt, Ev sieht es, als sie den Streifen von ihrer Haut abzieht, dann sieht sie auch Rudi durch die Durchreiche, der sie aus wässrigen Augen beobachtet und keine Miene verzieht. Sie hat ihn nicht die Treppe herunterkommen gehört. Jetzt schnell die Zeitschriften vom Tisch, umziehen, und nichts wie raus, es ist ihr täglicher Ehrgeiz: Die Hoftür muss sich hinter ihr schließen, noch bevor die Oma den Fleischklopfer auf das erste rote Schnitzel fallen lässt.
Die Kirchturmuhr zeigt zwanzig vor sechs, als sie ihr Fahrrad aus dem Hof schiebt und aufsteigt, auf der Hauptstraße ist es so still, wie es um diese Zeit im Juli in der Wetterau nur sein kann. In den Höfen liegt das warme Kopfsteinpflaster noch zur Hälfte in der Sonne, Hofhunde dösen im Schatten, manche sind vor der flirrenden Hitze in einen Hausflur geflüchtet, mit dem Blick zur Küchentür warten sie, ob sie gerufen werden. Beim Metzger sind die Jalousien heruntergelassen, nur ein rosa Gipsschwein neben der Eingangstür zeigt, man könnte noch ein Viertel Hack holen. Der Bäcker hat kaum mehr etwas in den Regalen, der Bienenstich, schon leicht hinüber, wird morgen an die Schweine in der Nachbarschaft verfüttert, auch die Oma gibt die Reste weg. Schweineschnitzel an Schweine, Ev muss bei jedem Schnitzel vor sich auf dem Teller an die Matrjoschkas denken, die Wilhelm im Edeka-Laden in der Schreibwarenecke stehen hat, direkt neben den Brokatdeckchen. Ein Kinderfahrrad lehnt im Fahrradständer vor dem Schaufenster, die Stützräder hochgeklappt. Das Hoftor daneben wird von innen zugezogen.
4.
Im Fünfliterboiler über dem Spülbecken brodelt es, ihre drei Eisenpfannen, mit Zeitungspapier ausgewischt, stehen schon auf dem Herd. In der Drehung sieht sie ihre Enkelin an der Küchentür vorüberlaufen, die Hintertür wird aufgestoßen, das Hoftor quietscht in den Angeln. Man hört sie nur und sieht sie kaum um diese Tageszeit, sie vermeidet, mit ihr und Rudi allein in der Küche zu sein, sie hat einen Sprung gemacht im letzten Jahr. Ist älter geworden, und auch eigen.
Rudi sitzt schon hinter ihr auf seiner Eckbank, die Hände auf dem Arbeitstisch, sitzt da mit seinem runden Gesicht und betrachtet die glänzende Haut seiner Finger. Sie weiß es, ohne hinzuschauen. Manchmal wäre ihr lieber, er würde ihr wie früher Fragen stellen, doch er spricht schon seit langem nur noch das Nötigste. Um diese Uhrzeit wartet er auf seinen Kaffee. Der Wasserkessel pfeift, der rote Knopf des Boilers springt heraus, nur die immer gleichen Handgriffe halten eine Küche in Takt. Sie schneidet ihm ein Stück Streuselkuchen frisch vom Blech, brüht den Kaffee im Filter auf und lässt das Wasser aus dem Boiler in das tiefe Spülbecken mit seinen Wänden voller Haarrisse laufen. Auch wenn es auf seinem Grund schon ganz rau ist, sie wird bei ihrem Spülbecken bleiben. Es hat die Farbe von Milch.
Na, Mutter, sagt Rudi, als sie den Kaffee vor seine Hände stellt, schwarz, wie er ihn um diese Uhrzeit braucht, und den Streuselkuchen dazu. Es ist dieses Aufmüpfige in seiner Stimme, die Verbindung zwischen Tonfall und Wortwahl, die manchmal ihren Widerstand hervorruft, die imitierte Manneskraft, die er in diese zwei täglich wiederkehrenden Worte legt. Er ist der einzige Mann in der Familie, darauf besteht er. Aber er schaut ihr nicht in die Augen, wenn er mit ihr spricht, seit seinem Sturz im letzten Jahr, nachdem sie ihm die Unterwäsche wechselte wie einem kleinen Kind, erwidert er ihren Blick nicht mehr. Er spricht seine zwei Worte hin zum schwarzen Kaffee, als wäre sie gar nicht da, und da tut er ihr auch schon wieder leid. Man steckt nicht drin in ihm. Man möchte es auch gar nicht.
Sie lässt Kaltes zu ihrem Spülwasser laufen, spritzt Pril rein und schaut hoch in den Spiegel, der über der Spüle hängt, vom Lauf der Jahre scheint er fast unmerklich nach oben gerückt zu sein. Ihre Ohrringe zittern, es sind immer noch die Ohrringe, die sie kurz vor ihrer Hochzeit kaufte, winzige achteckige Steine, in Gelbgold gefasst. Sie wippen bei jeder ihrer Bewegungen in ihren ausgeweiteten Ohrlöchern, gehören zu ihr wie ihr Ohr selbst. Mit kleinen Augen und schmalem Mund prüft sie ihr graues Haar, das im Nacken kurzgeschnitten ist, die Dauerwelle, die sie sich manchmal legen lässt, wenn Rosi sie dazu drängt, ist über die Stirn nach hinten ausgekämmt.
Rudi stellt die leere Kaffeetasse auf den leeren Kuchenteller, er isst unregelmäßig, doch mit der Gleichgültigkeit eines Menschen, der die Mengen nicht abschätzen kann, es ist Viertel vor sechs, im Zweiten fängt die Drehscheibe an. Kommst du mit, wird er sagen, eine völlig vergebliche Frage, nein, wird sie antworten, ich mach erst mal euren Dreck weg. Die Drehscheibe läuft schon, sagt er dann auch, da ist er schon hinter der Theke, durch die Durchreiche sieht sie nur seinen Rücken. Er tut schon wieder so, als suche er etwas in einer der Schubladen, vielleicht einen Gummi, vielleicht einen Stift. Sie antwortet nicht, wischt nur kurz die Hände an ihrer Kittelschürze ab, räumt den Teller und die Tasse vom Tisch und lässt sie im Spülwasser versinken. Gleich wird er sein sinnloses Herumkramen, seine Heuchelei, die niemand mehr erträgt, für einen Moment unterbrechen und sich zur Asbachflasche umdrehen, seinen Flachmann hat er immer in der Hosentasche. Rasch zieht sie die Besteckschublade heraus und schlägt sie wieder zu, sie will nicht hören, wie es still wird, weil Rudi sich den Schnaps aus der Flasche zieht, bei nichts sonst ist er so konzentriert wie bei dieser heimlichen Geste.
Ihre Haut ist fast so hell wie die Wand neben dem Spiegel, den der Wasserdampf von unten beschlägt, doch ihr Kinn ist immer noch entschlossen. Sie kennt sich zur Genüge, deshalb beugt sie sich nach vorne und taucht die Hände in ihr Spülwasser. Zu heiß ist es, so, wie sie es mag, sie hält ganz still. An ihren Unterarmen türmt sich der Seifenschaum, hundertfach zerplatzen die Bläschen mit einem Knistern, das auf der Haut kitzelt. Sie wartet einen Moment, bis es ihr durch den Körper zieht, egal, wie heiß es in der Küche ist, für ihre Knochen kann es nicht genug Wärme geben. Rosi ist spät dran, sie müsste schon unten sein und die Theke vorbereiten. Wahrscheinlich wieder eingeschlafen. Gleich rufen, wenn der Abwasch fertig ist.
Die alte Frau Böhm wird sie genannt, nur außerhalb ihrer Hörweite, aber sie weiß es doch. Frau Böhm, wenn man sie anredet oder den Kopf auf die Höhe der Durchreiche beugt und in die Küche ruft, es habe gut geschmeckt, wie immer! Die alte Frau Böhm ist sie, und so fühlt sie sich auch. Schon zweiundsechzig und kein Ende abzusehen, wer sonst soll alles auf Trab halten. Mit fünfundvierzig hatte sie den Grünen Baum übernommen und ihr Eingliederungsdarlehen reingebuttert, das im Dorf immer nur Flüchtlingszuschuss genannt wurde. Es war die Zeit des Ärmelhochkrempelns und Freddys Heimweh