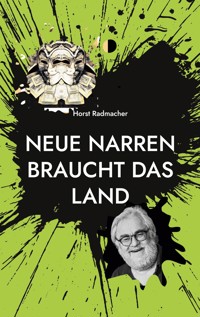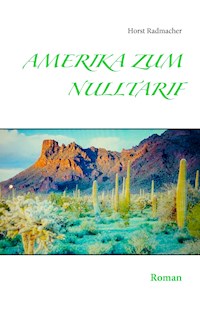
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Abenteuer pur: ein Jahr lang ohne Geld am Rande der amerikanischen Überflussgesellschaft durch die USA - 'from coast to coast'. Ein Roadtrip voller unbändiger Freiheit wird zu einem gefährlichen Erlebnis durch die Verstrickung im Netz einer dubiosen Religionsgemeinschaft. Rückkehr in ein unabhängiges Leben ist nur durch Flucht möglich; ein Unterfangen, das sich bald als lebensbedrohliches Wagnis erweist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch:
Ohne einen Cent ein Jahr lang durch die USA zu reisen - das ist der Einsatz, den Olaf Menzel bei einer Wette mit seinem Freund Gerald Volkmann erbringen muss. Das mittellose Leben außerhalb der amerikanischen Überflussgesellschaft gewährt ihm dabei Einblicke in die Lebensart der Amerikaner, die dem normalen Reisenden versagt bleiben. Die scheinbar grenzenlose persönliche Freiheit beim Ausleben dieses Roadtrips verwandelt sich für ihn in ein Leben voller Zwänge, als er sich im Netzwerk einer obskuren Sekte verstrickt. Bald geht es nicht mehr um Befriedigung alltäglicher Bedürfnisse, sondern um die Abwehr lebensbedrohlicher Gefahren.
Der Autor:
Horst Radmacher, geboren 1948 in List auf Sylt, bereist seit mehr als dreißig Länder aller Kontinente. Die vielfältigen Eindrücke dieser Reisen sind in umfangreichen Fotosammlungen dokumentiert. Im Jahr 2011 erschien sein erster Roman, DAS ANDENKREUZ. Es folgten (2012) AMANDAS GEDBURTSTAG und (2013) MORBUS MONITUS. In all seinen Büchern erzählt er spannende Geschichten vor der abenteuerlichen Kulisse exotischer Reiseziele. Horst Radmacher lebt und schreibt in Neustadt in Holstein.
„Freedom is just another word for nothing left to loose“
(Kris Kristofferson * 1937 - aus: BOBBY MC GEE)
Eine Parkbank über der steilen Uferkante des Santa Monica State Beach. Die Temperatur in dieser frühen Stunde des Tages war angenehm. Eine milde Brise, angereichert mit würziger Meeresluft des nahen Pazifiks, umfächelte die zu dieser Tageszeit noch wenigen Spaziergänger und Jogger auf höchst gefällige Weise. Eine friedvolle Stille lag über dem Strand mit seinen sanft anrollenden Wellen des in der Morgensonne glänzenden Ozeans. Für fast jeden Normalurlauber der ideale Ausgangspunkt, um sich nach einem üppigen American Breakfast auf einen Ferienaufenthalt in Kalifornien einzustimmen. Für mich galt das nicht. Ich hatte zwar solch ein opulentes Frühstück hinter mich gebracht, war aber nicht in der Stimmung, mich freudig auf einen unbeschwerten Urlaubstag einzustellen. Es waren einerseits die Umstände meines Aufenthaltes hier, die meinen Gefühlszustand dämpften; andererseits war es mein Befinden nach einer schwer durchzechten Nacht, das keinerlei Vorfreude auf einen sonnigen Strandtag an der kalifornischen Südküste aufkommen ließ.
Vor weniger als einer halben Stunde hatte sich mein alter Freund Gerry von mir verabschiedet und war nun auf dem Weg zum Los Angeles International Airport, von wo aus er seinen Rückflug nach Deutschland antreten würde - ohne mich.
„Überlege es Dir nochmal. Noch kannst du mit zurück.“
„Nee, lass mal gut sein. Nun zieh ich das Ding hier durch. Das kriege ich schon hin. Wir sehen uns.“
Ein kräftiger Händedruck, ein schiefes Grinsen, das war es dann schon.
So ganz wohl war mir allerdings nicht zumute, als ich Gerald Volkmann mit diesen Worten verabschiedete. Es lag nicht an einer spezifischen Bockigkeit, oder war auch nicht dem übermäßigen Alkoholgenuss geschuldet, dass ich ihn wie verabredet alleine ziehen ließ. Es war vielmehr die mir eigene Beharrlichkeit, Vorhaben, die ich ernsthaft zugesagt habe, bis an die Grenze der Selbstzerstörung durchzuziehen. Und eine Vereinbarung dieser Kategorie hatte ich getroffen; für mich gab es kein Zurück.
Das war die wenig erheiternde Ausgangssituation, in der ich in die kalifornische Morgensonne blinzelte und die immer mehr Zweifel in mir aufsteigen ließ. Jetzt, da sich der Alkoholnebel allmählich verflüchtigte, holte mich die Realität ein und es kroch mir ein Unbehagen den Nacken hoch, wie ich bis dahin noch keines verspürt hatte. Nicht einmal nach meiner Scheidung. Und diesem unseligen Ereignis vor gut zwei Jahren gab ich eine gewisse Mitschuld an dem Lauf der Dinge, die mich letztlich in diese missliche Lebenslage gebracht hatten.
Meine Ex-Frau Claudia, neben mir eine der beiden Beteiligten, war natürlich für die heutige Situation nicht direkt verantwortlich. Es waren seinerzeit vielmehr die Umstände einer zähflüssigen Trennung, die mich aus meiner gewohnten Lebensbahn geworfen hatten. Mein Dasein als zufriedener, oder wie es in meiner Umgebung meist geheißen hatte, spießiger Familienmensch, wurde innerhalb weniger Monate völlig auf den Kopf gestellt.
Ich lebte bis dahin, wie ich meinte, sorgenfrei mit Frau und zwei Kindern in einer norddeutschen Kleinstadt. Das Reihenhaus war fast abbezahlt. Ich liebte meine Frau wie eh und je und ich fand tagtäglich Erfüllung in meinem Beruf als Gärtner, in dem ich für die Anlage und Pflege der städtischen Parkanlagen zuständig war.
Seit meine Frau wieder einen Halbtagsjob in einem Steuerbüro ausübte, hatte sie meiner Meinung nach eine interessante Abwechslung vom häuslichen Einerlei gefunden und das zusätzliche Einkommen machte uns den Alltag leichter. Unsere beiden Kinder, Julia und Matthias, befanden sich zu der Zeit in der Berufsausbildung bzw. im Studium; beide direkt auf dem Weg in die Eigenständigkeit. Claudia und mir ging es gut, jedenfalls meiner Einschätzung nach. Mich störte das Verharren in der geordneten Welt einer Kleinbürgeridylle überhaupt nicht.
Vielleicht hätte ich jedoch vorher den Warnsignalen meiner Ehefrau diesmal mehr Beachtung schenken sollen, aber Diskussionsansätze wie, Wir müssen mal reden, hatte ich schon früher nie sonderlich ernst genommen. Beim allerersten Mal hatte solche eine Gesprächsaufforderung unterschwellig noch etwas Bedrohliches für mich gehabt. Irgendwann lief es in solchen Fällen nach kurzen Aufwallungen dann stets nach einem eingefahrenem Muster ab und das Leben ging bald weiter wie vorher.
Im Prinzip hatten wir ja keine unüberwindbaren Probleme miteinander. Mit den Macken des Partners konnten wir beide überwiegend gut umgehen. Meine, wie ich zugeben muss, pedantisch ausgelebte Ordnungsliebe in Haus und Garten war zwar grenzwertig und hatte die eine oder andere heftige Meinungsverschiedenheit ausgelöst, es kam dabei aber nie zu Grundsatzdebatten über die Qualität unserer Ehe. Claudia dagegen ist ziemlich unordentlich und hasst Hausarbeit. Bis auf das Kochen. Da ist sie überaus talentiert und managt alles was mit Essen und Trinken zu tun hat auf nahezu perfekte Weise. Insgesamt waren das alles keine Probleme, die auf ein Scheitern unserer Ehe hätten hindeuten können.
Dieses Mal kam es jedoch anders. Mit Einsichtigkeit, einem beiderseitigem Versprechen, wir versuchen es nochmal, wir machen alles besser, war es dann nicht mehr zu schaffen gewesen. Wir kamen an einen Punkt, an dem sich nichts mehr bewegte. Der Versuch einer Revitalisierung unseres einschlafenden Ehelebens hatte zu keinem Erfolg geführt. Die Unzufriedenheit meiner Frau war zu gravierend gewesen; ich hatte die Situation völlig unterschätzt. Nach einem nervenaufreibenden Hin und Her kam es zur endgültigen Trennung, auf die später die Scheidung folgte.
Ich zog aus dem Reihenhaus aus, mietete mir eine Eineinhalb-Zimmerwohnung und überwies jeden Monat pünktlich einen Teil meines nicht gerade üppigen Gehaltes als Unterhalt für die verflossene Ehefrau und für die Kinder.
Der Trennungsschmerz war heftig. Ich weiß nicht, wie ich heil durch dieses Situation gekommen wäre, ohne die Hingabe zu meinem Beruf als Gärtner und ohne den Beistand meines ältesten Freundes, Gerald Volkmann.
In meinem Beruf habe ich stets Erfüllung gefunden. Besonders in angespannten Lebenslagen half es mir ungemein, mich in diesen zu versenken. Wenn nötig, konnte ich mich nach getaner Arbeit noch zusätzlich in dem gepachteten Schrebergarten am Rande der Stadt verwirklichen. Hier hatte ich mir ein Refugium der besonderen Art geschaffen: ein Gewächshaus für Kakteen und andere Sukkulenten. Bei der Beschäftigung mit diesen mich außerordentlich faszinierenden Gewächsen konnte ich die Welt um mich herum komplett ausblenden.
Als Ergebnis meiner intensiven Beschäftigung mit dieser attraktiven Gattung von fleischigen Stachelgewächsen hatte ich eine Vorrichtung konstruiert, die ein gleichmäßiges Wuchsbild der Pflanzen ermöglichte, so wie es anspruchsvolle Züchter bevorzugen. Ich hatte es geschafft, einen halbautomatischen Dreh- und Gießapparat zu entwerfen, der einerseits durch Drehen der Töpfe in regelmäßigen Intervallen für eine ideale Lichtzufuhr sorgte, andererseits die richtige Gießmenge verteilte, ohne die empfindlichen Triebe und Wurzelballen zu vernässen. Ein zusätzlicher Effekt war, dass die Pflanzen dadurch über einen längeren Zeitraum keiner weiteren Pflege bedurften. Diese Erfindung wurde selbst von Fachleuten anerkennend bewundert. So mancher Experte sah in dieser Konstruktion eine gute Chance für eine erfolgreiche Vermarktung. Um so etwas serienreif fertigen zu lassen und anschließend in großer Stückzahl zu vertreiben, fehlten mir allerdings sowohl die technischen wie auch die finanziellen Mittel; den Traum davon gab ich allerdings nie ganz auf.
Sprach man bei anderen Menschen mit Geschick bei der Gartenarbeit von einem grünen Daumen, dann musste man bei mir, in aller Bescheidenheit, von einem grünen Arm sprechen. Seit frühester Kindheit gelang mir so ziemlich alles perfekt, was mit der Aufzucht und Hege von Pflanzen zu tun hatte.
So war es dann auch nicht verwunderlich gewesen, dass ich das Gymnasium nach der zehnten Klasse verlassen hatte, um eine Lehre als Gärtner anzutreten. Mein Vater erklärte mich daraufhin kurzzeitig für verrückt. Meine Mutter nannte mich Kindskopf. Das kam der Sache schon etwas näher; denn ich habe bis heute den emotionalen Rückweg in meine Kindheit nie versperrt. Ohne nennenswerte schulische Probleme die Oberstufe des Gymnasiums zu verlassen, konnte in ihrer beider Sichtweise nicht normal sein. Für mich war es das aber. Ich hätte auch mit einem bestandenen Abitur nichts anderes als Gärtner werden wollen, das wusste ich schon seit frühen Kindertagen. Ich glaube, meine Eltern haben mich in dieser Hinsicht bis heute nicht verstanden.
Mein Freund Gerald war ein völlig anderer Typ, was uns aber nie daran gehindert hatte, seit Kindergartenzeiten enge Freunde zu sein. Es änderte auch nichts daran, dass er die Schule bis zum Abschluss besuchte und dann nach dem Abitur BWL studierte. Nach einem Praktikum bei einem großen Versicherungskonzern übernahm er die bedeutende Versicherungsagentur seines Vaters und ist heute ein erfolgreicher Geschäftsmann, sehr wohlhabend wie ich weiß. Auch familiär hätten wir uns nicht unterschiedlicher entwickeln können. Wir sind eben verschiedene Wege gegangen. Ich, der städtische Gärtner Olaf Menzel, führte lange Zeit ein ruhiges Leben mit Frau und Kindern. Gerald war da ganz anders gestrickt. Sein Markenzeichen war eher eine Unbeständigkeit, was Frauen anging. Statt eine Familie zu gründen, bevorzugte er die Freuden eines ungebundenen Lebens; auf dem Gebiet war er ebenso erfolgreich wie als Manager.
Unserer Freundschaft taten diese unterschiedlichen Werdegänge keinen Abbruch. Wir verstehen uns heute noch blind, selbst wenn wir uns, was selten vorkommt, für längere Zeit nicht gesehen haben sollten.
In der ersten Zeit nach meiner Scheidung war mein Freund Gerald eine große Stütze für mich gewesen. Sofern es seine Zeit abseits von Job und Frauengeschichten erlaubte, kümmerte er sich um mich. Ernsthafte Gespräche bis tief in die Nacht, Albereien mit und ohne Alkoholgenuss von ebensolcher Zeitdauer, das war es, was mich aufrichtete.
Irgendwann war ich seelisch wieder einigermaßen stabil und nahm auch wieder regelmäßig am Handballtraining in unserer Alt-Herrenmannschaft teil. Inzwischen war ich vermutlich körperlich zu sehr Alter Herr geworden, oder ganz einfach nicht ausreichend trainiert und so erlitt ich einen Sportunfall, in dessen Folge ich an einem Bänderriss im linken Sprunggelenk operiert werden musste. In der gähnenden Langweile des Krankenhausaufenthaltes gab es eine Änderung meiner Lebensgewohnheiten, die ebenfalls indirekt verantwortlich dafür war, dass ich jetzt einsam an einem kalifornischen Strand über eine mehr als unsichere Zukunft nachzudenken habe.
All meine Freunde und Verwandten wussten, dass ich mir nichts aus Bücherlesen machte. Tageszeitung, gelegentlich eine Zeitschrift, das war es dann auch schon zum Thema Lesen. Meine Ex-Schwiegermutter Lydia, zu der ich auch nach der Scheidung ein freundschaftliches Verhältnis unterhielt, brachte mir eines Tages während des Krankenhausaufenthaltes ein Magazin mit, dessen Titelblatt ein besonders schönes Exemplar eines Teddy Bear Cactus', botanisch Cylindropuntia Bigelovi, in voller Pracht zeigte. Diese äußerst ansehnliche Kakteenart wirkt ihrem Namen entsprechend tatsächlich wie das flauschige Fell eines großen Teddybären. Dass das hölzerne Pflanzenskelett dieses grünlichweiß schimmernden Gewächses aus harten Stacheln mit unzähligen Widerhaken im Mikroformat besteht, tut seinem pittoresken Anblick keinen Abbruch. Unangenehm wird es allerdings für den, der mit der spitzstachligen Schönheit in Berührung kommt.
„Ich hoffe, mein Lieber, das lenkt dich ab. Kakteen sind doch immer noch deine Leidenschaft, oder?“
Ich nahm die Zeitschrift gerne entgegen. Der Bericht über diese spezielle und andere Arten von Sukkulenten interessierte mich und passte in mein Leseschema. Was die gute Lydia übersehen hatte, bei dem von ihr mitgebrachten Magazin handelte es sich nicht, wie sie angenommen hatte, um eine Fachzeitschrift über Kakteen, sondern um ein Reisemagazin zum Thema Nationalparks in den USA. Das Titelbild stammte aus dem Organ Pipe Cactus National Park im Südwesten der USA. Das Hauptthema des Blatts war gut aufgemacht, auch wenn es hier eher um touristische als um botanische Dinge ging.
Für mich als notorischen Reisemuffel, außer der Nordseeinsel Spiekeroog, Mallorca und dem Allgäu, hatte ich nie irgendwelche Urlaubsorte kennengelernt, änderte sich durch die Lektüre des Blattes im Krankenhaus einiges. Ich war von den Beschreibungen des Kaktus-Nationalparks so fasziniert, dass ich alle Hefte dieser Reihe förmlich verschlang. Es ging dabei unter anderem auch um die Darstellungen der jeweiligen Naturlandschaften in den Parks. Was mich aber bei der Lektüre dieser Artikel an mir selber am meisten überraschte, war, dass ich immer mehr Interesse an der touristischen Infrastruktur um die Nationalparks herum entwickelte.
Ich las alles, was ich zu diesem Thema finden konnte, sah mir sämtliche Fernsehdokumentationen über Naturlandschaften in den USA an, um mir über dieses Wissensgebiet möglichst umfangreiche Kenntnisse anzueignen. Es dauerte nicht lange und ich war zu einem ausgesprochenen Experten für sämtliche amerikanische Nationalparks und deren umgebende Landstriche geworden. Bücher und Zeitschriften zum Thema Nordamerika stapelten sich bald unübersichtlich in meinem ansonsten stets gut aufgeräumten Wohnzimmer. Das gesamte Gebiet der USA existierte durch meine gezielten Privatstudien für mich in vielen Details kartografisch komplett ausgebreitet vor meinem inneren Auge. Die rein geografischen Gegebenheiten wurden komplettiert durch angelesene Details über die Natur und die Umwelt des Landes, über Verkehrsstrukturen, American Way of Life, sowie politische Aspekte. Ich las über dieses Sachgebiet einfach alles, was in mich reinpasste. Zusätzlich hatte ich noch einen Volkshochschulkurs für American English belegt.
An einem milden Sommerabend saßen mein Freund Gerald und ich im Biergarten unseres Stammlokals und zechten munter drauf los. Es musste an diesem Abend etwas Besonderes in der Luft gelegen haben; denn wir befanden uns nach einigen Pints Guinness auf einen ungewöhnlich kreativen Höhenflug und kalauerten drauf los wie aufgeheizte Biertisch-Philosophen. Das alles lief in einem sanften, sich jedoch stetig steigernden Rausch ab, aber beide behielten wir erstaunlich lange Bodenhaftung, bis an den Punkt, an dem die Thematik sich entscheidend änderte.
„Alter, wir müssen mal zusammen verreisen. USA, das wäre doch was. Jede Menge Spaß. Jetzt, wo du deinen Reisehorizont so mächtig erweitert hast.“
Gerry war schon mehrfach in den Staaten gewesen, meistens zu Urlaubszwecken mit einer seiner zahlreichen Freundinnen. Ich kannte ihn zu gut. Er wollte mich provozieren, da ich nun ein schier unerschöpfliches theoretisches Wissen über Amerika angehäuft hatte. Diese Entwicklung hatte auch ihn verblüfft.
Zunächst ging ich nicht auf seinen Vorschlag ein. Dann aber, einige Gläser des samtenen Dunkelbieres weiter, stürzte ich mich förmlich ich auf das Thema.
„Na klar, allein nur mit dem Wissen eines Telefon-Jokers wie in einer Quiz-Sendung durchs Leben zu laufen ist ziemlich öde. 'Ne Reise dort hin, das wäre tatsächlich was.“
Gerry war total verblüfft.
„Das ist doch nicht dein Ernst? Du und freiwillig verreisen? Das guck ich mir an.“
Ich weiß nicht, was mich an dem Abend geritten hatte. Ich kannte mich bis dahin eigentlich nicht als Typ mit Hang zum Größenwahn, aber ich setzte noch einen drauf.
„Weißt du was? Ich traue mir zu, mich ohne einen Cent einmal quer durch die USA durchzuschlagen und auch sonst nur mit dem ausgestattet, was ich so am Leibe trage. Ansonsten ohne alles. Ein Jahr lang. Von Los Angeles nach New York.“
Nun fand ich mich auf der Überholspur wieder.
„Genau nach einem Jahr, da treffen wir uns wieder. Punkt zehn Uhr vor dem Eingang des Hard Rock Café, in New York, Broadway - Ecke Times Square.“
Jetzt schwebte ich in schwindelerregenden Höhen.
„Ich kenne dieses verdammte Land inzwischen so gut, dass ich sicher bin, zum Nulltarif da durchzukommen. Im gelobten Land des Überflusses wird schon etwas für mich abfallen.“
„Spinner.“
Er nahm mich natürlich nicht ernst, aber das hätte er in dieser Situation so nicht sagen dürfen.
„Spinner, sagst Du? Schlag ein.“
Ich reichte meinem Freund Gerald Volkmann die Hand. Völlig verdattert schlug er ein. Er kannte mich gut und wusste, wie ernst ich eine solche Abmachung nehmen würde. Trotz der fortgeschrittenen Alkoholwirkung befanden wir uns immer noch annähernd auf dem Boden der Realität. Gerald wusste dass ich finanziell nicht gut gestellt war. Eine reine finanzielle Unterstützung durch ihn ohne Gegenleistung war aber für uns beide schon vorher nie infrage gekommen. Eine besser dotierte Anstellung in seiner Firma hatte ich in der Vergangenheit bereits mehrfach abgelehnt. Versicherungsbranche, das wäre einfach kein Job für mich gewesen.
Um jetzt dieses ungeheure Vorhaben in eine Art geschäftlichen Rahmen einzufügen, schlug Gerry vor, dass ich nach erfolgreich abgeschlossener Durchführung des verrückten Plans, die Summe von fünfzigtausend Euro erhalten würde; sehr viel Geld für mich. Mit solch einem Betrag könnte ich zum Beispiel die Weiterentwicklung meiner Erfindung vorantreiben. Sollte ich scheitern, müsste ich ein Jahr lang für ein Gehalt in Höhe der amtlichen Grundversorgung in Geralds Versicherungsagentur arbeiten.
So, und nun saß ich hier, völlig mittellos an einem Strand am Rande von LA und murmelte halblaut vor mich hin:
„So eine Riesenscheiße! Einmal quer durch - from coast to coast - und das alles zum Nulltarif.“
It never rains in Southern California – In Süd-Kalifornien regnet es nie.
Noch nie in meinem bisherigen Leben habe ich so sehr darauf gehofft, dass der Text eines Popsongs annähernd wahr sein möge, wie bei diesem Titel des britischen Soft-Rocksängers Albert Hammond aus den frühen siebziger Jahren des vorherigen Jahrhunderts. Aus unerfindlichen Gründen hing mir dieses Lied schon den ganzen Morgen wie fest installiert in den Ohren.
Es war keineswegs der Wunsch nach dem idealen Wetter für einen Strandurlaub an der amerikanischen Westküste, der mich in diese Hoffnung trieb. Nein, Ströme essentieller Überlebensstrategien fluteten mein Bewusstsein. Regen? Den konnte ich nun gar nicht gebrauchen, vor allem nicht nachts.
Noch konnte ich sie genießen, die grandiose Aussicht auf die Bucht von Santa Monica, nördlich bis zum Malibu State Beach, dort wo die Reichen und Schönen Hollywoods ihre Strandvillen haben. Ich fühlte mich bis jetzt noch gut; die praktischen Probleme meines Alltags ergriffen aber im weiteren Verlauf des Tages immer mehr Besitz von mir. Jemand, der mehr Gefallen an malerischen Küsten hatte als ich, würde wohlbeim Anblick dieser atemberaubenden Landschaft zu Begeisterungsstürmen hingerissen werden. Ich nahm dieses pazifische Bilderbuchpanorama lediglich zur Kenntnis.
Für meine nächste Aufgabe, mich um die Versorgung der grundlegenden Alltagsbedürfnisse kümmern zu müssen, erschien mir die Gegend um Malibu, zwischen Strand-Refugium für Reiche und den küstennahen Villenhügeln der Santa Monica Mountains gelegen, für meine Zwecke wenig geeignet. Zu nobel das Ganze. Ich musste mich mehr auf 'normale' Plätze konzentrieren, an Orte mit viel Publikumsverkehr. Viel Publikum bedeutete viel Kommerz und der wiederum verhieß viel Überschuss und jede Menge Abfall. Dort würde das Ziel meiner Versorgungsbemühungen liegen müssen.
Und von den Einflüssen eines solchen Platzes wurde ich jetzt angeregt. Mit dem leichten Seewind wehte mir der Geruch von gebackener Pizza, gebratenen Hamburgern, frittierten Pommes und ähnlichem Fastfood direkt in die Nase. Nur wenige hundert Meter schräg vor mir ragte das Gebilde der Santa Monica Pier auf ihren wuchtigen Pfählen in die Uferbrandung des Meeres. Wie eine überdimensionierte Mondlandefähre auf dicken hölzernen Stelzen wirkte diese mächtige Konstruktion. Diese Vorrichtung war ursprünglich zu dem Zweck errichtet worden, die Abwässer der küstennahen Häuser weiter draußen in das Meer zu leiten. Irgendwann später wurde die Pfahlkonstruktion erweitert und ist seit diesem Zeitpunkt ein beliebter Anziehungspunkt für Touristen. Shopping-Arkaden, Vergnügungspark mit Karussell, Aquarium und vor allen Dingen verschiedenartige Restaurants ziehen täglich zehntausende Besucher an. Oft dient die Pier-Anlage auch als Kulisse für Hollywood-Filme.
Mich lockten jetzt die Ausdünstungen der dort befindlichen Fressbuden. Es war mittlerweile Nachmittag geworden, die Sonne brannte erbarmungslos vom wolkenlosen Himmel und die Beschwerden eines mittelschweren Sonnenbrandes wurden jetzt immer stärker durch ein starkes Hungergefühl überlagert. Ich folgte also den Essensgerüchen und begab mich zum Eingang des Pacific Parks hoch über den Brandungswellen des Meeres. Direkt unter dem Schild, End of the Trail Route 66, das werbewirksam dem westlichen Ende der legendären Route 66 optisch Nachdruck verlieh, stieß ich auf das erste Fastfood-Restaurant, den Groß-Imbiss Pier Burger mit seinen verlockenden Angeboten. Nicht, dass ich ein großer Freund von solcher Art Essens gewesen wäre, oder dass ich solch eine Mahlzeit im Moment überhaupt hätte bezahlen können, nein, mich trieb der schiere Hunger dorthin, angefacht von den in der Luft hängenden Bratendüften. Mir erschien diese Art von Gastronomie, Selbstbedienungs-Restaurant mit großem Freiluftbereich, für meine Zwecke ideal.
Ich lehnte mich nahe des Restauranteingangs am Rande des Brückengeländers so auf die Holzbrüstung, wie man es tut, um einen guten Ausblick auf das Wasser und den Strand zu haben. Mit einem Auge konnte ich dabei aus dieser Postion den äußeren Bereich des SB-Restaurants gut beobachten. Die Geräusche meiner Verdauungsorgane in Erwartung einer kulinarischen Befriedigung schwollen auf eine enorme Lautstärke an.
Es dauerte nicht lange und ich wurde fündig. Wenige Meter vor mir verließ eine Frau mit ihren zwei Kindern nach ihrer Mahlzeit den Tisch. Die Mutter war offensichtlich vom Genörgel ihres Nachwuchses genervt, die alle beide in ihrem Essen nur herumgestochert hatten. Sie schob die quengelnden Gören ungeduldig zum Ausgang, ohne die Tabletts mit den Essensresten entsorgt zu haben. Normalerweise stellten die Gäste nach verrichteter Mahlzeit ihr benutztes Geschirr am anderen Ende des Restaurants ab, wo das Service-Personal dieses anschließend entsorgte. Für die Fälle, in denen Gäste das Abräumen vergaßen, sorgten Angestellte des Restaurants für das Leeren der Tische.
Bevor es in diesem Fall dazu kommen konnte, hatte ich mich zügig zu dem freigewordenen Tisch begeben und nahm vor den Essensüberresten platz. Das Ergattern von Nahrungsmittelresten war absolutes Neuland für mich. Entsprechend aufgeregt war ich dann auch bei meinen Bemühungen. Mit möglichst unverfänglicher Miene sah ich mich um und stellte fest, kein Mensch interessierte sich für mich und meine Aktion.
Da ich von jeher eine große Abscheu vor dem Verzehr von angefressenem Futter fremder Menschen empfinde, stellte ich mich in meinem Erstversuch zögerlich und ungeschickt dabei an, die auf den Plastiktellern der Kinder verbliebenen Reste für meine Zwecke zu präparieren. So sorgfältig es nur ging, wischte ich mit einer Papierserviette das Plastikbesteck ab und schnitt dann die angeknabberten Überbleibsel der zurückgelassenen Chicken-Nuggets und des Hamburgers ab. Von den Pommes drohte keine Hygiene-Falle; denn die waren von den Kindern nur mit den dazugehörigen Pieksern berührt worden.
Anschließend war ich mit meiner ersten Mahlzeit zum Nulltarif sehr zufrieden. Kein kulinarischer Hochgenuss, aber immerhin, die lauwarmen Fleischreste und die gehärteten kalten Pommes Frites hatten mich erstmal gesättigt. Das Ganze hatte ich dann mit einer Art Cola-Schorle heruntergespült, bestehend aus einem kleinen Rest Pepsi Cola und dem kühlen Wasser des geschmolzenen Eises, den die Mutter in dem XXL-Pappbecher hinterlassen hatte. Natürlich hatte ich den im Becher steckenden Trinkhalm vorm Trinken entfernt und entging so den Bedrohungen einer weiteren potentiellen Bakterienschleuse. Ordentlich wie ich war, brachte ich das Geschirr nach der Mahlzeit zur vorgesehenen Ablagestelle und versorgte mich dann noch mit einer Garnitur Plastikbesteck und ein paar Servietten. Man konnte ja nie wissen.
An diesem ersten Tag in meinem neuen Leben hatte ich bislang außer körperlich notwendigen Verrichtungen noch keine nennenswerten Tätigkeiten geleistet. Den banalen Sinnspruch, Die Zeit ist wie ein scheues Reh, hatte ein wohl eher schlichtes Gemüt kreiert; rückblickend am Ende eines Lebens mochte da wohl etwas Wahres dran sein. In meiner neuen, bisher unstrukturierten Tagesroutine fühlte sich das komplett anders an; die Zeit hing eher wie zäher Kleister an mir.
Spontan fiel mir nicht besseres ein, als meine Zeit mit Spazierengehen zu füllen. Zweifellos befand ich mich für diesen Zweck in einer gut geeigneten Umgebung. Der Ocean Front Walk zwischen Santa Monica Beach und dem nur wenige Kilometer südlichen liegenden, weltberühmten Venice Muscle Beach stellt eine der beliebtesten Flaniermeilen im Raum Los Angeles dar: Jahrmarkt der Eitelkeiten, das ist sicher keine übertriebene Beschreibung für dieses Mekka der Narzissten und Schaulustigen. Dazu sorgen schier unzählige Kneipen und Restaurants für Unterhaltung bis spät in die Nacht.
Für mich ging es weniger darum, mich zur Schau zu stellen oder mich in der grellen Kneipenszene zu vergnügen. Anonym in der Masse meinen Tag zu verbringen und dabei kostenfrei für meinen Lebensunterhalt zu sorgen, das war eher mein ehrgeiziges Anliegen. Wie ich die Nächte verbringen würde? Noch hatte ich nicht einmal andeutungsweise eine Vorstellung davon.
Am späten Nachmittag schlenderte ich also den Ocean Front Walk in Richtung Venice Beach. Bei dieser Gelegenheit übte ich dann schon, meinen Blick mit der Absicht des Beutemachens zu schärfen. Und es war nicht wenig, was dort von den zig-tausenden Strandgängern zurückgelassen worden war. Innerhalb kürzester Zeit hatte ich mich durch die Lektüre dreier aufgesammelter Tageszeitungen gearbeitet. Nicht, dass mich die amerikanische Nachrichtenlage stark interessiert hätte, nein, das langsame Lesen dieser Blätter bedeutete ganz einfach, die Zeit zu füllen.
Kurz vor Sonnenuntergang erlebte ich außer meiner nachmittäglichen Frei-Mahlzeit einige weitere Höhepunkte dieses anstrengenden Tages. Auf einer Parkbank des Dortothy Green Parks erblickte ich eine herrenlose Schildkappe mit dem lila und gelbem Logo des Basketball-Teams LA Lakers