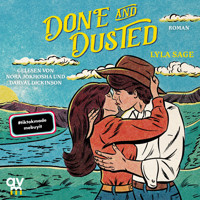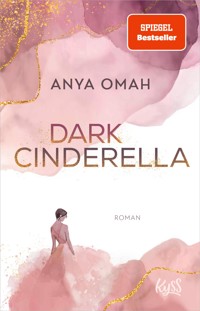Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amnesty bildet den Abschluss der für den Nebula und den LAMBDA Award nominierten Glam-Spionagethriller-Trilogie. In Amberlough City kehrt aus der Asche der Revolution ein Verräter zurück, eine politische Schlacht spitzt sich zu, und das Volk fordert Gerechtigkeit für vergangene Verbrechen. Wer kann der Vergeltung entgehen, während eine Nation um den Wiederaufbau kämpft?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
All denen gewidmet,die mir auf dem Weg zur Seite gestanden haben.
INHALT
DANKSAGUNG
TEIL EINS
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
TEIL ZWEI
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
TEIL DREI
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
DANKSAGUNG
Wow. Es ist so weit: Der letzte Band der Amberlough-Reihe. Wir haben es geschafft. Und ich meine wirklich uns alle. Wie immer stammt dieses Buch nicht allein von mir – es ist durch die Liebe, Unterstützung und das Mitgefühl vieler Menschen entstanden. Zunächst sind da natürlich meine Lektorin Diana Pho und mein Agent Connor Goldsmith. Diana hat dieses Buch richtig in Form gebracht, damit die Trilogie ein starkes Ende bekommt, und Connor hat am Ende des Tunnels ein Licht leuchten lassen, damit ich ein Ziel hatte, auf das ich hinarbeiten konnte. Und meine Dankbarkeit gilt außerdem Desirae Friesen, der Pressesprecherin aller Pressesprecherinnen, die Ihnen dieses Buch quasi in die Hand gedrückt hat.
Der Rest dieser Liste ist wahrscheinlich furchtbar unvollständig. Ich weiß, dass es da draußen Leute gibt, die ich vergessen habe, und dafür möchte ich mich ehrlich entschuldigen. Wo ihr euch auch befindet, wer ihr auch seid: Euch gilt meine ewige Dankbarkeit!
Ohne meine unzähligen Gruppen wunderbarer Schriftstellerfreunde hätte ich die Trilogie nicht beenden können. Ein besonderer Dank geht an den Alpha-Studenten Zach Nash, der dem Plot mit den beiden Worten »kapitalistische Oligarchie« einen Senkrechtstart verpasst hat. Und natürlich an all meine Freunde im Pub, aber insbesondere an Jay Wolf, Andrea Tatjana, Jennifer Mace, Sarah Berner und Marianne Kirby, die mir mehrfach Lösungen für besonders knifflige Probleme geliefert haben. Außerdem danke ich Nicasio Reed, der mir die krasseste Amberlough-Playlist aller Zeiten zusammengestellt und mich mit Jidenna bekannt gemacht hat.
Lex Beckett, Kelly Robson, Kellan Szpara, Sarah Pinsker, Jordan Sharpe, Debra Wilburn und Alexandra Renwick: Unser Aufenthalt im Timberhouse war genau das, was dieses Buch für seinen zweiten Entwurf benötigt hat.
Ein großes Dankeschön an die ganze Mannschaft bei Clarion, die mich auf dieser Reise begleitet hat, ganz besonders aber an Patrick Ropp und Huw Evans, die weltbesten Cheerleader.
Kelsey Hercs, du bist eine Inspiration und beglückst allein durch deine Anwesenheit, selbstredend bist du eine hervorragende Dramatikerin und ich bin wahnsinnig froh darüber, dass wir durch Zufall Freunde geworden sind. Eric Mersmann, danke, dass du mich zum Thema ordentliche Gerichtsverfahren beraten hast. Ich schulde dir eine Portion Eiscreme mit Gewürzgurkengeschmack.
Selbstverständlich danke ich meinen Eltern, die mir als kleinem Kind viele Wörter in den Kopf gepflanzt haben, indem sie mir vorgelesen und sich anschließend um die daraus erwachsene fleischfressende Sumpfpflanze gekümmert haben. Ihr seid meine größten Fans und habt wahrscheinlich im Alleingang so viele Exemplare meiner Bücher persönlich verkauft, dass es eine zweite Auflage gab.
Eine ganze Reihe an Danksagungen und Entschuldigungen geht an die Familie Routh, die mich über die Feiertage zu sich nach Hause eingeladen und dann durchgefüttert hat, während ich über meinen Laptop gebeugt krampfhaft versucht habe, den ersten Entwurf von Amnesty zu beenden und parallel Armistice stilistisch zu lektorieren.
Aber vor allem gelten meine Liebe und mein Dank Eliot, der mit mir zusammenleben musste, während ich das Buch fertiggestellt habe. Du bist ein Held und hast mich vor dem Wahnsinn bewahrt.
Wir geben uns voreinander so abgebrüht, aber in Wahrheit sind wir es nicht. Ich meine … man kann nicht die ganze Zeit draußen in der Kälte bleiben, irgendwann muss man heraus aus der Kälte.
– John le Carré,Der Spion, der aus der Kälte kam
Ich habe nie einen Menschen gekannt, der bessere Motive für all den Ärger hatte, den er verursachte.
– Graham Greene,Der stille Amerikaner
TEIL
EINS
KAPITEL
1
Bei all dem Lärm von Radio, Fernschreiber und klappernden Schreibmaschinen hörte Aristide das Läuten seines Telefons nicht. Aber selbst wenn er es gehört hätte, hätte er nicht abgenommen. Dafür gab es Sekretäre. Da er nicht durch das Läuten vorgewarnt worden war, überraschte Daoud ihn, als er gerade tief über das Kassenbuch gebeugt dasaß und ihm beinahe die Brille von der Nase rutschte.
»Ari«, sagte Daoud, und als Aristide ihn schließlich hörte, klang es wie die dritte oder vierte Wiederholung.
»Tut mir leid«, meinte er, blinzelte und schaute ihn durch die obere Hälfte seiner Zweistärkenbrille an. »Was gibt es?«
»Telefon.«
Aristide nahm die neue Brille ab und presste die Hände gegen die schmerzenden Augen. Verdammtes neues Rezept. Verdammter alter Körper. »Sag denen, dass sie morgen wieder anrufen sollen. Ich brauche einen Drink.«
Daoud verzog den Mund und damit auch den Bart. »Es ist Seine Hoheit. Prinz Asiyah.«
Schlagartig horchte Aristide auf und spannte sich an wie eine Klaviersaite. Übertrieben sorgsam legte er seinen Stift zur Seite. »In Ordnung. Stell ihn durch.«
Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelte es sich um die Warnung, die Aristide seit dem vorigen Sommer erwartete, als er und Merrilee Cross ihre erste Ladung Teer zum frisch befriedeten Hafen von Amberlough verschickt hatten. Asiyah gehörte keinesfalls zur Drogenpolizei oder Hafenbehörde, war auch kein Verbündeter von Cross-Costa Importe oder einem der zahlreichen Tochterunternehmen. Dennoch hatte er in der Vergangenheit einem alten Freund Hinweise gegeben – vielleicht aus Mitleid oder Schuldgefühlen, da die Informationen, die Aristide ihm ursprünglich entlockt hatte, weder Profit noch zufriedenstellende Ergebnisse gebracht hatten. Cyril DePaul war nicht aus dem lisoanischen Dschungel aufgetaucht.
Oder vielleicht ging es gar nicht um den Teer, sondern um den Befehl, keine porachinischen Hilfslieferungen mehr abzuzweigen. Aristide hatte sein Bestes getan, um das vor der Königsfamilie oder dem Geheimdienst zu verbergen.
Es hatte klein angefangen. In seinem ursprünglichen Vorhaben gescheitert und durch die Kämpfe in den Süden gedrängt, war Aristide, nachdem der Krieg richtig ausgebrochen war, gemeinsam mit Daoud in den Süden gereist und hatte sich in Rarom niedergelassen, in der Nähe des Flugplatzes. Dort gab es eine schäbige kleine Bar, in der die Piloten gern einen hoben, und schon bald stand Aristide in einer guten Beziehungen zu Wedi, die ihm den einen oder anderen Karton zuschob, wenn sie davon ausging, dass diese niemandem fehlen würden.
Als er sich allmählich in Merrilees Markt drängte, kam diese aus Ul-Mejj herunter. Zum damaligen Zeitpunkt hatte sich ihre Stadt sowieso an der Front befunden, darum hatten sie ihr Unternehmen in seinem Garten gegründet. Hier hatte es weniger Blindgänger gegeben.
Sie hatten Erfolge und vertrieben Reis und Tabak an die Höchstbietenden. Polizei und königliche Agenten drückten meist beide Augen zu, solange man sie schmierte. Aber ein Prinz wäre etwas anderes, vor allem nun, da der Krieg beendet war und die königliche Familie das Gesicht wahren und ihre Gesetze dem Land aufzwingen musste, das sie der republikanischen Kontrolle entrissen hatte. Dort wurde die porachinische Hilfe dringend benötigt.
Aristide war darauf eingestellt, einen freundlichen Hinweis zu erhalten – oder eine königliche Vorladung. Darauf, was auf Asiyahs Höflichkeitsfloskeln folgte, war er allerdings nicht vorbereitet.
»Ich habe Neuigkeiten über einen gemeinsamen Freund«, sagte der Prinz.
In Gedanken ging Aristide ihre gemeinsamen Bekannten wie eine Hand voll Visitenkarten durch. Pulan? Lillian? Zu den beiden hatte er postalisch Kontakt gehalten, wenn auch nur sporadisch, manchmal auch per Funkanruf, falls ein besonderer Anlass es erforderte, doch diese waren teuer und wahnsinnig aufwendig zu organisieren. In der Regel waren es Briefe, von Zeit zu Zeit ein Telegramm. Tatsächlich hatte Lillian ihm erst in der Vorwoche eines geschickt und ihn zu einer Veranstaltung eingeladen, aber er hatte geradeheraus abgelehnt. Er würde an keinem Denkmal ein Band durchschneiden, nur damit sie sich mit Geddas Kandidatinnen für das Ministeramt gut stellen konnte. Zumindest nicht bei diesem Denkmal.
»Entschuldige bitte«, sagte er, als ihm klar wurde, dass Asiyahs Schweigen sich in Erwartung gewandelt hatte. »Um wen geht es?«
»Das kann ich über diese Leitung nicht sagen.«
Also ging es um geheime Aktivitäten. Verschwörungen. Spionage. Inzwischen hatte Aristide mit Füchsen weniger zu tun als mit Verbrechern. Pulan hätte Asiyah am Telefon erwähnen können. Wenn sie es nicht war, dann …
Als wäre die letzte Zuhaltung eines störrischen Schlosses eingerastet, kam ihm die Erleuchtung wie mit einem metallischen Klicken. Fünf Jahre waren vergangen, aber vielleicht hatte der Dschungel seinen kostbaren Schatz doch endlich freigegeben.
»Wo?« Aristide umklammerte den Hörer, sodass das Harz an den Nähten knackte.
»Heute Abend geht ein Flug nach Dadang«, sagte Asiyah und Aristide wurde klar, dass er auf eine andere, simplere Bedeutung des Wortes geantwortet hatte.
»Nein«, widersprach er. »Wo hast du ihn gefunden …?« Er ermahnte sich nicht bewusst, diesen Namen nicht auszusprechen. Er konnte es einfach nicht.
»Pack einen Koffer und komm bis spätestens neun Uhr an den Flugplatz«, meinte Asiyah.
Aristide machte kaum etwas Angst. Er hatte Kämpfe bestritten und sie beendet. Er war in völliger Dunkelheit ohne jedes elektrische Licht an von Regen und Hagel glitschigen Klippen entlanggelaufen. Er hatte Wölfe und Füchse abgewehrt und Leute, die ihm Gewalt antun wollten. Er hatte gehungert, auf der Straße geschlafen, einem anderen Mann ein Messer in den Bauch gerammt und jemandem eine Kugel in den Kopf gejagt.
Trotzdem hasste er es noch immer zu fliegen.
Als die Mgenu-330 schließlich vom Asphalt abhob – aufgrund des Wetters mit drei Stunden Verspätung –, hatte er sich einen therapeutischen Rausch angetrunken. Der dämpfte seine Angst, als das kleine Flugzeug direkt nach dem Start in Turbulenzen geriet, andererseits verschlimmerte er zugleich seine Übelkeit, als es sich in eine Kurve legte und die Erde aus dem Fenster verschwand.
Der Flug dauerte länger, als Aristide recht war. Am besten wäre er so nüchtern geblieben, dass er einige Arbeiten hätte erledigen können – es gab Briefe zu schreiben, sowohl geschäftliche als auch persönliche. Daoud hatte große Augen gemacht, als er ihm gesagt hatte, dass er in ein paar Tagen zurückkehren würde, und seinen Reiseplänen vehement und wortreich widersprochen, aber eigentlich ging es nur darum, dass er mit einer schlecht gelaunten Cross ungern allein bleiben wollte.
Aristide war allerdings ganz und gar nicht mehr nüchtern und die Mischung aus Angst und Eintönigkeit versetzte ihn in einen Zustand betäubter Grübelei.
In Liso hatte er fünf Jahre verbracht. Als er, vom ersten Monsunregen völlig durchnässt, in Oyoti angekommen war, war er sich seines Erfolges so sicher gewesen. Dumm. Das konnte er nun zugeben. Wenn er sich nicht hätte gehen lassen, wäre es ihm bereits damals bewusst geworden. Aber nicht nur das luxuriöse Leben in Porachis hatte ihm den Scharfsinn genommen. Im Nachhinein betrachtet hatte er seinen Geist nicht mehr geschärft, seit er die Besitzurkunde für die Baldwin Street unterschrieben hatte.
Aristide hatte alles erreicht, was er sich erhofft hatte. Hatte er sich das nicht immer wieder gesagt? Wenn ich erst reich bin, muss ich mir darum keine Gedanken mehr machen. Das hatte er sich zugeflüstert, bis es der Wahrheit entsprach, und dann, wie dumm nur, selbst an diesen Mythos geglaubt. Aristide Makricosta, Schwarzmarktkönig, Herrscher der Halbwelt. Unantastbar, unbezähmbar. Nicht einmal der Meister der Jagdhunde des FOCIS konnte ihn kleinkriegen, als es darauf ankam, sondern legte sich, als er ihn an der Kehle packte, auf den Rücken und streckte ihm den weichen Bauch entgegen.
Hoffentlich hatte Aristide daraus gelernt. Wie gern wollte er glauben, dass er die Arroganz inzwischen überwunden hatte, doch allein der Gedanke löste ähnliche Gefühle aus.
Zwei Jahre hatte er schwitzend im tropischen Regenwald verbracht und Phantome durch den vom Krieg gezeichneten Dschungel gejagt, das hatte ihn gelehrt, selbst dem winzigsten Fünkchen Selbstvertrauen gegenüber misstrauisch zu sein. Jede scheinbar vielversprechende Spur endete höchstwahrscheinlich in einer Enttäuschung. Alles, was sich als sichere Sache verkaufte, führte unweigerlich zu peinlichen Begebenheiten. Im fortgeschrittenen Alter hatte Aristide wieder gelernt, vorsichtig zu sein, allerdings hatte ihn diese Lektion sehr verärgert.
Trotzdem saß er nun zehntausend Fuß über dem Boden in den Sitz gegossen, ach, Verdammnis und Verderben sollten diesen Gedanken ereilen, und all das nur aufgrund eines einzigen Telefonats.
Als das Flugzeug durch weitere Turbulenzen holperte, klammerte er sich an die Armlehne und sprach sich Mut zu: Hier handelte es sich um keinen gnadenlosen Kriegsherrn, der die fauligen Zähne fletschte und zweifelhafte Informationen zu überhöhten Preisen verhökerte. Es handelte sich um Asiyah Sekibou, Geheimdienstbaron, und noch dazu so etwas wie ein alter Freund. Die letzte Aristide bekannte Person, die Cyril DePaul lebend gesehen hatte, der Letzte, der mit ihm gesprochen, seine Funksprüche gehört hatte – und er verlangte keinerlei Gegenleistung.
Das machte Aristide misstrauisch. Asiyah wollte etwas von ihm. Aber egal, wie viele Steine er bei der Suche nach einem Grund umdrehte, warum der Prinz lügen sollte – eine Falle, ein Trick, eine Verschwörung –, er konnte sich nicht einreden, dass es sich nicht schlicht um die Wahrheit handelte. Diese Überzeugung verursachte ihm mehr Übelkeit als die plötzliche Höhenänderung des Flugzeugs, als der Pilot im raschen Sinkflug Kurs auf den Flughafen Souvay-Dadang International nahm.
Asiyah erwartete ihn auf dem Rollfeld im Fond eines schwarzen Automobils, das am Bordstein irgendeiner Straße nicht weiter aufgefallen wäre, zwischen Dutzenden Flugzeugen geparkt allerdings herausstach.
Im Osten zeigten sich die ersten Strahlen des Sonnenaufgangs und erhellten den kobaltfarbenen Himmel auch dort, wo er noch nicht von den Lichtern Dadangs erleuchtet wurde. Eine glatzköpfige Frau, die völlig unnötigerweise eine Pilotensonnenbrille trug, hielt Aristide die Hintertür auf der Beifahrerseite auf, setzte sich dann auf den Fahrersitz und legte den Gang ein.
»Freut mich, dich wiederzusehen«, meinte Asiyah. Er sah so aus, als hätte er die Nacht nicht im Bett verbracht. Seine Wangen waren mit Bartstoppeln übersät und vorne auf seiner zerknitterten roten Tunika prangte ein Fleck, als hätte er etwas verschüttet …
»Kaffee?« Er bot Aristide eine grüne Thermoskanne aus Metall an.
Dieser nahm an und drehte den Deckel auf. Ein Schwall bitteren, duftenden Dampfes pustete ihm die vom Flug verstopfte Nase frei und milderte seine Kopfschmerzen. Er stieg ihm in den Rachen und löste einen Hustenreiz aus: schleimiger Husten, der sich etwa vor einem Jahr in seiner Lunge festgesetzt hatte und den keine Mentholzigarette und kein Senfwickel vertreiben konnte. Eigentlich hätte Aristide einen Arzt aufsuchen sollen, doch seit seiner letzten Untersuchung hatte er Angst davor. Genau wie das Flugzeug ließ ihm der Gedanke daran das Herz gefrieren, wie es nicht einmal der Lauf einer Pistole vermochte.
Vorsichtig goss er sich Kaffee in den Deckel der Thermoskanne, der zugleich als Tasse fungierte. »Hast du damit gerechnet, dass ich betrunken sein könnte?«, fragte er zwischen vorsichtigen Schlückchen.
Asiyah zuckte mit den Achseln. »Ich habe nur gedacht, dass du vielleicht welchen gebrauchen kannst.«
Aristide goss sich eine zweite Tasse ein und trank sie etwas zu schnell, um bloß keine bissige Bemerkung zu machen, die sein unordentlicher Zustand sofort Lügen strafen würde. Nachdem er ausgetrunken hatte, drehte er den Deckel wieder auf die Kanne und sagte, eher an sie als an Asiyah gerichtet: »Also gut. Wo ist er?«
»In Sicherheit.«
Dass es auch andere Möglichkeiten gegeben hätte, verursachte Aristide größere Bauchschmerzen, als es sollte. »Und kann ich ihn sehen? Mit ihm sprechen?«
»Wenn du das nicht könntest, hätte ich dir nicht gesagt, dass du nach Dadang fliegen sollst. Aber warte lieber noch etwas – jetzt ist es erst halb sechs. Die meisten Leute schlafen noch. Ruh dich etwas aus. Frühstücke.«
»Gibt es in der Nähe von … wo auch immer ein gutes Hotel?«
»Mhm.« Asiyah schob die Trennwand zwischen dem Wagenfond und der Fahrerin zur Seite und sagte etwas auf Shedengue, das Aristide kaum verstand – es klang nach einem Befehl, wenn auch nach einem höflichen. Sie antwortete mit einem einzigen Wort, dann schob er die Trennwand wieder zurück.
Aristide musste schwer schlucken, schmeckte noch den Kaffee, der in seinem Mund inzwischen sauer geworden war. »Vielen Dank für all das hier«, meinte er. Solche Sätze kamen ihm nur auf der Bühne leicht über die Lippen und er hatte schon seit Langem vor keinem Publikum mehr gestanden. Je ernster er die Worte meinte, desto stärker blieben sie ihm im Halse stecken. Diesmal bekam er davon Halsschmerzen.
Asiyah schnaubte bloß: Wortlos erkannte er die Dankbarkeit an, ohne sie jedoch anzunehmen.
Nun ja, damit hatte Aristide zwar gerechnet, trotzdem war er erleichtert, dass es sich nicht um reine Wohltätigkeit handelte. »Was ist los?«
»Ich mache das nicht für dich«, sagte Asiyah. »Verstehst du das? Ich kann dich nur dazuholen, weil die Nachbesprechung mit ihm bereits stattgefunden hat. Und selbst jetzt sollte ich es eigentlich nicht tun. Aber …«
»Du willst etwas von mir.« Als Aristide mit diesen Worten in die Verhandlungen einstieg, fühlte er sich so wohl, wie seit dem Augenblick nicht mehr, als Daoud bei ihm geklopft und ihm gesagt hatte, wer am Telefon war. »Also los. Worum geht’s?«
Wenigstens besaß Asiyah genug Anstand, den Blick zu senken, versuchte es mit einem verschämten Lächeln und betrachtete den goldbestickten Saum seiner Tunika, die sich über seine Knie ausbreitete. »Die Hilfslieferungen.«
Das war nur eine Frage der Zeit gewesen, außerdem ging der Krieg nun sowieso zu Ende. »Hach ja«, seufzte Aristide. »Die Erträge aus Schwarzmarktbohnen hätten eh nicht für die Ewigkeit gereicht. Ich stelle den Betrieb ein, sobald ich wieder in Rarom bin.« Mit seinen Worten überraschte er sich selbst. Als ob er nach allem, was auch immer heute passierte, einfach wieder in den Alltag zurückkehren könnte. Als wäre all das hier vielleicht gar nicht real, sondern ein eigenartiger Traum, aus dem er desorientiert unter dem Moskitonetz in seinem Schlafzimmer aufwachen würde, in dem luftigen, stuckverzierten Haus in der Blatti Ahzed. Zumindest hatte der Flug sich wie ein Albtraum angefühlt und die letzten Auswirkungen von zu viel Gin gaben jedem Wort und jeder Handlung den Anschein, der Wirklichkeit etwas entrückt zu sein.
Asiyahs Lächeln wurde kleiner, verschwand dann ganz. »Es geht … nein. Das Ganze ist etwas komplizierter. Meinetwegen musst du nicht damit aufhören. Ich möchte, dass du mit mir zusammenarbeitest. Die Sache etwas … strategischer angehst?«
Darin lag das Problem, wenn man Hilfslieferungen an Orte brachte, wo Gewalt herrschte – Überlebenswichtiges wurde zu Spieljetons, sodass Reis und Palmöl gleichbedeutend mit Waffen, Macht, Land waren. »Du willst, dass ich die Leute von der Versorgung abschneide, die euch Probleme bereiten.«
»Das ist … weitestgehend korrekt. Ja.«
»Hast du jemand Bestimmtes im Sinn?« In Gedanken ging er eine Liste ihrer wichtigeren Kunden durch, doch da hielt der Wagen an und Asiyah legte ihm die Hand aufs Knie.
»Nicht jetzt, Aristide. Über das Geschäftliche sprechen wir später. Vielleicht beim Abendessen? Oder morgen. Jetzt hast du Zeit, um zu schlafen. Dich … vorzubereiten.« Asiyah gab ihm eine Visitenkarte. »Ruf dort an, wenn du so weit bist.«
Aristide steckte die Karte ein, ohne sie anzusehen; er hatte Angst, dass er die Nummer sofort wählen würde, wenn er sie erst einmal kannte. Und zugleich hatte er Angst, dass er die Karte, wenn er sie noch länger in der Hand hielt, so weit wegschleudern würde, wie er konnte, um sich vor dieser Abrechnung zu retten.
KAPITEL
2
Das Haus in der Coral Street war kalt und leer und wurde nur mit minimalem Personal unterhalten, die meisten Räume blieben verschlossen. Wie die ganze Straße und die Stadt: Sie erholten sich noch von den Kämpfen und dem Bürgerkrieg.
»Ma’am.« Der Butler Magnusson hielt Lillian die Vordertür auf wie die Figur einer Wanduhr, die auf ihre Ankunft eingestellt war. Allerdings wurde die Wirkung durch die Lesebrille, die er an einer Kette um den Hals trug, erheblich gemildert. Eine abgenutzte Ausgabe von Rita Ryder und Rote Mitternacht ragte aus einer Schublade unter der Bank in der Eingangshalle hervor.
Lillian hatte nicht vorgehabt, zwei Häuser gleichzeitig zu finanzieren, besonders nicht mit ihrem befristeten Regierungsgehalt, das die anstehende Wahl nicht überdauern würde. Eigentlich konnte sie sich die Bediensteten auch gar nicht leisten. Doch obwohl Damesfort weniger stark beschädigt war und als Rückzugsort für die Wochenenden benötigt wurde, brauchte sie zudem eine Übernachtungsmöglichkeit in der Stadt. Es war günstiger, das Schlafzimmer zu heizen, als sich dauerhaft in einem Hotel einzumieten, auch wenn das Haus sie deprimierte. Und da sie, genau wie Jinadh, zeitlich sehr eingespannt war, konnten sie auf Personal nicht verzichten.
Beide Häuser, eines in der Stadt, das andere auf dem Land, waren irgendwelchen Ministern aus dem Ospie-Mittelbau übergeben worden. Diese hatten umdekoriert, umgeräumt, Antiquitäten von unschätzbarem Wert verscherbelt. Während der Unruhen war das Erdgeschoss in der Coral Street geplündert worden, doch die oberen Etagen waren noch bewohnbar – gerade so. Ihr Geld hatte ausgereicht, um die Bibliothek im Erdgeschoss freizuräumen und einen Schreibtisch hineinzustellen, allerdings gab es in dem Raum noch immer keine Bücher.
Die Ospies hatten ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Aber wenigstens wohnte Lillian nun hier, und sobald sie sich eingewöhnt hatte und es sich leisten konnte, würde sie alles in Ordnung bringen.
»Wie ist Ihr Termin mit Ms. Higata verlaufen?«, fragte Magnusson und nahm ihr Schirm und Aktentasche ab.
Rinko Higata war die Vorsitzende des Sackett-Debattierclubs gewesen, als Lillian sich eingeschrieben hatte: eine Frau mit unbeugsamem Willen, den sie durch ihre Haltung wie eine perfekt ausbalancierte Klinge schwang. Später hatte sie Jura studiert und sich einen Namen gemacht, Amberlough jedoch verlassen und war nach Inorugara gegangen, als die Ospies es in Gedda … unwirtlich werden ließen. Nun war sie zurück und übernahm Fälle von Bedürftigen.
»Das war leider nichts. Ich hatte zwar nicht geglaubt, dass sie uns groß weiterhelfen kann, aber wenigstens wäre sie kostenlos gewesen.«
Nachdem Lillian aus Porachis geflohen war, hatte sich ihr gesamtes Vermögen auf mysteriöse Weise in Luft aufgelöst. Es gab zwar keine Aufzeichnungen, die bewiesen, dass es komplett in die Taschen der Ospies gewandert war, doch in diesem Punkt hatte sie sich Rechtsbeistand holen wollen. Rinkos Spezialgebiet waren Wirtschaftsverbrechen und sie konnte wie von Zauberhand belastende Finanzdokumente aufspüren, doch wenn alle Beweise vernichtet worden waren, dann konnte sogar sie wenig ausrichten.
»Und die Komiteesitzung?« Magnusson, selbst mit beschränktem Budget ein Profi durch und durch, hielt ihr ein leicht verbeultes Silbertablett hin, darauf ein Glas Whiskey, pur. Vielleicht war es ein extravagantes Vorhaben, die Bibliothek zu bestücken, doch die Bar stellte eine medizinische Notwendigkeit dar.
»Die reinste Keilerei, wie erwartet. Bihaz hält es für keine gute Idee, Makricosta zur Einweihung einzuladen – sie glaubt, damit erregen wir zu viel Aufmerksamkeit für … unangenehme Gerüchte. Lenken zu sehr vom ernsten Anlass der Veranstaltung ab. Und Miles argumentiert noch immer gegen das gesamte Vorhaben, aber dafür ist es jetzt etwas zu spät.«
»Und Ms. Simons?«
»Honora?« Noch eine Schulfreundin, die die Ospies überlebt hatte, indem sie mitgespielt und auf Partys freundlich gelächelt hatte, während sie alles, was sie entbehren konnte, an unauffällige Wohltätigkeitsorganisationen gespendet hatte, die davon die Hälfte an den Laufsteg weitergaben. »Sie hat sich sehr lieb für Miles’ Verhalten entschuldigt, nachdem er den Raum verlassen hatte.« Lillian stürzte den halben Whiskey hinunter und seufzte. »Sind die Koffer gepackt?«
»Und alle anderen sind auf dem Weg ins Wochenende.«
»Hätten Sie nicht mitfahren und Bern hierlassen sollen?«
»Ma’am«, erwiderte Magnusson. »Bitte verzeihen Sie, wenn ich meine Kompetenzen überschritten habe, aber Mr. Addas profitiert von einem Botenjungen mehr als von mir, da Ms. Wilce ja das Haus verwaltet.«
»Sie wollten Zeit zum Lesen haben«, meinte Lillian und beobachtete, wie seine eingefallenen Wangen zur Antwort erröteten. Vielleicht war das etwas zu vertraut, doch in schwierigen Zeiten kam es zu solchen Entwicklungen.
Magnusson war ein geddischer Auswanderer, der als junger Mann eine Asunanerin geheiratet hatte und früh verwitwet worden war. Die Sprache beherrschte er fließend und stellte eine Bereicherung für Lillians Familie da. Als sie nach Sunho gekommen waren, war er jeden Pfennig, den sie sich nicht leisten konnten, wert gewesen. Bei ihrer Abreise war es ihnen recht gut gegangen: Lillian als Leiterin der Presseabteilung für die Sunhoer Filiale von Camden Standard Trade, Jinadh als Assistent des Kulturredakteurs im asunanischen Zweig von Siebenthal’s. Ja, sie hatten sich beinahe zu Tode gearbeitet, doch dafür konnten sie Magnusson bezahlen, ihr Haus zu verwalten.
Als das Ospie-Regime schließlich zusammenbrach, wollte er zurückkehren: Seit fünfzehn Jahren war er nicht mehr in Gedda gewesen. Lillian fühlte mit ihm. Und als Honora sich mit dem Angebot an sie gewandt hatte, ihr eine Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Übergangsregierung zu geben, hatte sie ihm angeboten mitzukommen. Siebenthal’s zauberte Jinadh eine Stelle beim Observer aus dem Hut, einer Zeitung in Amberlough City, die sie kürzlich erworben hatten. Dafür hatte er zwar Gehaltseinbußen hinnehmen müssen, doch ihm gefiel die Arbeit.
»Der letzte Zug nach Damesfort fährt in einer Stunde«, sagte Magnusson, »aber Sie könnten auch noch den in einer halben erwischen.«
»Wenn er denn fährt«, meinte Lillian. Die Bahnverbindungen im Land waren eine einzige Katastrophe, die Hälfte der Strecken zerbombt und nicht benutzbar. Letzten Endes war die Strategie des Laufstegs aufgegangen: aushungern, spalten und erobern. Doch sie hatte Chaos hinterlassen. Darauf bezogen sich beide Ministerkandidatinnen in ihren Kampagnen. Frye als Teil ihres Programms und Saeger als Mittäterin bei den Bombenanschlägen.
Trotz der anstehenden Einweihungszeremonie wurden die Mitglieder des Laufstegs nicht von allen als Helden betrachtet.
»Bevor Sie gehen, Ma’am«, sagte Magnusson, »da ist ein Telegramm gekommen, während Sie außer Haus waren.« Mit dem Kopf deutete er auf das Posttablett auf dem Kartentisch im Flur.
Makricosta.
Sie waren lose in Kontakt geblieben, deshalb hatte sie keine Bedenken dabei gehabt, ihn wegen der Zeremonie anzuschreiben. Das Ganze war eher Honoras Einfall gewesen. Lillian koordinierte Presseinformationen, stellte den Übergangsministern und dem Regierungsrat öffentliche Erklärungen zusammen. Honora veranstaltete Partys, die der Übergangsregierung den Anschein gab, als wüsste sie, was sie täte: Mittagessen, Galas, Brunch zu Wohltätigkeitszwecken. Mit Pomp konnte man jedem einen Funken Selbstbewusstsein verleihen.
Als zum ersten Mal über die Denkmalsidee diskutiert wurde, hatte Honora Lillian zur Seite genommen und sie, beinahe atemlos, gefragt: »Kriegen wir es irgendwie hin, Makricosta herzuholen? Dann hätten wir einen echten Zeitzeugen dabei.«
Und obwohl Lillian aus zahlreichen Gründen energisch widersprochen hatte, hatte Honora sie kleingekriegt. Lillian war ihr für die Stelle etwas schuldig und sie hasste es, jemandem etwas schuldig zu bleiben.
Beim ersten Mal hatte Aristide schlichtweg abgelehnt – das Telegramm hatte einfach Nein gelautet –, doch beim zweiten Mal hatte der brennende Zorn seiner Worte das Florpostpapier beinahe in Flammen aufgehen lassen, was Lillian als einen Fortschritt betrachtete. Auf ihr drittes Telegramm hatte sie keine Antwort bekommen … noch nicht.
Ihr saß das Komitee im Nacken, sie fragten ständig nach, wann sie die Liste der Redner festlegen und die Zeremonie öffentlich ankündigen könnten. Sehr viel länger konnte sie sie nicht vertrösten.
Beklommen stellte sie ihren Whiskey ab und brach das Siegel.
CYRIL IN DADANG STOPP ARI HINGEFAHREN STOPP DIREKTE KORRESPONDENZ GRAND LDOTHO HOTEL STOPP D QASSAN ENDE
Das zarte Papier knisterte, als Lillian scharf die Luft einsog.
»Ma’am?« Magnussons Schuhe knarzten, während er von einem Bein aufs andere trat und offenbar auf Anweisungen wartete.
Lillian hatte keine. Um sie herum verschob sich die Geräuschkulisse, sodass das Rauschen eines vorbeifahrenden Wagens auf der verregneten Straße ihr in den Ohren dröhnte, Magnussons Stimme jedoch wie aus weiter Ferne zu ihr drang. Hinter ihren Augen pulsierte das Blut, so schnell, dass es schmerzte.
»Ma’am. Ms. DePaul.« Magnusson drückte sie am Ellenbogen, legte ihr eine Hand zwischen die Schultern. »Geht es Ihnen gut?«
Ohne einen Gedanken an Anstand oder Klassenunterschiede klammerte sie sich an seinen Unterarm. »Stuhl«, entfuhr es Lillian und Magnusson führte sie zum Telefonbänkchen unter der Treppe.
»Schlechte Neuigkeiten?«, fragte er.
»Nein«, antwortete sie. »Ich weiß es nicht.«
»Möchten Sie ein Glas Wasser?«
»Wo ist mein Whiskey?«, fragte Lillian und klammerte sich an die abgewetzte Armlehne mit grünem Samtpolster. Ihr Schweiß sickerte in den weichen Flor des Stoffes. Sie ließ die Hand sinken und wischte sie an ihrem Mantel ab, den sie noch nicht abgelegt hatte.
Vom Kartentisch brachte Magnusson ihr das Glas. Lillian atmete langsam aus und zwang sich, das Telegramm noch einmal zu lesen. Cyrils Name in Großbuchstaben, unten am Y leicht verwischt. Cyril war in Dadang. Man hatte Cyril gefunden.
Schon vor Jahren hatte Lillian ihn aufgegeben und für tot gehalten. In Porachis hatte sie kurz Hoffnung geschöpft, doch dann hatte es lange Zeit keine Neuigkeiten gegeben, während ihr eigenes Leben derart kompliziert geworden war, dass sie keinen Bruder anerkennen konnte, der nicht tot war. Im allgemeinen Chaos, das folgte, als sie sich in Sunho eingewöhnen, heiraten und Arbeitserlaubnisse beantragen, nach einer Anstellung suchen und für Stephen Nachhilfelehrer sowie eine Schule finden mussten, hatte sie weder die Zeit noch die Energie dafür gehabt, mehr als einfach nur zu trauern. Nun wurde sie von Schuldgefühlen übermannt, zählte die Jahre, in denen sie nach ihrem Bruder hätte suchen können, Jahre, in denen sie zumindest hätte hoffen sollen.
»Ihr Whiskey, Ma’am.«
Beinahe wäre Lillian zusammengezuckt, doch die Gewohnheit ließ sie stillsitzen. »Danke, Magnusson.«
»Ich möchte nicht neugierig erscheinen«, setzte er an und hielt inne.
Was sollte sie ihm denn verdammt noch mal sagen? Das Telegramm enthielt kaum Informationen. Cyril lebte also. Würde er nach Hause kommen? War er bei Verstand? Gesund? Unverletzt?
»Anscheinend«, fing Lillian an, schüttelte dann jedoch den Kopf. »Ich habe Neuigkeiten erhalten. Ich …«
Mutter und all ihre Söhne, sie sollte in zwanzig Minuten im Zug nach Carmody sitzen. Was, wenn Daoud ihr eine weitere Nachricht hierherschickte?
»Können Sie heute Nacht hierbleiben?«, fragte sie Magnusson. »Den Zug morgen früh nehmen?«
»Selbstverständlich«, antwortete er, und obwohl er sich eigentlich über die Zeit zum Lesen hätte freuen sollen, wirkte er vor allem besorgt.
»Vielen Dank. Ich muss ein Telegramm verschicken. Jetzt sofort. Es tut mir leid, ich weiß, dass es weit unterhalb Ihrer Zuständigkeit liegt. Wenn Bern hier wäre …«
»Das geht schon in Ordnung«, sagte Magnusson, nahm den Füller von der Telefonbank und riss ein Blatt Papier vom Block. »Ich bin so weit.«
»Es geht an Cross-Costa Importe, Blatti Iynodib, dritte Zone in Rarom, Ibdassi. Das ist in Liso. Ja, das wissen Sie natürlich. An Herrn Daoud Qassan. Jede weitere Korrespondenz nach Damesfort, Carmody, Dameskill County usw. Stopp. Bitte halten Sie mich über alle neuen Entwicklungen auf dem Laufenden. Stopp. Falls nötig, Funkverbindung einrichten. Stopp. Mein Name. Ende. Und falls über Nacht etwas eintrifft …«
»Leite ich es nach Damesfort weiter, bevor ich das Haus abschließe. Oder falls es spät kommt, bringe ich es mit.«
»Vielen Dank.« Endlich trank Lillian den Whiskey aus, der sich in ihrem Magen wie eine Wasserbombe anfühlte.
Mit dem letzten Zug nach Carmody kam Lillian erst sehr spät am Bahnhof an. Martí erwartete sie unten an der Treppe und sah in etwa so erschöpft aus, wie sie sich fühlte.
»Es tut mir sehr leid, Sie zu dieser nachtschlafenden Zeit aus dem Bett zu holen«, sagte sie und übergab ihr ihren Koffer.
Martí senkte den Kopf, allerdings nicht aus Respekt, sondern um ein Gähnen zu verbergen.
Wie so viele andere Dinge konnte Lillian sich eigentlich keine Fahrerin leisten. Doch entweder sie tat es oder sie verpasste Besprechungen, weil sie von den Launen der Bahn und Straßenbahnwagen abhängig war, die sich beide noch von dem Laufsteg-Ansturm in der Spätphase des Ospie-Regimes erholten. An diesem Abend hatte Lillian ausnahmsweise den Zug genommen, da Jinadh ihn gern mied. Die Geddaner spürten den Stachel des Gewürzkrieges noch immer und einigen Leuten stießen die jüngsten Verwicklungen Geddas mit Jinadhs Heimatland sauer auf.
Außerdem brauchten sie den Wagen in Damesfort: Martí sollte Stephen am nächsten Tag von der Schule abholen. Lillian wollte ihn nach den Briefen, die sie von der Schulleitung erhalten hatte, lieber nicht alleine Zug fahren lassen.
In diesem Trimester hatte sie beinahe jede Woche einen auf dem Posttablett gefunden, zuletzt kam der Schlag, dass man es in Cantrell bevorzugen würde, wenn Stephen der Schule eine Zeit lang fernblieb. Genauer gesagt, das ganze Leighberth-Trimester. Abhängig von seiner Haltung und seinen schulischen Leistungen, die durch schriftliche und mündliche Prüfungen ermittelt werden würden, durfte er nach der Tagundnachtgleiche vielleicht bis auf Widerruf zurückkehren. Falls er die Prüfung nicht bestand oder, was wahrscheinlicher war, sich sein Verhalten nicht besserte, flog er von Cantrell und kam auf die schwarze Liste, was ihm die Chance auf eine der besseren weiterführenden Schulen verwehren würde.
Von all ihren Sorgen völlig zermürbt war Lillian eingeschlafen, als Martí vor dem Aufgang in Damesfort anhielt. Sie wachte auf, als die Fahrertür zuknallte, und ihr schmerzte der Nacken. Aus dem Augenwinkel sah sie warmes Licht aufleuchten und blinzelte dagegen an, als sie sich ihm zuwandte. Ihr näherte sich eine vertraute Silhouette, die bereits die Stufen heruntereilte.
»Da bist du ja«, sagte Jinadh. Er klang erleichtert. In letzter Zeit hatten ihre Aufgaben mehr Planänderungen in letzter Minute erfordert, als ihm lieb war. Und er gewöhnte sich noch immer in Amberlough ein. Manchmal hörte Lillian die Abscheu in seiner Stimme, wie eine dünne Rauchspur im Wind. In Asu hatten sie sich wenigstens beide auf unbekanntem Terrain bewegt. In Gedda hatte sie halbwegs vertrauten Boden unter den Füßen. Er hingegen hatte keinerlei Anknüpfungspunkte, und das ließ ihn oft gereizt reagieren.
Lillian stieg aus dem Wagen und streckte sich, dann küsste sie ihn auf die Wange. »Hat jemand angerufen? Telegrafiert?«
»Es ist drei Uhr nachts.«
»Das weiß ich.« Sie atmete die reine Landluft ein, um zur Ruhe zu kommen, und als sie ausatmete, bildete sich eine Wolke. Den Regen hatten sie hinter sich gelassen, am Himmel über dem Anwesen zeichneten sich einzelne silberne Wolken ab, hinter denen Sternenbänder entlangzogen.
»Es ist nichts gekommen«, sagte Jinadh auf Geddisch, als könnte er sie damit besser überzeugen. »Komm rein. Komm ins Bett. Es ist eisig hier draußen.« Hier war es kälter als in der Stadt, wo die enge Bebauung die meisten Straßen vor dem Wind schützte. Jinadh, der in den Tropen geboren worden war, trug über einem Strickpullover einen Hausmantel mit Flanellfutter, zitterte aber trotzdem noch.
»Geh schon mal vor«, erwiderte Lillian. »Ich will nur schnell in der Bibliothek vorbeischauen.«
Er lachte auf. »Das ist doch Blödsinn.«
»Ist es nicht.«
Martí zuckte zusammen, als sie derart hart widersprach. Jinadh trat einen Schritt zurück. »Ein Abend ohne diesen Mist wäre nett gewesen.«
»Es tut mir leid.« Lillian legte sich eine Hand an die Stirn, als könnte sie damit ihre Gedanken sortieren. Die Belastung, die eine weitere Auswanderung und ein Sohn im Teenageralter mit schlechtem Benehmen mit sich brachte, hatte ihre Ehe nicht gut vertragen. Wahrscheinlich würde die jüngste Entwicklung auch keine Wunder vollbringen. »Aber ich glaube einfach nicht, dass ich schlafen kann. Ich habe Neuigkeiten erhalten. Kurz bevor ich in der Stadt aufgebrochen bin.«
»Bestimmt kann die Arbeit ein paar Stunden warten«, meinte Jinadh. »Bitte ruf erst am Morgen zurück.«
»Es geht nicht um …« Lillian hielt inne, da Martí gerade ihre Koffer hereintrug und Bern an der offenen Eingangstür auf sie wartete. »Später.«
Bei diesen Worten wich Jinadhs gereizter Gesichtsausdruck Neugier, doch das war noch schlimmer, denn diese Miene war ihr nicht vertraut. »Wenn du in die Bibliothek gehst …«, sagte er und sie fand sich damit ab, dass sie nicht allein sein würde.
»Lassen Sie die Koffer einfach im Flur stehen, Martí«, sagte sie. »Ab ins Bett mit Ihnen.«
»Ja, Ma’am. Danke.« Martí tippte sich an die Kappe und schlurfte wieder hinaus, um den Wagen in die Garage zu fahren.
»Sie auch, Bern.« Lillian winkte den Diener fort, als er gerade ihren Koffer nehmen wollte. »Ich mache das schon.«
»Ma’am«, verabschiedete er sich und unterdrückte ein Gähnen.
»Was ist los?«, fragte Jinadh und trat so dicht neben sie, dass sich ihre Schultern berührten. Diese Nähe verstärkte Lillians Erschöpfung noch und sie ließ sich gegen ihn sinken, vergrub die Nase in seinen Haaren. Alle Feindseligkeit schmolz dahin, als sie seinen Duft einatmete. Ihr brannten die Augen und sie biss sich in die Wange.
»Sie …« Noch einmal musste sie Atem holen. Aus Vorsicht fuhr sie auf Porashtu fort. »Jinadh, sie haben ihn gefunden.«
Einen Augenblick lang herrschte Stille, kurz wusste er nicht, wen sie meinte.
»Cyril«, erklärte sie, so leise, dass nur er es hören konnte.
Jinadh blieb mitten in der Eingangshalle stehen und packte sie am Ellenbogen, drehte sie zu sich herum. Für einen flüchtigen Moment sahen sie sich in die Augen, doch dann verlor sie die Fassung, und als er die Arme um sie legte, entrang sich ihr ein Schluchzen, das sie schon vor Stunden hätte zulassen sollen.
»Nicht hier«, meinte sie, die feuchte Wange an sein Ohr gedrückt.
Jinadh packte sie noch fester am Ellenbogen und führte sie tiefer in ihr Elternhaus hinein, so als hätte sie den Weg vergessen. Beinahe fühlte es sich so an. Kurz vor der Bibliothek betätigte er den Lichtschalter, sodass die Eingangshalle in Dunkelheit gehüllt wurde. Im Kamin der Bibliothek brannten die Reste eines Feuers und das gepolsterte Ledersofa war warm. Über einer Armlehne hing eine gehäkelte Decke, leicht zerwühlt, da sie kürzlich benutzt worden war.
»Du hast auf mich gewartet«, sagte Lillian.
Jinadh zuckte mit den Achseln. Dann setzte er sich neben sie. »Erzähl es mir.«
»Ich weiß auch nicht.« Sie nestelte mit der Decke in den Händen, zog die Maschen auseinander. »Ich habe ein Telegramm bekommen, aber da stand nichts drin. Nur, dass er aufgetaucht ist und Makricosta zu ihm gereist ist. Ganze drei Zeilen, Jinadh. Mehr nicht. Und mein Bruder …« Sie presste die Hand auf den Mund, um die hervorsprudelnden Worte aufzuhalten, denn anders schien es ihr unmöglich. Jinadh legte sanft seine darauf, zog ihr die kalten Finger von den Wangen.
»Wenn du zu ihm fahren musst, dann tu das. Wahrscheinlich können wir uns deine Reisekosten leisten. Und ich weiß, dass ich sehr darauf bestanden habe, aber Stephen und ich können uns über die Feiertage auch allein beschäftigen.«
»Ach, Tempelglocken noch mal«, schimpfte Lillian und kniff die Augen so fest zusammen, dass sie Sterne sah. »Ich kann nicht verreisen. Die Einweihungszeremonie, Jinadh. Und die letzten Wahlkampfmonate. Wenn ich will, dass … dann kann ich nicht in Liso sein.«
Nachdem ihr klar wurde, was sie gerade gesagt hatte, wagte sie es nicht, die Augen zu öffnen. Sie spürte, wie Jinadh sich von ihr zurückzog.
Seit ihrer Ankunft herrschte zwischen ihnen eine gewisse Spannung, was zum Teil daran lag, dass Lillian fest entschlossen war, sich einen Platz in jeder möglichen Regierung zu sichern, die ins Cliff House einziehen würde. Ihre Stelle bei der Übergangsregierung würde selbstverständlich nicht von Dauer sein. Lillian war gut qualifiziert, um für den Staat Werbung zu machen, und das könnte dabei helfen, den Familiennamen wieder aufzupolieren, der in jüngerer Zeit etwas befleckt worden war.
Die ehemalige Laufsteg-Strategin Opal Saeger, einst die rechte Hand Cordelia Lehanes, hatte vor dem Aufstieg der Ospies zwei Amtszeiten lang den amberlinischen Zweig der Geddischen Allianz der Bühnentechniker geleitet und die große örtliche Gewerkschaft bei Nationaltreffen vertreten. Dort hatte Saeger sicher einiges an politischer Erfahrung gesammelt, doch nach Lillians Meinung längst nicht genug, um ein ganzes Land zu regieren.
Saeger war jung, jünger als Lillian, und ihre Rhetorik naiv, wodurch sie an den Universitäten ein starkes Gefolge gewonnen hatte. Ihre politische Partei Gedda voran konzentrierte sich hauptsächlich auf soziale Programme und ließ weite Teile der Innen- und Außenpolitik nahezu unbeantwortet oder vermischte sie völlig verwirrend miteinander.
Die Industriemagnatin Emmeline Frye, eine frühere Ratsherrin in Nuesklend-Stadt, hatte bereits Lillians Stimme. Doch das musste Saeger nicht wissen. Lillian würde unter beiden Kandidatinnen eine Anstellung annehmen. Jinadh, der in die höfische Politik hineingeboren worden und ihr mit großer Erleichterung entkommen war, freute sich nicht gerade darüber, dass Lillian sich wieder ins Getümmel stürzen wollte.
Sogar sie selbst war darüber bestürzt, wie sehr sie zögerte, nach Liso zu reisen. Aber es ging einfach nicht, wenn sie für einen Posten in der Regierung im Rennen bleiben wollte.
»Ich habe Magnusson beauftragt, Daoud zu telegrafieren, dass alle Neuigkeiten hierhergeschickt werden sollen. Und alles, was heute Abend oder morgen kommt, bringt er mit, hat er gesagt.«
»Schön«, meinte Jinadh und sie sah, wie sehr er sich bemühte, ihren Pragmatismus zu schlucken. »Also telegrafieren sie dir hierher. Und was dann? Kommt er nach Gedda?«
Das ließ sie innehalten wie einen Jäger, dessen Pferd vor einem Zaun scheute. »Ich … ich weiß es nicht. Vielleicht könnten wir ihn aufnehmen? Hättest du etwas dagegen?«
»Wäre das denn sicher?«
Nach Lillians Flucht aus Porachis war die Ospie-Presse nicht gerade zimperlich mit den DePauls umgegangen. Ihre Liaison mit Jinadh war völlig überzeichnet und mit Spionage in Verbindung gebracht worden, ebenso wie mit – und das war nicht völlig falsch – porachinischem Geld und lisoanischen Waffen, die an den Laufsteg weitergeleitet worden waren. Diese Geschichte hatte Lillian zu ihrem Vorteil drehen können, nachdem Acherby abgesetzt worden war. Doch was sie über Cyril gedruckt hatten … Da bot sich weniger Spielraum.
Ein mehrfacher Mörder und Überläufer, der inzwischen alle Seiten gegen sich aufgebracht hatte. Keine Loyalität gegenüber der OSP oder dem FOCIS, was ihn zumindest wie einen ehrbaren Gegner hätte erscheinen lassen. Der einzige Aspekt, den ein wohlwollender Leser vielleicht aufgreifen könnte, war seine Affäre mit Aristide Makricosta, die kurz als kleines Detail einer Reihe schmutziger Fehltritte ausgeführt worden war. Jemand in Acherbys Regierung hatte eindeutig erkannt, dass es hier einen Angriffspunkt gab, und diesen so weit heruntergespielt, wie es eben ging.
Lillian rieb sich den steifen Nacken. »So sicher wie für jeden heutzutage. In den letzten fünf Jahren hat es mehr als genug Nachrichten gegeben, um alles zu vergraben, das wir lieber im Dunkeln lassen wollen.«
»Falls dein Plan Erfolg hat«, meinte Jinadh. »Falls du wirklich Pressesprecherin wirst …«
»Dann bin ich in der idealen Position, um mit dieser Art von Problemen umzugehen.«
»Was ist mit Stephen?«
»Was soll mit ihm sein?«
»Glaubst du nicht, dass dein Bruder vielleicht … dass er vielleicht nicht das beste Vorbild abgibt?«
Lillian verdrehte die Augen. »Wahrscheinlich verstehen sich die beiden wie junge Hunde.« Da sie Jinadhs Verwirrung über diese Redewendung bemerkte, fügte sie hinzu: »Äh, Freunde wie Docht und Streichholz?«
»Lillian, ich meine es ernst«, erwiderte Jinadh. Tief in seinen Augen spiegelte sich der schwache Schein des Feuers, genau dort, wo er seine Wut verbarg.
»Das weiß ich.« Sie legte die Hände auf seine. »Es tut mir leid.«
Er schüttelte den Kopf. »Nein. Nein, mir sollte es leidtun. Das ist deine Last. Ich sollte dir helfen, sie zu tragen, stattdessen mache ich dir Vorwürfe.«
»Wir müssen einfach abwarten und schauen, was passiert. Im Augenblick kann ich dir nicht sagen, was ich vorhabe.«
Mit ernster Miene nickte Jinadh, ergriff ihre Hände und ließ sie auf seinem Schoß ruhen. Dann fuhr er mit neuer Entschlossenheit fort: »Wenn er kommt, ist das eine gute Sache. Ich habe immer … es hat mir wehgetan, dass du keine Familie hattest, die ich kennenlernen konnte, und dass du meine nicht kennenlernen konntest.«
»Ich glaube nicht, dass es eine solche Begegnung sein wird. Kein … kein glückliches Wiedersehen. Ich weiß nicht, wie es sein wird. Ich weiß nicht, wie er sein wird.«
»Er ist dein Bruder«, sagte Jinadh. »Egal, wie er ist, ich werde froh sein, ihm begegnet zu sein. Vor allem zur Sonnenwende.«
KAPITEL
3
»Ich muss dich warnen«, sagte Asiyah. »Er ist nicht … Er sieht möglicherweise nicht so gut aus, wie du ihn in Erinnerung hast.«
Sie standen im Hof eines Familiensitzes am Rande von Dadang. An einem Brunnen ragte eine niedrige Flaschenpalme mit dickem Stamm auf und warf karierte Schatten. Zwischen den Doppelhäusern waren Leinen gespannt, an denen bunte Tuniken und Umhängetücher hingen. Aristide fragte sich, wem sie gehörten. Hier lebte doch sicher niemand. Trotzdem war die Illusion bewundernswert. Und wenn er sich auf die raffinierte Inszenierung konzentrierte, konnte er verdrängen, was er gleich tun würde.
»Er hat lange Zeit auf feindlichem Gebiet verbracht«, fuhr Asiyah fort. »Er … Mensch!« Er wechselte ins Porashtu, das Aristide zwar schlecht verstand, aber deutlich besser als Shedengue, und sagte: »Hat sich durchgeschlagen?«
Aristide nickte und fragte sich, wo Cyril sich diese Fähigkeiten angeeignet hatte. Dachte an all die Fragen, die er nie gestellt hatte: über die leuchtende Narbe, die sich über seinen Bauch zog, die eigenartige Angewohnheit, stets wachsam zu sein, die ihn auf seinem Lebensweg begleitete. Wo hatte ein Schreibtischtäter aus gutem Hause so etwas gelernt? Auf welche andere Weise ihn das Leben wohl nun gezeichnet hatte?
»Bist du bereit?«, fragte Asiyah.
Aristide hasste, dass er in diesem Punkt derart leicht zu durchschauen war. Finster sah er Asiyah an. Seine Wut verbarg die anderen Emotionen nicht, aber wenigstens fühlte er sich dadurch etwas besser.
»Komm mit«, forderte der Prinz ihn auf und öffnete die Tür.
Von der aufsteigenden Sonne wurde ein gemütliches Wohnzimmer beleuchtet, auf einem Brett lagen Spielsteine verteilt, dort hatte jemand eine Partie Solitär unterbrochen. Die Stille im ganzen Haus erinnerte Aristide an ein leeres Filmset oder den Bereich hinter der Bühne am frühen Nachmittag. Ein Ort, der auf ein Drama vorbereitet war.
Am Zugang zu einem langen Flur, an dessen anderem Ende eine weitere Tür lag, blieb Asiyah stehen. Aristide musste ein Lachen unterdrücken, spürte einen Anflug von Hysterie. Wenn dies eine Szene in einem seiner Filme gewesen wäre, hätte er sie genauso gedreht. Vielleicht mit leichtem Dolly-Zoom, um die Spannung zu erhöhen. Zumindest wurde ihm schwindelig, als er den Flur entlangblickte.
»Ich warte hier«, verkündete Asiyah und zog sich auf das Sofa mit dem Solitär zurück.
»Er weiß Bescheid«, sagte Aristide. »Oder? Dass ich komme?«
Asiyah nickte einmal, nahm sich dann einen gelben Spielstein vom Tisch und steckte ihn demonstrativ in ein Loch.
Einen Augenblick zögerte Aristide noch, dann trat er in den Flur, der sich vor ihm wie klebriges Toffee erstreckte, bis er schließlich, sehr plötzlich, vor der Tür stand.
Sollte er anklopfen? Das schien ihm absurd. Aber es war eine Form der Höflichkeit, die man Cyril wahrscheinlich seit einiger Zeit nicht mehr erwiesen hatte. Außerdem ließ sich das Unvermeidliche dadurch noch etwas aufschieben.
Als Aristides Fingerknöchel auf das Holz trafen, bremste er die Bewegung ab, fragte sich dann, ob es zu leise gewesen war. Gerade als er ein weiteres Mal klopfen wollte, raschelte es hinter der Tür.
Ihm verschlug es den Atem.
»Herein.«
Enttäuschung fraß sich in sein Herz. Das war nicht die richtige Stimme. In seinen Erinnerungen hörte er sie genau: ihr warmes Timbre und glatter Ton, so klangvoll und verlebt wie ein Jackett aus Baumwollsamt oder die Kurven antiker Möbelstücke. Diese Stimme jedoch wirkte rau und schroff, wie fadenscheiniger Stoff mit ausgefransten Rändern.
Schmerzhaft dehnte sich das Schweigen, bis es durch ein weiteres Rascheln unterbrochen wurde. Dieses Geräusch konnte Aristide problemlos einordnen: die Seite einer Zeitung, barsch umgeblättert.
Dieser Laut weckte eine Erinnerung: Cyril am Frühstückstisch, der eine unangenehme Frage mied, indem er eine weitere Seite umblätterte – das Lecken am Daumen, die kurze Pause, bevor das Nachrichtenblatt an seinem Gesicht vorbeiwischte und sich an seine Kollegen schmiegte. Das Blitzen seiner Augen beim Flattern des Papiers, wie bei einer Wundertrommel. Manchmal erwischte Aristide ihn dabei, wie er ihn durch die kleine Lücke beobachtete. Danach taten sie so, als wären sich ihre Blicke nie begegnet.
Als er die Tür öffnete, musste er ihn unwillkürlich anstarren.
Ganz eindeutig handelte es sich um Cyril. Er musste es sein. Hinter dem Bollwerk der Zeitung waren seine Augen genauso scharf und blau, wie Aristide sie in Erinnerung hatte: das Innerste einer Kerzenflamme. Nun hatten sie allerdings rote Ränder und waren in tiefen Schatten versunken, rundherum hatte sich die Haut vor Erschöpfung lila gefärbt.
Cyrils Haare, die in Aristides Erinnerung goldgelb geleuchtet hatten, glitschig vor Öl und klebrig vom Wachs, hatte man kurz geschoren, sodass unter den Stoppeln die schmutzige Kopfhaut zu sehen war. In seinem Gesicht hatten sich Falten gebildet und die Haut hing an mehreren Stellen schlaff herab. Er war zwar fast zehn Jahre jünger als Aristide, wirkte aber ein Jahrzehnt älter.
Seine Muskeln waren verschwunden, hatten Haut und Knochen hinterlassen. Aristide hätte ihn auf etwa sechzig Kilo geschätzt, wenn man von dem Gewicht absah, das ihm das übermäßige Trinken an die Taille gehängt hatte. Davon waren ihm auch die kleinen Blutgefäße an Wangen und Nase aufgeplatzt – seine Nase, früher gerade und so scharf wie eine Messerklinge, nun mit einem Höcker in der Mitte, ein Bruch, der schlecht verheilt war.
Einst hatte Aristide darüber gestaunt, dass, welche Gewalt Cyrils Körper und Seele auch geschunden haben mochte, seine zerbrechliche Nase verschont hatte. Sie ihm gelassen hatte, damit er in gewissen Augenblicken mit tief verwurzelter, begüterter Arroganz auf andere herabschauen konnte. Nun war Cyril selbst das genommen worden.
Er sah furchtbar aus.
Falls Cyril genauso … ja, was eigentlich? Am Boden zerstört war? Erstaunt? Wie nannte man dieses hohle Gefühl der Leere? Falls er sich genauso eigenartig fühlte wie Aristide, ließ er es sich kaum anmerken. Er faltete lediglich die Zeitung zusammen und legte sie zur Seite, nahm sich dann eine Zigarette, die rauchend im Aschenbecher gelegen hatte. Diese hielt er geschützt unter der Handfläche, vorsichtig und verkrampft, als erwarte er, dass Wind oder Regen sie löschen könnten. Welche Schande: Er war ein so eleganter Raucher gewesen.
Aristide knallte die Tür zu fest zu. Cyril zuckte zusammen, ließ sich dann aber wieder auf seinen Stuhl sinken, als wäre ihm seine Reaktion gar nicht aufgefallen.
Sie befanden sich in einem Raum, der sicher ein Schlafzimmer gewesen wäre, wenn hier tatsächlich jemand gewohnt hätte. Außer zwei Korbstühlen und einem Tisch mit grober Holzplatte befanden sich keine weiteren Möbel darin. Aristide setzte sich Cyril gegenüber.
»Hallo«, sagte er und kam sich sofort wie ein Narr vor.
»Heilige Steine«, erwiderte Cyril. Er zog einmal an der Kippe und blies langsam den Rauch aus. »Bist du alt geworden.«
Das stimmte nicht. Nun ja. Zum Teil. Während Cyril Aristide betrachtete, konnte er all das sehen, was dieser Mann einst gewesen war. Die Jahre hatten ihn nicht verblassen lassen: Sie hatten ihn nur etwas zerbrechlicher gemacht. Über sein Alter hatte er sich nie klar ausgedrückt, war ein Meister darin gewesen, es in einem Gespräch nicht zum Thema werden zu lassen. Doch in den vergangenen Jahren schien es ihn eingeholt zu haben. Seinen Bewegungen und seiner Haltung haftete etwas Sprödes an. Oder vielleicht lag es einfach an der Situation, in der sie sich befanden.
Jedenfalls konnte er nicht besonders alt sein, trotz der silbernen Haare. Sie standen ihm gut: An den Wurzeln leuchteten sie und verblassten an den in Wellen gelegten Strähnen zu braunen und schwarzen Spitzen.
Aber dennoch, Grausamkeit vermittelte Cyril ein Gefühl von Sicherheit. Es hieß, entweder grausam zu sein oder die Fassung zu verlieren, und er wusste genau, welche Möglichkeit weniger Schmerzen verursachte.
»Du siehst auch nicht gerade …«, setzte Aristide an, hielt dann jedoch inne, weil ihm beinahe die Stimme brach.
»Sag es«, forderte Cyril ihn auf, denn er hätte es nicht ertragen können, wenn Ari in seinem Beisein rührselig geworden wäre. »Ich sehe schrecklich aus.«
»Als hätte dich jemand von seiner Schuhsohle gekratzt.«
Der Rhythmus seiner Worte, der Slang, riss Cyril einen Brocken aus dem Herzen, von dem er nicht gewusst hatte, dass er ihn noch verlieren konnte. Noch einmal zog er an seiner Zigarette, um das Loch zu stopfen. Seinen Geschmackssinn hatte er längst zerstört, hatte zu viel geraucht, zu viel getrunken, Teer genommen, als andere Laster die Spannung nicht mehr lösten oder den Schmerz dämpften. Nun schmeckte die Zigarette nach nichts, sie brannte nur.
»Asiyah hat mir erzählt, dass du hinter den feindlichen Linien gewesen bist«, sagte Aristide. »Ich habe gewusst, dass du für den lisoanischen Geheimdienst LSI gearbeitet hast, aber zuletzt hatte ich gehört …«
»Dass ich tot wäre.« Cyril hatte das ebenfalls geglaubt. Und manchmal hatte er sich gewünscht, dass es der Wahrheit entspräche. Vielleicht wünschte es sich ein Teil von ihm noch immer. »Beinahe wäre es so weit gewesen.«
»Also bist du entführt worden?«, fragte Aristide. »Oder bist du geflohen?«
»Historisch betrachtet habe ich dafür kein besonderes Talent.« Diese Worte ließ er so ätzend wie Lauge wirken, denn es war leichter, auf Aristide wütend zu sein als auf sich selbst.
Und Ari zuckte zurück, als hätte man ihn gestochen. Cyril konnte die vielen Anzeichen dafür entdecken, dass er um Fassung rang, und fragte sich, ob er seine Beobachtungsgabe seit ihrer letzten Begegnung derart verfeinert und geschärft hatte oder ob Ari nachlässig geworden war. Oder ob es sich einfach um die lange schlummernde Vertrautheit mit den Angewohnheiten des anderen handelte, die sich Bahn brach.
Von diesen drei Möglichkeiten gefiel ihm die erste am besten. Die anderen beiden betrachtete er nicht allzu eingehend, aus unterschiedlichen Gründen. Nun, da er sich den Luxus erlauben konnte, nicht nur ans Überleben und Strategien zu denken, sich durch List und Tücke einen Vorteil zu verschaffen, entdeckte er, dass sein Geist ein Feld voller Blindgänger war.
»Also dann«, setzte Aristide an. »Waren es wirklich republikanische Militante?«
Cyril nickte und nahm wieder die Nachbesprechungshaltung an. »Die sind mitten in der Nacht gekommen, haben gesagt, dass sie wüssten, was ich für den Süden mache. Haben mich verprügelt und zu sich ins Lager geschleppt.« Er überging die grausigen Details, die er Asiyahs Leuten haarklein berichtet hatte. Vor die Wahl gestellt – in Zukunft würde er stets sicherstellen, dass er eine Wahl hatte –, würde er nie wieder irgendjemandem davon erzählen. »Die haben mich eine Woche gefangen gehalten. Ich habe ihnen nichts erzählt.« Titten, er musste dringend etwas gegen diesen defensiven Tonfall unternehmen, damit gab er zu viel preis. »Die hätten mich umgebracht, aber sie haben sich nah an der Grenze befunden und da hat sie ein Überfallkommando gefunden. Haben alles zerstört. Mir das Leben gerettet.«
»Warum bist du nicht wieder über die Grenze gegangen?«
»Hab ich behauptet, dass sie mich gerettet hätten?« Inzwischen drückte er sich nicht mehr so klar wie bei der Nachbesprechung aus, sondern flüchtete sich in sichere Zweideutigkeiten. »Ich bin in einem Aschehaufen aufgewacht. Sie haben alles um mich herum niedergebrannt. Vielleicht haben sie geglaubt, dass ich tot war, oder gar nicht bemerkt, dass ich da war. Vielleicht war es ihnen auch einfach scheißegal. Ich weiß es nicht.«
Cyril zog eine weitere Zigarette aus dem mit einem Deckel verschlossenen Korb auf dem Tisch und entzündete sie am Ende seiner ausbrennenden Kippe, die er zu den vier anderen, die er an diesem Morgen bereits geraucht hatte, in seine Westentasche schmuggelte. Irgendwo hatten sie einen zerknitterten alten Leinen-Dreiteiler für ihn ausgegraben. Vermutlich speziell für dieses Treffen. Damit er sich wohler fühlte? Eine verdammte Farce. Der Anzug saß nicht gut. In Tunika und Tunnelzughose hätte er sich wohler gefühlt. Allerdings war alles besser als die Lumpen, die sie ihm bei seiner Ankunft ausgezogen hatten.
Aristide griff in den Zigarettenkorb.
»Die haben mir keine Streichhölzer dagelassen«, erklärte Cyril. »Auch keine Messer. Nichts Interessantes.«
»Weshalb?«, fragte Ari. »Hättest du … etwas Ungezogenes angestellt?« Die Anspielung brachte er nicht über die Lippen, ohne darüber zu stolpern. Cyril analysierte die möglichen Wege, die sein Satz hätte einschlagen können: Das Haus in Brand gesteckt? Dir etwas angetan?
Dann überdachte er seine Antworten und entschied sich, keine davon zu geben. Nur ein Lächeln, wie felsenfest angeschraubt.
Aristide holte ein Feuerzeug aus der Jackentasche und klopfte es mit einer schmerzhaften, gezierten Bewegung auf den Tisch. Es war ein hübsches Ding: purpurfarbene Emaille mit Goldrand an der Kappe. Etwas, wofür Cyril ihn, vor einer Ewigkeit, geneckt hätte. Nun überkam ihn der absurde Drang, es sich zu schnappen, in der Hand zu wiegen, das leuchtend glatte Material abzulecken. Doch er schaute nur mit trockenem Mund zu, wie Aristide sich mit kaum merklich zitternden Händen die Kippe anzündete.
Ari mit unsteten Händen. In was für eine Welt war er da zurückgekehrt?
»Was ist dann passiert?« Der Rauch weichte die harten Kanten von Aris Worten kaum auf, die überraschend knapp waren. Nun, mit diesem Spiel kannte Cyril sich aus, spielte es bereits, seit sich die Tür geöffnet hatte. Barrikaden errichten, die Füße fest in den Boden stemmen.
»Meine Nachbesprechung hat bereits stattgefunden, Aristide.« Er verschränkte die Arme. »Warum bist du hier?«
»Irgendjemand musste herkommen und ich war am nächsten dran. Ich habe meinen Sekretär beauftragt, deiner Schwester zu telegrafieren. Glücklicherweise haben wir Kontakt gehalten.«
Heiliger Bimbam. »Du hast Lillian kennengelernt?« Das konnte keiner von ihm verlangen: in eine Welt zurückzukehren, in der die Interaktion mit anderen nicht auf Stärke, Waffen, Informationen fußte. Sich neu einzugewöhnen. Seinem früheren Liebhaber zu begegnen. Dem, den man beinahe … tja. Und dann herauszufinden, dass dieser, während man im Fegefeuer gefangen gewesen war, mit der eigenen Schwester gequatscht hatte? »Ich wette, das ist gut gelaufen.«
»Besser als gedacht«, erwiderte Aristide. In der Art, wie er die Hand hielt, wie er die Asche an seiner Kippe betrachtete, lag ein ganzes Universum unausgesprochener Dinge. Wie eine Nebelbank, die an einem zerklüfteten Hügel festhing, breitete sich das Schweigen aus. Kurz bevor es sie beide erdrückte, blies Aristide es mit einem Themenwechsel, einem Tonartwechsel fort. »Ich habe nach dir gesucht, weißt du?«
Cyril legte den Kopf schief, lud ihn ein weiterzureden, ohne besonderes Interesse zu zeigen.
»Nicht sofort. Als du nicht … als ich nichts gehört habe. Aber als ich in Porachis war, wo ich Lillian kennengelernt habe, sind einige Informationen ans Licht gekommen. Mir kam zu Ohren, dass man dich in Liso gesehen hatte. Asiyah hat mir sehr geholfen, glaubte aber nicht, dass du noch am Leben wärst. Deshalb bin ich gekommen. Das muss ungefähr vor, na? … fünf Jahren gewesen sein? Jedenfalls hat er gesagt, dass du versucht hast, mich rauszuschmuggeln – mit deinen schlecht durchdachten Machenschaften. Anscheinend sind wir uns in die Quere gekommen. Da habe ich mich … verpflichtet gefühlt, nach dir zu suchen.«
Es fühlte sich an, als watete Cyril durch einen Sumpf, wäre sich nicht sicher, ob er vor sich festen Boden unter den Füßen hatte. Das war kein ehrliches Geständnis. Wenn Ari ihm diese Geschichte erzählte, lauerte darin irgendwo ein Schluckloch. Ein falscher Schritt und er würde im Schlamm versinken, der ihm die Lunge zerquetschen würde.
»Du hast mich nicht gefunden«, sagte Cyril, denn manchmal konnte man sich auf Fakten verlassen.
»Na ja«, erwiderte Aristide. »Ich habe aufgehört zu suchen, nicht wahr?«
Cyril wollte nicht, dass es schmerzte. Das sollte es nicht. Doch Ari hatte seine Bemerkung mit perfekter Theatralik vorgetragen, so berechnet, dass sie ihn zwischen die Rippen traf und tötete. »Warum?«
»Wie bitte?« Aristide neigte den Kopf, wandte Cyril ein Ohr zu. »Das habe ich nicht verstanden.«
Nun war er grausamer, als nötig war. Cyril biss die Zähne zusammen und zwang die Worte hinaus. »Warum hast du nicht mehr weitergesucht?«
»Tja, Liebling.« Nun hatte er sich mit seiner teuflischen Klinge selbst geschnitten und in seinen Worten rauschte der Schmerz wie Blut. »Wie lange bist du da draußen gewesen? Acht Jahre? Ich habe mich nicht gerade versteckt und selbst im Dschungel gibt es Zeitungen. Irgendwann hat es mich getroffen wie ein Sandsack gegen den Kopf: Selbst wenn du noch am Leben warst, du hast nie versucht, mich zu finden.«
Und Cyril, der einst beinahe ertrunken wäre – der das Gefühl kannte und noch immer Angst davor hatte –, spürte, wie er in den Fluten der Schuld versank. »Vermutlich erwartest du eine Entschuldigung.«
Aristide, der sich anscheinend besser fühlte, weil er diese Belanglosigkeit aus der Welt geschafft hatte, legte seine glühende Kippe in den Aschenbecher und sagte, beinahe fröhlich: »Mir würde ein Mittagessen reichen.«
Und weil Cyril so viel Schuld auf sich geladen hatte – Aristide, Amberlough, allen gegenüber –, spielte er mit.
Cyrils Wissen und Erfahrung waren für die Royalistenzellen im Nordterritorium Gold wert gewesen, doch dem LSI brachten sie nicht mehr viel, da der Krieg praktisch vorbei war. Während der Woche, in der er auf dem Familiensitz eingelocht war, hatten sie ihn ausgewrungen wie ein nasses Küchentuch. Ari hätten sie niemals ins Haus gelassen, wenn sie nicht alles Nötige erledigt hätten.
Cyril war frei.
Liso schuldete ihm eine Rente. Das fühlte sich sehr förmlich an. Einige festgelegte Anforderungen musste er erfüllen, dann konnte er sein Gerippe irgendwo abladen, bis es starb.
Bis dahin ließ er sich in einen Wagen verfrachten und durch die Stadt fahren, setzte sich auf einen Hocker, als er dazu aufgefordert wurde.
Unter der niedrigen Decke einer dunklen Taverne, die mittags leer war, wirkte das Schweigen zwischen ihnen erdrückend. Ari bestellte auf gebrochenem Porashtu, das der Barkeeper teilweise verstand, einen Cocktail, einen doppelten Martini mit Twist, sehr trocken, mit einer dekorativen Locke aus Zitronenschale. Cyril zündete sich eine weitere Zigarette an. Dass etwas, wonach er über so lange Zeit stets hatte suchen müssen, plötzlich ständig verfügbar war, erschwerte es ihm, damit aufzuhören. Unter seiner Haut summte das Nikotin. Als der Barkeeper ihnen den Rücken zuwandte, schnappte er sich eine Handvoll Streichholzbriefchen und steckte sie sich in die Jackentasche. Vielleicht war der Anzug doch keine so schlechte Idee gewesen. Tunika und Hose hätten ihm nicht so viele Verstecke für seine Beute geboten.
»Ach, eigentlich habe ich gar keinen Hunger«, meinte Aristide, nachdem sein erster Martini serviert worden war.
Cyril lachte auf. »Achtest du auf deine Figur?«
»Hast