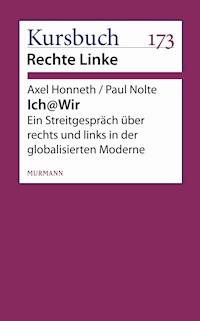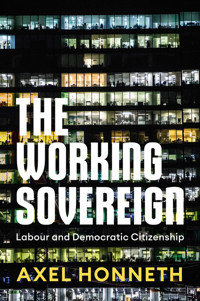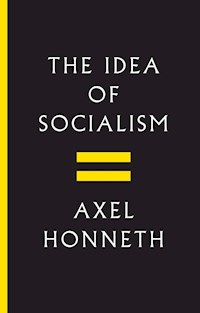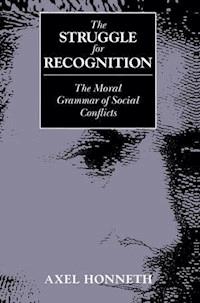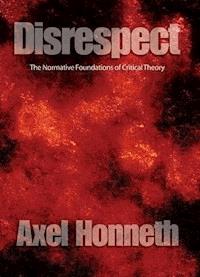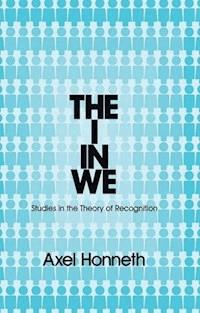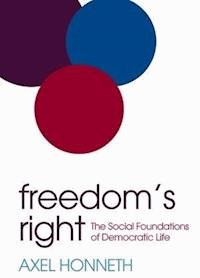23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seinem neuen Buch rekonstruiert Axel Honneth die Idee der Anerkennung in der Vielfalt der Bedeutungen, die sie seit Beginn der Moderne in Europa angenommen hat. Mit Blick auf drei wirkmächtige europäische Denktraditionen – die französische, die britische und die deutsche – zeichnet er nach, wie sie aufgrund unterschiedlicher politisch-sozialer Herausforderungen jeweils ganz verschiedene philosophische Interpretationen und gesellschaftspolitische Ausprägungen erfahren hat.
Während in Frankreich mit reconnaissance die Gefahr des individuellen Selbstverlustes assoziiert wird, gilt der Prozess der recognition in Großbritannien als Bedingung der normativen Selbstkontrolle; und hierzulande meint Anerkennung auch die Vollzugsform allen wahren Respekts unter Menschen. Erstaunlich ist, dass keine dieser drei Bedeutungen, deren Wurzeln bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen, in der Gegenwart an Einfluss verloren hat. Ob sie sich heute eher ergänzen oder gegenseitig im Weg stehen, zeigt diese Studie, die auch einen Beitrag zur Klärung unseres aktuellen politisch-kulturellen Selbstverständnisses leistet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
3Axel Honneth
Anerkennung
Eine europäische Ideengeschichte
Suhrkamp
7Jürgen Habermas in Dankbarkeit gewidmet
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
5Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Vorbemerkung
I
. Ideengeschichte versus Begriffsgeschichte: Methodische Vorüberlegungen
II
. Von Rousseau zu Sartre: Anerkennung und Selbstverlust
III
. Von Hume zu Mill: Anerkennung und Selbstkontrolle
IV
. Von Kant zu Hegel: Anerkennung und Selbstbestimmung
V
. Anerkennung im ideengeschichtlichen Vergleich: Versuch eines systematischen Resümees
Namenregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
7
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
9Vorbemerkung
Diese Studie verdankt sich einer Einladung des Cambridge Centre for Political Thought, im Mai 2017 an der University of Cambridge die alle zwei Jahre stattfindenden John Robert Seeley Lectures zu halten. Ich muss zugeben, dass mich der enorme Ruf, der diesem Centre schon seit langem als einem Schmelztiegel der politischen Ideengeschichte vorauseilt, ein wenig eingeschüchtert hat, weshalb ich mich zu einer Vorsichtsmaßnahme entschloss: Meine Vorlesungen sollten sich einem Thema widmen, das zwar deutlich ideengeschichtliche Züge tragen würde, für das ich aber gleichzeitig bereits eine gewisse sachliche Autorität beanspruchen konnte. So ist aus dem Kalkül, mich zwar auf das Feld der politischen Ideengeschichte vorzuwagen, dabei jedoch einen mir schon philosophisch vertrauten Stoff zu behandeln, die Idee zur Gestaltung meiner Seeley-Lectures und damit zu der folgenden Studie entstanden: Was sowohl die sogenannte Cambridge School als auch die deutsche Tradition der »Begriffsgeschichte« für eine Reihe von Schlüsselkategorien unseres politischen Selbstverständnisses geleistet haben, also die Rekonstruktion dieser Kategorien entlang einer komplizierten, konflikthaften Geschichte, um uns über die historische Herkunft demokratischer Leitbegriffe aufzuklären, will ich im Folgenden mit meinen bescheidenen Mitteln für den inzwischen zu einiger Bedeutung gelangten Begriff der Anerken10nung unternehmen. Es wird also in den fünf Kapiteln meines Buches darum gehen, die ideengeschichtlichen Wurzeln der heute für uns selbstverständlichen Vorstellung freizulegen, dass das Verhältnis der Subjekte untereinander durch eine wechselseitige Abhängigkeit von der Wertschätzung oder Anerkennung durch den oder die jeweils Anderen geprägt ist.
Wie schwierig die Aufgabe ist, die ich mir damit vorgenommen habe, ist schon an dem Umstand zu erkennen, dass die Idee der Anerkennung heute in verschiedenen Kontexten ganz unterschiedliche Assoziationen weckt. Das eine Mal wird in der Abhängigkeit des Einzelnen von der Anerkennung durch Andere die Quelle aller modernen, egalitären Moral gesehen, das andere Mal nur ein soziales Mittel, um das Individuum auf die richtige Bahn eines gesellschaftsförderlichen Verhaltens zu lenken; und in einem wieder anderen Kontext wird in derselben Abhängigkeit die Wurzel einer fatalen Selbsttäuschung des Individuums über die eigene, »authentische« Persönlichkeit vermutet, Anerkennung also als eine Gefährdung »wahrer« Individualität begriffen. Einige dieser Differenzen hängen, wie sich noch zeigen wird, mit semantischen Eigenarten des Anerkennungsbegriffs in den jeweiligen nationalen Sprachkulturen zusammen. Während er im Französischen mit dem Wort reconnaissance und im Englischen mit recognition ausgedrückt wird, sprechen wir im Deutschen in deutlicher Abgrenzung dazu nicht von Wieder-, sondern von An-erkennung.1 Andere Unterschiede ergeben sich aus den Assoziationsketten, die sich im Laufe seiner kultur11spezifischen Verwendung in den lokalen Bedeutungskern des Begriffs eingeschlichen haben: Ob mit der Anerkennung einer Person eher deren soziale Reputation gemeint ist oder doch etwas vom öffentlichen Ansehen Unabhängiges, eine tiefere Schicht Betreffendes, dürfte am Ende einen großen Unterschied für den theoretischen Gebrauch des Begriffs machen; von ebenso großer Bedeutung in Hinblick auf die Verwendung des Ausdrucks »Anerkennung« wird es sein, ob damit gedanklich eher ein moralischer Akt verbunden wird, eine Art von Respektbezeugung gegenüber anderen Personen, oder doch viel stärker ein epistemischer Vorgang, also eine Leistung unserer Erkenntnis objektiver Sachverhalte. All das ‒ die Unterschiede im semantischen Gehalt des Ausdrucks, seine verschiedenen Assoziationsketten in lokalen Zusammenhängen ‒ sind Fragen, die eine große Rolle spielen müssen, wenn man die neuzeitliche Geschichte der Idee der Anerkennung rekonstruieren möchte.
Bevor ich aber diese Aufgabe selbst in Angriff nehme, möchte ich zunächst denjenigen danken, die mich durch ihre ehrenvolle Einladung überhaupt erst auf den Gedanken einer solchen ideengeschichtlichen Untersuchung gebracht haben. Allen voran gilt mein aufrichtiger Dank John Robertson, der mich als Direktor des Cambridge Centre for Political Thought eingeladen hat, die Seeley-Lectures 2017 in Cambridge zu halten; er hat mir durch seine großzügige Gastfreundschaft nicht nur ermöglicht, meinen Aufenthalt an seiner Universität sehr zu genießen, sondern hat zudem durch seine scharfsinnigen, aus tiefer Kenntnis der europäischen 12Aufklärung gespeisten Rückfragen erheblich zur Abrundung meiner Sicht auf die intellektuelle Entwicklung der Idee der Anerkennung beigetragen; das Gleiche gilt für John Dunn, Christopher Meckstroth und Michael Sonenscher, deren Kommentare und Einwände mich ebenfalls vor allzu schnellen und unüberlegten Schlussfolgerungen bewahrt haben; auch ihnen bin ich daher zu großem Dank verpflichtet. Wichtige Anregungen und Hinweise in Hinblick auf das 4. Kapitel meiner Studie, das sich mit dem Anerkennungsdenken des Deutschen Idealismus beschäftigt, habe ich schließlich von Michael Nance erhalten, der als Humboldt-Fellow zwei Semester am Institut für Philosophie der Goethe-Universität in Frankfurt verbracht hat; auch ihm möchte ich für seine Mithilfe herzlich danken. Die wesentlichen Impulse, aus meinen Vorlesungen zügig eine Monographie zu machen, verdanke ich Elizabeth Friend-Smith von der Cambridge University Press und Eva Gilmer vom Suhrkamp Verlag, die beide durch sanften Druck und freundliche Mahnungen die relativ pünktliche Abgabe des Manuskripts bewirkt haben. Eva Gilmer möchte ich darüber hinaus in einer beinahe schon liebgewonnenen Gewohnheit für die Durchsicht meines Manuskripts danken, die sie auch diesmal wieder mit großer Sorgfalt und Akribie vorgenommen hat.
13I. Ideengeschichte versus Begriffsgeschichte: Methodische Vorüberlegungen
Es ist wichtig für unsere demokratische Kultur, so hatte ich schon in der Vorbemerkung angedeutet, sich die historischen Ursprünge und Entwicklungen derjenigen Ideen oder Begriffe vor Augen zu führen, von denen unser politisch-soziales Zusammenleben bis heute nachhaltig geprägt ist; denn nur im Spiegel einer solchen historischen Rückversicherung können wir gemeinsam erkennen, warum wir geworden sind, wer wir sind, und welche normativen Ansprüche mit diesem geteilten Selbstverständnis einhergehen. Auch der Begriff »Anerkennung« verdient inzwischen eine derartige historische Rückbesinnung, weil er seit einigen Jahrzehnten ebenfalls zum Kernbestand unseres politisch-kulturellen Selbstverständnisses geworden ist; das zeigt sich in so unterschiedlichen Forderungen wie denen, sich wechselseitig als gleichberechtigte Mitglieder einer Kooperationsgemeinschaft zu achten,2 der Eigenart des Anderen unbedingte Anerkennung zu gewähren3 oder den kulturellen Minderheiten im Sinne einer »Politik der Anerkennung« Wert14schätzung entgegenzubringen.4 Wenn es also im Folgenden darum gehen soll, die neuzeitliche Geschichte der Idee der Anerkennung zu rekonstruieren, dann ist mit einem solchen Vorhaben die Hoffnung verknüpft, etwas Ordnung in dieses Feld der Bedeutungen zu bringen und dadurch zur Klärung unseres heutigen politisch-kulturellen Selbstverständnisses beizutragen. Bevor ich mich allerdings direkt dieser Aufgabe zuwenden kann, sind zunächst einige Worte zur Art meines Vorgehens und den damit verknüpften Zielen erforderlich, denn mit dem Vorhaben, die Ursprünge unserer gegenwärtigen Vorstellung von Anerkennung freizulegen, können ja Ansprüche und Erwartungen von ganz unterschiedlicher Komplexität oder Raffinesse einhergehen.
Meinem Versuch, den Begriff der Anerkennung historisch nachzuvollziehen, sind aus unterschiedlichen Gründen zwei enge Grenzen gezogen. Zum einen wäre es höchst irreführend, den Eindruck zu erwecken, es sei dieser eine Ausdruck, um den es sich handeln würde, wenn man die heute so zentrale Idee der Anerkennung in ihrer historischen Genese freilegen wollte. Im Unterschied zu anderen uns heute leitenden Begriffen ‒ beispielsweise »Staat«, »Freiheit« oder »Souveränität« ‒ hat die Idee, die uns heute beflügelt, wenn wir von »Anerkennung« sprechen, in unserer Vergangenheit nicht in Form eines einzigen, feststehenden Terminus existiert; vielmehr waren es ganz unterschiedliche Ausdrücke, mit denen im neuzeitlichen Denken auf den Sachverhalt verwiesen wurde, dass wir durch verschiedene Formen der Anerkennung stets schon aufeinander bezogen sind ‒ 15Jean-Jacques Rousseau benutzte für diesen Tatbestand im Anschluss an die französischen Moralisten den Begriff der amour propre, Adam Smith sprach vom nach Innen verlagerten »äußeren Beobachter«, und erst Johann Gottlieb Fichte und Georg Wilhelm Friedrich Hegel benutzten dafür schließlich die uns heute geläufige Kategorie »Anerkennung«. Insofern lässt sich die Genese und Geschichte der zeitgenössischen Idee der Anerkennung nicht anhand des gleichlautenden Ausdrucks zurückverfolgen; man würde zu viele relevante Seitenstränge, zu viele bedeutende Quellen und Anregungen aus dem Blick verlieren, hielte man sich bei der historischen Rekonstruktion nur an den einen Terminus. Um eine Begriffsgeschichte im engen Sinne kann es sich daher bei dem im Folgenden zu unternehmenden Versuch nicht handeln; verlangt ist vielmehr eine Art von Ideengeschichte, in der ein konstitutiver Gedanke in seiner Entwicklung daraufhin nachverfolgt wird, welche Bedeutungen entweder durch Korrekturen oder Anreicherungen hinzugetreten sind. Mit der schwierigen Frage, ob es dabei so etwas wie eine Initialzündung, einen Punkt des ersten Anstoßes gegeben hat, werde ich mich deshalb schon gleich zu Beginn beschäftigen müssen.
Nun lässt sich freilich auch das Vorhaben einer »Ideengeschichte« der Anerkennung methodisch auf die verschiedenste Weise durchführen; bekanntlich haben Denker wie Robin G. Collingwood und Quentin Skinner, Michel Foucault und Reinhart Koselleck, um nur einige wenige zu nennen, ganz unterschiedliche Vorstellungen davon entwickelt, was es heißt, die Ursprünge und Geschichte eines bestimmten Gedankens historisch zu rekonstruieren. Wenn ich hier jedoch die Genese unserer heutigen Idee der Anerkennung nachzuvollziehen ver16suche, verbinde ich damit nicht die Ansprüche einer Ideengeschichte in einem solchen disziplinären Sinn; weder will noch kann ich mich der Mühe unterziehen, eine Antwort auf die vertrackte Frage zu geben, welches geschichtliche Kausalverhältnis zwischen einzelnen Versionen ein und derselben, nur vage umrissenen Idee tatsächlich bestanden hat. Eine solche »echte« historische Untersuchung würde verlangen, um Michael Dummett zu paraphrasieren, Belege dafür anzugeben, dass bestimmte Denker von anderen Denkern wirklich beeinflusst worden sind; und ein solcher Nachweis macht es Dummett zufolge weiter erforderlich, dass »Veröffentlichungsdaten überprüft, Tagebücher und Briefwechsel entziffert und sogar Bibliotheksverzeichnisse durchforscht werden, um herauszubekommen, was bestimmte Einzelpersonen gelesen haben oder hätten lesen können«.5 Dazu sehe ich mich angesichts der Mittel, die mir aufgrund meiner eigenen akademischen Ausbildung zur Verfügung stehen, nicht in der Lage; ich habe es weder gelernt, bibliographische Recherchen zu unternehmen, noch bin ich darin geübt, intellektuellen Einflüssen historisch auf den Grund zu gehen. Insofern muss hier mit einer »Ideengeschichte« vorliebgenommen werden, die viel geringere Ansprüche stellt als die Disziplin, die herkömmlicherweise unter diesem Titel firmiert; mich interessiert in den folgenden Untersuchungen, wie ein bestimmter Gedanke, nämlich der der Anerkennung, dadurch, dass er gewissermaßen »in der Luft lag«, in verschiedene Richtungen weiterentwickelt wurde und auf dem jeweils eingeschlagenen Weg immer neue, aufschluss17reiche Bedeutungen angenommen hat. Ob diese disparaten Abkömmlinge des einen Gedankens am Ende dann zusammenstimmen und ein einheitliches Bild ergeben oder doch bloß unvereinbare Bruchstücke bilden, denen jeder innere Zusammenhang fehlt, wird eine Frage sein, mit der ich mich am Ende meiner historischen Rekonstruktionen beschäftigen werde. Auf jeden Fall wird es um die Geschichte der argumentativen Weiterentwicklung eines Gedankens gehen, und nicht um die Geschichte der kausalen Sequenz des Einflusses eines Autors auf den anderen. Es dürfen hier also keine Neuentdeckungen zu intellektuellen Konstellationen oder Abhängigkeiten erwartet werden, sondern, wenn überhaupt, eine veränderte Sicht auf bereits hinlänglich bekanntes Material.
In einem Punkt hoffe ich allerdings dennoch, über die schon vertrauten Ergebnisse der ideengeschichtlichen Erforschung der Neuzeit hinauszugelangen. Ein besonderes Augenmerk möchte ich nämlich auf die Frage legen, ob möglicherweise die soziokulturellen Bedingungen eines Landes mit dafür verantwortlich waren, dass die Idee der Anerkennung dort eine spezifische Einfärbung angenommen hat. Angesichts der Vielzahl von Bedeutungen, die die Vorstellung, wir seien stets schon durch Anerkennungsbeziehungen aufeinander bezogen, im neuzeitlichen Denken angenommen hat, lasse ich mich mithin von der Hypothese leiten, dass diese Unterschiede mit nationalen Eigenheiten der jeweiligen Herkunftskultur zusammenhängen. Diese zugegebenermaßen riskante Vermutung nötigt mich freilich auch zu einer besonderen Anlage meiner Ausführungen: Ich werde mich nicht zuvörderst an einzelnen Autoren orientieren können, um deren Werke dann in ihrer jeweiligen 18Individualität hervortreten zu lassen, sondern muss vielmehr mehrere Autoren der gleichen nationalen Herkunft als typische Vertreter einer ganzen Gruppe behandeln, in der gewisse theoretische Überzeugungen und ethische Bewertungen geteilt werden. Das heißt, ich werde mich darauf einlassen müssen, individuelle Werke als Exemplare einer gemeinsamen Kultur zu betrachten; insofern sollte man nicht überrascht sein, wenn ab jetzt die nationalen Besonderheiten im Verständnis dessen, was mit »Anerkennung« bezeichnet werden soll, den Leitfaden meiner Ausführungen bilden werden.
Natürlich bin ich mir im Klaren darüber, dass ich mich mit einer solchen Redeweise in das gefährliche Fahrwasser einer Tradition begeben könnte, in der entweder unbesonnen oder sehr gezielt vom »Volksgeist« oder gar der »Seele« einer ganzen Nation gesprochen wurde; und wir sollten uns hüten ‒ zumal, wenn wir aus Deutschland kommen ‒, solche Ideen einer »nationalen«, einem gesamten Staatsvolk zurechenbaren »Gesinnung« heute wieder naiv aufleben zu lassen. Daher soll hier im Folgenden auch keinesfalls von kollektiven »Geisteshaltungen«, nationalen Mentalitäten oder Ähnlichem die Rede sein; wenn ich von den nationalen Besonderheiten im Bedeutungsumfeld der Idee der Anerkennung spreche, ist damit vielmehr gemeint, dass es möglicherweise die soziokulturellen Gegebenheiten eines bestimmten Landes waren, die eine Reihe von dort beheimateten Denkern veranlasst haben, mit dieser Idee ungefähr die gleichen Assoziationen zu verknüpfen. Was ich also mit der genannten Hypothese vor Augen habe, ist in etwa das, was uns mit Recht fragen lässt, ob nicht in der philosophischen Tradition eines beliebigen Landes gewisse Motive, Themen oder Denkstile deswegen 19vorherrschen, weil dort institutionelle oder soziale Voraussetzungen gegeben sind, die es von anderen Ländern deutlich unterscheidet.6 In diesem Sinn möchte ich in den folgenden Untersuchungen der Vermutung nachgehen, dass es nationale Besonderheiten in der geschichtlichen Entwicklung waren, die der Idee der Anerkennung in den verschiedenen Ländern eine jeweils spezifische Färbung oder Tonart verliehen haben.
Ich bin gewiss nicht der Erste, dem es aufgefallen ist, dass im französischen Denken die Idee, dass wir wechselseitig auf die Anerkennung durch den je Anderen angewiesen sind, häufig mit einem negativen Vorzeichen versehen wird; man vermutet in dieser Tradition, angefangen spätestens mit Rousseau bis hin zu Jean-Paul Sartre oder Jacques Lacan, dass unsere Abhängigkeit von sozialer Wertschätzung und Zustimmung die Gefahr mit sich bringt, sich selbst in seiner eigenen, uneinholbaren Individualität zu verlieren. Wie immer dieser Gedanke weiter ausbuchstabiert und im Einzelnen begründet wird, seine regelmäßige Wiederkehr bei einer Reihe von französischen Autoren lässt den Verdacht aufkommen, dass dabei nicht der Zufall, sondern einige Besonderheiten des Landes ihre Hände im Spiel hatten; und so beginnt man darüber nachzudenken, welche Eigenschaften der Sozial- oder Kulturgeschichte Frankreichs dazu geführt haben könnten, dass hier die Idee der Anerkennung von Anfang an typischerweise eine eher negative Bedeutung angenommen hat. Hat man aber erst einmal begonnen, Überlegungen in eine solche Richtung anzustellen, liegt es nahe, auch in anderen Län20dern nach Zusammenhängen zwischen soziokulturellen Gegebenheiten und der dort beheimateten Idee von Anerkennung zu suchen. Von diesem Zwischenschritt aus ist es dann nicht mehr weit zu der Hypothese, dass es möglicherweise die Erfahrungshorizonte verschiedener philosophischer Kulturen waren, die dazu beigetragen haben, dass die eine Idee der Anerkennung während ihrer Entfaltung in den letzten dreihundert Jahren sehr disparate Bedeutungen angenommen hat.
Damit ist aber noch nicht erklärt, warum ich mich auf drei Länder, nämlich Frankreich, Großbritannien und Deutschland, konzentriere möchte. Für diese Auswahl sprechen gewiss zunächst erst einmal pragmatische Gründe, die sich daraus ergeben, dass diese drei Länder im Hinblick auf die sich in ihnen seit Beginn der Neuzeit vollziehenden Wandlungen im politischen Denken besonders gut erforscht sind; mit allem, was sich dort jeweils in den letzten rund vierhundert Jahren an Neuerungen im politisch-kulturellen Selbstverständnis vollzogen hat, sind wir weitaus besser vertraut als mit den zeitgleichen und wahrscheinlich ebenso relevanten Veränderungen in anderen Ländern und Kulturräumen des europäischen Kontinents. Mit dem Umstand, dass in unserem ideengeschichtlichen Bewusstsein die drei genannten Länder eine Vorrangstellung einnehmen, mag auch zusammenhängen, dass fast ausschließlich deren Autoren inzwischen als »Klassiker« des politischen Denkens betrachtet werden; mit nur ganz wenigen Ausnahmen ‒ es fallen einem spontan Baruch de Spinoza und vielleicht noch Francisco Suárez ein ‒ sind die politischen Gelehrten, die heute unsere Lehrbücher füllen, entweder im französischsprachigen, im englischsprachigen oder im deutschsprachigen Teil von Europa beheimatet. Ob sich 21in dieser deutlichen Bevorzugung nur der theoretische Imperialismus von drei später mächtigen Nationen spiegelt oder tatsächlich eine der Sache nach begründete Rangordnung, ist dann eine kaum zu vermeidende, sich mit Macht aufdrängende Anschlussfrage.
Schon das bloße Aufwerfen dieses Problems gibt freilich unmissverständlich zu erkennen, dass allein pragmatische Gründe nicht ausreichen dürften, um meine Auswahl zu rechtfertigen. Bliebe es bei dem bislang Gesagten, so würde nämlich den folgenden Betrachtungen unweigerlich der Verdacht anhaften, nur die philosophische Perspektive der herrschenden Mächte in Europa wiederzugeben. Um derartige Bedenken entkräften zu können, bedarf es mithin stärkerer Argumente als solcher, die nur auf den Forschungsstand oder die wissenschaftlichen Gepflogenheiten einer Disziplin abheben. Weiterhelfen kann hier vielleicht eine Überlegung, auf die ich zum ersten Mal in einem begriffsgeschichtlichen Essay von Reinhart Koselleck gestoßen bin und die ich anschließend in einer Reihe von weiteren Untersuchungen wiedergefunden habe. Koselleck ist der Überzeugung, dass sich in den Entwicklungen, die Frankreich, Großbritannien und Deutschland seit dem 17. Jahrhundert genommen haben, exemplarisch drei Verlaufsmuster der bürgerlichen Gesellschaft in der Neuzeit widerspiegeln; nicht nur habe das Bürgertum seine Rolle und historische Lage in den drei Ländern jeweils anders verstanden, wie sich an den Bedeutungsunterschieden zwischen dem »citoyen«, dem »Bürger« und den »middle classes« zeigen ließe, sondern in diesen semantischen Unterschieden seien auch die prinzipiellen Alternativen vorgezeichnet gewesen, die der neuen Gesellschaftsordnung als typische Entwicklungspfade zur Verfügung ge22standen hätten.7 Ähnlich argumentiert Jerrold Seigel in seiner materialreichen Studie über Modernity and Social Life, in der er anhand der Unterschiede im Selbstverständnis des Bürgertums untersucht, welchen Weg der Modernisierung Frankreich, Großbritannien und Deutschland jeweils eingeschlagen haben; wie Koselleck lässt er sich dabei von der Prämisse leiten, dass mit diesen drei Vergleichsfällen nicht einfach nur beliebige, sondern die paradigmatischen Verlaufsmuster der bürgerlichen Gesellschaft im modernen Europa zu erfassen seien.8 Spinnen wir den damit angedeuteten Grundgedanken weiter, so tritt ein Argument zu Tage, das es vielleicht erlaubt, die Begrenzung meines ohnehin auf Europa beschränkten Unternehmens auf die ideengeschichtliche Entwicklung in nur drei Ländern auch sachlich zu rechtfertigen. Wenn es nämlich tatsächlich so wäre, wie Koselleck und Seigel nahezulegen scheinen, dass sich in Frankreich, Großbritannien und Deutschland im Verlauf der letzten Jahrhunderte jeweils gedankliche und soziale Veränderungen vollzogen haben, die später auch für den Rest Europas strukturbildend geworden sind, dann hätte meine Beschränkung auf diese drei Länder mehr als nur beliebigen, rein pragmatischen Charakter; in den semantischen Einfärbungen und Akzentuierungen, die dort die Idee der Anerkennung jeweils alterna23tiv erhalten hat, würden sich vielmehr die Bedeutungsvariationen wiederfinden, zu denen der Begriff im europäischen Bewusstseinshorizont überhaupt in der Lage gewesen ist. Aber selbst diese Überlegung klingt gewiss noch nach einer bloß angemaßten Vormachtstellung, weswegen ich sie noch einmal in einer vorsichtigeren Formulierung wiederholen möchte: Träfe es zu, dass in Frankreich, Großbritannien und Deutschland im je anderen Selbstverständnis des Bürgertums die drei Varianten der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft durchgespielt worden wären, die für ganz Europa paradigmatischen Charakter besessen haben, so hätte man mit einer historischen Analyse der Wandlungen und Abschattierungen der Idee der Anerkennung in diesen drei Ländern deren Bedeutungsreichtum auch schon weitgehend erschöpft.
Es ist dieser Grundgedanke, aus dem die nun folgende Untersuchung der Ursprünge und Entwicklungen der Idee der Anerkennung in der europäischen Neuzeit die Hoffnung bezieht, nicht nur eine sehr partikulare Sichtweise wiederzugeben; es mag zwar sein, dass es in anderen Sprachregionen Europas auch interessante, illuminierende Spielarten der Idee der Anerkennung gegeben hat, aber diese besaßen eben nicht die Kraft, sich in lebendigen Bedeutungskonnotationen niederzuschlagen, die bis heute wirksam sind. Aus Gründen, die schnell deutlich werden dürften, möchte ich meine ideengeschichtliche Analyse nun im französischen Sprachraum beginnen lassen; hier hat die Vorstellung, dass wir durch Verhältnisse der wechselseitigen Anerkennung immer schon aufeinander bezogen sind, zum ersten Mal gedanklich fruchtbare Wurzeln geschlagen und zur Ausbildung einer sehr spezifischen, national eingefärbten Konzeption von Intersubjektivität beigetragen.
24II. Von Rousseau zu Sartre: Anerkennung und Selbstverlust
Schon seit geraumer Zeit findet untergründig und weit verzweigt eine Diskussion darüber statt, welchem Denker der Neuzeit die Idee der Anerkennung wohl ihren ersten Anstoß zu verdanken hat. Bestand vor dreißig Jahren noch große Einigkeit darüber, dass es Fichte und Hegel waren, die gleichzeitig mit dem Begriff auch der ganzen Theorie den Weg bereitet haben, so hat sich die Lage inzwischen erheblich verändert; man überschlägt sich heute geradezu mit Vorschlägen, die Geburtsstunde der Idee der Anerkennung doch weiter nach hinten zu verlagern und bei philosophiehistorisch älteren Autoren nach ihren ursprünglichen Wurzeln zu suchen.9 Den kühnsten Vorstoß in diesem Streit über philosophische Urheberschaft und gedankliche Herkunft hat bislang Istvan Hont unternommen, der in seinem Buch Politics 25in Commercial Society die These vertreten hat, dass es kein geringerer als Thomas Hobbes gewesen sei, der zum ersten Mal die überragende Bedeutung der Anerkennung für das menschliche Zusammenleben unterstrichen habe; neu und bahnbrechend an dessen Werk sei nämlich die Einsicht gewesen, dass nicht so sehr »physische« Bedürfnisse, sondern primär das »psychologische« Verlangen nach Auszeichnung und Ehre die Menschen dazu motivierte, nach Geselligkeit mit Anderen zu streben und daher in sozialen Verbänden zu leben.10 An diesem Versuch, Hobbes zum Ahnherrn einer Theorie der Anerkennung zu machen, ist sicherlich so viel richtig, dass der Autor des Leviathan in vielen seiner Schriften immer wieder hervorgehoben hat, wie sehr der Drang, in den Augen der Mitmenschen als ehrenhaft und vorzüglich zu gelten, das individuelle Subjekt erfüllt; stärker als seine Vorgänger und Zeitgenossen ist er sich im Rahmen seiner politischen Anthropologie darüber im Klaren, dass es der Wunsch nach dem Herausragen aus der Menge, der Stolz und die Geltungssucht sind, die den Menschen den Kontakt mit seinesgleichen suchen lassen.11 Aber deswegen Hobbes gleich zum Stammvater der gesamten neuzeitlichen Anerkennungslehre zu erklären würde verlangen, auch im Kern seiner politischen Philosophie das Fortwirken solcher »psychologischen« Strebungen des Menschen nachweisen zu können. Da26von aber kann, so weit ich es sehe, kaum die Rede sein: Der Vertragsschluss, zu dem Hobbes die Subjekte gerne motiviert sehen möchte, kommt in seinen Augen zustande, weil jeder Einzelne im Naturzustand so massiv um seine physische Sicherheit besorgt ist, dass er die gemeinsame Unterwerfung unter einen sicherheitsgarantierenden Herrscher als Vorteil für sich selbst empfindet; und der Monarch, der auf diese Weise aus strategischem Kalkül von der Menge der vereinzelten Subjekte inthronisiert wurde, hat sich Hobbes zufolge dann im Weiteren vorrangig um die Gewährleistung politischer Stabilität, nicht aber um Vorkehrungen zur Befriedigung des Strebens nach sozialer Anerkennung zu kümmern.12 Schon diese beiden entscheidenden Schachzüge im Leviathan lassen es in meinen Augen als wenig plausibel erscheinen, Hobbes zugutezuhalten, er habe in seiner politischen Philosophie als Erster das volle Gewicht unseres Bedürfnisses nach sozialer Anerkennung zur Geltung gebracht; für viel überzeugender würde ich hingegen die These halten, im Werk des Autors bestünde eine empfindliche Kluft zwischen seinen psychologisch-anthropologischen Einsichten und seiner politischen Lehre, in der sich von jenen kaum mehr Spurenelemente finden lassen.
Ich werde daher einen anderen Weg einschlagen und versuchen, die Ursprünge der Anerkennungstheorie bei Rousseau und seinen Vorgängern im französischen Moralismus des 17. Jahrhunderts aufzuspüren ‒ allerdings nicht ohne die Einschränkung vorauszuschicken, dass der Gedanke, wir Menschen seien konstitutiv auf Anerkennung angewiesen, damals in vielen europäischen Län27dern gleichsam »in der Luft« lag. In dem Maße, in dem sich dank erster, noch zaghafter Modernisierungsschübe die alte Gesellschaftsordnung aufzulösen begann, wurden ab dem 17. Jahrhundert breitenwirksam auch die traditionellen Sozialbezüge und Klassenzugehörigkeiten brüchig; je weniger das herrschende Schichtungsgefüge als einfach von Gott gesetzt und gewollt erfahren werden konnte, desto stärker musste der Einzelne sich mit der Frage beschäftigen, welchen Platz er aus welchen Gründen innerhalb der Gesellschaft einzunehmen hatte oder einzunehmen gewillt war. Es war, so könnte man zugespitzt sagen, der allmähliche Übergang von der alten, feudalen Ständeordnung mit ihren gruppenspezifischen Verhaltensmaßregeln zur modernen Klassengesellschaft, der die Frage nach der sozialen Anerkennung in weiten Teilen Europas überhaupt erst virulent werden ließ. Der Umstand, dass wir durch verschiedene Formen der Anerkennung stets schon aufeinander bezogen sind, wurde in derjenigen historischen Phase zum Thema von Philosophie und Literatur, als unklar zu werden begann, wo das Individuum sozial hingehört und wie es sich dementsprechend zu verhalten habe. In Frankreich nun nimmt diese neue Problematik im Lauf des 17. und 18. Jahrhunderts nicht nur eine besondere Dringlichkeit, sondern auch eine sehr spezifische Tönung an; hier entwickelt sich angesichts der Frage, auf was der Einzelne zukünftig seine Stellung innerhalb der Gesellschaft zu gründen vermag, recht schnell eine Art von »negativer Anthropologie«,13 die dem Subjekt unterstellt, stets 28als »besser« oder »mehr« gelten zu wollen, als es tatsächlich seiner ganzen Persönlichkeit nach ist. Anerkennung musste damit als ein sehr riskantes Unternehmen betrachtet werden, bei dem man nie sicher sein konnte, ob es den Anderen in seinem »wahren« Wesen tatsächlich trifft; und dieser untergründige Verdacht wird den Diskurs über Anerkennung in Frankreich bis heute, so lautet meine These, wie ein böser Schatten begleiten.
Der Begriff, der in Frankreich zum Träger der neuen sozialen Idee wurde, war der der amour propre. Noch bevor Rousseau diesen Terminus systematisch entfalten sollte, um darauf seine ganz eigene Anerkennungslehre zu gründen, dient er schon den Moralisten als ein Mittel, um althergebrachte Auffassungen vom Wesen des Menschen in Frage zu stellen; vor allem der Herzog La Rochefoucauld ist es, der sich mit Blick auf die auffällige Neigung seiner Zeitgenossen, sich öffentlich in einem möglichst vorteilhaften Licht zu präsentieren, daranmacht, die Quellen solch eitlen Gebarens zu identifizieren. Die begriffliche Operation, der sich La Rochefoucauld zu diesem Zweck bedient, besteht in der säkularen Umdeutung eines von Augustinus geprägten Gegensatzpaares: War für den christlichen Theologen die superbia dasjenige Laster gewesen, das der Tugend einer von Gott gewollten, sozialverträglichen Selbstliebe entgegenstand, so bleibt bei dem französischen Moralisten von diesem Dualismus nur die erste Größe, der Hochmut oder die Selbstgefälligkeit, übrig, die er zudem nicht länger als ein ethisches Fehlverhalten, sondern als eine naturgegebene Leidenschaft des Menschen versteht.14 Die29sen fixen Antrieb belegt er fortan mit dem schwer zu übersetzenden Begriff der amour propre, der sich einer sprachschöpferischen Übersetzungsleistung des jungen Michel de Montaigne verdankte15 und der mit »Geltungsdrang« oder »Eitelkeit« nur mangelhaft wiedergegeben wäre; auf jeden Fall wird aber die damit gemeinte Disposition nun zum Dreh-und Angelpunkt der berühmten Réflexions ou Sentences et maximes morales von La Rochefoucauld. Darin schlägt sich die neue Semantik in der Weise nieder, dass hier alles Verhalten, welches den Anschein von Tugendhaftigkeit, persönlicher Größe oder moralischer Vortrefflichkeit hat, unter den Generalverdacht eines bloßen Vorgaukelns von nicht vorhandenen Eigenschaften gestellt wird; und was die Individuen bei einem solchen Vortäuschen von sozial hoch geschätzten Charakterzügen letztlich antreiben, was sie dabei befeuern soll, ist nach Meinung des Herzogs ebenjene amour propre, das »ungestüme Verlangen« (»désir impétueux«), vor den Mitmenschen mustergültig und vortrefflich dazustehen.16
Was La Rochefoucauld an dieser natürlichen Leidenschaft des Menschen so stark beunruhigt, dass er ihr mehr als fünfhundert Aphorismen widmet, ist nicht nur die kognitive Ungewissheit, in die sie uns dadurch versetzt, dass wir nie sicher sein können, mit wem wir 30es bei unserem jeweiligen Interaktionspartner tatsächlich zu tun haben; mindestens ebenso sehr alarmiert ihn der Umstand, dass die amour propre den Einzelnen dazu verleiten könnte, bei all dem Vortäuschen nicht vorhandener Vortrefflichkeit am Ende zu vergessen, wer er selber seiner ganzen Persönlichkeit nach wirklich ist. In der berühmten Maxime 119 heißt es in diesem Sinne kurz und bündig: »Wir gewöhnen uns so sehr daran, uns vor den anderen zu verstellen, dass wir uns schließlich vor uns selbst verstellen.«17 Für La Rochefoucauld stellt mithin die amour propre einen menschlichen Grundtrieb dar, der Auswirkungen nach außen wie nach innen, das heißt in das Selbstverhältnis jeder Person hinein, besitzt; nach außen, gegenüber unseren Mitmenschen, spornt er uns an, diesen gegenüber bestimmte, sozial als vorbildlich angesehene Charaktereigenschaften vorzutäuschen, nach innen aber verführt er uns kraft der Gewöhnung an eine solche Vorspiegelung dazu, uns über unseren »wahren«, tatsächlichen Charakter nachhaltig zu täuschen ‒ und beide Versuchungen, die Täuschung der Anderen wie diejenige uns selbst gegenüber, nimmt der Herzog deswegen als höchst bedenklich und für seine Zeit bedrohlich wahr, weil sie uns zusammengenommen jeder Möglichkeit zur Selbstverfügung, unserer Fähigkeit zur Autonomie, berauben könnten.18
Nun ist La Rochefoucauld weder Philosoph noch Gelehrter genug, um aus diesen scharfsinnigen Beobachtungen mehr zu machen als teils vergnügliche, teils bitterbö31se Aperçus; ihm fehlt sowohl der theoriegeschichtliche Überblick als auch die begriffliche Präzision, die es ermöglicht hätten, die Einsicht in die Wirkungsweise der amour propre zum Schlüssel einer umfassenden Neubestimmung der menschlichen Intersubjektivität zu machen. Allerdings ist es auch gar nicht die Absicht des Herzogs, mit seinen Maximen zur Vertiefung unseres Wissens um die Dynamik und Konfliktanfälligkeit sozialer Interaktionen beizutragen; nicht Theoriebildung, nicht wissenschaftliche Erkenntnis, sondern Entlarvung seiner Zeitgenossen ist das Ziel, das er sich mit seinen für den geselligen Gebrauch im Salon geschriebenen Betrachtungen gesetzt hat. Enttäuscht über den Misserfolg der Fronde, an deren Kämpfen gegen die politische Marginalisierung des Adels durch Ludwig XIV. er auf vorderstem Posten beteiligt war, legt La Rochefoucauld in seinen Maximen Zeugnis davon ab, wie seine ehemaligen Mitstreiter sich vergeblich bemühen, durch Vortäuschung hochgeschätzter Tugenden doch noch die Gunst des Königs zu erlangen. Die Geburtsstunde der französischen Tradition einer Anerkennungslehre schlägt mithin in dem geschichtlichen Augenblick, als die Mitglieder des Adels sich misstrauisch daraufhin zu beobachten beginnen, welche interaktiven Mittel des Gunsterwerbs und der persönlichen Profilierung beim Hof zum Einsatz gelangen.
Für alles, was in den folgenden Jahrhunderten an Theoriebildung in Frankreich folgen wird, sollte diese durch La Rochefoucauld vorbereitete Weichenstellung allergrößte Bedeutung besitzen. Der Begriff der amour propre, den er für das Studium zwischenmenschlicher Beziehungen fruchtbar gemacht hatte, legte von Anbeginn das Augenmerk auf eine Dimension von Anerkennung, die als solche nicht unbedingt selbstverständlich 32war. Wie ich dargelegt habe, wurde das, was später mit dieser Kategorie bezeichnet werden sollte, aus der Perspektive eines Subjekts gedacht, das von dem Drang beherrscht wird, sich in den Augen seiner Mitsubjekte als vortrefflich, als überlegen oder als höherrangig zu erweisen; mit dem Ziel, eine derartige Anerkennung oder ‒ besser ‒ Wertschätzung von Seiten der Anderen zu erfahren, ist das betreffende Subjekt ständig mit Versuchen beschäftigt, über das hinaus, was es tatsächlich an Eigenschaften besitzt, den Anschein weiterer charakterlicher Merkmale zu erwecken, und zwar solcher, die in seiner Kultur eine besondere Hochachtung genießen. Durch diese natürlich bewirkte Tendenz, öffentlich stets »mehr« aus uns zu machen, als unsere Persönlichkeit möglicherweise hergibt, entsteht auf beiden Seiten, das heißt bei der beurteilenden Öffentlichkeit und beim beurteilten Subjekt, ein Problem, das schon bei La Rochefoucauld unübersehbar epistemologische Züge trägt: Sowohl die richtende Instanz, die Anerkennung gewährt, als auch das nach Anerkennung strebende Individuum müssen jeweils alsbald in Zweifel darüber geraten, ob den präsentierten Vortrefflichkeiten in der Realität personaler Eigenschaften tatsächlich etwas entspricht. Mit dieser Wendung ins Epistemische nimmt der Vorgang der Anerkennung bei La Rochefoucauld eine Bedeutung an, die dem kognitiven Bestandteil der französischen re-connaissance