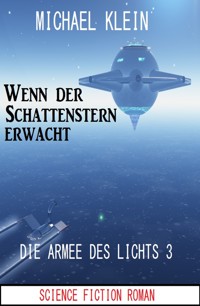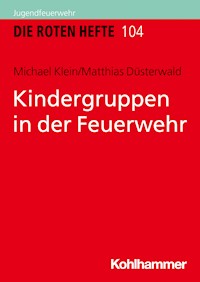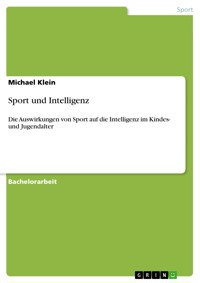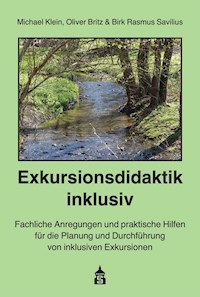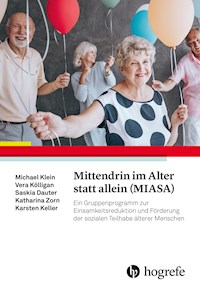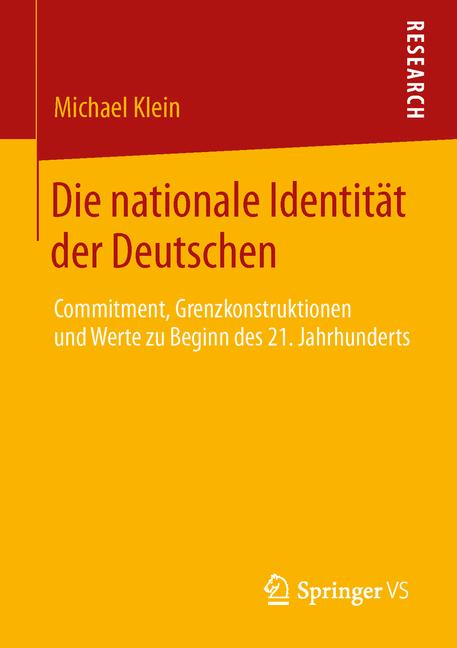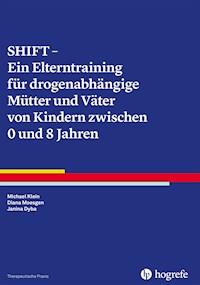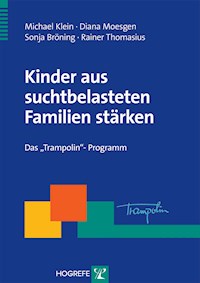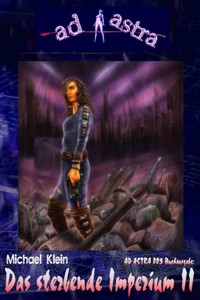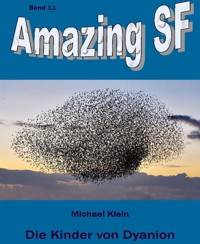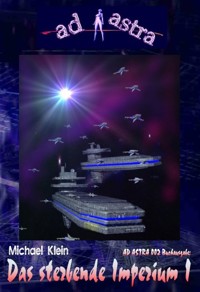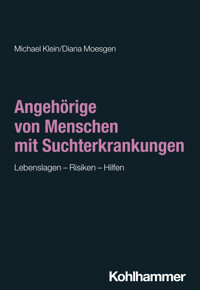
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Eine Suchterkrankung stellt nicht nur für die Betroffenen eine schwere Belastung dar, sondern auch für ihr enges soziales Umfeld: Angehörige sind den Folgen der Sucht intensiv ausgesetzt. Dieses Buch widmet sich den betroffenen Personengruppen - Partner, Kinder, Eltern, Freunde und Kollegen von Menschen mit Suchterkrankungen - und veranschaulicht deren unterschiedliche Belastungen und Unterstützungsbedarfe anhand von Forschungsresultaten und Fallbeispielen. Die Autoren diskutieren Grundlagen und Theoriemodelle zum Thema - z.B. das umstrittene Konzept der Co-Abhängigkeit - und zeigen bewährte und innovative Unterstützungsmöglichkeiten und Behandlungsansätze für Angehörige von Menschen mit Suchterkrankung auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Geleitwort der Reihenherausgeber
1 Einleitung
2 Fallvignetten
3 Epidemiologie
3.1 Prävalenz von Störungen durch Substanzgebrauch
3.2 Prävalenz von Störungen durch Verhaltenssüchte
3.3 Prävalenzen zu Angehörigen von Menschen mit Suchterkrankungen
3.3.1 Prävalenzraten zu Partnern von Personen mit Substanz- oder Verhaltenssüchten
3.3.2 Prävalenzraten zu Kindern von Personen mit Substanz- oder Verhaltenssüchten
4 Lebenssituation von Angehörigen von Menschen mit Suchterkrankungen
4.1 Partner von Menschen mit Suchterkrankungen
4.1.1 Partner von Menschen mit Störungen durch Substanzgebrauch
4.1.2 Partner von Menschen mit Störungen durch Verhaltenssüchte
4.2 Kinder aus suchtbelasteten Familien
4.2.1 Psychosoziale Risiken
4.2.2 Suchtmittelspezifische Risiken
4.3 Andere Angehörigengruppen
5 Auswirkungen der Suchterkrankung auf die Angehörigen
5.1 Partner von Menschen mit Suchterkrankungen
5.2 Kinder aus suchtbelasteten Familien
5.2.1 Folgen pränataler Exposition mit Alkohol und/oder Drogen
5.2.2 Folgen von Störungen durch Substanzgebrauch für Kinder aus suchtbelasteten Familien
5.2.3 Folgen von Verhaltenssüchten für Kinder aus belasteten Familien
5.2.4 Umgebungs- und individuumsbezogene Schutzfaktoren für Kinder aus suchtbelasteten Familien
6 Modelle zur Erklärung des Angehörigenverhaltens
6.1 Dependente Persönlichkeitsstörung
6.2 Co-Abhängigkeit
6.3 Stress- und Coping-Ansätze
7 Unterstützungs- und Behandlungsansätze
7.1 Unterstützungs- und Behandlungsansätze für Partner von Menschen mit Suchterkrankungen
7.1.1 Allgemeine Wirksamkeit von Paarinterventionen
7.1.2 CRA und CRAFT
7.1.3 BCT und ABCT
7.1.4 ETAPPE
7.2 Unterstützungs- und Behandlungsansätze für Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien
7.2.1 TRAMPOLIN
7.2.2 Strengthening Families Program (SFP)
8 Ausblick
Literatur
Sachwortverzeichnis
Sucht: Risiken – Formen – InterventionenInterdisziplinäre Ansätze von der Prävention zur Therapie
Herausgegeben von Oliver Bilke-Hentsch,Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank und Michael Klein
Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Bände der Reihe finden Sie unter:
https://shop.kohlhammer.de/sucht-reihe
Die Autoren
Prof. Dr. rer. nat. Michael Klein, Dipl. Psych., ist Psychologischer Psychotherapeut in eigener Praxis mit Schwerpunkt Suchtkranke und Angehörige. Forschungsschwerpunkte: Sucht und Familie, Kinder von Suchtkranken, Männerpsychologie.
© Marion Koell
Prof. Dr. rer. nat. Diana Moesgen, Psychologin M.Sc., Psychologische Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie, ist Professorin für Sozial- und Klinische Psychologie an der Katholischen Hochschule NRW, Abt. Paderborn. Nebenberuflich ist sie in eigener Praxis als Psychotherapeutin tätig.
Michael KleinDiana Moesgen
Angehörige von Menschen mit Suchterkrankungen
Lebenslagen – Risiken – Hilfen
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-029977-1
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-029978-8epub:ISBN 978-3-17-029979-5
Geleitwort der Reihenherausgeber
Die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte im Suchtbereich sind beachtlich und erfreulich. Dies gilt für Prävention, Diagnostik und Therapie, aber auch für die Suchtforschung in den Bereichen Biologie, Medizin, Psychologie und den Sozialwissenschaften. Dabei wird vielfältig und interdisziplinär an den Themen der Abhängigkeit, des schädlichen Gebrauchs und der gesellschaftlichen, persönlichen und biologischen Risikofaktoren gearbeitet. In den unterschiedlichen Alters- und Entwicklungsphasen sowie in den unterschiedlichen familiären, beruflichen und sozialen Kontexten zeigen sich teils überlappende, teils sehr unterschiedliche Herausforderungen.
Um diesen vielen neuen Entwicklungen im Suchtbereich gerecht zu werden, wurde die Reihe »Sucht: Risiken – Formen – Interventionen« konzipiert. In jedem einzelnen Band wird von ausgewiesenen Expertinnen und Experten ein Schwerpunktthema bearbeitet.
Die Reihe gliedert sich konzeptionell in drei Hauptbereiche, sog. »tracks«:
Track 1:Grundlagen und Interventionsansätze
Track 2:Substanzabhängige Störungen und Verhaltenssüchte im Einzelnen
Track 3:Gefährdete Personengruppen und Komorbiditäten
In jedem Band wird auf die interdisziplinären und praxisrelevanten Aspekte fokussiert, es werden aber auch die neuesten wissenschaftlichen Grundlagen des Themas umfassend und verständlich dargestellt. Die Leserinnen und Leser haben so die Möglichkeit, sich entweder Stück für Stück ihre »persönliche Suchtbibliothek« zusammenzustellen oder aber mit einzelnen Bänden Wissen und Können in einem bestimmten Bereich zu erweitern.
Unsere Reihe »Sucht« ist geeignet und besonders gedacht für Fachleute und Praktiker aus den unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Suchtberatung, der ambulanten und stationären Therapie, der Rehabilitation und nicht zuletzt der Prävention. Sie ist aber auch gleichermaßen geeignet für Studierende der Psychologie, der Pädagogik, der Medizin, der Pflege und anderer Fachbereiche, die sich intensiver mit Suchtgefährdeten und Suchtkranken beschäftigen wollen.
Die Herausgeber möchten mit diesem interdisziplinären Konzept der Sucht-Reihe einen Beitrag in der Aus- und Weiterbildung in diesem anspruchsvollen Feld leisten. Wir bedanken uns beim Verlag für die Umsetzung dieses innovativen Konzepts und bei allen Autoren für die sehr anspruchsvollen, aber dennoch gut lesbaren und praxisrelevanten Werke.
Der vorliegende Band schließt eine Lücke in der Fachliteratur zu Sucht. Die Situation von Angehörigen wird allzu oft vernachlässigt. Dabei leiden sie unter der Suchtkrankheit in der Familie besonders stark. Es ist zur Prävention, Therapie und Nachsorge bei Sucht von herausragender Wichtigkeit, Partner und Partnerinnen, Kinder und Eltern mit zu berücksichtigen und ihnen eigenständige wie auch koordinierte Hilfen anzubieten. Es ist schon lange bekannt, dass die Suchterkrankung eine komplexe psychische Erkrankung darstellt, die die ganze Familie über Generationen betrifft. Im vorliegenden Band werden Angehörige als Gruppe ebenso betrachtet wie einzelne Subgruppen von Angehörigen: Partner und Partnerinnen, Kinder und Jugendliche, Geschwister, Eltern und Großeltern. Der Band soll nicht nur die Lage der Angehörigen vor dem Hintergrund relevanter internationaler Forschung aufzeigen, sondern insbesondere mehr praktische Hilfen in den Bereichen Prävention und Psychotherapie initiieren.
Oliver Bilke-Hentsch, LuzernEuphrosyne Gouzoulis-Mayfrank, KölnMichael Klein, Köln
1 Einleitung
Daten zur Prävalenz von Suchterkrankungen belegen die weite Verbreitung von Substanzmissbrauch und -abhängigkeit in unserer Gesellschaft. Faktisch gehören Suchterkrankungen neben Angststörungen und affektiven Störungen zu den am häufigsten vorkommenden psychischen Störungen in der Bevölkerung. Bei Männern stellen sie mit großem Abstand die häufigste psychische Störung dar. Eine Substanzabhängigkeit bedeutet zumeist aber nicht nur für das betroffene Individuum eine schwere Belastung, sondern auch für sein enges soziales und familiäres Umfeld. Oft ist das Umfeld noch schwerer belastet, da insbesondere für die Familienangehörigen Stress und Anforderungen auf der einen Seite zunehmen, während Stigmatisierung und Ausgrenzung auf der anderen Seite drohen. Die Gruppe der Angehörigen von Menschen mit Suchterkrankungen ist allein angesichts der verschiedenen Möglichkeiten bezüglich der Art der Bezogenheit auf eine nahestehende Person (z. B. Partner1, Kinder, Eltern, Freunde usw.) groß und heterogen zusammengesetzt (siehe unten). Ein Großteil der Angehörigen von Menschen mit Suchterkrankungen erleidet dauerhafte und schwerwiegende Belastungen. Diese liegen vor allem innerhalb der oft belasteten Beziehung des Angehörigen zur Person mit Suchterkrankung und können von Konflikten in und Zerrüttung von der Partnerschaft und Familie bis hin zu physischer Gewalt und Misshandlung reichen. Auch Trennungen und Scheidungen, oft nach vielen Jahren der Hoffnung auf Besserung der Suchtstörung des Partners, sind häufig. Ungünstige äußere Bedingungen, wie z. B. Arbeitsplatzverlust und finanzielle Schwierigkeiten, verschärfen die Lage oft zusätzlich. Auf Seiten der Angehörigen entstehen somit Probleme, die biopsychosozialer Natur sein können und daher Person, Körper und Umfeld betreffen. Hieraus ergibt sich ein besonderer Unterstützungsbedarf, der bislang jedoch zu selten umfassend und frühzeitig erfüllt wird (Bischof 2019). Es bestehen noch zu wenige spezifische professionelle und evidenzbasierte Angebote für Angehörige von Menschen mit Suchterkrankungen – wobei besonders an für die Betroffenen erkennbare, niedrigschwellig zu erreichende Hilfen zu denken ist.
Das vorliegende Buch zielt darauf ab, einen umfassenden und aktuellen Überblick zur Situation von Angehörigen von Menschen mit Suchterkrankungen zu bieten. Hierzu soll zunächst in diesem Kapitel eruiert werden, welche Personengruppen als Angehörige von Menschen mit Suchterkrankungen zu bezeichnen sind. Im folgenden ▸ Kap. 2 werden vier Fallvignetten aus verschiedenen Sucht- und Familienkontexten vorgestellt. Dabei tauchen in Anbetracht verschiedener Suchtformen und Substanzen sowohl Unterschiede als auch Parallelen hinsichtlich der innerfamiliären Situationen, der Symptomatiken und Konsequenzen auf. Das anschließende ▸ Kap. 3 widmet sich der Epidemiologie. In diesem Kapitel werden vorliegende Zahlen zu Angehörigen von Menschen mit Suchterkrankungen dargestellt, wobei bestehende Untergruppen gesondert berücksichtigt werden. ▸ Kap. 4 widmet sich intensiv den besonderen Stressoren und Belastungen, denen Angehörige von Menschen mit Suchterkrankungen exponiert sind. Aufgrund der Heterogenität der Angehörigengruppe muss von unterschiedlichen Belastungen und Unterstützungsbedarfen ausgegangen werden, welche in diesem Kapitel genauer betrachtet werden. Thematisiert werden hier z. B. dauerhaft konfliktreiche oder sogar gewaltbelastete Beziehungen, das Erleben wiederkehrender Unsicherheiten und Unberechenbarkeiten, Sorgen um die Gesundheit der von einer Suchterkrankung betroffenen Person, fortgesetztes Kontrollverhalten in Bezug auf die Person mit einer Suchterkrankung sowie die Einschränkung der eigenen sozialen Kontakte und Freizeitgestaltung. ▸ Kap. 5 betrachtet im Folgenden die Konsequenzen, die diese Belastungen für die Angehörigen besitzen können. Dabei wird ein besonderer Fokus auf psychische oder psychosomatische Konsequenzen gelegt. Die verschiedenen Angehörigengruppen sowie die Art der Suchterkrankung, der diese exponiert sind, sind dabei weitestgehend differenziert betrachtet. Das folgende ▸ Kap. 6 behandelt verschiedene theoretische Hintergrundmodelle zum Thema Angehörige von Menschen mit Suchterkrankungen. Das Kapitel bietet eine kritische Reflektion der potenziellen Rolle einer dependenten Persönlichkeitsstörung sowie des sehr verbreiteten, aber auch sehr umstrittenen Begriffs der »Co-Abhängigkeit«. Die Bedeutung der Co-Abhängigkeit sowie die eher uneinheitliche Verwendung dieses Begriffs werden erörtert. Es folgt eine kritische Auseinandersetzung mit dem entsprechenden Konzept. Darauf aufbauend werden Verbesserungsvorschläge aufgezeigt. Zuletzt werden die bedeutsamen Stress- und Coping-Ansätze berücksichtigt. Das siebte Kapitel (▸ Kap. 7) widmet sich den existierenden Unterstützungsmöglichkeiten und Behandlungsansätzen für die verschiedenen Angehörigengruppen. Es werden für die verschiedenen Gruppen Behandlungsmöglichkeiten und -schwerpunkte aufgezeigt. Ein besonderes Gewicht liegt dabei auf Programmen, deren Wirksamkeit sich im Rahmen wissenschaftlicher Studien bewährt hat. Der dennoch bestehende Bedarf nach zielgruppenorientierten neuen Stressreduktions- und Ressourcenförderprogrammen wird zuletzt aufgezeigt. Das Buch schließt im letzten ▸ Kap. 8 mit einem kurzen Ausblick auf künftige Forschungsaktivitäten und wünschenswerte Präventionsvorhaben.
Die Situation von Angehörigen von Menschen mit Suchterkrankungen wurde bislang in Forschung und Praxis nur lückenhaft und wenig kontinuierlich beachtet (Klein und Bischof 2013). Der aktuelle Forschungsstand zeigt, dass bis dato zu den spezifischen Belastungen der Zielgruppe und ihren konkreten Unterstützungsbedarfen, insbesondere in Deutschland, zu wenig Kenntnisse vorliegen. Er deutet aber darauf hin, dass das Stresserleben und die daraus resultierenden negativen Konsequenzen für Angehörige erheblich sind (Klein & Bischof 2013; Berndt et al. 2017; internationale Sicht vgl. Salize et al. 2014, Orford et al. 2013). Für eine nachhaltige Verbesserung der Situation von Angehörigen müssen aber deren individuelle Problemlagen adäquat und differenziert wahrgenommen und bei Hilfeangeboten rekonstruiert werden, damit passgenaue Unterstützungskonzepte entwickelt werden können. Angehörige sollen in ihrem Verhalten im Allgemeinen und ihren Reaktionen auf ihre Bezugsperson mit einer Suchterkrankung nicht verurteilend stigmatisiert oder vorschnell einer Diagnosekategorie zugewiesen werden, sondern Empathie und Respekt erfahren. Dadurch sind am ehesten Zugang und Veränderung möglich, wie die zahlreichen Studien im Bereich des »Motivational Interviewing«, auch für betroffene Angehörige, zeigen konnten (Miller & Rollnick 2015). Dabei gilt es zu beachten, dass die Gruppe der Angehörigen von Menschen mit Suchterkrankungen mindestens so heterogen zusammengesetzt ist wie die der Gruppe der Menschen mit Suchterkrankung selbst.
Merke
Angehörige von Menschen mit Suchterkrankungen sind eine in Praxis und Forschung immer noch vernachlässigte Gruppe. Sie ist mindestens so heterogen zusammengesetzt wie die Gruppe der Menschen mit Suchterkrankungen.
Eine Einteilung der Gruppe der Angehörigen in Untergruppen erscheint daher sinnvoll und zweckmäßig für die optimale Zuordnung von Hilfen. Um einen entsprechenden Versuch der Definition von Untergruppen vorzunehmen, ist eine Berücksichtigung der folgenden Merkmale erforderlich:
♦
Geschlecht: männlich, weiblich, divers
♦
Altersgruppe: Kinder, Jugendliche und Erwachsene jungen, mittleren und höheren Alters
♦
Status der Angehörigkeit:
-
Ehepartner oder Lebensgefährte,
-
minderjähriges Kind (leibliches, Stief-, Adoptiv- oder Pflegekind), im selben Haushalt lebend oder nicht,
-
erwachsenes Kind (leibliches, Stief-, Adoptiv- oder Pflegekind),
-
Freund,
-
nahestehender Kollege, Vorgesetzter oder
-
Eltern- oder Großelternteil
♦
Art der Suchterkrankung der betroffenen Person:
-
Alkohol
-
Cannabis
-
illegale Drogen (Heroin, Kokain, (Meth-)Amphetamine, Halluzinogene usw.)
-
(verschreibungspflichtige) Medikamente
-
polyvalenter Substanzkonsum
♦
Störung durch Verhaltenssüchte (v. a. Glücksspiel, Internet, Online-Spiele, Soziale Medien, Kaufsucht, Pornographienutzungsstörung, exzessives Sexualverhalten
♦
Dauer der Suchterkrankung sowie der Zeitraum, in dem der Angehörige der Suchterkrankung exponiert war (wenige Monate oder Jahre bis mehrere Jahrzehnte)
♦
Art des Zugangs zum Hilfesystem durch den Angehörigen: Angehöriger ...
-
ist in Selbsthilfe-Gruppen engagiert,
-
hat Zugang zur professionellen Suchthilfe,
-
hat Zugang zu unspezifischen Hilfen oder
-
hat bisher keinerlei Kontakt zu Hilfeangeboten gehabt.
♦
Art des Zugangs zum Hilfesystem durch die Person mit Suchterkrankung: Betroffene Person ist ...
-
in das professionelle Hilfesystem eingebunden, z. B. ambulante oder stationäre Therapie, ambulante Beratung, Selbsthilfe etc. oder
-
nicht in das professionelle Suchthilfesystem eingebunden,
-
wenn nicht angebunden, grundsätzlich offen für professionelle Hilfen oder
-
nicht offen für professionelle Hilfen.
Abgesehen von der Tatsache, dass jeder Mensch mit Suchterkrankung ein Individuum mit eigenen Merkmalen, Eigenschaften und Verhaltensweisen darstellt, und dass auch jeder Angehörige eine einzigartige Person mit eigenen Stressbewältigungskompetenzen, Coping-Strategien und Ressourcen ist, muss allein aufgrund der hier genannten Charakteristika von unterschiedlichen Belastungen und Konsequenzen für die Angehörigen und damit auch von verschiedenen Unterstützungsbedarfen ausgegangen werden, die in den folgenden Kapiteln beleuchtet werden. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf die beiden besonders prävalenzstarken Gruppen der weiblichen Partnerinnen und Kinder/Jugendlichen (Klein 2002) gelegt. Diese Personengruppen stellen die mit Abstand häufigsten betroffenen Angehörigen von Menschen mit Suchterkrankungen dar.
Endnoten
1Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit wird in diesem Werk das generische Maskulinum verwendet. Es schließt sowohl Frauen als auch Männer ein. Wo ausdrücklich nur Frauen gemeint sind, wird das generische Femininum verwendet.
2 Fallvignetten
Fall 1: Elvira (43), Frau eines Mannes mit Alkoholkonsumstörung und Tochter eines Vaters mit Alkoholkonsumstörung
Elvira (43 Jahre), ist die älteste von zwei Töchtern eines Kraftfahrers (Heinz, 63 Jahre) und seiner Ehefrau (Hildegard, 62 Jahre). Der Vater hatte schon früh mit häufigem Trinken begonnen. An Wochenenden oder an den Abenden, wenn er »auf Tour« war, nahmen die Trinkmengen immer mehr zu. Er stieg dabei von Bier immer häufiger auf Schnaps um. Später nahm er dann die ärztlich verordneten Benzodiazepine, um seine Trinkmengen zu verringern und zeitweise ganz alkoholabstinent zu sein. Seine spätere Ehefrau Hildegard lernte er kurz vor seinem 18. Geburtstag auf einem Junggesellenfest in seinem Heimatdorf kennen. Auch in dieser Situation hatte er viel getrunken. Hildegard wurde sehr schnell mit Elvira schwanger und die beiden beschlossen – eher unfreiwillig – zu heiraten, weil dies in ihren Familien so erwartet wurde. Zu Elviras ältesten Erinnerungen gehört eine Szene in der häuslichen Küche, bei der der Vater immer wütender wurde, heftig seine Frau Hildegard anbrüllte und ihr schließlich zweimal heftig ins Gesicht schlug. Sie erinnert immer noch, dass der Mutter daraufhin Blut aus der Nase lief und der Vater sich angewidert abwandte. Elvira zog sich in der Kindheit immer mehr zurück und entwickelte sich zu einem ängstlichen, selbstunsicheren Kind. Sie tröstete, so gut sie konnte, die oft verzweifelte, weinende Mutter. Heute weiß sie, dass die Mutter schon früh unter Depressionen litt und sogar Suizidgedanken hegte. Ihre kleine Schwester Melanie (37 Jahre) behütete sie so intensiv wie möglich. In der Schule war sie eher Einzelgängerin und hatte nur wenige Freundinnen. Nach dem Besuch der Realschule begann sie eine dreijährige Ausbildung zur Erzieherin. In ihrer Familie häuften sich in dieser Zeit die Streitigkeiten. Ihre Mutter schaffte es jedoch nicht, sich zu trennen. Nachdem der Vater vor 15 Jahren bei einem schweren Verkehrsunfall unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss Führerschein und Arbeitsstelle verloren und auch schwere Frakturen und innere Verletzungen erlitten hatte, rückte die Familie enger zusammen. Heinz absolvierte eine mehrmonatige Entwöhnungsbehandlung und blieb danach – auch mit Unterstützung einer Suchtselbsthilfegruppe – abstinent. Während der stationären Therapie des Vaters lernte Elvira seinen Mitpatienten Oliver (heute 45 Jahre) kennen. Sie ging sehr schnell mit ihm eine feste Beziehung ein. Es war ihre zweite sexuelle Erfahrung mit einem Mann. Sie fühlte sich von Olivers Selbstsicherheit und Dominanz stark angezogen. Er sei im Unterschied zum Vater keiner, der »sich duckt und unterordnet«. Die beiden heirateten schon nach sechs Monaten und Elvira fühlte sich endlich »glücklich und angekommen«. Die Ehe blieb kinderlos, worunter Elvira sehr leidet, da sie sich immer sehnlichst ein Kind wünschte.
Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung als Erzieherin hatte sie begonnen, in einer Kindertagesstätte zu arbeiten. Der Beruf macht ihr bis heute viel Freude. Oliver wurde drei Jahre nach Beendigung seiner Therapie rückfällig mit Alkohol und Amphetaminen. Er verweigerte jegliche Hilfe. Elvira versuchte zunächst, ihn zu überreden, wieder mit dem Substanzkonsum aufzuhören. Sie entschuldigte sein Verhalten nach außen, auch gegenüber ihren Eltern. Ihr Vater hat inzwischen eine dauerhafte Abstinenz erreicht und beschuldigte seine Tochter der »Komplizenschaft« mit Oliver und dass sie eine Co-Abhängige sei. Daraufhin zog sie sich immer weiter von ihm zurück und das Paar isolierte sich auch zunehmend von Verwandten und bisherigen Freunden.
Die Partnerschaft mit Oliver wird für Elvira immer belastender und anstrengender. Trotzdem schafft sie es nicht, sich zu trennen und leidet subjektiv sehr stark. Sie fühlt sich manchmal daran erinnert, wie es ihrer Mutter vor Jahren ergangen ist und hofft dann, dass Oliver eines Tages »doch noch zur Vernunft kommt« und wieder in Therapie geht, um abstinent zu werden.
Fall 2: Sarah (28), Frau mit Drogenkonsumstörung mit einem Partner mit Drogenkonsumstörung
Sarah (28 Jahre) konsumierte in ihrer Jugend früh Alkohol und Tabak (Einstieg mit 13 Jahren) und ab dem 15. Lebensjahr auch Cannabis. Sie fühlte sich von ihren Eltern, die sich bereits getrennt hatten, als sie noch im Kindergarten war, oft im Stich gelassen. Ihre Beziehung zur Mutter, bei der sie überwiegend aufwuchs und die nach der Trennung zunächst mehrere kurzzeitige Beziehungen zu Männern hatte, war oft disharmonisch und distanziert. Ihr war von der Mutter vermittelt worden, dass sie, Sarah, als ihr einziges Kind ihr Leben zerstört hatte, weil sie schon mit 18 Jahren mit ihr schwanger geworden sei und sie daraufhin ihre Berufsausbildung abgebrochen habe. Auch erzählte sie ihr einmal im alkoholisierten Zustand, dass sie sich damals zu spät zu einer Abtreibung entschlossen habe, weil sie die Schwangerschaft erst zu Beginn des dritten Monats bemerkt habe. In ihrem heutigen Alter habe sie keine Chance mehr auf einen adäquaten Job. Sarah selbst orientierte sich schon sehr früh nach außen und verbrachte viel Zeit mit ihren Schulfreundinnen und -freunden. Auch zu ihrem Vater hatte sie nie den gewünschten Kontakt. Dieser habe mit einer neuen Partnerin noch zwei Kinder bekommen und sie hätte sich bei den seltenen Besuchen in der dortigen Familie nicht wohl gefühlt.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: