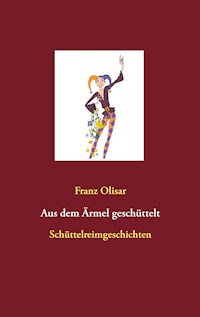Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Autor lässt uns teilhaben an einer autobiografischen Aufarbeitung und zugleich satirischen Abrechnung mit einem Teil unwiederbringlicher und sinnlos vergeudete Lebenszeit. Als detailverliebtes Zeitdokument der wilden Siebziger-Jahre des vorigen Jahrhunderts, lädt das Buch dazu ein, sich selbst mit einem Schmunzeln im Gesicht zurückzuerinnern, sich selbst wiederzuentdecken und sich aus heutigem Blickwinkel humorvoll in einem alten Spiegel zu betrachten. Töffler, Glockenhosen, Röhrenjeans, lange Haare und 'Love & Peace' im Kampf gegen sinnlose Befehlssucht, abgestumpfte Borniertheit, traurige Leere und aussichtslose Versuche von Intelligenzkompensation durch viel zu viel Alkoholmissbrauch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis:
Vorwort
Bei der Musterung
Maskenball mit Folgen
Alles Wels
Erster Tag als Soldat
Mahlzeit
Rechts um!
Beim Rapport
Mein Kameradschaftsbund
Wandertag mit Folgen
Die Hand zum Kappenrand
Im Krankenstand
Der erste Überzeit-Schein
Die Inventur
Schraufen und Schrauffen
Zwischen den Fronten
Das eiserne Kreuz
Hoher Zaun
Tag der Abrüstung
Resümee
Vorwort
Es war einmal vor langer, langer Zeit. Ich war mitten im neunzehnten Lebensjahr, hatte aus damaliger Sicht all meine Lebensziele erreicht und stand nun als neuer fertiger Erwachsener mitten im Leben. Die Schule hatte ich längst schon vor- und rechtzeitig abgebrochen, um nicht ob all der Dummheit, Borniertheit und Ignoranz der Nachkriegs-Lehrkörperschaft Amok zu laufen. Zudem hatte ich gerade die Lehrabschlussprüfung zum „Technischen Zeichner“ mit der nicht gerade übermäßig schmeichelhaften Beurteilung „Bestanden“ bestanden. Sogar die Führerscheinprüfung hatte ich erfolgreich absolviert und überdies stand mir ein eigenes Auto zur Verfügung, womit der großen Freiheit eigentlich keine Grenzen mehr gesetzt schienen.
Es ging langsam Richtung Ende der siebziger Jahre, meine Leiberl hießen noch nicht T-Shirt, und waren aus grober, naturweißer Baumwolle gewebt, sowie über und über mit bunten Blumen und Ornamenten bestickt. Meine Tschick, also die Zigaretten (ich glaube, es waren „Dames“), mein Feuerzeug, etwas Kleingeld und einige Musik-Kassetten mit einem selbst aufgenommenen Musik-Mix aus Deep Purple, Leonard Cohen, Pink Floyd, John Lennon, Lucio Battisti, Patty Smith, Uriah Heep, Lou Reed, Kraftwerk, Jean-Michel Jarre, Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Konstantin Wecker und Ludwig Hirsch klimperten in meinem hellbraunen Umhänge-Beutel um die Wette. Der Beutel war aus Rauleder gefertigt. Damals hieß das ja noch Rauhleder und eine Rechtschreibreform war noch lange nicht in Sicht. Ein Raulederbeutel deswegen, weil es noch einige Jahre zu früh war für Jutesäcke. Jutesäcke kamen erst später in Mode. Zu jener Zeit trug man in Jutesäcken noch keine Musik-Kassetten, sondern hauptsächlich Erdäpfel. Manche glaubten, sich den neuen Zeiten anpassen zu müssen und sagten damals schon Kartoffel. Das waren aber nur die, welche dann auch am Aschermittwoch Herings-Kas statt Haringkas bestellten und ähnlichen aufgesetzten Nonsens.
Freilich gab es damals auch etwas andere Musik. In den österreichischen Hitparaden tummelten sich jede Menge hübsche Lieder, die zum Tanzen in den aus dem Boden schießenden Diskotheken förmlich einluden. Die Barden Waterloo & Robinson hatten ihren Hit „My little World“, mit dem sie beim „grand prix de la chanson“ durchaus reüssieren konnten, auf Deutsch aufgenommen und man tanzte zu „Meine kleine Welt“, je nach Tanzkurs-Perfektion, entweder „offen“ im freien Stil oder in komplizierten Schritt-Kombinationen, die mir allerdings nicht gegönnt waren. Ich war beim Grundkurs nicht über den langsamen Walzer, die Polka, den Landler und den vereinfachten Cha-Cha-Cha, dessen Figuren sich in Wischer und New-Yorker erschöpften, hinausgekommen. Nun rächte es sich doch offensichtlich, den Tanzkurs bequem im ländlichen Wallern, anstatt im urbanen, fortschrittlichen Wels absolviert zu haben. Die schnellen Schritte raubten mir schon beim Zusehen die Sinne. Allerdings schwitzte ich deutlich weniger, was mir auf der Pirsch nach Weiblichem auch nicht ganz unwichtig erschien.
Der angesagteste Tanz war aber ohnehin der sogenannte „Bump“, den man zu Penny McLeans Lied „Lady bump“ zu tanzen hatte. Aus heutiger Sicht waren wir für diese Art von Tanz einfach noch etwas zu unreif. Man sollte ja bei diesem „Bump“ zum Refrain mit den Hüften „bumpen“, also einen Zusammenstoß andeuten oder eben in moderater Form mit den Hüften tatsächlich zusammenstoßen. Sich dabei gegenseitig wuchtig von der Tanzfläche zu schießen und dadurch mit blutunterlaufenen Hüftprellungen herum zu torkeln war wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders. Schon aus medizinischer Sicht waren wir letztendlich alle heilfroh, als sich der hüftschonende Vogerltanz langsam durchzusetzen begann.
Meine Haare waren schwarz und unbeschreiblich dicht, und schränkten durch ihre ansehnliche Länge das Hören und Sehen deutlich ein. Es war, als trüge ich ständig eine Kapuze mit Zusatz-Schleier. Das trübte vor allem die Rundumsicht und so war ich zu jener Zeit gar nicht so leicht von der Seite her ablenkbar und war, nicht zuletzt deshalb, zumeist eher nach vorne orientiert. Aber zumindest das Hören konnte ich bei dem, was mir wichtig schien, ganz gut kompensieren. Ich brauchte ja nur den Lautstärke-Regler des Platten- oder Kassettenspielers bis zum Anschlag aufdrehen. Kopfhörer waren zu dieser Zeit kein Thema. Man war ja grundsätzlich in Aufbruchs- und Revolutionsstimmung und wollte ja, dass jeder hörte, was man hörte.
Wenn es warm war, ging ich barfuß, und wenn es nicht so warm war, steckten meine Füße in Töfflern. Töffler hießen diese Holz-Clogs mit vorne zwei und hinten vier Zentimeter hohen Absätzen und einem schwarzen, aufgenageltem Leder-Oberteil.
Bei meinen Exemplaren neigte dann immer das Oberleder zum Abfärben, und zwar interessanterweise innen und so hatte ich auch dann schmutzige Füße, wenn ich nicht barfuß unterwegs war. Sie waren eben dann halt oben schmutziger als unten. Sobald dann die relativ dünnen Gummisohlen-Plättchen abgenutzt oder verloren waren, nutzten sich zumeist die Hinter- und Vorderstöckel durch das ständige Dahinschlapfen je nach persönlichem Gang und der jeweiligen Holzbeschaffenheit etwas unregelmäßig ab, was nicht gerade zur Eleganz in der Vorwärtsbewegung beitrug. Mir kamen sie damals sehr bequem vor.
Aber zurück zum Auto. Gut, das gehörte mir nur zur Hälfte, nachdem kurz zuvor meine Mutter ebenfalls mit Stolz ihren Führerschein gemacht hatte, weil das eben zum gerade erst zart aufblühenden Pflänzchen der Gleichberechtigung nun einfach „dazu gehören“ würde, und wir uns dieses Auto theoretisch teilen wollten. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, ob sie auch einmal damit gefahren ist. Das Teilen kam mir allerdings vor allem beim Ankauf doch sehr entgegen, nachdem der durchaus sensationell dastehende, spurverbreiterte, tiefergelegte, feuerrote Mini-Clubman mit knapp 30.000 Schilling zum Verkauf stand, und ich trotz des Verkaufs meiner entdrosselten, getunten 50ccm Honda-Rennmaschine mit Höcker-Sitzbank und angedeuteter Halbschalenverkleidung nur knappe 12.000 Schilling zusammenkratzen konnte. Zu meiner Entschuldigung ist anzumerken, dass etwa 2 Jahre vorher, just zum Zeitpunkt des Erwerbes der obengenannten Rennmaschine sich der Benzinpreis über Nacht von 3 auf 6 Schilling verdoppelt hatte, und mir dadurch die Betankung unkontrolliert die Haare vom Kopf fraß. Leider konnte ja die Erhöhung der Lehrlingsentschädigung mit der exorbitanten Erhöhung des Benzinpreises in keiner Weise Schritt halten. Und das trotz des alleinregierenden Kabinetts Kreisky III, das sonst über fast jeden Zweifel erhaben schien.
Ja, ich war aus meiner damaligen Sicht erwachsen und bereit fürs Leben. Möglicherweise war man damals aber generell, durch das Fehlen der elektronischen Medien mit ihrem Überangebot an Informationen jeglicher Art, noch nicht so überreizt und abgeklärt wie heute, so dass man eher fröhlich, neugierig und unverdorben bis ins zarte Erwachsenenalter hinein pubertierte. Bei mir war jedenfalls damals doch zumeist die Chance, sich paaren zu dürfen, vielem anderen deutlich und beinahe unangemessen übergeordnet. Und so war ich dann auch bei manchen anstehenden Lebensentscheidungen gewillt, diese den sich nur rar bietenden Chancen nach Möglichkeit anzupassen.
So viel vorweg am Rande, nachdem die eine oder andere Eigenschaft oder Begebenheit doch im weiteren Verlauf der Geschichte immer wieder eine mehr oder weniger tragende Rolle spielen sollte. So wie eben auch die Tatsache, dass ich aus heutiger Sicht zu jener Zeit wohl als „lästige Grätzn“ gegenüber jeglicher Art von „Obrigkeit“ zu bezeichnen war, und manche Zeitgenossen damals schon intensiv mit der Hoffnung zu spekulieren begannen, dass mir dann beim Bundesheer endlich die „Wadln vüri gricht“ würden, also sprichwörtlich die Waden nach vorne gerichtet würden. Für mich war die Aussicht auf die unausweichliche Musterung nicht ganz so erfreulich. Man könnte eher sagen, dass ich bangen Herzens und darob ungeduldig darauf wartete. Es dauerte und dauerte, Carl XVI. Gustav nutzte die Zeit, um inzwischen die deutsche Hostess Silvia Sommerlath zu ehelichen und zu sich auf den schwedischen Thron zu setzen, Antonin Panenka schupfte frech an der verdutzten, in eine Ecke gehechteten deutschen Tormann-Legende Sepp Maier vorbei, den entscheidenden Elfmeter mitten auf’s Tor und machte damit die damalige Tschechoslowakei zum Europameister, aber mein Aufruf zu Stellung oder auch Musterung ließ auf sich warten. Vietnam wiedervereinigte sich und am selben Tag führten die Vereinigten Staaten von Amerika, zwei Tage vor dem 200. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit die Todesstrafe wieder ein, um legal weitertöten zu können, nur mein Befehl zur Stellung ließ auf sich warten. Wolfgang Ambros raunzte „Du schwarzer Afghane“ ins Mikrofon, Georg Danzer brachte sich mit seinem „Jö schau“ einem breiten Publikum in kommerzielle Erinnerung, um sich dann wieder gewohnter Qualität zu widmen, und die Biene Maja schickte sich an, die große Fernsehwelt zu erobern. Nur ich musste warten.
Bei der Musterung
Eines schönen Tages, mitten hinein in dieses bange Warten, hinein in diese dampfende Schwüle, in dieses erweiterte, aufbegehrende Flüggewerden, in dieses Genießen von Freiheit und Selbstbestimmung, in dieses ganzheitliche Mannwerden, flatterte dann schließlich, in Form eines mehrbögigen Formulars, tatsächlich der Aufruf zu Stellung und Musterung ins Haus.
Da, wie bereits angedeutet, meine Prioritäten auf Grund der anhaltenden Pubertät leicht verschoben zu sein schienen, erachtete ich es beim Ausfüllen des Formulars als wichtigsten Punkt, meinen persönlichen Wünschen und Zielen bezüglich des Standorts, an dem ich meinen Präsenzdienst abzuleisten gedachte, genug Raum zu geben und entsprechend Ausdruck zu verleihen. Als meine bevorzugte Ausbildungs-Kaserne gab ich jene in Ried im Innkreis an, und begründete das mit meiner Überzeugung, mich dort bestmöglich als wertvolles Mitglied der Gesellschaft, und vor allem als aufrichtiger Verteidiger meines Vaterlandes, entwickeln zu können.
Mein Wunsch und meine Überzeugung entsprangen dem Umstand, dass ich just zu dieser Zeit ein nettes Mädchen aus dem Nachbarort kennengelernt hatte, dass bereit war, nach gegebenen Umständen und Möglichkeiten, sowie mit zufriedenstellender Frequenz, mit mir gemeinsam die Welt der Sexualität zu erforschen und das Wissen darüber langsam zu vertiefen. Wir sind also, wie man das damals nannte, „fix miteinander gegangen“. Die Möglichkeiten ergaben sich dann nach dem unausweichlichen Ende der Sommerferien leider meistens nur mehr am Wochenende. Meine bevorzugte Sexualpartnerin war nämlich eine angehende Kindergärtnerin in schulischer Ausbildung in einem Internat im fernen Ried im Innkreis. Das waren von meinem damaligen Heimatort, dem schönen Wallern an der Trattnach, hin und retour, mehr als 80 Kilometer Anreise, und wir wissen bereits, dass gerade zu jener Zeit der Benzinpreis in lichte Höhen geschraubt worden war. Zudem waren die damaligen Auto-Motoren wahrlich keine Sparmeister. Also gingen, vermutlich triebgesteuert, meine Überlegungen natürlich fast automatisch in jene Richtung, dass ein mehrmonatiger Wohnortwechsel in Richtung Ziel meiner Begierde mir durchaus zu pass kommen würde.
Und so machte ich mich schließlich zum gebotenen Termin mit dem penibel ausgefüllten Formular, in meinen Töfflern, meinem Hippie-Leiberl und meiner engen Glockenhose, die meinem Hintern, meinem Gemächt und meinen Schenkeln mehr Luft und Blut abschnürte, als sie meinen Waden und Knöcheln großzügig zurückgeben konnte, auf den Weg zur Musterungsstelle und versuchte dort, umrahmt von meiner langen, schwarzen, wallenden Haarpracht, einen guten Eindruck zu machen. Aus heutiger Sicht war das wohl ein eher aussichtsloses Unterfangen.
Die dort versammelte Kommission machte dann einen kompetenten und überwiegend zielgerichteten Eindruck. Dass der eine Arzt in Uniform einen etwas glasigen Blick hatte, und doch relativ stark nach Alkohol roch, störte mich nicht sonderlich. Da ich die Gepflogenheiten und das „business as usual“ im Alltagsbetrieb des Bundesheeres noch nicht kannte, dachte ich in meiner Unbefangenheit, dass er halt am Vortag eine Geburtstagsfeier oder ähnliches besucht haben musste, und dabei ein bisschen zu viel erwischt haben könnte. Sowohl sein Handschlag zur Begrüßung, als auch der routinierte, untersuchende Griff an meine Hoden waren kräftig und respekteinflößend. Meine leichte Farbenblindheit und insbesondere meine Rot-Grün-Sehschwäche konnte er verständlicherweise in seinem Zustand, und wohl vor allem durch seine rotgetrübten Augen, nicht erkennen. So wurde dann letztendlich sowohl meinen Hoden als auch meinen Augen die volle Tauglichkeit für den Dienst mit der Waffe bescheinigt.
Das anschließende, meine Wunschdestination betreffende, von seinem beisitzenden Kameraden gebellte, Fragen-Stakkato „Riet im Innkreis, allso?“, „Warrumm geratte Riet im Innkreis?“ und „Was spricht Sie so pesontters an am Pattalllion Riet?“ zeigte mir schlagartig auf, dass meine Vorbereitung nicht ganz optimal gewesen war. Zusätzlich irritierte mich wohl, dass immer, wenn er beim Bellen den Mund weit öffnete, sich ein Speichelfaden zwischen den oberen und unteren Schneidezähnen bildete, der sich dann beim Hervorbellen von harten Konsonanten in meine Richtung zerplatzend entlud. Seine Sprache hatte viele harte Konsonanten. Unglücklicherweise fiel mir dann leider spontan ein, dass ich so einen Speichelfaden schon einmal gesehen hatte. Es war Monate zuvor beim Skifahren, als mir in einer Gondelbahn ein holländischer Ski-Tourist mit halboffenem Mund gegenübersaß. Da hatte ich zuletzt so einen Speichelfaden gesehen. Es war auf eine eigene Weise ekelig und ich erinnerte mich, dass ich ihn kurz vor der Mittelstation gebeten hatte, seinen Mund zu schließen. Nicht nur der Umstand, dass der Holländer damals beleidigt reagiert hatte, hielt mich davon ab, meinem Gegenüber dasselbe vorzuschlagen, sondern vor allem auch der Plan, einen guten Eindruck zu hinterlassen.
Nun ja, ich hatte jedenfalls nicht die leiseste Ahnung, was einen am Bataillon Ried speziell ansprechen könnte und versuchte, das mit einer Ablenkungstaktik etwas zu kompensieren.
Ich erklärte, dass ich es für alle Beteiligten als höchst zielführend erachten würde, nicht direkt vor meiner Haustüre in Wels oder Hörsching stationiert zu sein, sondern eben einerseits ein Stückchen weiter weg, um mich von meinem Elternhaus, im Bestreben, ein richtiger Kerl und Soldat zu werden, abnabeln zu können, aber andererseits nicht allzu weit weg, um den Wochenend-Kontakt zu Familie, Freunden und meinen sportlichen Aktivitäten nicht ganz zu verlieren. Ried, erklärte ich mit Überzeugung, schien mir da hervorragend geeignet.
Ich hatte den Eindruck, dass sie meiner Argumentation durchaus folgen konnten und fuhr positiv gestimmt, frohen Mutes, mit aus dem offenen Seitenfenster wehenden Haaren, in meinem roten Mini-Cooper wieder nach Hause.
Ich sollte diesmal noch viel länger warten. Die Eagles veröffentlichten ihr legendäres Album „Hotel California“, und nichts geschah. In Europa wurde offiziell der Montag als erster Tag der Woche eingeführt, nachdem bis zu dieser Einführung gemäß abrahamitischer, also jüdisch-christlichmuslimischer Zählung, der Sonntag als erster Tag der Woche gegolten hatte, nur bei mir änderte sich nichts. Auch der Tod von Elvis Presley und später auch noch jener von Charlie Chaplin konnten mir natürlich die Zeit des Wartens nicht mit Kurzweil und Unterhaltung verkürzen.
Erst nach vielen Wochen und Monaten bangen Wartens erhielt ich den ersehnten Einberufungsbefehl. Meinem Wunsch beziehungsweise Ersuchen wurde teilweise stattgegeben. Der Teil mit dem Abnabeln hatte wohl den stärksten Eindruck hinterlassen. Ich sollte mich zur Ableistung meines achtmonatigen Präsenzdienstes in Wien einfinden. Nun war Feuer am Dach! Das war dieser Tag, an dem das Verhältnis zwischen dem österreichischen Bundesheer und meiner Wenigkeit so sehr getrübt wurde, dass es sich aus meiner Sicht nie wieder erholen konnte. Wien korrelierte so gar nicht mit meinem Sexualtrieb. Da schon eher Wels, nachdem sich in der Zwischenzeit diesbezüglich die Interessenslage, nicht zuletzt aufgrund der aktuell günstigeren, geographischen Lage, von Ried langsam Richtung Wels zu verschieben anschickte.
Jedenfalls war ich am Boden zerstört, und innerlich zerzaust und hatte einen Gesichtsausdruck wie der alte Wiener Wappen- und Siegel-Adler, der nach mir gerufen hatte.
Maskenball mit Folgen
Nun begab es sich allerdings zu jener Zeit, dass inzwischen die Ballsaison ins Land gezogen war, und ich Gelegenheit fand, beim lokalen, von der SPÖ-Ortsgruppe veranstalteten Faschings-Gschnas an der „Sekt-Bar“ meinen Kummer zu ertränken. Irgendwann stand ein gemütlicher Mann neben mir, nahm ein Achterl Wein zu sich, rauchte genüsslich ein Pfeiferl und schien amüsiert darüber zu sein, wie ich einem Freund von mir, mit schwerer Zunge und blumigen Worten, meinen harten Schicksalsschlag zu erklären versuchte. Ich schätzte den Fremden auf Ende dreißig, also aus meiner damaliger Sicht uralt und jenseits von Gut und Böse. Aber irgendwie wirkte er mit seinem gemütlichen Lächeln sympathisch, und wir kamen ins Gespräch. Bei meinem Freund hatte ich ohnehin das Gefühl, dass seine geistige und vor allen auch körperliche Aufnahmekapazität langsam erschöpft war. Im Laufe des Gesprächs stellte sich heraus, dass mein neuer, Pfeife rauchender, Gesprächspartner ein nicht ganz unwichtiger Politiker, und aus diesem Grund quasi Ehrengast auf diesem Ball war. Möglicherweise war Vorwahlzeit. Ich erinnere mich nicht.
Pfeife rauchende Politiker waren damals ja an allen Ecken und Enden durchaus nicht unüblich. Die meisten von denen waren aber ziemliche Deppen. Einige Jahre später hatte ich zum Beispiel das zweifelhafte Vergnügen, auf dem „Welser Volksfest“ in einer kleinen Durchgangshalle, welche zwei große Bierzelte miteinander verband, und in denen sich auch der Zugang zu den WC-Anlagen befand, was geruchsmäßig dem relativ kleinem Raum ein besonderes Ambiente verlieh, einen gewissen Jörg Haider persönlich kennenzulernen. Der rauchte ebenfalls Pfeife, und der hinterließ bei mir einen kuriosen, eigenartig benebelten Eindruck, was allerdings am wenigsten an seiner Pfeife gelegen haben dürfte.