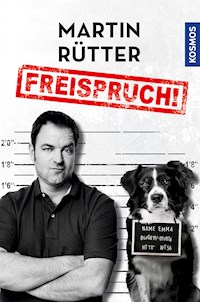16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Furcht vor Donnergrollen, Panik beim Auto- oder Bahnfahren, Angst vor Artgenossen – ängstliche Hunde liegen Martin Rütter besonders am Herzen, denn diese leiden oftmals still und ihre Menschen mit ihnen. Auch Hunde aus dem Tierschutz, die mit einem neuen Lebensumfeld konfrontiert werden, sind häufig davon betroffen. Zusammen mit Co-Autorin Andrea Buisman erklärt der Hundeprofi, wie man die ersten Anzeichen von Angst und Unsicherheit erkennt, welche Ursachen dahinterstecken und welche Möglichkeiten es gibt, seinem Hund mehr Selbstvertrauen und damit mehr Lebensqualität zu geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Stattdessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
— Angst bei Hunden
mit Martin Rütter
© Klaus Grittner/Kosmos
Entstehung von Angst und Trauma
Die Zeiten, in denen Tieren jegliches Gefühlsleben abgesprochen wurde, sind zum Glück vorbei. Auch Tiere können Emotionen wie Freude und Leid erleben.
Hunde bieten mit ihrer ausgeprägten Mimik besondere Möglichkeiten, tief in ihre „Seele“ zu blicken und zu erkennen, was gerade in ihrem Kopf vor sich geht. Es gehören nicht nur Freudenausbrüche und glückliche Momente zum Leben eines Hundes. Auch Aggressionen und Ängste spielen eine bedeutende und berechtigte Rolle. Wer unbekannten Situationen erst einmal ein wenig ängstlich bzw. vorsichtig entgegentritt, erhöht seine Chancen, gesund und unversehrt zu bleiben und letztendlich zu überleben. So macht ein Hund, der zum ersten Mal einen Igel am Wegesrand sieht und sich direkt mit einem Satz auf ihn stürzt, unmittelbar schmerzhafte Erfahrungen. Eine vorsichtige Annäherung wäre in diesem Fall sicher die bessere Alternative gewesen.
Ein gewisses Maß an Angst ist also durchaus wichtig und von der Natur sinnvoll eingerichtet – als Selbstschutz quasi. Aus großer Höhe in unbekannte Tiefe springen kann z.B. schnell das Leben kosten. Zum Problem wird Angst erst, wenn sie übertrieben ist und damit keine für das Lebewesen wichtige Funktion mehr erfüllt. Denn dann beeinträchtigt sie das „normale Leben“ und bereitet mehr Sorgen als Nutzen.
© Klaus Grittner/Kosmos
Angst, ein unangenehmes Gefühl
Angst beschreibt in erster Linie ein Gefühl, das als unangenehm empfunden wird. Es tritt immer dann auf, wenn man sich in einer Situation befindet, in der man lieber nicht sein möchte, jedoch keine Möglichkeit hat, sich zu entziehen. Angst entsteht zum einen, wenn ein Reiz oder eine Situation entweder als gefährlich eingestuft wird oder wenn man eine Situation gar nicht erst einschätzen und damit bewerten kann. Zum anderen entsteht Angst, wenn man mit einer Situation überfordert ist, mit ihr nicht umgehen kann (vgl. Feddersen-Petersen 2004, S. 85). Menschen, die mit einem Messer bedroht werden, stufen diese Situation ganz klar als gefährlich ein und bekommen deshalb „berechtigte“ Angst. Andere haben große Angst davor, vor einem Publikum zu referieren. Wirklich gefährlich ist dies im Grunde nicht, besagter Mensch stuft dies jedoch als angsteinflößend ein, weil ihm entsprechende Handlungsalternativen fehlen, um mit solch einer Situation adäquat und souverän umzugehen. Bei Hunden ist das nicht anders: Während sich der eine vor einem Mann fürchtet, der laut schreiend mit einem Stock in der Hand auf den Vierbeiner zuläuft – was objektiv als gefährliche Situation eingestuft werden kann –, möchte ein anderer nach dem Anblick eines Heißluftballons am Himmel am liebsten schon Reißaus nehmen. Hier ist die Gefahr nicht offensichtlich, die Angst scheint auf den ersten Blick also unbegründet zu sein.
Problem mit vielen Facetten
Angst ist ein sehr subjektives Phänomen. Während es für den einen Hund überhaupt kein Problem darstellt, über eine schmale Holzbrücke zu laufen, geht ein anderer erst gar nicht in die Nähe einer solchen Konstruktion. Der eine Vierbeiner schenkt dem Heißluftballon am Himmel keinerlei Beachtung, für einen anderen geht die Welt unter, selbst wenn sich der Ballon noch in großer Entfernung befindet. Für jemanden, der keine Angst hat, erscheinen solche subjektiven Angstauslöser oft lächerlich, schließlich handelt es sich doch nur um eine Holzbrücke, einen Heißluftballon, um ein Referat, das gehalten werden soll etc. Dem ängstlichen Hund bzw. Menschen ist allerdings nicht zum Lachen zumute.
Mit dem Gefühl der Angst gehen auch körperliche Symptome wie z.B. Zittern, schnelle Atmung oder gesteigerte Speichelbildung einher. Auch hier unterscheiden sich Mensch und Hund wenig voneinander. Die feuchten Hände vor dem Referat sind mit den Pfotenabdrücken auf dem Tierarzttisch zu vergleichen – der pure Angstschweiß.
© Klaus Grittner/Kosmos
Mischlingshündin Leni nähert sich vorsichtig Martin. Dieser wendet den Blick ab, um Leni nicht noch weiter zu verunsichern. Mit langem Hals schnuppert Leni an Martins Hand.
Definition Angst
Angst ist ein Begriff, der oft umgangssprachlich gebraucht wird. Genau genommen müsste man in den meisten Fällen von Furcht sprechen, denn Furcht bezeichnet eine spezifische Angst vor einem bestimmten Objekt oder Subjekt. Der Hund fürchtet sich also z.B. vor der Holzbrücke oder vor dem schreienden Mann. Von Angst spricht man dagegen bei diffuseren Situationen, die nicht genau eingeordnet werden können. Sie stellen eine unbestimmte Bedrohung dar, sind in gewisser Weise undurchschaubar wie z.B. die Angst vor Erdbeben oder Gewitter. Gerade weil der Begriff „Angst“ im Alltag oft synonym für „Furcht“ verwendet wird, schließen wir uns dieser umgangssprachlichen Formulierung im Folgenden an.
Phobien – wenn Ängste krankhaft werden
Als Phobie bezeichnet man eine Angst, die krankhaft und irrational ist. Kann man Ängste noch als durchaus funktional bezeichnen, da Angst wie bereits beschrieben auch eine Schutzfunktion haben kann, lässt sich bei einer Phobie ein Sinn, eine biologische Funktionalität, nicht entdecken. Denn eine abnorme, krankhafte und unkontrollierbare Furcht schützt nicht vor Gefahren, sondern macht das Leben schwieriger. Bei einer Phobie nimmt ein Lebewesen sogar Nachteile in Kauf. Ein Mensch mit einer Spinnenphobie würde also beispielsweise den ganzen Tag die Küche, in der er eine Spinne entdeckt hat, nicht mehr betreten, bis der Partner nach Hause kommt und die Spinne entfernt. Menschen besitzen bei einer Phobie Einsicht in die Irrationalität. Der Spinnenphobiker weiß also, dass seine Angst vor Spinnen eigentlich unbegründet ist, da Spinnen zumindest hierzulande keine Gefahr bedeuten. Diese Einsicht ist bei Hunden natürlich nur schwer nachweisbar. Dennoch können Hunde vermutlich genauso wie Menschen an Phobien leiden. Denn als was sollte man sonst z.B. die Angst eines Hundes vor Wolken bezeichnen, die den Hund so stark einschränkt, dass er sich bei bewölktem Himmel nicht mehr vor die Tür traut?
Erlernte Hilflosigkeit
Dauert Angst über einen längeren Zeitraum an oder tritt sie immer wieder auf, kann dies zu weiteren Gefühlen wie Resignation und Hilflosigkeit führen. Man nennt diesen Zustand auch „erlernte Hilflosigkeit“. „Erlernte Hilflosigkeit bezeichnet das Phänomen, dass Menschen und Tiere infolge von Erfahrungen der Hilf- oder Machtlosigkeit ihr Verhaltensrepertoire dahingehend einengen, dass sie als unangenehm erlebte Zustände nicht mehr abstellen, obwohl sie es (von außen betrachtet) könnten“ (Specht 2015, S. 30). Aufgestellt wurde diese Definition nach Versuchen mit Ratten. Eine Hälfte eines zweigeteilten Käfigs, in dem sich Ratten befanden, wurde unter Strom gesetzt. Die Ratten lernten schnell, in die andere Hälfte des Käfigs zu flüchten. In der nächsten Versuchsreihe wurde die Flucht der Ratten verhindert, die Ratten hatten über einen längeren Zeitraum keine Möglichkeit, den Stromschlägen auszuweichen. Dies führte dazu, dass die Ratten sich ihrem Schicksal ergaben und die Stromschläge ohne Reaktion über sich ergehen ließen. Glücklicherweise ist der Einsatz von Stromimpulsgeräten zur Hundeausbildung mittlerweile in Deutschland verboten. Denn nicht selten wurden Hunde z.B. für Jagdverhalten mithilfe von Stromschlägen korrigiert, ohne dass jedoch Alternativen oder ein Rückrufsignal, geschweige denn eine vertrauensvolle Beziehung zum Menschen mit Orientierung an diesem zuvor aufgebaut worden war. Diese Hunde hatten also keine Idee, was von ihnen erwartet wurde bzw. welches Verhalten unerwünscht war und daher korrigiert wurde. Da sich das Gerät am Hals des Hundes befand, konnte dieser weder durch Flucht noch durch einen Angriff der Korrektur entgehen. Nach mehreren Korrekturen bleiben solche Hunde dann zwar beim Menschen, zeigen jedoch deutliche Anzeichen erlernter Hilflosigkeit. Sie laufen neben dem Menschen her ohne jegliches Interesse an ihrer Umwelt, jegliche Lebensfreude und Interaktion fehlt. Allein schon aus diesem Grund ist das Training mit Starkzwangmethoden abzulehnen!
Erlernte Hilflosigkeit findet man bei Hunden heutzutage auch in ganz anderen Bereichen. Gut gemeinte Rettungsaktionen enden für Hunde aus dem Ausland häufig damit, dass sie bewegungslos in ihrer Box liegen und sämtliche Transportmaßnahmen nur noch über sich ergehen lassen.
© Klaus Grittner/Kosmos
Auch wenn ein Hund ruhig in der Box im Auto liegt, heißt das nicht, dass er sich darin wohlfühlt. Die weit aufgerissenen Augen und das starke Hecheln zeigen deutlich die Angst des Hundes.
Aus der Praxis
Mischlingsrüde Gustav wurde von der Straße gerettet und befindet sich nun in einer Transportbox in einem Auto. Da er weder an das Autofahren noch an eine Transportbox gewöhnt wurde, löst diese Situation Angst bei ihm aus. Da der Wagen durch sehr unebenes Gelände fährt, wird Gustav mal an die eine Wand der Box gedrückt, mal an die andere. Zudem ruckelt es so stark, dass es ihm schwerfällt, sein Gleichgewicht zu halten.
Kann Gustav nun aber Möglichkeiten finden, mit der angstauslösenden Situation umzugehen, kann die Angst abnehmen, bis sie überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Er kann beispielsweise bellen, um so auf sich aufmerksam zu machen, bis der Fahrer des Wagens anhält. Damit hat Gustav eine Verhaltensweise gefunden, sich Erleichterung in dieser Situation zu verschaffen – der Wagen steht, und das Ruckeln und Wackeln hört auf. Er kann aber auch so lange an der Tür der Box kratzen, bis sie sich öffnet und er aus dieser springen kann. Auch das ist eine Möglichkeit, sich aus der Situation zu befreien. Bestehen diese Möglichkeiten jedoch nicht, erlebt Gustav eine Hilflosigkeit, er hat keine Möglichkeit, die Situation mit eigenen Mitteln zu verändern bzw. zu bewältigen. Probiert er nun also verschiedene Dinge aus, um mit seiner Situation umzugehen, indem er bellt, fiept und kratzt, nichts davon führt jedoch zum Erfolg, weiß er irgendwann einfach nicht mehr weiter.
Traumata – wenn die Psyche leidet
Ein weiterer Begriff, der oft im Kontext mit Angst fällt, ist die Bezeichnung „Trauma“. Das Wort Trauma kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Wunde“ oder „Verletzung“. Beim medizinischen Trauma erfolgt eine Verwundung bzw. Verletzung eines Organismus durch eine Gewalteinwirkung von außen. Der Begriff bezeichnet nicht nur die Verletzung selbst, sondern auch die indirekten Auswirkungen der Verletzung auf den Organismus wie z.B. starken Blutverlust. Neben dem medizinischen Trauma gibt es aber auch das psychologische Trauma, auf das in diesem Buch Bezug genommen wird. Ein psychologisches Trauma bezeichnet entsprechend eine seelische Verletzung, die durch ein traumatisierendes Erlebnis hervorgerufen wurde. Dabei kann es sich z.B. um eine Naturkatastrophe, Krieg, Folter oder auch Vergewaltigung handeln. Ein Trauma entsteht also aus einer Situation mit extremer psychischer Belastung, für die der Betroffene – Hund wie Mensch – keine adäquate Bewältigungsstrategie kennt. Dabei können auch weniger dramatische Ereignisse wie persönliche Angriffe, andauerndes Mobbing oder Trennungen, zu einem psychischen Trauma führen, und zwar immer dann, wenn das Gefühl absoluter Hilflosigkeit entsteht. Bei Hunden kann ein Trauma z.B. durch plötzliches Erschrecken, Unfälle, physische und psychische Misshandlungen, wozu auch erzwungene Sexualität gehört, dauerhaften Entzug sozialer Zuwendung und zu guter Letzt auch durch unsachgemäßen Einsatz von Trainingsmitteln wie z.B. Disc-Scheiben oder Wurfketten erfolgen.
Anonyme Korrekturen
Immer wieder liest man in Erziehungsratgebern für Hunde, dass diese bei unerwünschtem Verhalten, wenn der Hund z.B. Essen vom Tisch klaut, durch eine anonyme Korrektur bestraft werden sollen. Der Hund wird dabei in Versuchung geführt, indem ein Leckerbissen auf dem Tisch drapiert wird. Direkt daneben befinden sich mit Steinen gefüllte Rappeldosen oder zu einem wackeligen Turm aufgebaute Plastikschüsseln. Der Mensch verlässt nun den Raum oder das Haus. Versucht der Hund jetzt den Leckerbissen vom Tisch zu schnappen, fallen die Dosen oder Schüsseln mit lautem Geklapper herunter. Der Hund soll durch diesen Schreck so beeindruckt sein, dass er den Leckerbissen liegen lässt und auch künftig keine Lebensmittel mehr klaut. So weit die Theorie …
Die Praxis sieht jedoch meist ganz anders aus. Selbstbewusste und auf Reize bzw. Geräusche gut sozialisierte Hunde werden lediglich kurz zur Seite springen. Sie warten ab, bis der Lärm sich gelegt hat. Nun ist der Weg frei, weitere Objekte befinden sich ja nicht neben dem begehrten Leckerbissen, der jetzt problemlos verzehrt werden kann. In diesem Fall hat die anonyme Korrektur keine Auswirkung, der Hund lernt nicht, dass er Lebensmittel nicht klauen soll, er wird aber auch nicht traumatisiert. Hat man nun aber einen weniger selbstsicheren, reizempfänglichen bzw. schlecht an visuelle/akustische Reize gewöhnten Hund, wird dieser vermutlich stark erschrecken, wenn die Dosen oder Schüsseln herunterfallen. Tatsächlich kann dies dazu führen, dass ein solcher Hund nie wieder versucht, Lebensmittel vom Tisch oder der Küchenanrichte zu klauen. Eigentlich doch prima, könnte man meinen. Die Gefahr besteht jedoch darin, dass der Hund so stark erschrickt, dass dies eine Traumatisierung auslöst. Denn der Hund hatte in diesem Augenblick nicht mit einem so massiven Reiz gerechnet, er wird scheinbar „aus dem Nichts heraus“ angegriffen. Dies kann dazu führen, dass er sich im eigenen Zuhause, das eigentlich Sicherheit bieten und Geborgenheit vermitteln soll, nicht mehr sicher fühlt. Die Möglichkeit, dass hieraus ein Trauma entsteht, ist groß.
© Klaus Grittner/Kosmos
Ein Leberwurstbrötchen in einem Turm aus Schüsseln soll den Hund in Versuchung führen, vom Tisch zu klauen.
© Klaus Grittner/Kosmos
Der Bracco Italiano-Rüde Enno lässt sich nicht lange bitten. Sobald er allein ist, klettert er auf den Stuhl.
© Klaus Grittner/Kosmos
Enno lässt sich durch die herunterfallenden Schüsseln kaum beeindrucken und wird wieder nach Essen suchen.
Aus dieser Unsicherheit heraus kann sich eine generelle Angst vor dem Alleinbleiben entwickeln, da die unangenehme Erfahrung in dem Moment gemacht wurde, in dem sonst niemand zu Hause war. Vielleicht wird der Hund aber auch allgemein sehr schreckhaft. Für einen sehr umweltunsicheren Hund, der nur in seinem Zuhause entspannen kann, weil er sich dort sicher fühlt, wäre eine Verunsicherung nach eben beschriebenem Beispiel fatal. Er merkt, dass selbst in diesem letzten sicher geglaubten Fleckchen Erde Gefahren lauern. Dementsprechend muss er künftig auch hier auf der Hut sein, denn er weiß nicht, wann er wieder mit so unangenehmen Ereignissen zu rechnen hat. Die notwendigen Entspannungsphasen können nicht mehr stattfinden, der Hund leidet somit extrem.
Direkte Korrektur durch den Menschen
Viel sinnvoller ist daher bei dieser Problematik eine direkte Korrektur seitens des Menschen. Du legst dazu z.B. ein Brötchen auf den Tisch und wendest dich leicht ab. Versucht dein Hund nun, sich das Brötchen zu schnappen, drehst du dich um, fixierst deinen Hund und korrigierst ihn z.B. mit einem Schnauzgriff. Dabei fügst du ein deutliches „Nein“ oder „Lass es“ hinzu. Du benutzt zur Korrektur damit Signale, die dein Hund auch aus seiner Kommunikation mit Artgenossen kennt. Besitzt ein Hund einen Knochen, wird er diesen gegenüber einem anderen Hund durch Fixieren, lautes, tiefes Knurren und gegebenenfalls durch eine körperliche Korrektur verteidigen. Dein Hund weiß bei dieser Trainingsvariante aber genau, woher die Korrektur kam und vor allem wofür die Korrektur war. Er lernt, dass du es offensichtlich genauso wenig wie ein anderer Hund magst, wenn man dir dein Essen klaut. Und genauso wie unter Hunden üblich, kann der Anspruch auf eine Beute von dir auch aus einiger Distanz erhoben werden. Nur weil du vielleicht ein paar Schritte weggegangen bist, gibst du deinen Besitzanspruch auf das Essen nicht sofort auf. Lässt ein Hund jedoch Beute liegen und entfernt sich vollständig, gibt er sie damit automatisch für andere frei, er erhebt nicht weiter Anspruch darauf. Daher kann ein Hund nicht nachvollziehen, warum er Essen, das einfach so herumliegt, während du das Haus verlassen hast, nicht aufnehmen darf. Dass ein Hund keine Lebensmittel klaut, während sein Mensch anwesend ist, kann man ihm also problemlos beibringen. Tendiert dein Hund aber dazu, Nahrung „zu klauen“, wenn du nicht Zuhause bist, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit: Du musst viel ordentlicher werden und deine Nahrungsmittel, sowie alles, was dein Hund als essbar ansieht, sicher aufbewahren und wegräumen, bevor du das Haus verlässt.
© Klaus Grittner/Kosmos
Arjuna ist am Frühstücksbrötchen interessiert und überlegt, ob sie wohl einen Happen ergattern kann.
© Klaus Grittner/Kosmos
Ein fixierender Blick von Nicole genügt, um Arjuna zu korrigieren. Beschwichtigend wendet sie sich vom Brötchen ab.
Folgen eines Traumas
Unmittelbare Folge eines Traumas ist ein Nervenzusammenbruch, der, etwas fachlicher ausgedrückt, auch akute Belastungsreaktion genannt wird. Menschen wirken hierbei wie betäubt und führen Handlungen durch, die unangebracht oder vollkommen sinnlos erscheinen. Begleitet werden diese Reaktionen von allgemeinen Stresssymptomen wie z.B. Schwitzen, Zittern oder Herzrasen. Hunde neigen in diesen Momenten zu ähnlichen, scheinbar sinnlosen Handlungen. Sie führen Übersprunghandlungen aus, wie z.B. Sich-Kratzen, Ziellos-auf-dem-Boden-Schnuppern oder Gähnen. In Bezug auf körperliche Symptome sind dabei vor allem Zittern sowie Hecheln auffällig. Die darauf folgende Phase ist der Verarbeitung gewidmet, in der die Beschwerden abnehmen. Eine akute Belastungsreaktion dauert in der Regel nur wenige Stunden bis Tage, selten auch länger, es bedarf in der Regel keiner therapeutischen Behandlung.
Halten die Symptome jedoch länger als vier Wochen an, spricht man von einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), bei der es sich beim Menschen um eine therapiebedürftige Erkrankung handelt. Der Betroffene erinnert sich bei einer posttraumatischen Belastungsstörung immer wieder an das Ereignis, er erlebt es wiederholt. Außerdem werden Situationen vermieden, die dem belastenden Ereignis ähneln. Es werden Symptome allgemeiner psychischer Belastung gezeigt, wie z.B. Schlafstörungen, erhöhte Schreckhaftigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten oder starke Reizbarkeit. Ob ein Hund sich immer wieder an das Ereignis erinnert, wird man nur schwer feststellen können. Die übrigen Symptome lassen sich auch beim Hund feststellen. Hunde zeigen nach einem traumatischen Ereignis die Vermeidung ähnlicher Situationen sowie Symptome wie Schreckhaftigkeit oder Reizbarkeit. Auch das Unvermögen, sich längere Zeit zu konzentrieren, kann beim Training eines Hundes auffallen.
© Klaus Grittner/Kosmos
Beim Ausflug in den Park kann der drei Monate alte Dobermann Bentley viele Reize in Ruhe kennenlernen.
Entscheidend ist die Persönlichkeitsstruktur
Ob eine Situation für einen Hund traumatisierend wirkt, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Die Struktur der Persönlichkeit ist dabei entscheidend für die Erlebnisverarbeitung und nicht etwa die Situation, in der es zu dem Trauma kommt. Das bedeutet, dass man keine Wertigkeit von Traumaauslösern erstellen kann. So kann ein herunterfallender Kochtopfdeckel stärker traumatisieren als ein Angriff eines anderen Hundes – je nach Persönlichkeitsstruktur des Traumatisierten. Genauso gut kann ein Scheinangriff eines anderen Hundes sehr stark traumatisierend sein, obwohl es zu keinem Kratzer kam, sich die Hunde eventuell nicht einmal berührt haben. Die Heftigkeit des Erlebnisses entspricht keinesfalls objektiven Kriterien.
Was der eine Hund ohne Probleme wegsteckt, kann bei einem anderen starke Angstzustände auslösen.
Hierbei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Ein Hund, der sowieso schon skeptisch oder ängstlich ist, wird leichter bzw. schneller traumatisiert werden als ein Hund mit einem sehr souveränen Naturell. Aber auch das Alter muss berücksichtigt werden. So sind junge Lebewesen in der Regel schneller zu traumatisieren als Lebewesen im mittleren Lebensalter. Dabei ist vermutlich die vorhandene Erfahrung entscheidend. Wer bereits viele Erfahrungen gemacht und als nicht lebensbedrohlich abgespeichert hat, ist nicht so schnell zu traumatisieren. Beim Menschen hat man festgestellt, dass im Alter die Gefahr einer Traumatisierung wieder zunimmt. Das scheint auch nachvollziehbar, sind doch die Möglichkeiten, Situationen physisch oder psychisch zu bewältigen, im Alter geringer. Auch alte Hunde zeigen häufig Ängste, die nicht erklärbar sind. Doch noch ein weiteres Problem kann gerade bei Hunden im jungen Alter zu einer schnelleren Traumatisierung führen – ein Zuwenig an Reizen.
© Klaus Grittner/Kosmos
In einer guten Welpengruppe lernen die Welpen durch das gemeinsame Spiel viele verschiedene Rassen und Mischlinge sowie deren Verhaltensweisen kennen.
Verarbeitungsproblem von Reizen
Leider gibt es immer noch viele Hunde, die in ihren ersten Lebenswochen nur eine sehr begrenzte Umwelt erleben, da sie im Stall aufwachsen und so nicht mit alltäglichen Reizen konfrontiert werden, denen sie in ihrem späteren Leben ausgesetzt sind. Diese Reize können dann Angst auslösen, wenn der jetzt erwachsene Hund auf einmal mit ihnen konfrontiert wird. Es ist deutlich schwieriger und zum Teil sogar unmöglich, erwachsene Hunde mit allem vertraut zu machen, was sie bisher nicht kennengelernt haben. Dieses Zuwenig an Information in der wichtigen Welpenzeit kann also dazu führen, dass das ganz normale Lebensumfeld traumatisierend auf diese Hunde wirkt. Schon allein deshalb kann man gar nicht oft genug darauf hinweisen, wie wichtig die Auswahl eines seriösen Züchters und die Auswahl einer guten Welpengruppe sind.
Hunde, die ausschließlich im Zwinger gehalten werden, leiden auch unter einem Reizmangel, vor allem auf sozialer Ebene, der genauso traumatisierend sein kann. Selbst wenn ein Welpe daher in idealem Umfeld beim Züchter aufgewachsen ist, spielt also das weitere Erleben eine große Rolle. Verbringt der Hund den Rest seines Lebens im Zwinger, ohne die Möglichkeit, Reize zu erleben oder aber mit Artgenossen bzw. Menschen kommunizieren zu können, führt dieses Zuwenig an Reizen ebenfalls dazu, dass dieser Hund bereits von einem eigentlich alltäglichen Reiz schnell überfordert ist.
© Klaus Grittner/Kosmos
Wird ein Hund ausschließlich im Zwinger gehalten, führt diese Isolation oft zu Stress.
Das Problem liegt darin, dass diese Hunde nicht in der Lage sind, von einem Reiz auf andere zu generalisieren. Jeder Reiz muss neu erlernt und als positiv oder negativ abgespeichert werden! Ein schlecht sozialisierter Hund kann also lernen, dass er vor dem Nachbarn mit Gehhilfe, dem er immer im Treppenhaus begegnet, keine Angst haben muss. Trifft er aber unten auf der Straße einen anderen Mann mit Gehhilfe, muss er erneut lernen, dass auch diese Person keine Gefahr für ihn darstellt. Es gelingt diesen Hunden oft nicht, von der einen auf die andere Situation zu schließen. Somit löst jede neue Situation ein Problem aus, da sich diese Hunde nicht oder nur schlecht anpassen können. Sie gelten oft als sehr scheu, sind aber im Grunde genommen traumatisiert.
© Klaus Grittner/Kosmos
Obwohl Greyhound Carl in seinem Leben nicht viel kennengelernt hat, geht er offen auf Menschen zu.
Unterschiedliche Traumata
Es wird deutlich, dass es verschiedene Arten von Traumata gibt. Eine Rolle spielt dabei auch die Länge der traumatisierenden Situation bzw. eine Wiederholung. Eine Traumatisierung, die durch ein kurzes, einmaliges Erlebnis verursacht wurde, wird dabei als Typ-I-Trauma bezeichnet. Typ-II-Traumata werden dagegen durch länger andauernde bzw. häufig sich wiederholende Ereignisse ausgelöst, wie es z.B. im Krieg oder bei Missbrauch der Fall ist.
Auswirkungen auf die Gesundheit
Die Auswirkungen eines einmaligen traumatischen Erlebnisses können mit der Zeit schwächer werden; Dauertraumata führen dagegen zu einer chronischen Beeinträchtigung, die sich unter anderem in selbstschädigendem Verhalten zeigen kann (vgl. Nathan 2000, S. 30).
Relativ häufig lecken sich Hunde die Pfoten oder andere Körperstellen wund, zupfen sich Fellbüschel aus, beknabbern sich bis hin zu blutigen Wunden oder rupfen sich Krallen und Pfotenballen komplett heraus. Oft genug kann der Tierarzt keine Ursachen wie Milben, Hautallergien, Futterunverträglichkeiten oder Ähnliches, das zu diesem Verhalten führt, finden. Es besteht weiterhin die Annahme, dass traumatischer Stress zu körperlichen Krankheiten führen kann. Es werden vor allem Herzinfarkt, Infektionskrankheiten, chronische Darmentzündungen oder andere Schmerzsyndrome genannt (vgl. Nathan 2000, S. 30), da der Hund auch außerhalb der Traumasituation leidet.
Soziale Unterstützung
Bei der Behandlung von Traumata beim Menschen weiß man, dass eine stabile Bezugsperson eine wichtige und bedeutende Hilfe für den traumatisierten Menschen ist. Die Unterstützung durch das soziale Umfeld kann einen positiven Einfluss auf die Behandlung einer posttraumatischen Belastungsstörung haben. Auch wenn ein Hund nicht über seine traumatischen Erlebnisse sprechen kann, ist eine vertrauensvolle Mensch-Hund-Beziehung, in der der Hund sich sicher fühlen kann, genauso einer der wichtigsten Punkte bei der Behandlung von Traumata.
© Klaus Grittner/Kosmos
Carl lebt noch nicht lange in Deutschland, vieles bereitet ihm Stress. In kleinen Schritten muss er sich nun an sein neues Leben, mit vielen unbekannten Reizen, gewöhnen.
Wichtig
Unterstützung ist wichtig!
Während Angst bzw. Furcht in Maßen sinnvoll und nützlich sein kann, sind es die extremen Ausprägungsgrade davon und Traumata nicht. Hier liegt es an dir, deinen Hund beim Umgang mit Angst und Trauma zu unterstützen.
Auslöser von Traumata erkennen
In der Regel gibt es ein einschneidendes Ereignis, das das Trauma verursacht. In Bezug auf den Hund liegt das Problem jedoch darin, dass uns Menschen dieses Ereignis nicht immer bekannt ist. Viele Hunde werden erst im erwachsenen Alter übernommen, über ihre Vorgeschichte ist nichts bzw. nur wenig bekannt. Doch da traumatische Erlebnisse nicht grundsätzlich wirklich gefährlich sein müssen, kann es auch passieren, dass wir unmittelbar dabei sind, das Ereignis jedoch als harmlos einstufen. Erst am veränderten Verhalten unseres Hundes, häufig auch erst viel später, wird deutlich, dass eine Traumatisierung stattgefunden hat.
Aus der Praxis
Ein Hund, der beim Agilitytraining auf dem Steg ins Rutschen gekommen ist, erlitt eine Traumatisierung, da er keine Kontrolle mehr über seine Pfoten hatte. Da es sich dabei jedoch lediglich um ein paar Zentimeter handelte, es also keinen dramatischen Vorfall gab, fiel seinem Menschen dieses Ereignis gar nicht auf. Das Agilitytraining wurde daher nach diesem Lauf beendet. Erst eine Woche später, als der Hund erneut über den Steg laufen sollte, verweigerte dieser die sonst zuverlässig ausgeführte Übung, er zeigte deutliche Angst vor dem Steg. Erst nach längerem Überlegen wurde klar, dass der Hund offensichtlich beim letzten Training, an dem es zum Abend hin kalt und feucht wurde, auf dem Steg ins Rutschen gekommen sein musste. Da das ängstliche Verhalten des Hundes bis zum Lebensende bestehen blieb, trotz eines zwei Wochen nach dem Vorfall begonnenen Trainings und obwohl der Hund bis zu diesem Zeitpunkt, also über zwei Jahre lang, sicher und problemlos über den Steg gelaufen war, kann man hier mit Sicherheit von einer Traumatisierung sprechen.
Im hier beschriebenen Beispiel konnte der Auslöser für das Verweigern und das ängstliche Verhalten des Hundes gefunden werden. Nicht immer jedoch gelingt dies so problemlos, denn der Hund kann seine Ängste nicht aussprechen. Gerade dann, wenn viele unterschiedliche Faktoren mit der Situation, in der die Traumatisierung erfolgte, verknüpft sind, ist es oftmals für uns Menschen im Nachhinein nicht mehr möglich, diese als Auslöser zu erkennen.
Meideverhalten
Wurde ein Hund beim Spaziergang im Park von einem anderen Hund attackiert, kann dieses Erlebnis traumatisch gewesen sein. Begegnet der attackierte Hund dem anderen erneut, fängt er an zu hecheln, zu zittern und möchte sich am liebsten in Luft auflösen bzw. sich irgendwie aus dieser Situation entfernen. Meist führt das dazu, dass ein großer Bogen um den anderen Hund gelaufen wird. Ein solches Verhalten wird auch als Meideverhalten bezeichnet.
Viele Menschen bestärken Hunde, die Meideverhalten zeigen. Hat ein Hund Angst vor anderen Hunden, weicht man künftig auf dem Spaziergang anderen Hunden in einem großen Bogen aus. Als erste Strategie ist das zunächst einmal auch in Ordnung. Allerdings kann ein Hund so seine Angst niemals überwinden, da ein Hund, der Meideverhalten zeigt, sich nicht mit dem Angstauslöser auseinandersetzt. Im Umgang mit der Angst kann die Unterstützung des Meideverhaltens also immer nur eine „Erste-Hilfe-Maßnahme“ sein. Erst mithilfe einer gezielten Verhaltenstherapie wird sich die Angst verringern und der Hund lernt, seine Angst zu überwinden.
Hat der Hund die Attacke des anderen Hundes aber nicht nur mit diesem verknüpft und in seinem Kopf abgespeichert, sondern auch noch mit anderen Reizen, die in dieser Situation gerade präsent waren, wie z.B. dem Klingeln eines vorbeifahrenden Fahrrads, spielenden Kindern oder dem Geruch von Blumendünger, kann es also durchaus sein, dass besagter Hund in Zukunft auch beim Geruch von Blumendünger Meideverhalten zeigt, einfach nur, weil der Geruch die Erinnerung an die Attacke auslöst. Für das Training bzw. die Therapie ist es also wichtig, dass die Trauma auslösende Situation so gut wie möglich analysiert wurde. Was ist bzw. wie genau ist es passiert? Wer oder was war noch dabei? Leider lässt sich nicht immer alles rekonstruieren.
Mehrere Faktoren können für die Entstehung von Angst ursächlich sein. Häufig ist nicht klar abzugrenzen, was zu wie viel Prozent Schuld am ängstlichen Verhalten hat. Waren es physiologische Gründe, liegt eine genetische Prädisposition vor oder sind doch Lernerfahrungen bzw. eine ungenügende Prägung und Sozialisierung Auslöser ängstlichen Verhaltens? Oftmals greifen die Ursachen auch ineinander und sind nicht klar voneinander zu trennen.
© Klaus Grittner/Kosmos
Mischlingshündin Leni hat große Angst vor fremden Männern. Sie nähert sich Martin nur, weil dieser mit dem Rücken zu ihr sitzt und sie nicht anschaut.
Auslöser erkennen
Es gibt viele verschiedene Ursachen, die zu Angstverhalten beim Hund führen. Wie zuvor beschrieben, spielen häufig mehrere Faktoren eine Rolle, sodass die Angst nicht auf einen einzigen Auslöser zurückgeführt werden kann.
Zu begreifen, warum ein Hund Angst hat, ist der erste Schritt zu einer erfolgreichen Angsttherapie. So können gezielt Trainingsschritte ausgewählt werden, die für den betreffenden Hund ideal sind. Doch auch bei sogenannten „Secondhand-Hunden“, bei denen die Vorgeschichte oft unbekannt ist, oder bei denjenigen, die keine offensichtliche Ursache für ihre Angst erkennen lassen, ist es hilfreich, sich über die eventuellen Entstehungsmöglichkeiten Gedanken zu machen. Häufig wird einem erst dann bewusst, in welcher Situation die Angst entstanden sein könnte.
Leider lässt sich nicht bei jedem Hund genau sagen, woher die Angst ursprünglich kommt. Weiß man jedoch um die verschiedenen Entstehungsmöglichkeiten, kann man künftige Situationen besser einschätzen und dementsprechend vermeidend tätig sein.
© Klaus Grittner/Kosmos
Die neun Jahre alte Jack Russell-Hündin Luna zeigt auf einmal unerklärliche Angst auf dem Spaziergang. Vor einer Therapie wird sie vom Tierarzt gründlich durchgecheckt.
Physiologische Gründe für die Entstehung von Angst
Zwar sind physiologische Gründe als Ursache für Angstverhalten beim Hund nicht extrem häufig, jedoch sollte diese Möglichkeit vor jeder Therapie immer erst einmal abgeklärt werden. So können etwa Vitaminmangelerscheinungen, Hormonstörungen oder organische Gehirnerkrankungen zu ängstlichem Verhalten führen, genauso wie Schmerzen, die der Hund empfindet.
So wird z.B. der Neurotransmitter Serotonin aus der Aminosäure Tryptophan und einigen Vitamin-B-Komplexen gebildet. Serotonin gilt als „Glücksbotenstoff“ und beeinflusst unter anderem die Stimmungslage. Ein zu niedriger Serotoninspiegel kann z.B. zu Ängsten führen. Sind nun Vitamine nicht in ausreichender Menge vorhanden, weil sie über die Nahrung nur unzureichend zugeführt werden oder vom Hund nicht richtig aufgenommen bzw. verwertet werden können, kann es zu einem Serotoninmangel kommen. Vitaminmangelerscheinungen zeigen sich allerdings erst nach längerer Zeit, es muss also bereits länger eine Unterversorgung vorherrschen bzw. eine Verdauungsstörung im Verdauungstrakt vorliegen. Wurden Hunde früher vorwiegend mit Fertigfutter ernährt, muss diesem Punkt heutzutage eine größere Bedeutung beigemessen werden, da immer mehr Menschen das Futter ihres Hundes selbst zusammenstellen. Wer seinen Hund mit Frischfutter ernähren möchte, sollte sich daher zuvor intensiv mit dem Bedarf des Hundes und Besonderheiten in der Fütterung auseinandergesetzt haben. Hunde können Gemüse z.B. nur dann verwerten, wenn durch Erhitzen oder Zerkleinern die Pflanzenzellen zerstört wurden. Wer dem Hund eine rohe Möhre im Ganzen füttert, sorgt zwar für Beschäftigung und eventuell auch für Kaugenuss, jedoch nicht für eine entsprechende Versorgung mit Vitaminen.
Schilddrüsenunterfunktion
In Bezug auf Hormonstörungen tritt bei Hunden häufig eine Schilddrüsenunterfunktion auf. Hierbei kann es je nach Ausprägung unter anderem zu übersteigerter Aggression gegen Mensch und Tier aufgrund einer erhöhten Reizbarkeit, stark verminderter Stressresistenz sowie übersteigertem Angstverhalten kommen. Diese Symptome zeigen sich sehr häufig bereits in jungem Alter. Die Behandlung ist in diesem Fall recht einfach, da nur die fehlenden Schilddrüsenhormone verabreicht werden müssen. Dazu muss der Tierarzt lediglich Blut abnehmen und die Schilddrüsenwerte im Labor bestimmen lassen. Die Therapie muss zwar lebenslang durchgeführt werden, gut eingestellt können diese Hunde jedoch ein beschwerdefreies Leben führen. Anders sieht es bei einer Schilddrüsenüberfunktion aus, die beim Hund jedoch eher selten ist. Ursache hierfür ist meist ein Tumor an der Schilddrüse.
Tumoren und Gelenkerkrankungen
Tumoren im Gehirn können ebenfalls Ursache für unerklärliches Angstverhalten des Hundes sein. Eine organische Gehirnerkrankung kann aber auch aus einer Gehirnerschütterung oder einer Hirnhautentzündung resultieren. Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule oder in den Gelenken führen ebenfalls oft zu übersteigertem Angst- und Aggressionsverhalten. Ein Hund, dem jede Bewegung weh tut, wird diese Schmerzen unter Umständen mit bestimmten Situationen verbinden und künftig schon im Vorhinein Angstverhalten zeigen. Hat ein Hund Probleme mit der Wirbelsäule, sodass er Schmerzen beim Bürsten hat, wird er künftig vermutlich schon Meideverhalten zeigen, wenn man die Bürste nur in die Hand nimmt.
Bestehen auch nur minimale Zweifel an der physischen Gesundheit deines Hundes, ist es ratsam, einen Tierarzt aufzusuchen. Bei jeder Angsttherapie sollte dein Hund zudem tierärztlich durchgecheckt werden, hier ist zuerst einmal eine Blutuntersuchung wichtig und die Überprüfung der Beweglichkeit von Gelenken, Wirbelsäule etc. sowie des Herz-Kreislauf-Systems.
Vererbung, die Rolle der Gene
Die Diskussion darüber, welche Verhaltenselemente vererbt oder erst durch Lernerfahrungen erworben wurden, betrifft das Thema Angst genauso wie alle anderen Reaktionsmöglichkeiten auf bestimmte Situationen. Traut sich der Hund nicht zu einem auffällig gekleideten Menschen, weil er keine oder schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht hat – sein Verhalten also auf Lernerfahrungen beruht – oder weil er von Geburt an per se ein ängstlicher Hund ist, was in diesem Fall für eine genetische Ursache sprechen würde?
Da das Phänomen der Angst sehr komplex ist, wurde bisher noch keine genau definierte Anlage im Erbgut gefunden, die für Angst verantwortlich wäre. Es gibt also leider nicht „das eine Gen“, das Angstverhalten verursacht und auf das dann züchterisch Einfluss genommen werden kann. Zudem wäre es auch nicht anzuraten, einen Hund ohne jegliches Angstverhalten zu züchten, da Angst durchaus sinnvoll und zum Teil auch überlebensnotwendig ist (siehe hier). Betrachtet man jedoch die unterschiedlichen Hunderassen insbesondere in Bezug auf die Ausprägung von Angstverhalten, fallen deutliche Unterschiede auf. Und selbst innerhalb einer Rasse findet man in bestimmten Linien eine besondere Anfälligkeit für ängstliches Verhalten. Natürlich kommt hierbei auch wieder das Argument des erlernten Verhaltens zum Tragen, denn die Mutterhündin ist ihren Welpen ein Vorbild. Reagiert sie also ängstlich auf Besucher, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Welpen künftig ebenfalls auf Besucher mit Skepsis reagieren, sehr groß.
© Klaus Grittner/Kosmos
Viele Straßenhunde aus dem Süden kommen mit den vielen Reizen hierzulande nicht zurecht.
© Klaus Grittner/Kosmos
Podenco-Mix Milo ist im Alltag häufig überfordert. Ein fremder Mann ist für ihn eine Bedrohung.
Verschiedene Rassen und ihre Aufgaben
Während beispielsweise ein „typischer“ Rottweiler oder Großer Schweizer Sennenhund eine vorbeifliegende Plastiktüte auf dem Spaziergang kaum registriert und sich entspannt anderen Dingen widmet, läuft ein „typischer“ Bearded Collie einen großen Bogen um das flatternde Objekt. Der unterschiedliche Umgang der Hunde mit ein und derselben Situation liegt unter anderem an ihrer unterschiedlichen Zuchtgeschichte.
Rottweiler bzw. Große Schweizer Sennenhunde wurden dafür gezüchtet, auf dem Hof aufzupassen und die Kuhherden voranzutreiben. Allein deswegen dürfen diese Hunde nicht allzu schreckhaft und sensibel sein. Bei diesem Größen- und Gewichtsunterschied zwischen Kuh und Hund kann es schon einmal passieren, dass die beiden unsanft zusammenstoßen. Ein Hund, der vor Panik gleich weglaufen würde, wäre hier total fehl am Platz. Es handelt sich also um relativ robuste Hunde, die nicht so schnell zu beeindrucken sind. Auch nehmen sie körpersprachliche Signale, zumindest vom Menschen, nicht so ernst; sie selbst kommunizieren auch eher grob. Für die Funktion, für die sie gezüchtet wurden, sind sie somit jedoch optimal ausgerüstet.
© Klaus Grittner/Kosmos
Der Große Schweizer Sennenhund Cooper folgt Sarah gelassen an der Leine. Selbst eine plötzlich herbeigewehte Plastiktüte kann ihn nicht aus der Ruhe bringen.
Aber auch der Bearded Collie, der zur Kategorie der Hütehunde gehört, ist für seine Arbeit passend ausgestattet. Er soll eine Herde, in der Regel eine Schafherde, zusammenhalten, indem er die Schafe umkreist und sie dabei fixiert. Bricht ein Schaf aus der Herde aus, ist es die Aufgabe des Bearded Collies, dieses wieder zurück zur Gruppe zu bringen. So ist der Bearded Collie also darauf bedacht, auf kleine Veränderungen in seiner Umwelt schnell zu reagieren. Bei großen Herden ist es gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten. Da ist es von Vorteil, wenn jede Kleinigkeit, die sich verändert, direkt auffällt. Diese starke Reizempfänglichkeit trägt jedoch dazu bei, dass diese Hunde in der Regel schreckhafter und damit schneller zu traumatisieren sind.