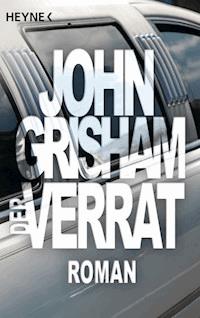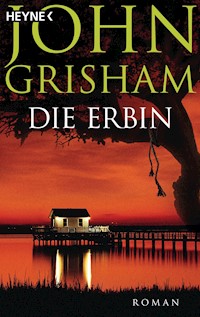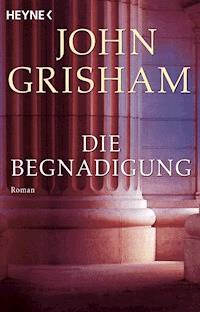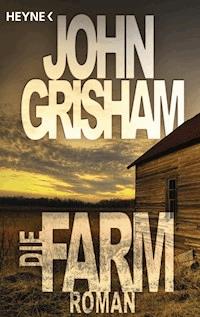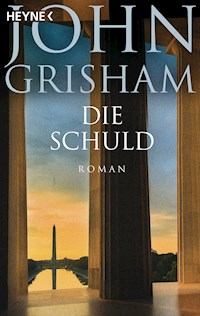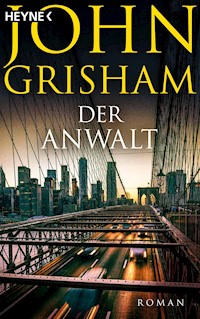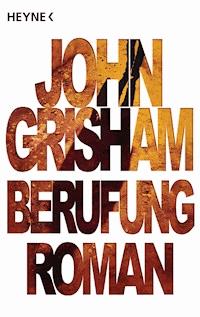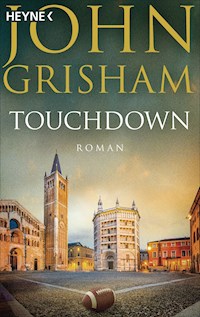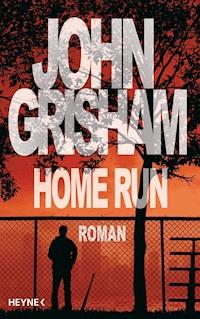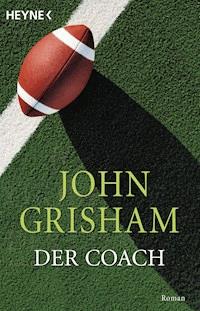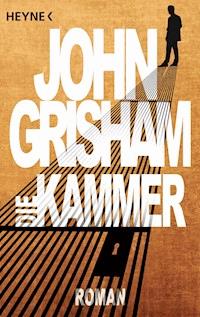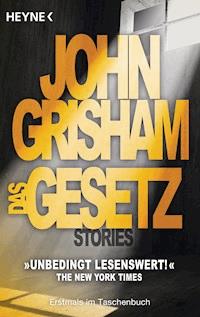9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jedes Unrecht hat seinen Preis
Als New Yorker Anwältin hat es Samantha Kofer binnen weniger Jahre zu Erfolg gebracht. Mit der Finanzkrise ändert sich alles. Samantha wird gefeuert. Doch für ein Jahr Pro-Bono-Engagement bekommt sie ihren Job zurück. Samantha geht nach Brady, Virginia, einem 2000-Seelen-Ort, der sie vor große Herausforderungen stellt. Denn anders als ihre New Yorker Klienten, denen es um Macht und Geld ging, kämpfen die Einwohner Bradys um ihr Leben. Ein Kampf, den Samantha bald zu ihrem eigenen macht und der sie das Leben kosten könnte.
Samantha Kofer, ambitionierte Anwältin bei einer der größten Kanzleien in New York, wird kurz nach dem Untergang der US-Investmentbank Lehman Brothers von ihrem Job freigestellt. Im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen, die von einem auf den anderen Tag auf der Straße stehen, bietet man ihr einen Deal an: Wenn sie für ein Jahr ohne Gehalt bei einer Non-Profit-Organisation arbeitet, behält sie ihren Job. So verschlägt es Samantha nach Brady, einem kleinen Ort in den Bergen Virginias, wo sie bei einer Beratungsstelle für kostenlosen Rechtsbeistand anheuert. Anfangs noch etwas unbeholfen in der ungewohnten Umgebung, entwickelt Samantha bald ein Gespür für die Nöte der Einwohner Bradys. Menschen, die auf den umliegenden Kohlefeldern jahrelang Schwerstarbeit geleistet haben und nun, ausgebrannt oder erkrankt, von den Kohleunternehmen im Stich gelassen werden. Der tragische Fall eines Arbeiters, der von Elend und Krankheit so gezeichnet ist, dass ihm nur noch wenige Monate zu leben bleiben, lässt Samantha schließlich über sich hinauswachsen. Gemeinsam mit einem befreundeten Anwalt nimmt sie den Kampf gegen die Kohlemagnaten auf und schreckt auch dann nicht zurück, als ihr Leben akut bedroht wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 684
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ZUMBUCH
Samantha Kofer, ambitionierte Anwältin bei einer der größten Kanzleien New Yorks, wird kurz nach dem Untergang der US-Investmentbank Lehman Brothers von ihrem Job freigestellt. Im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen, die von einem auf den anderen Tag auf der Straße stehen, bietet man ihr einen Deal an: Wenn Sie für ein Jahr ohne Gehalt bei einer Non-Profit-Organisation arbeitet, behält sie ihren Job. So verschlägt es Samantha nach Brady, einem kleinen Ort in den Bergen Virginias, wo sie bei einer Beratungsstelle für kostenlosen Rechtsbeistand anheuert. Anfangs noch etwas unbeholfen in der ungewohnten Umgebung, entwickelt Samantha bald ein Gespür für die Nöte der Einwohner Bradys. Menschen, die auf den umliegenden Kohlefeldern jahrelang Schwerstarbeit geleistet haben und nun ausgebrannt oder erkrankt von den Kohleunternehmen im Stich gelassen werden. Der tragische Fall eines Arbeiters, der von Elend und Krankheit so gezeichnet ist, dass ihm nur noch wenige Monate zu leben bleiben, lässt Samantha schließlich über sich hinaus wachsen. Gemeinsam mit einem befreundeten Anwalt nimmt sie den Kampf gegen die Kohlemagnaten auf und schreckt auch dann nicht zurück, als ihr Leben akut bedroht wird.
ZUMAUTOR
John Grisham hat 27 Romane, ein Sachbuch, einen Erzählband und vier Jugendbücher veröffentlicht. Seine Bücher wurden in 38 Sprachen übersetzt. Er lebt in Virginia und Mississippi.
JOHN
GRISHAM
ANKLAGE
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Kristiana Dorn-Ruhl,
Bea Reiter und Imke Walsh-Araya
In Erinnerung an Rick Hemba
1954–2013
Bis bald, Ace
1
Das Schlimmste war das Warten. Die Ungewissheit, die schlaflosen Nächte, die Magengeschwüre. Kollegen gingen einander aus dem Weg und verriegelten ihre Bürotüren. Sekretärinnen und Rechtsassistenten verbreiteten unter vorgehaltener Hand Gerüchte. Die Stimmung war gereizt, und jeder fragte sich, wen es als Nächsten treffen würde. Die Partner aus der obersten Führungsetage wirkten wie gelähmt und mieden jeden Kontakt mit ihren Untergebenen. Wer wusste schon, wem man bald das Messer in die Brust rammen musste.
Die Gerüchteküche brodelte. In der Abteilung Zivilprozesse habe es zehn Mitarbeiter erwischt – fast richtig, tatsächlich waren es nur sieben. Die Nachlassabteilung sei komplett aufgelöst worden, mitsamt der Leitung – das stimmte. Acht Partner aus der Kartellabteilung hätten sich zu einer anderen Kanzlei gerettet – falsch, zumindest bislang.
Die Atmosphäre war so vergiftet, dass Samantha das Büro möglichst oft verließ, um sich mit ihrem Laptop in ein Café in Lower Manhattan zu setzen und dort zu arbeiten. Einmal saß sie bei schönem Wetter auf einer Parkbank – es war Tag zehn nach dem Kollaps von Lehman Brothers – und betrachtete das hohe Gebäude weiter unten in der Broad Street mit der Hausnummer 110. Die gesamte obere Hälfte war von Scully & Pershing gemietet, der größten Anwaltskanzlei, die die Welt je gesehen hatte und die ihr Arbeitgeber war. Noch, zumindest, denn die Zukunft war alles andere als gewiss. Zweitausend Anwälte waren bei der Großkanzlei beschäftigt, in zwanzig Ländern, die Hälfte davon in New York, tausend Juristen zwischen der dreißigsten und der fünfundsechzigsten Etage. Wie viele von ihnen würden am liebsten aus dem Fenster springen? Samantha konnte es nicht einschätzen, aber sie war sicher nicht die Einzige. Die größte Kanzlei der Welt schnurrte zusammen wie ein Luftballon, nicht anders als die Konkurrenz. Die Welt der Großkanzleien war genauso in Panik wie die Hedgefonds, Investmentbanken, Endverbraucherbanken, Versicherungsgesellschaften, die Regierung in Washington und die Einzelhändler in der Main Street.
Tag zehn verging ohne Gemetzel, ebenso Tag elf. Am zwölften Tag kam ein Funke Optimismus auf, als Ben, einer von Samanthas Kollegen, das Gerücht mitbrachte, die Londoner Kreditmärkte lockerten angeblich ein wenig die Zügel, sodass unter Umständen bald wieder Gelder zu haben seien. Am späten Nachmittag jedoch war klar, dass an diesem Gerücht nichts dran war. Und so warteten sie weiter.
Zwei Partner leiteten bei Scully & Pershing die Abteilung Gewerbliche Immobilien. Der eine stand kurz vor dem Rentenalter und war bereits vor die Tür gesetzt worden. Der andere war Andy Grubman, vierzig, Bürohengst. Er hatte noch nie einen Gerichtssaal von innen gesehen. Als Partner bewohnte er ein schönes Büro mit Fernblick auf den Hudson, dessen Wasser er jedoch seit Jahren nicht mehr wahrgenommen hatte. Auf einem Regal hinter seinem Schreibtisch stand zwischen Diplomen und Auszeichnungen eine Sammlung Hochhausmodelle, die er »meine Türme« nannte. Sobald eines seiner Objekte fertiggestellt war, beauftragte er einen Bildhauer, eine Miniatur davon anzufertigen. Eine noch kleinere Version davon schenkte er dann den Mitgliedern »meines Teams«. In den drei Jahren, die sie für S&Parbeitete, hatte Samantha sechs »Türme« gesammelt. Mehr würden es nicht werden.
»Setzen Sie sich«, ordnete er an und schloss die Tür. Samantha nahm neben Ben und Izabelle Platz. Die drei Angestellten blickten beim Warten starr auf ihre Füße. Samantha verspürte den Drang, Bens Hand zu ergreifen, in Panik wie eine Gefangene vor einem Erschießungskommando. Grubman sank auf seinen Stuhl. Ohne sie anzusehen, bedacht, die Sache möglichst rasch hinter sich zu bringen, begann er, den Schlamassel darzulegen, in dem sie sich befanden.
»Wie Sie wissen, ist Lehman Brothers vor vierzehn Tagen kollabiert.«
Ach tatsächlich, Mr. Grubman! Finanzkrise und Kreditcrash haben die Welt an den Rand einer Katastrophe gebracht. Das weiß jeder. Aber wann haben Sie schon mal etwas Originelles von sich gegeben?
»Wir arbeiten an fünf Projekten, die alle von Lehman finanziert werden. Ich habe mit den Investoren gesprochen, sie werden alle Mittel abziehen. Drei weitere Aufträge waren in der Pipeline, zwei mit Lehman, einer mit Lloyd’s, aber, nun ja, alle Kredite liegen auf Eis. Die Banker haben sich verschanzt und trauen sich keinen Penny mehr herauszugeben.«
Ja, Mr. Grubman, auch das wissen wir. Das steht auf den Titelseiten der Zeitungen. Jetzt machen Sie schon, sonst springen wir.
»Der Vorstand hat sich gestern zusammengesetzt und einige Kürzungen beschlossen. Dreißig im letzten Jahr neu eingestellte Mitarbeiter werden freigestellt, manche davon fristlos gekündigt. Alle Neuen bleiben bis auf Weiteres in der Warteschleife. Die Nachlassabteilung wurde aufgelöst. Und, nun ja, es fällt mir nicht leicht, das zu sagen, aber auch unsere gesamte Abteilung wird aufgelöst, rausgekürzt, eliminiert. Wer weiß, wann wieder gebaut wird, wenn überhaupt jemals. Die Kanzlei ist nicht bereit, Sie weiter zu beschäftigen, solange die Welt auf Kreditangebote wartet. Verdammt, wir könnten auf eine schlimme Depression zusteuern. Das ist wahrscheinlich nur die erste Runde von Kürzungen. Tut mir leid für Sie. Tut mir wirklich leid.«
Ben sprach als Erster. »Dann sind wir fristlos entlassen?«
»Nein. Ich habe mich natürlich für Sie eingesetzt. Zunächst wollten die Sie umstandslos vor die Tür setzen. Ich muss Sie nicht daran erinnern, dass wir die kleinste Abteilung der Kanzlei sind und es uns im Moment wahrscheinlich am härtesten trifft. Ich konnte ihnen ein Arrangement abringen, das man als Beurlaubung bezeichnen kann. Sie gehen jetzt, kommen aber später vielleicht wieder.«
»Vielleicht?«, fragte Samantha. Izabelle wischte sich eine Träne ab, behielt jedoch die Fassung.
»Ja, ein dickes, fettes Vielleicht. Im Moment ist eben nichts sicher, Samantha. Wir tun, was wir können. In sechs Monaten könnten wir alle an der Suppenküche stehen. Sie kennen die Fotos von 1929.«
Ach, Mr. Grubman, die Suppenküche, ernsthaft? Als Partner haben Sie letztes Jahr 2,8 Millionen Dollar netto verdient, das war ein Durchschnittsgehalt bei S&P, die damit beim Nettoeinkommen pro Partner auf Platz vier der Rangliste rangierten. Was natürlich nicht gut genug war, jedenfalls nicht, bis Lehman die Luft ausging, Bear Stearns zusammenbrach und die Hypothekenblase platzte. Plötzlich sah der vierte Rang ziemlich gut aus, zumindest für den einen oder anderen.
»Was ist unter Beurlaubung zu verstehen?«, fragte Ben.
»Der Deal sieht so aus: Die Kanzlei behält Sie für die nächsten zwölf Monate unter Vertrag, aber Sie bekommen kein Gehalt.«
»Wie nett«, murmelte Izabelle.
Ohne auf sie einzugehen, fuhr Grubman fort: »Sie behalten Ihre Krankenversicherung, aber nur, wenn Sie für eine von uns ausgewählte gemeinnützige Organisation ehrenamtlich tätig werden. Die Personalabteilung stellt eine Liste geeigneter Vereine zusammen. Sie gehen jetzt, tun ein bisschen was Gutes, retten die Welt, in der Hoffnung, dass die Wirtschaft sich erholt, dann steigen Sie in einem Jahr wieder ein, ohne an Seniorität verloren zu haben. Sie werden zwar nicht mehr gewerbliche Immobilien betreuen, aber die Kanzlei wird eine Stelle für Sie finden.«
»Sind unsere Jobs denn nach der Beurlaubung garantiert?«, wollte Samantha wissen.
»Garantiert ist gar nichts. Ehrlich gesagt, niemand kann vorhersagen, wo wir in einem Jahr sein werden. Präsidentschaftswahlen stehen vor der Tür, Europa steuert auf den Abgrund zu, die Chinesen drehen durch, Banken kollabieren, Märkte brechen ein, niemand baut oder kauft. Das Ende der Welt ist nah.«
Einen Augenblick lang verharrten die vier stumm in der düsteren Stille von Grubmans Büro, gelähmt vom Gedanken an den bevorstehenden Weltuntergang. Schließlich erkundigte sich Ben: »Sie auch, Mr. Grubman?«
»Nein. Ich wurde versetzt. In die Steuerabteilung. Können Sie sich das vorstellen? Ich hasse Steuer. Aber es gab nur die Wahl zwischen Steuer oder Taxifahren. Immerhin habe ich Steuerrecht studiert, da dachten sie wohl, sie könnten mich verschonen.«
»Glückwunsch«, sagte Ben.
»Es tut mir so leid für Sie.«
»Nein, ich meine es ernst. Ich freue mich für Sie.«
»In einem Monat könnte ich auch auf der Straße stehen. Wer weiß?«
»Wann sollen wir gehen?«, fragte Izabelle.
»Sofort. Sie werden zuerst eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnen, dann packen Sie Ihre Sachen und gehen. Die Personalabteilung wird Ihnen eine Liste von gemeinnützigen Organisationen samt den erforderlichen Unterlagen mailen. Es tut mir so leid.«
»Hören Sie auf, das zu sagen«, sagte Samantha. »Nichts, was Sie sagen, kann uns helfen.«
»Das stimmt, aber es könnte noch schlimmer sein. Die meisten in Ihrer Situation haben keine Beurlaubung angeboten bekommen. Sie wurden einfach so gefeuert.«
»Verzeihen Sie, Mr. Grubman«, bat Samantha. »Ich bin ziemlich durcheinander.«
»Ist schon in Ordnung. Ich verstehe das. Sie haben jedes Recht, wütend und aufgebracht zu sein. Ich meine, Sie alle haben an Eliteuniversitäten studiert, und jetzt werden Sie abgeführt wie Einbrecher. Entlassen wie Fabrikarbeiter. Es ist schrecklich, einfach schrecklich. Einige der Partner haben angeboten, ihre Gehälter zu halbieren, um solche Dinge zu vermeiden.«
»Ich wette, das war eine kleine Gruppe«, bemerkte Ben.
»Ja, sehr klein, leider. Aber der Beschluss ist unumstößlich.«
An dem Vierertisch, den sich Samantha mit Izabelle und zwei weiteren Kollegen teilte, wartete eine Frau in schwarzem Hosenanzug und schwarzem Halstuch. Ben stand etwas weiter hinten im Flur. Die Frau bemühte sich um ein Lächeln. »Ich bin Carmen. Kann ich Ihnen behilflich sein?« Sie hielt einen offenen Karton, der nicht beschriftet war, damit niemand sehen würde, dass es sich um einen offiziellen Scully & Pershing-Behälter für die persönlichen Sachen von Mitarbeitern handelte, die beurlaubt worden waren. Oder gefeuert oder wie auch immer man es bezeichnen wollte.
»Nein, danke«, sagte Samantha bemüht höflich. Es gab keinen Anlass, patzig zu werden, denn Carmen tat nur ihre Arbeit. Samantha fing an, Schubladen zu öffnen und alle persönlichen Dinge herauszunehmen. In einem Fach fand sie ein paar Unterlagen von S&P. »Was ist damit?«
»Die bleiben hier«, erwiderte Carmen, die sie nicht aus den Augen ließ, als bestünde die Gefahr, dass Samantha Wertgegenstände klaute. In Wahrheit war ohnehin alles von Wert auf ihren Rechnern gespeichert, einem Standcomputer und dem Laptop, den sie fast überallhin mitnahm. Ein Laptop von Scully & Pershing, der ebenfalls hierbleiben würde. Sie hatte zwar von ihrem privaten Laptop aus Zugriff zu allen Daten, doch sie wusste, dass die Passwörter längst geändert waren.
Wie eine Schlafwandlerin räumte sie die Schubladen aus. Behutsam packte sie die sechs Mini-Hochhäuser ein, obwohl sie überlegte, ob sie sie nicht wegwerfen sollte. Izabelle kam und erhielt ihre persönliche Pappschachtel. Alle anderen – Anwälte, Sekretärinnen, Rechtsassistenten – hatten ganz plötzlich anderswo zu tun. Die Umstände hatten eine neue Etikette hervorgebracht: Wenn jemand seinen Arbeitsplatz räumt, soll er das in Ruhe tun können, ohne Zeugen, ohne Gaffer, ohne hohle Abschiedsworte.
Izabelles Augen waren rot und verschwollen, ganz offensichtlich hatte sie auf der Toilette geweint. »Ruf mich an«, flüsterte sie. »Lass uns heute Abend was zusammen trinken gehen.«
»Gern«, erwiderte Samantha. Sie stopfte alles, was noch übrig war, in den Karton, ihren Aktenkoffer und ihre voluminöse Designerhandtasche und folgte Carmen ohne einen Blick zurück durch den Flur. Auch beim Warten an den Aufzügen im achtundvierzigsten Stock sah sie sich nicht noch einmal um. Die Tür öffnete sich, die Kabine war zum Glück leer.
»Ich kann das nehmen«, sagte Carmen und deutete auf den Karton, der in ihren Armen bereits schwerer und unhandlicher zu werden schien.
»Nein«, wehrte Samantha ab und trat hinein. Carmen drückte die Taste zum Gebäudeausgang. Warum brauchte sie eine Eskorte? Je länger Samantha darüber nachdachte, umso wütender wurde sie. Sie wollte schreiend um sich schlagen, doch am liebsten hätte sie jetzt ihre Mutter angerufen.
Der Aufzug hielt im dreiundvierzigsten Stock, und ein gut gekleideter junger Mann trat ein. Er trug den gleichen Karton wie Samantha, außerdem eine große Tasche über der Schulter und eine lederne Aktentasche unter dem Arm. Sein Gesicht zeigte den gleichen Ausdruck von ängstlicher Verwirrung. Samantha war ihm im Lift schon begegnet, kannte ihn aber nicht näher. Was für eine Kanzlei. So riesig, dass die Angestellten bei der schauerlichen Weihnachtsfeier Namensschilder trugen. Ein Sicherheitsmann im schwarzen Anzug trat hinter ihn, und als alle sicher an Bord waren, drückte Carmen erneut die Taste ins Erdgeschoss. Im neununddreißigsten Stock hielt der Aufzug wieder, und Mr. Kirk Knight stieg ein, den Blick auf sein Handy gesenkt. Als sich die Tür geschlossen hatte, sah er auf und entdeckte die zwei Kartons. Er schnappte kurz nach Luft und verkrampfte die Schultern. Knight war Vorstandsmitglied und Seniorpartner der Abteilung Fusionen und Übernahmen. Unvermittelt mit zweien seiner Opfer konfrontiert, schluckte er und senkte den Blick. Dann betätigte er abrupt den Knopf für die achtundzwanzigste Etage.
Samantha war zu benommen, um ihn zu beschimpfen. Der Kollege hatte die Augen geschlossen. Nachdem der Aufzug gehalten hatte, eilte Knight davon. Während die Tür zuglitt, kam Samantha in den Sinn, dass die Kanzlei die Etagen dreißig bis fünfundsechzig angemietet hatte. Wieso war Knight in der achtundzwanzigsten ausgestiegen? Und interessierte sie das wirklich?
Carmen begleitete sie durch die Eingangshalle und zur Tür hinaus auf die Broad Street. Sie murmelte eine zaghafte Entschuldigung, doch Samantha reagierte nicht. Beladen wie ein Packesel, ließ sie sich ziellos im Strom der Fußgänger treiben. Dann fielen ihr die Zeitungsfotos von den Lehman- und Bear-Stearns-Mitarbeitern ein, die mit vollen Kartons auf dem Arm aus ihren Bürotürmen gehastet waren, als stünden die Gebäude in Brand und sie müssten um ihr Leben rennen. Auf einem Bild, einem großen Farbfoto auf der Titelseite vom Wirtschaftsteil der New York Times, war eine Lehman-Händlerin zu sehen gewesen, die mit Tränen auf den Wangen verloren auf dem Bürgersteig stand.
Doch solche Bilder waren längst Schnee von gestern. Samantha sah nirgendwo Kameras. An der Ecke Broad und Wall Street stellte sie den Karton ab und wartete auf ein Taxi.
2
In dem schicken Loft in SoHo, für das sie monatlich zweitausend Dollar Miete bezahlte, ließ Samantha Karton und Taschen fallen und warf sich auf das Sofa. Das Handy umklammernd, die Augen geschlossen, atmete sie tief durch, bis sie ihre Gefühle halbwegs im Griff hatte. Sie brauchte jetzt die aufmunternde Stimme ihrer Mutter, doch sie wollte nicht schwach und verwundbar klingen, wenn sie mit ihr sprach.
Ein Gefühl der Erleichterung überkam sie, als ihr plötzlich bewusst wurde, dass sie gerade eines Jobs enthoben worden war, den sie im Grunde gehasst hatte. Heute Abend um sieben Uhr würde sie vielleicht einen Film anschauen oder mit Freundinnen im Restaurant sitzen, aber mit Sicherheit nicht bei laufender Zeituhr im Büro schuften. Am Sonntag könnte sie aufs Land fahren, ohne einen Gedanken an Andy Grubman und seine Berge von Unterlagen für den nächsten superwichtigen Deal zu verschwenden. Das Firmenphone, dieses lästige kleine Gerät, das drei Jahre lang förmlich mit ihr verwachsen gewesen war, hatte sie abgegeben. Sie fühlte sich befreit und herrlich unbelastet.
Die Angst, die sie trotz allem empfand, gründete auf dem Verlust des regelmäßigen Einkommens und dem plötzlichen Karriereknick. Als Angestellte im dritten Jahr bekam sie hundertachtzigtausend Dollar jährlich Grundgehalt plus einen hübschen Bonus. Das war viel Geld, doch das Leben in New York verschlang auch viel. Die Hälfte ging für Steuern weg. Samantha besaß zwar ein Sparkonto, doch das pflegte sie nur halbherzig. Mit neunundzwanzig, als Single in New York, mit einer Stelle, die im folgenden Jahr mehr Grundgehalt abwarf als im aktuellen Jahr Gehalt plus Bonus – wozu da Geld auf die hohe Kante legen? Eine Freundin, mit der sie an der Columbia University Jura studiert hatte, war nach fünf Jahren bei S&P zur Juniorpartnerin avanciert und verdiente jetzt eine halbe Million im Jahr. Samantha hatte den gleichen Plan verfolgt.
Sie hatte aber auch zwei Freunde, die nach zwölf Monaten von der Tretmühle gesprungen waren und der Hölle von S&Pzufrieden den Rücken gekehrt hatten. Einer davon war jetzt Skilehrer in Vermont. An der Uni noch Herausgeber der Columbia Law Review, lebte er jetzt irgendwo an einem Fluss in einer Blockhütte und ging nur noch sporadisch ans Handy. In nur dreizehn Monaten war aus dem ehrgeizigen jungen Anwalt ein gestörter Sonderling geworden, der an seinem Schreibtisch schlief. Kurz bevor die Personalabteilung einschritt, bekam er einen Nervenzusammenbruch und zog aus der Stadt. Samantha dachte oft an ihn, meist mit einem Anflug von Neid.
Zu Erleichterung und Angst gesellte sich ein schlechtes Gewissen. Ihre Eltern hatten eine kostspielige Privatschule in Washington finanziert. Sie hatte an der Georgetown University Politologie studiert und mit Magna cum laude abgeschlossen. Das Jurastudium hatte sie mit Leichtigkeit durchlaufen und mit Auszeichnungen absolviert. Nach einem Referendariat am Bundesgericht hatte sie Stellenangebote von einem Dutzend Großkanzleien bekommen. Die ersten neunundzwanzig Jahre ihres Lebens waren von überwältigendem Erfolg und nur vereinzelten Niederlagen geprägt. So abserviert zu werden war niederschmetternd, aus dem Gebäude eskortiert zu werden erniedrigend. Es war mehr als nur ein kleiner Rückschlag in einer erfolgreichen Berufslaufbahn.
Einen gewissen Trost fand sie in der Statistik. Seit der Lehman-Pleite waren Tausende junger Juristen auf der Straße gelandet. Es heißt, geteiltes Leid sei halbes Leid, doch im Augenblick konnte sie wenig Mitgefühl aufbringen.
»Karen Kofer, bitte«, forderte sie ihr Smartphone auf, während sie regungslos auf dem Sofa lag, um ihren Atemrhythmus zu beruhigen. »Mom, ich bin’s«, sagte sie dann. »Sie haben es getan. Ich bin rausgeflogen.« Sie biss sich auf die Lippe und kämpfte mit den Tränen.
»Das tut mir so leid, Samantha. Wann?«
»Vor etwa einer Stunde. Es kam nicht wirklich überraschend, trotzdem ist es schwer zu fassen.«
»Ich weiß, mein Schatz. Es tut mir wirklich leid.«
In der letzten Woche hatten sie über kaum etwas anderes gesprochen als über eine womöglich bevorstehende Entlassung. »Bist du zu Hause?«, fragte Karen.
»Ja, und mir geht’s gut. Blythe ist bei der Arbeit. Ich habe es ihr noch nicht erzählt. Ich hab’s noch niemandem erzählt.«
»Tut mir so leid.«
Blythe war eine Freundin und ehemalige Studienkollegin von der Columbia, die für eine andere Großkanzlei arbeitete. Sie teilten die Wohnung, aber sonst nicht viel von ihrem Leben. Wenn man fünfundsiebzig Stunden die Woche arbeitete, blieb keine Zeit übrig, die man teilen konnte. Blythes Kanzlei ging es auch nicht besonders gut, und sie rechnete mit dem Schlimmsten.
»Mir geht’s gut, Mom.«
»Glaube ich nicht. Komm doch für ein paar Tage nach Hause.«
»Zuhause« war für Samantha ein eher abstrakter Begriff. Ihre Mutter hatte eine schöne Wohnung in der Nähe des Dupont Circle, und ihr Vater wohnte in Alexandria in einem kleinen Apartment am Fluss. Sie hatte noch nie länger als vier Wochen bei einem von beiden verbracht und hatte es auch nicht vor. »Mach ich«, erwiderte sie. »Aber nicht jetzt.«
Es entstand eine längere Pause. »Was hast du denn jetzt für Pläne, Samantha?«, fragte ihre Mutter schließlich leise.
»Ich habe keine Pläne, Mom. Im Augenblick stehe ich unter Schock und kann nicht mal über die nächste Stunde hinausdenken.«
»Ich verstehe. Ich wünschte, ich könnte bei dir sein.«
»Mir geht’s gut. Wirklich.« Das Letzte, was Samantha jetzt brauchte, war, dass ihre Mutter ständig in der Nähe war und sie mit wohlgemeinten Ratschlägen überschüttete.
»Unter welchen Bedingungen haben sie dich entlassen?«
»Die Kanzlei nennt es ›Beurlaubung‹. Der Deal ist, wenn wir ein oder auch zwei Jahre für eine gemeinnützige Organisation arbeiten, behalten wir unsere Krankenversicherung. Und wenn es wieder aufwärtsgeht, werden wir zurückgeholt, ohne dass wir durch die Fehlzeit Einbußen haben.«
»Klingt nach einem erbärmlichen Versuch, euch bei der Stange zu halten.« Herzlichen Dank für die deutlichen Worte, Mom ... Karen fuhr fort: »Warum hast du den Idioten nicht gesagt, sie sollen sich zum Teufel scheren?«
»Weil ich krankenversichert bleiben will, und außerdem finde ich es beruhigend zu wissen, dass es eine Chance auf Rückkehr gibt.«
»Du kannst doch überall einen Job finden.«
Da sprach mal wieder die erfolgreiche Regierungsangestellte. Karen Kofer war seit dreißig Jahren leitende Juristin im Justizministerium in Washington und hatte nie etwas anderes getan. Wie alle ihre Kollegen war sie umfassend geschützt. Was auch immer geschah – Wirtschaftsdepressionen, Kriege, Zahlungsunfähigkeit der Regierung, nationale Katastrophen, politische Umbrüche –, Karen Kofers Stelle und Gehalt waren unantastbar. Die lässige Arroganz, die viele alteingesessene Regierungsangestellte zur Schau stellten, war nicht verwunderlich. Wir sind kostbar, denn ohne uns geht nichts.
»Nein«, widersprach Samantha. »Im Moment gibt es einfach keine Jobs. Nur falls du davon noch nichts gehört hast, wir stecken in einer Finanzkrise, und eine Depression steht vor der Tür. Kanzleien setzen im großen Stil Leute vor die Tür und machen dann zu.«
»Ich bezweifle, dass die Dinge wirklich so schlecht stehen.«
»Ach, tatsächlich? Scully & Pershing hat gerade sämtliche Neueinstellungen auf Eis gelegt. Das bedeutet, rund ein Dutzend der besten Harvard-Absolventen hat gerade erfahren, dass die Stellen, die sie im September antreten wollten, nicht mehr existieren. Dasselbe gilt für Abgänger aus Yale, Stanford und Columbia.«
»Aber du bist so gut in deinem Beruf, Samantha.«
Versuch nie, mit einem Bürokraten zu diskutieren. Samantha atmete tief durch und wollte sich schon verabschieden, als ein dringender Anruf »vom Weißen Haus« hereinkam und Karen auflegen musste, nicht ohne zu versprechen, sofort zurückzurufen, sobald sie das Land gerettet habe. Okay, Mom, sagte Samantha. Ihre Mutter war immer für sie da, wenn sie sie brauchte. Sie war ein Einzelkind, was sich rückblickend als Segen erwies angesichts des Schlachtfelds, das ihre Eltern bei der Scheidung hinterlassen hatten.
Es war ein klarer, schöner Tag, jedenfalls was das Wetter anging, und Samantha verspürte das Bedürfnis, spazieren zu gehen. Sie lief durch SoHo und anschließend durch das West Village. In einem menschenleeren Café rief sie ihren Vater an. Marshall Kofer hatte früher Schadenersatzprozesse geführt, Spezialgebiet: Flugzeugabstürze. Er hatte eine aggressive, erfolgreiche Kanzlei in Washington geleitet und an sechs von sieben Tagen der Woche rund um die Welt in Hotels übernachtet, im Zusammenhang mit seinen Prozessen oder auf der Jagd nach neuen Fällen. Er verdiente damit ein Vermögen, das er mit vollen Händen ausgab, und Samantha war als Teenager sehr wohl bewusst gewesen, dass ihre Familie weit mehr besaß als viele ihrer Mitschüler in ihrer Washingtoner Privatschule. Während ihr Vater einen hochkarätigen Prozess nach dem anderen führte, kümmerte sich ihre Mutter um sie, wobei sie beharrlich die eigene Karriere im Justizministerium vorantrieb. Wenn ihre Eltern Streit hatten, bekam Samantha nichts davon mit. Ihr Vater war ohnehin nie zu Hause. Irgendwann, niemand erfuhr jemals, wann genau, tauchte eine junge, hübsche Rechtsassistentin auf, und Marshall ließ sich auf das Abenteuer ein. Aus dem Techtelmechtel wurde eine dauerhafte Affäre, bis Karen nach ein paar Jahren misstrauisch wurde. Sie sprach ihren Mann darauf an, der nach anfänglichem Abstreiten alles zugab und dann erklärte, er wolle die Scheidung, denn er habe die Liebe seines Lebens gefunden.
In derselben Phase, in der Marshall sein Familienleben auf den Kopf stellte, traf er ein paar weitere unkluge Entscheidungen. Zum Beispiel plante er, größere Mengen seiner Einnahmen außer Landes zu bringen. In Sri Lanka war ein Jumbojet der United Asia Airlines mit vierzig Amerikanern an Bord abgestürzt. Es gab keine Überlebenden, und Marshall Kofer war wie immer als Erster vor Ort. Während er den Vergleich aushandelte, richtete er eine Reihe von Scheinfirmen in der Karibik und in Asien ein, um seine beträchtlichen Honorare über verschlungene Wege jeglichem Zugriff der Behörden zu entziehen.
Samantha besaß einen dicken Ordner mit Zeitungsausschnitten und Ermittlungsberichten über den erbärmlichen Steuerhinterziehungsversuch ihres Vaters. Man hätte ein spannendes Buch darüber schreiben können, aber sie hatte kein Interesse daran, das zu tun. Er war aufgeflogen, auf den Titelseiten der Zeitungen bloßgestellt und schließlich zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zwei Wochen bevor sie in Georgetown ihren Abschluss machte, war er auf Bewährung freigekommen. Heute hatte Marshall ein kleines Büro in der Altstadt von Alexandria und war seinen eigenen Worten zufolge als »Consultant« tätig und beriet Anwaltskollegen in Sammelklageprozessen. Details dazu hatte er jedoch bislang nicht verraten. Samantha war ebenso wie ihre Mutter überzeugt, dass Marshall einen Großteil seiner Beute irgendwo in der Karibik versteckt hielt. Karen wollte längst nichts mehr davon wissen.
Marshall würde nie beweisen können, was er vermutete, denn Karen würde es immer bestreiten – nämlich dass seine Exfrau bei den Ermittlungen gegen ihn die Finger im Spiel gehabt hatte. Sie bekleidete ein hohes Amt im Justizministerium und hatte ein gut funktionierendes Netzwerk.
»Dad, ich bin gefeuert worden«, sagte Samantha mit gedämpfter Stimme in ihr Handy. Das Café hatte keine weiteren Gäste, doch der Barista stand nicht weit von ihr, und sie wollte nicht, dass er etwas mitbekam.
»Oh, Sam, das tut mir leid«, sagte Marshall. »Lass hören, was passiert ist.«
Soweit sie es beurteilen konnte, hatte ihr Vater im Gefängnis nur eines gelernt, und das waren weder Demut noch Geduld, weder Verständnis noch Vergebung, noch was man sonst normalerweise an Erfahrung aus niederschmetternden Erlebnissen mitnahm. Er war ehrgeizig und rastlos wie eh und je, noch immer jederzeit bereit, die Ärmel hochzukrempeln und jeden zu überrollen, der sich ihm in den Weg stellte. Nein, aus irgendwelchen Gründen hatte Marshall Kofer gelernt zuzuhören, zumindest seiner Tochter. Langsam wiederholte sie ihren Bericht, und er folgte Wort für Wort. Sie versicherte ihm, dass alles gut ausgehen werde. Irgendwann klang er, als kämen ihm gleich die Tränen.
Unter anderen Umständen hätte er sie jetzt harsch für ihre Karriereplanung kritisiert. Er hasste die Großkanzleien, weil er jahrelang gegen sie ins Feld gezogen war. Für ihn waren sie keine Partnerschaften mit echten Anwälten, die zum Wohl ihrer Mandanten arbeiteten, sondern reine Wirtschaftskonzerne. Er konnte stundenlang darüber referieren, warum man Großkanzleien grundsätzlich misstrauen müsse. Samantha kannte alle seine Vorträge und war jetzt überhaupt nicht in der Stimmung dafür. Stattdessen aber fragte er nur: »Soll ich vorbeikommen, Sam? Ich kann in drei Stunden bei dir sein.«
»Danke, lieber nicht. Noch nicht. Gib mir einen Tag Zeit. Ich brauche eine Pause. Vielleicht fahr ich ein paar Tage weg.«
»Ich komme und hole dich ab.«
»Vielleicht, aber nicht jetzt. Mir geht’s gut, Dad, wirklich.«
»Unsinn. Du brauchst deinen Vater.«
Die Worte klangen seltsam aus dem Mund eines Mannes, den sie in den ersten zwanzig Jahren ihres Lebens praktisch nicht gesehen hatte. Immerhin gab er sich jetzt Mühe.
»Danke, Dad. Ich ruf dich wieder an.«
»Lass uns zusammen wegfahren, irgendwo ans Meer, und Rum trinken.«
Sie musste lachen, weil sie noch nie allein mit ihm irgendwohin gefahren war. In ihrer Kindheit hatte es ein paar hektische Ferien gegeben, die typischen Städtetrips nach Europa, die aber fast immer vorzeitig abgebrochen wurden, weil zu Hause wichtige Geschäfte drängten. Trotz der gegebenen Umstände war die Vorstellung, mit ihrem Vater ans Meer zu fahren, nicht auf Anhieb verlockend.
»Danke, Dad. Vielleicht bald, aber nicht jetzt. Ich muss mich hier um ein paar Dinge kümmern.«
»Ich kann dir einen Job besorgen. Einen richtigen Job.«
Nicht schon wieder, dachte sie, erwiderte jedoch nichts. Ihr Vater versuchte seit Jahren, sie zu überreden, als »richtige« Anwältin zu arbeiten, was seiner Ansicht nach vor allem beinhaltete, Großkonzerne für deren illegale Machenschaften vor Gericht zu bringen. In Marshall Kofers Welt mussten Unternehmen ab einer gewissen Größe entsetzliche Sünden begehen, um in der halsabschneiderischen Welt des westlichen Kapitalismus zu bestehen. Es war die Aufgabe von Anwälten – vielleicht auch ehemaligen Anwälten – wie ihm, das verbrecherische Treiben aufzudecken und mit allen Mitteln für Gerechtigkeit zu sorgen.
»Danke, Dad. Ich ruf dich wieder an.«
Es war geradezu absurd, dass ihr Vater sie nach wie vor in das Tätigkeitsfeld locken wollte, das ihn ins Gefängnis gebracht hatte. Sie hatte kein Interesse an Gerichtsarbeit und öffentlichen Disputen. Sie war nicht sicher, was sie wollte – vermutlich einen ruhigen Schreibtischjob mit einem hübschen Gehalt. Vor allem weil sie eine Frau und intelligent war, hatte sie einmal eine realistische Chance gehabt, bei Scully & Pershing zur Partnerin aufzusteigen. Doch zu welchem Preis?
Vielleicht wollte sie eine solche Karriere, vielleicht auch nicht. Im Augenblick wollte sie nur durch die Straßen von Lower Manhattan ziehen, um ihre Gedanken zu ordnen. Stundenlang ließ sie sich durch Tribeca treiben. Ihre Mutter rief zweimal an, ihr Vater einmal, doch sie beschloss, nicht abzunehmen. Izabelle und Ben meldeten sich ebenfalls, aber sie hatte keine Lust zu reden. Irgendwann stand sie vor dem Moke’s Pub unweit von Chinatown und blickte für einen Augenblick durch die Fenster hinein. Beim ersten Date mit Henry waren sie hier gewesen, vor vielen Jahren. Sie hatten sich über Freunde kennengelernt. Er war ein ehrgeiziger junger Schauspieler gewesen, einer von Hunderttausenden in New York, sie hatte gerade bei S&P angefangen. Sie waren ein Jahr zusammen, dann zerbrach die Beziehung unter dem Stress ihrer gnadenlosen Bürozeiten und seiner Arbeitslosigkeit. Er ging nach Los Angeles, wo er letzten Berichten zufolge unbekannte Schauspieler in Limos durch die Gegend fuhr und als Statist in Werbeclips auftrat.
Unter anderen Umständen hätte sie Henry lieben können. Er hätte genügend Zeit, Engagement und Leidenschaft für eine Beziehung gehabt. Doch sie war immer erschöpft gewesen. Für Frauen in ihrem Beruf war es nicht ungewöhnlich, mit vierzig aufzuwachen und festzustellen, dass zehn Jahre ins Land gezogen und sie immer noch Single waren.
Sie ließ das Moke’s Pub hinter sich und wandte sich nach Norden Richtung SoHo.
Anna aus der Personalabteilung erwies sich als bemerkenswert fleißig. Um siebzehn Uhr bekam Samantha eine ausführliche E-Mail mit den Namen von zehn gemeinnützigen Organisationen, die als geeignet erachtet wurden, den schwer geprüften Wesen, die gerade zwangsweise von der weltgrößten Großkanzlei beurlaubt worden waren, unbezahlte Praktika anzubieten: Sumpfschützer in Lafayette, Louisiana; ein Frauenhaus in Pittsburgh, Pennsylvania; eine Einwanderer-Initiative in Tampa, Florida; die Mountain Law Clinic in Brady, Virginia; die Sterbehilfe-Gesellschaft von Tucson, Arizona; ein Obdachlosenverein in Louisville; der Lake-Erie-Naturschutzbund. Und so weiter. Nichts davon auch nur halbwegs in der Nähe von New York.
Samantha blickte lange auf die Liste und versuchte sich vorstellen, wie es wäre, die Stadt zu verlassen. Sechs der letzten sieben Jahre hatte sie hier verbracht – drei Jahre als Studentin an der Columbia University und drei als Angestellte von S&P. Nach der Uni hatte sie bei einem Bundesrichter in Washington ihr Referendariat gemacht, war dann aber sofort nach New York zurückgekehrt. Sie hatte bislang immer in Großstädten gewohnt.
Lafayette, Louisiana? Brady, Virginia?
In einem Ton, der angesichts der Umstände viel zu fröhlich war, informierte Anna die Beurlaubten, dass die Stellen bei manchen der genannten Organisationen begrenzt seien. Anders ausgedrückt: Bewerbt euch schleunigst, sonst entgeht euch womöglich die Chance, in die Provinz zu ziehen und ein Jahr lang umsonst zu arbeiten. Samantha war nicht imstande, irgendetwas schleunigst zu tun.
Blythe sah kurz vorbei, um Hallo zu sagen und sich eine Pasta in der Mikrowelle warm zu machen. Samantha hatte ihr eine SMS mit der großen Neuigkeit geschickt, und ihre Mitbewohnerin war den Tränen nahe, als sie nach Hause kam. Nach ein paar Minuten hatte Samantha sie jedoch beruhigt und ihr versichert, dass das Leben weitergehe. Blythes Kanzlei vertrat eine ganze Reihe von Kreditgebern, und die Stimmung dort war ebenso düster wie bei Scully & Pershing. Seit Tagen hatten die beiden über kaum etwas anderes gesprochen als über ihre mögliche Entlassung. Blythe hatte die Pasta halb gegessen, da klingelte ihr Mobiltelefon. Ihr Vorgesetzter suchte sie. Und so ließ sie alles liegen und stehen und hastete um 18.30 Uhr zurück ins Büro, aus lauter Angst, die geringste Verspätung könnte sie den Job kosten.
Samantha schenkte sich ein Glas Wein ein und ließ die Badewanne mit warmem Wasser volllaufen. Sie legte sich hinein, trank und beschloss, dass sie, Geld hin oder her, die Welt der Großkanzleien hasste und nie wieder dorthin zurückkehren würde. Sie würde sich nie wieder anschreien lassen, weil sie nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang nicht im Büro war. Sie würde sich nie wieder vom Geld verführen lassen. Sie würde noch viel mehr Dinge nie wieder tun.
Ihre finanziellen Mittel waren relativ bescheiden, aber alles in allem war die Situation nicht hoffnungslos. Sie besaß einunddreißigtausend Dollar Sparguthaben und hatte keine Schulden, abgesehen von drei Monaten Mietanteil für das Loft, die noch ausstanden. Wenn sie sich einschränkte und mit Teilzeitjobs etwas dazuverdiente, konnte sie wahrscheinlich durchhalten, bis sich der Sturm gelegt hatte. Vorausgesetzt natürlich, dass nicht tatsächlich die Welt unterging. Sie konnte sich nicht vorstellen, kellnern zu gehen oder Schuhe zu verkaufen. Andererseits hatte sie auch nicht im Traum damit gerechnet, dass ihre vielversprechende Karriere so abrupt enden würde. Die Stadt wäre bald voller Kellner und Verkäufer mit Uniabschlüssen.
Zurück zu S&P? Ihr Ziel war es gewesen, mit fünfunddreißig Partnerin zu sein, eine von wenigen Frauen in der Führungsetage, und von ihrem schicken Eckbüro aus den Männern zu zeigen, wo es langging. Mit eigener Sekretärin, Rechtsassistentin, einem Fahrer in Rufbereitschaft, einem großzügigen Spesenkonto und einem Schrank voller Designerklamotten. Die hundert Wochenstunden würden auf ein erträgliches Maß zusammenschrumpfen. Sie würde über zwei Millionen im Jahr machen und nach zwanzig Jahren privatisieren und die Welt bereisen. Nebenbei würde sie sich einen Ehemann suchen und ein, zwei Kinder bekommen, und alles wäre perfekt.
So hatte sie sich ihr Leben vorgestellt, und es schien ein realistischer Plan gewesen zu sein.
In der Lobby des Mercer Hotels, vier Straßen von ihrem Loft entfernt, traf sie sich auf ein paar Martinis mit Izabelle. Sie hatten auch Ben eingeladen, doch der war frisch verheiratet und anderweitig beschäftigt. Die Entlassung wirkte bei jedem anders. Samantha war praktisch schon über den Schock hinweg und überlegte, wie es weitergehen sollte. Allerdings war sie auch in der glücklichen Lage, kein Studentendarlehen abbezahlen zu müssen, weil ihre Eltern die Ausbildung finanziert hatten. Izabelle hingegen war mit alten Krediten belastet und zermarterte sich den Kopf über die Zukunft. Sie nahm einen großen Schluck Martini, und der Gin stieg ihr direkt in den Kopf.
»Ich überstehe kein Jahr ohne Einkommen«, sagte sie. »Du?«
»Müsste gehen«, erwiderte Samantha. »Wenn ich mich richtig einschränke und nur noch von Suppe lebe, kann ich was sparen und in New York bleiben.«
»Ich nicht«, sagte Izabelle deprimiert und nahm noch einen Schluck. »Ich kenne einen Typ in der Prozessabteilung, der letzten Freitag geschasst wurde. Er hat fünf von den gemeinnützigen Organisationen angerufen, und alle hatten ihre Praktika schon vergeben. Hältst du das für möglich? Er hat die Personalabteilung angerufen und denen die Hölle heißgemacht, woraufhin sie meinten, sie würden noch an der Liste arbeiten und bekämen immer wieder Anfragen von Vereinen, die billige Arbeitskräfte suchten. Das heißt also, wir verlieren nicht nur unseren Job, auch der Deal funktioniert nicht richtig. Niemand will uns, nicht einmal, wenn wir umsonst arbeiten. Das ist ganz schön krank.«
Samantha nippte an dem Martini und genoss die leicht betäubende Wirkung. »Ich habe nicht die Absicht, den Deal anzunehmen.«
»Aber wie machst du das dann mit deiner Krankenversicherung? Du kannst doch nicht ohne leben.«
»Kommt auf einen Versuch an.«
»Wenn du krank wirst, verlierst du alles.«
»Ich habe nicht viel.«
»Das ist dumm, Sam.« Izabelle nahm einen weiteren Schluck, wenn auch einen etwas kleineren. »Du verzichtest also auf eine leuchtende Zukunft bei Scully & Pershing.«
»Die Kanzlei hat entschieden, auf mich zu verzichten, auf dich und viele andere. Es muss bessere Stellen und Möglichkeiten geben, Geld zu verdienen.«
»Darauf trinke ich.« Eine Bedienung trat heran, und sie bestellten die zweite Runde.
3
Samantha schlief zwölf Stunden und erwachte mit dem übermächtigen Drang, sofort aus der Stadt zu fliehen. Im Bett liegend, blickte sie zu den alten Holzbalken an der Zimmerdecke hoch und ließ in Gedanken den letzten Monat an sich vorüberziehen, wobei ihr klar wurde, dass sie seit sieben Wochen nicht aus Manhattan herausgekommen war. Ein langes Augustwochenende in Southampton war von Andy Grubman zunichtegemacht worden. Statt zu feiern und auszuschlafen, hatte sie Samstag und Sonntag im Büro verbracht und einen halben Meter Vertragsunterlagen durchgesehen.
Sieben Wochen. Sie duschte rasch und packte einen Koffer mit dem Nötigsten. Um zehn Uhr bestieg sie an der Penn Station einen Zug und hinterließ eine Nachricht auf Blythes Handy: Fahre für ein paar Tage nach Washington. Ruf mich an, falls dich der Hammer auch trifft.
In New Jersey wurde sie schließlich doch neugierig und schickte eine E-Mail an den Lake-Erie-Naturschutzbund und das Frauenhaus in Pittsburgh. Dreißig Minuten lang passierte nichts. Sie las die Times. Die Wirtschaftskrise forderte ihren Tribut: Es gab Entlassungswellen bei Finanzinstituten; Banken gewährten keine Kredite mehr oder schlossen gleich die Tore; der Kongress tagte nonstop; Obama machte Bush verantwortlich, das Gespann McCain/Palin die Demokraten. Über das Gemetzel bei S&P war kein Wort zu finden. Als Samantha auf ihren Laptop sah, entdeckte sie eine neue E-Mail von Anna, der fröhlichen Personalerin. Sechs weitere Organisationen hätten sich angeschlossen. Nun aber mal los!
Das Frauenhaus schickte eine freundliche Absage. Man danke Ms. Kofer für ihr Interesse, doch die Stelle sei bereits anderweitig besetzt. Fünf Minuten später meldeten sich die tapferen Recken, die für den Lake Erie kämpften, mit nahezu identischem Text. Aufgeschreckt schrieb Samantha an fünf weitere Vereine von Annas Liste sowie an Anna selbst, um sie höflich zu bitten, sie doch ein wenig zügiger auf dem Laufenden zu halten. Zwischen Philadelphia und Wilmington sagten die Moorschützer unten in Louisiana ab. Dann das Georgia Innocence Project gegen Justizirrtümer, die Einwandererinitiative von Tampa, die Gegner der Todesstrafe und die Pro-bono-Rechtsberatung von St. Louis. Danke für Ihr Interesse, aber die Praktikumsstelle wurde bereits besetzt.
Null von sieben. Sie bekam nicht mal einen Ehrenamtsjob!
An der Union Station unweit vom Kapitol nahm Samantha sich ein Taxi und drückte sich tief in die Rückbank, während der Wagen durch den Hauptstadtverkehr kroch. Ein Regierungsbüro nach dem anderen, dazwischen die Zentralen unzähliger Organisationen und Vereinigungen, Hotels und schicke neue Apartmentblocks, riesige Büros von Anwälten und Lobbyisten, die Bürgersteige voll mit Menschen, die geschäftig hin und her eilten, beseelt von der Mission, die Geschicke der Nation zu lenken, während die Welt am Rande des Abgrunds entlangschlingerte. Sie hatte die ersten fünfundzwanzig Jahre ihres Lebens in Washington verbracht, doch inzwischen fand sie die Stadt fade. Immer noch kamen intelligente junge Leute in Scharen hierher, doch die redeten ausschließlich über Politik und Immobilien. Die Lobbyisten waren die Schlimmsten. Von denen gab es mehr als Politiker und Juristen zusammen, sie beherrschten die Stadt und den Kongress – was dazu führte, dass sie die Gewalt über die Finanzen hatten. Und so langweilten sie ihre Umgebung beim Cocktail oder Abendessen mit Einzelheiten über ihre jüngsten Heldentaten, wie sie Staatsgelder lockergemacht oder ein Schlupfloch im Steuergesetz geschlossen hätten. Sämtliche Freunde aus Samanthas Kindheit und der Zeit in Georgetown hatten Jobs, die auf die eine oder andere Weise aus dem Bundestopf finanziert wurden. Ihre Mutter verdiente hundertfünfundvierzigtausend Dollar im Jahr als Juristin im Justizministerium.
Samantha war nicht sicher, womit ihr Vater sein Geld verdiente. Sie beschloss, zuerst ihn zu besuchen. Ihre Mutter machte spät Feierabend und würde erst nach Einbruch der Dunkelheit heimkommen. Samantha schloss die Wohnung ihrer Mutter auf, stellte den Koffer ab und fuhr mit demselben Taxi über den Potomac River in die Altstadt von Alexandria. Ihr Vater erwartete sie mit einem Lächeln und offenen Armen und schien alle Zeit der Welt zu haben. Er war inzwischen in ein wesentlich schöneres Gebäude gezogen und hatte seine Kanzlei in »Kofer Group« umbenannt.
»Klingt nach einem Haufen Lobbyisten«, sagte sie und sah sich in dem geschmackvoll eingerichteten Empfangsraum um.
»O nein«, widersprach Marshall. »Wir halten uns von dem Zirkus da drüben fern.« Er deutete in Richtung Washingtoner Stadtzentrum, als wäre es ein Ghetto. Auf dem Weg durch einen Flur blickten sie durch offene Türen in kleine Büros.
Sie wollte fragen: Was genau machst du dann, Dad? Doch sie beschloss, die Frage aufzuschieben. Er führte sie in ein großes Eckbüro, von dem aus man in der Ferne den Potomac River sehen konnte, ganz ähnlich dem Büro von Andy Grubman aus einem anderen Leben. Sie setzten sich in Ledersessel um einen kleinen Tisch, während eine Sekretärin Kaffee holen ging.
»Wie geht es dir?«, fragte er ernst, eine Hand auf ihrem Knie, als wäre sie ein kleines Mädchen und gerade die Treppe hinuntergefallen.
»Gut«, antwortete sie und spürte im selben Moment, wie ihre Kehle eng wurde. Reiß dich zusammen! Sie schluckte. »Es kam so plötzlich. Vor vier Wochen war alles noch gut, weißt du, alles, wie es sein soll, ohne Probleme. Lange Arbeitstage, aber so ist das eben in der täglichen Routine. Dann kamen Gerüchte auf, ganz leise, dass irgendetwas schiefläuft. Und auf einmal ging alles furchtbar schnell.«
»Das stimmt. Dieser Crash ging hoch wie eine Bombe.«
Der Kaffee kam auf einem Tablett, und die Sekretärin schloss im Hinausgehen die Tür.
»Liest du Trottman?«, fragte er.
»Wen?«
»Er schreibt wöchentlich über Politik und Finanzmärkte. Ist schon seit geraumer Zeit hier in Washington und kennt sich ziemlich gut aus. Vor sechs Monaten hat er einen Kollaps bei Subprime-Hypotheken vorausgesagt. Es habe sich über die Jahre aufgebaut und so weiter und werde einen Crash und eine massive Rezession geben. Er hat damals geraten, sich von der Börse zurückzuziehen, von allen Börsen.«
»Und? Hast du dich zurückgezogen?«
»Ich hatte praktisch nichts investiert. Aber selbst wenn, wäre ich seinem Rat wahrscheinlich nicht gefolgt. Vor sechs Monaten lebten wir in einer Traumwelt, in der die Immobilienpreise nie fielen. Kredite waren billig, und jeder lieh auf Teufel komm raus. Alles war möglich.«
»Was sagt Trottman jetzt?«
»Nun ja, wenn er unkt, weiß die Notenbank, was sie zu tun hat. Er sagt eine größere Rezession vorher, weltweit, aber nicht vergleichbar mit 1929. Er glaubt, die Märkte werden auf die Hälfte zusammenschrumpfen, die Arbeitslosigkeit wird neue Spitzenwerte erreichen, die Demokraten werden im November gewinnen, ein paar führende Banken werden Pleite machen, es wird viel Angst und Ungewissheit herrschen, aber die Welt wird irgendwie überleben. Was hörst du denn so da oben an der Wall Street? Du bist doch mitten im Geschehen. Zumindest warst du da bis vor Kurzem.« Er trug die gleichen schwarzen Troddelslipper wie eh und je. Der dunkle Anzug war wahrscheinlich maßgefertigt wie in Marshalls besten Tagen. Sündteure Kammgarnqualität. Seidenkrawatte, perfekt gebunden. Manschettenknöpfe. Als sie ihn das erste Mal im Gefängnis besucht hatte, hatte er ein Baumwollhemd und olivgrüne Latzhosen angehabt, die Häftlingsuniform, und bitterlich geklagt, wie sehr ihm seine Garderobe fehle. Marschall Kofer hatte schon immer ein Faible für edle Kleidung gehabt, und nun, da er wieder voll im Geschäft war, gab er ganz offensichtlich eine Menge Geld dafür aus.
»Heillose Panik«, sagte sie. »Der Times zufolge hat es gestern zwei Selbstmorde gegeben.«
»Hast du zu Mittag gegessen?«
»Ein Sandwich im Zug.«
»Dann lass uns zusammen abendessen gehen, nur wir zwei.«
»Das habe ich Mom schon versprochen. Aber wir können uns morgen zum Mittagessen treffen.«
»Alles klar. Wie geht’s Karen?« Wenn man ihn hörte, hatten ihre Eltern mindestens einmal im Monat ein nettes Telefonat. Ihrer Mutter zufolge sprachen sie etwa einmal im Jahr miteinander. Marshall wollte Freundschaft, doch Karen trug zu viele böse Erinnerungen mit sich herum. Samantha hatte nie versucht, sie zu einem Burgfrieden zu überreden.
»Gut, denke ich. Arbeitet viel.«
»Hat sie jemanden?«
»Ich frage sie nicht danach. Wie ist es bei dir?«
Die junge hübsche Rechtsassistentin hatte sich zwei Monate nach Antritt seiner Haftstrafe von ihm getrennt, und so war Marshall seit vielen Jahren Single – wenn auch selten allein. Er war knapp sechzig, immer noch fit und schlank, das graue Haar zurückgegelt, ein umwerfendes Lächeln auf den Lippen. »Oh, ich bin durchaus noch im Rennen«, sagte er lachend. »Und du? Gibt es jemanden in deinem Leben?«
»Nein, Dad, leider nicht. Ich habe die letzten drei Jahre in einer Höhle verbracht, während die Welt an mir vorüberzog. Ich bin neunundzwanzig und wieder einmal Jungfrau.«
»Das will ich nicht wissen. Wie lange bist du hier?«
»Ich bin gerade erst angekommen. Keine Ahnung. Ich habe dir von der Beurlaubungslösung erzählt, die die Kanzlei angeboten hat. Das werde ich mir mal ansehen.«
»Ein Jahr lang ehrenamtlich arbeiten und dann die Stelle wiederbekommen, ohne Nachteile durch die Fehlzeit?«
»So was in der Art.«
»Fieser Beigeschmack. Du traust diesen Typen doch nicht, oder?«
Sie atmete tief durch und trank einen Schluck Kaffee. Von hier aus konnte das Gespräch zu Themen abdriften, die sie im Moment auf keinen Fall ertragen würde. »Nein. Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht sagen, dass ich den Bossen von Scully & Pershing nicht traue.«
Marshall schüttelte in vollstem Verständnis den Kopf. »Und im Grunde willst du gar nicht wieder zurück, weder jetzt noch in zwölf Monaten. Stimmt’s?«
»Ich weiß nicht, was ich in zwölf Monaten denken werde, aber eine Zukunft in dieser Kanzlei kann ich mir nicht recht vorstellen.«
»Gut, gut.« Er stellte seine Tasse auf den Tisch und beugte sich vor. »Hör zu, Samantha, ich kann dir einen Job anbieten, gleich hier, der gut bezahlt ist und dich ein Jahr lang beschäftigt, bis du weißt, was du willst. Vielleicht bleibst du auf Dauer dabei, vielleicht nicht, aber du wirst genug Zeit haben, um diese Entscheidung zu treffen. Du wirst nicht praktizieren wie eine richtige Anwältin, aber das hast du, glaube ich, in den letzten drei Jahren auch nicht getan.«
»Mom meinte, du hast zwei Partner, denen ebenfalls die Lizenz abgenommen wurde.«
Er lachte gezwungen, aber die Wahrheit war eben unangenehm. »Das hat Karen gesagt? Ja, Samantha, wir sind hier zu dritt, alle dereinst angeklagt, verurteilt, entehrt, inhaftiert und, ich freue mich, das sagen zu können, vollständig rehabilitiert.«
»Tut mir leid, Dad, aber ich kann mir nicht vorstellen, für einen Laden zu arbeiten, der von drei Anwälten ohne Lizenz geleitet wird.«
Marshall ließ die Schultern ein wenig sinken. Sein Lächeln erstarb.
»Es ist keine richtige Kanzlei, oder?«
»Nein. Wir dürfen nicht praktizieren, weil wir unsere Lizenz noch nicht zurückhaben.«
»Was macht ihr dann?«
Er straffte sich. »Wir verdienen eine Menge Geld, meine Liebe. Wir sind als Berater tätig.«
»Beraten kann jeder, Dad. Wen beratet ihr, und wie sieht euer Rat aus?«
»Hast du schon mal etwas von Prozessfinanzierung gehört?«
»Zu Diskussionszwecken sagen wir mal: nein.«
»Okay. Es gibt private Agenturen, die sich Geld von Investoren leihen, um damit große Gerichtsverfahren zu finanzieren. Sagen wir zum Beispiel, eine kleine Software-Firma ist davon überzeugt, dass ihr einer der Giganten, sagen wir Microsoft, eine Software-Idee geklaut hat, nur dass die kleine Firma es sich nicht leisten kann, Microsoft zu verklagen und vor Gericht zur Rechenschaft zu ziehen. Absolut unmöglich. Also geht die kleine Firma zu einer Finanzagentur, die den Fall prüft und, wenn sie ihn für gerechtfertigt hält, eine ordentliche Summe bereitstellt, um Gebühren und Spesen zu decken. Ob zehn Millionen oder zwanzig Millionen, das spielt im Grunde keine Rolle. Auf jeden Fall ist jetzt genug Geld da. Natürlich bekommt die Agentur ein Stück vom Kuchen ab. Es findet ein faires Verfahren statt, und in der Regel kommt es zu einem lukrativen Vergleich. Unsere Aufgabe ist es, die Prozessfinanzierer zu beraten, ob sie sich in einem bestimmten Verfahren engagieren sollen oder nicht. Nicht alle potenziellen Verfahren sollten unbedingt angestrengt werden, auch nicht in diesem Land. Meine beiden Partner, die übrigens Mitinhaber dieses Büros sind, wie ich hinzufügen möchte, waren ebenfalls Spezialisten für große Sammelklagen, bis man sie sozusagen aus dem Rechtsberuf hinauskomplimentierte. Unser Geschäft boomt, trotz der kleinen Rezession. In Wahrheit glauben wir, dass das Desaster sogar zu unserem Vorteil ist. Jede Menge Banken werden in Kürze verklagt werden, und zwar auf astronomische Summen.«
Samantha hörte zu und trank dabei ihren Kaffee. Dieser Mann hatte früher regelmäßig Millionenbeträge aus Geschworenen herausgekitzelt.
»Was meinst du?«, fragte er.
Klingt schauderhaft, dachte sie und runzelte die Stirn, als würde sie ernsthaft darüber nachdenken. »Interessant«, brachte sie heraus.
»Wir sehen großes Wachstumspotenzial«, fügte er hinzu.
Ja, und mit drei Exknackis am Start war es nur eine Frage der Zeit, wann der Ärger losging. »Von Prozessführung habe ich keinen blassen Schimmer, Dad. Ich habe immer versucht, mich möglichst davon fernzuhalten. Ich habe in einem Finanzunternehmen gearbeitet, schon vergessen?«
»Ach, das lernst du schnell. Ich werde es dir beibringen. Wir werden viel Spaß haben. Versuch es doch! Probier es ein paar Monate aus, während du dir darüber klar wirst, was du wirklich willst.«
»Aber ich habe meine Lizenz doch noch«, entgegnete Samantha. Sie lachten beide, auch wenn es nicht besonders lustig war. »Ich werde es mir überlegen, Dad. Danke.«
»Du wirst dich schnell einfinden, versprochen. Vierzig Wochenstunden, ein hübsches Büro, nette Kollegen. Auf jeden Fall besser als das Hamsterrad in New York.«
»In New York fühle ich mich zu Hause. Hier nicht.«
»Okay, schon gut. Ich will dich nicht drängen. Das Angebot steht.«
»Vielen Dank dafür.«
Eine Sekretärin klopfte und streckte ihren Kopf durch die Türöffnung. »Ihr Sechzehn-Uhr-Termin, Sir.«
Marshall blickte stirnrunzelnd auf seine Uhr. »Ich bin gleich da«, sagte er, und sie zog sich zurück.
Samantha griff nach ihrer Tasche. »Ich muss los.«
»Keine Eile, Liebes. Die können warten.«
»Ich weiß, du hast viel zu tun. Wir sehen uns morgen zum Mittagessen.«
»Das wird nett. Grüß Karen von mir. Ich würde sie zu gern mal wieder sehen.«
Keine Chance. »Sicher, Dad. Bis morgen.«
Sie umarmten sich an der Tür, und Samantha beeilte sich, wegzukommen.
Die achte Absage kam von der Chesapeake-Gesellschaft in Baltimore, die neunte von einem Verein, der sich um den Schutz der Redwood-Wälder in Nord-Kalifornien bemühte. Noch nie in ihrem ganzen privilegierten Leben war Samantha Kofer neunmal abgelehnt worden, was auch immer sie angepackt hatte. Sie war nicht sicher, ob sie ein zehntes Mal ertragen konnte.
Sie saß in der Cafeteria von Kramerbooks am Dupont Circle und trank einen Kaffee. Beim Warten tauschte sie E-Mails mit Freundinnen aus. Blythe hatte ihre Stelle noch, doch die Dinge änderten sich stündlich. Es sei das Gerücht in Umlauf, dass ihre Kanzlei, die viertgrößte der Welt, ebenfalls im Rundumschlag Leute entlassen und dabei möglichst viele der klügsten Köpfe »beurlauben« und kostenlos an Vereine mit notorisch knapper Kasse verleihen werde. Sie schrieb: »Es müssen Tausende sein, die jetzt Klinken putzen gehen.«
Samantha hatte nicht den Mumm zuzugeben, dass sie neun Absagen bekommen hatte.
Da kündigte sich mit einem Signalton Nummer zehn an, eine knappe Nachricht von einer Mattie Wyatt von der Mountain Law Clinic in Brady, Virginia: »Rufen Sie mich auf dem Handy an, jetzt gleich, wenn Sie Zeit haben«, gefolgt von einer Mobilnummer. Nach neun Abfuhren fühlte sich das an wie eine Einladung ins Weiße Haus.
Samantha atmete tief durch, trank noch einen Schluck und sah sich um, ob ihr jemand zuhörte – als würden sich die anderen Kunden für ihre Angelegenheiten interessieren. Dann nahm sie ihr Handy und tippte die Nummer ein.
4
Die Mountain Law Clinic führte ihre ehrenamtliche Tätigkeit von einem ehemaligen Eisenwarenladen in der Main Street von Brady aus. Der Ort hatte zweitausendzweihundert Einwohner, deren Zahl jedoch beständig abnahm, und lag im Südwesten von Virginia in den Appalachen, dem Land der Kohle. Von den wohlhabenden Außenbezirken der Hauptstadt Washington im Norden war Brady nur fünfhundert Kilometer und zugleich ein ganzes Jahrhundert entfernt.
Mattie Wyatt führte die Kanzlei seit dem Tag vor sechsundzwanzig Jahren, an dem sie sie gegründet hatte. Sie nahm den Anruf an und sagte, was sie immer sagte: »Mattie Wyatt.«
Eine leicht schüchterne Stimme am anderen Ende meldete sich: »Hier ist Samantha Kofer. Ich habe gerade Ihre E-Mail bekommen.«
»Danke, Ms. Kofer. Ihre Anfrage ist heute Nachmittag eingegangen, zusammen mit ein paar anderen. Sieht so aus, als würden ein paar Großkanzleien ganz schön in der Tinte stecken.«
»So könnte man sagen.«
»Nun, wir hatten noch nie eine Praktikantin von einer großen New Yorker Kanzlei, aber wir können immer Hilfe gebrauchen. Arme Leute mit Problemen gibt es hier jede Menge. Waren Sie schon mal im Südwesten von Virginia?«
Nein, Samantha hatte zwar die Welt gesehen, aber in den Appalachen war sie noch nie gewesen. »Leider nein«, sagte sie so höflich wie möglich. Matties Stimme klang freundlich, sie hatte einen leichten Anklang von Südstaatenakzent, und Samantha beschloss, ihre besten Umgangsformen an den Tag zu legen.
»Na, dann wird es jetzt Zeit«, erwiderte Mattie. »Hören Sie, Ms. Kofer, ich habe heute drei solche Anfragen bekommen. Wir haben keinen Platz für drei Anfänger, die von nichts eine Ahnung haben. Verstehen Sie, was ich meine? Ich muss also Bewerbungsgespräche führen, um eine Auswahl zu treffen. Können Sie herkommen, um sich persönlich vorstellen? Die anderen beiden meinten, sie würden es versuchen. Einer davon war, glaube ich, auch aus Ihrer Kanzlei.«
»Ja, klar kann ich runterkommen«, antwortete Samantha. Was hätte sie sonst sagen sollen? Der kleinste Hinweis auf mangelnde Bereitschaft, und sie würde sich die zehnte Absage einfangen. »An wann hatten Sie denn gedacht?«
»Morgen, übermorgen, ganz egal. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass lauter arbeitslose Juristen vor meiner Tür stehen und einen Job wollen, der nicht einmal bezahlt ist. Da sich jetzt auf einmal mehrere darum reißen, würde ich sagen, je früher, desto besser. New York ist weit.«
»Ehrlich gesagt, bin ich zurzeit in Washington. Ich denke, ich könnte morgen Nachmittag da sein.«
»In Ordnung. Ich habe nicht viel Zeit für Bewerbungsgespräche, also werde ich vermutlich den Ersten, der auftaucht, einstellen und den anderen absagen. Vorausgesetzt, der Erste, der auftaucht, gefällt mir.«
Samantha schloss für einen Moment die Augen und versuchte, ihre Situation zu begreifen. Gestern früh hatte sie noch einen Schreibtisch in der größten Kanzlei der Welt gehabt, wo sie ordentlich bezahlt worden war und Aussicht auf eine lange, lukrative Karriere gehabt hatte. Kaum dreißig Stunden später saß sie arbeitslos in der Cafeteria eines Buchladens und versuchte alles, um einen befristeten, unbezahlten Job irgendwo in der tiefsten Provinz zu bekommen.
Mattie fuhr fort: »Ich war letztes Jahr in Washington auf einer Konferenz, da habe ich sechs Stunden für die Fahrt gebraucht. Wie wäre es so gegen vier Uhr morgen Nachmittag?«
»Okay. Bis dann. Und vielen Dank, Ms. Wyatt.«
»Nein, ich danke Ihnen, und bitte nennen Sie mich Mattie.«
Samantha ging ins Internet und fand die Website der Mountain Law Clinic. Die Mission lautete schlicht: »Kostenlose Rechtsberatung und -vertretung für Einkommensschwache in Virginias Südwesten.« Zu den Fachgebieten gehörten häusliche Gewalt, Schuldenberatung, Mietangelegenheiten, Gesundheit, Schule und Ausbildung sowie Entschädigungsleistungen aufgrund von Staublunge. In ihrer juristischen Ausbildung hatte sie ein paar dieser Bereiche gestreift, in ihrer beruflichen Laufbahn bislang nicht. Die Kanzlei nahm keine Strafangelegenheiten an. Außer Mattie Wyatt gab es eine weitere Anwältin sowie eine Rechtsassistentin und eine Empfangssekretärin. Nur Frauen.
Samantha beschloss, die Sache mit ihrer Mutter zu besprechen und dann darüber zu schlafen. Sie besaß kein Auto, und die weite Fahrt in die Appalachen erschien ihr wie reine Zeitverschwendung. In SoHo zu kellnern sah im Vergleich dazu regelrecht verlockend aus. Während sie auf ihren Bildschirm starrte, meldete sich das Obdachlosenheim in Louisville mit einem höflichen Nein. Zehn Absagen an einem Tag. Es reichte. Ihr war die Lust, die Welt zu retten, gehörig vergangen.
Karen Kofer erschien um kurz nach sieben Uhr im Firefly. Mit feuchten Augen schloss sie ihr einziges Kind in die Arme. Als sie ihr Mitgefühl aussprach, bat Samantha sie, das bitte zu unterlassen. Sie gingen an die Bar und bestellten Wein, während sie auf einen Tisch warteten. Karen war fünfundfünfzig und alterte in Würde. Sie gab einen Großteil ihres Gehalts für Kleidung aus und war immer trendig, ja mondän gekleidet. Solange Samantha sich erinnern konnte, beklagte sie den Mangel an Stil im Ministerium, als wäre es ihre Aufgabe, Pep in den Laden zu bringen. Seit zehn Jahren war sie alleinstehend; es hatte zwar immer Männer gegeben, doch der richtige war nie darunter gewesen. Aus Gewohnheit musterte sie ihre Tochter von den Ohrringen bis zu den Schuhen und bildete sich binnen Sekunden ein Urteil. Kein Kommentar. Samantha war das im Grunde egal. An diesem schrecklichen Tag hatte sie andere Dinge im Kopf.
»Dad lässt grüßen«, sagte sie, um das Gespräch gleich von den dringlichen Vorgängen im Ministerium wegzulenken.
»Du hast ihn gesehen?«, fragte Karen mit gehobenen Augenbrauen hellhörig.
»Ja. Ich habe ihn in seinem Büro besucht. Es scheint ihm gut zu gehen, er sieht gut aus. Er meinte, er wird sein Geschäft erweitern.«
»Hat er dir einen Job angeboten?«
»Ja. Ich könnte sofort anfangen, vierzig Stunden die Woche mit lauter tollen Kollegen.«
»Die haben übrigens alle ihre Lizenz verloren.«
»Das hast du mir schon erzählt.«
»Immerhin scheint es diesmal legal zu sein, was er treibt, jedenfalls noch. Du denkst sicher nicht im Ernst darüber nach, für Marshall zu arbeiten. Das ist ein Haufen Strolche. Über kurz oder lang wird es bestimmt wieder Probleme geben.«
»Du beobachtest sie also?«
»Sagen wir, ich habe Freunde, Samantha. Viele Freunde an den richtigen Stellen.«
»Willst du denn, dass er noch mal auffliegt?«
»Nein, Liebes, ich bin über deinen Vater hinweg. Es ist Jahre her, dass wir uns getrennt haben, und ich habe lange gebraucht, um mich davon zu erholen. Er hat Vermögen verheimlicht und mich bei der Scheidung über den Tisch gezogen, aber ich habe irgendwann losgelassen. Ich habe ein schönes Leben und werde nicht unnötig negative Energie auf Marshall Kofer verschwenden.«
Gleichzeitig tranken sie an ihrem Wein und sahen dem Barmann zu, einem attraktiven jungen Mann Mitte zwanzig in einem engen schwarzen T-Shirt.
»Nein, Mom, ich werde nicht für Dad arbeiten. Das wäre ein Desaster.«
Eine Bedienung führte sie zu ihrem Tisch, und ein Kellner schenkte Wasser mit Eis ein. Als sie wieder ungestört waren, sagte Karen: »Es tut mir so leid. Ich kann es einfach nicht fassen.«
»Bitte, Mom, lass das.«
»Ich weiß, aber ich bin deine Mutter, ich kann nicht anders.«
»Kann ich für ein paar Tage dein Auto haben?«
»Sicher. Wozu brauchst du es denn?«
»Es gibt in Brady, Virginia, eine dieser Kanzleien, die Pro-bono-Rechtsberatung für Einkommensschwache anbieten – einer von den Vereinen auf meiner Liste. Die würde ich mir gern ansehen. Es ist wahrscheinlich Zeitverschwendung, aber ich habe zurzeit nicht viel zu tun. In Wahrheit habe ich morgen überhaupt nichts zu tun, und eine lange Autofahrt könnte mir helfen, einen klaren Kopf zu bekommen.«
»Aber pro bono?«
»Warum nicht? Außerdem ist es nur ein Bewerbungsgespräch für eine Praktikumsstelle. Wenn ich den Job nicht bekomme, bin ich weiterhin arbeitslos. Und wenn ich ihn bekomme, kann ich jederzeit aufhören, falls er mir nicht gefällt.«
»Kein Gehalt?«
»Keinen Cent. Das ist Teil der Vereinbarung mit S&P. Ich bin zwölf Monate lang ehrenamtlich tätig, dafür behält mich die Kanzlei im System.«
»Aber du findest doch bestimmt ein nettes, kleines Anwaltsbüro in New York.«
»Das haben wir doch schon besprochen, Mom. Die großen Kanzleien entlassen Leute, die kleinen machen Pleite. Du hast keine Ahnung, was für eine Krisenstimmung hier im Moment herrscht. Du und deine Freunde, ihr habt Netz und doppelten Boden, keiner von euch wird seinen Job verlieren. Aber hier im wahren Leben drehen alle vollkommen durch.«
»Ich lebe also nicht das wahre Leben?«
Zum Glück kam der Kellner wieder, um in aller Ausführlichkeit die Tageskarte vorzustellen. Als er sich entfernte, tranken sie ihren Wein aus und betrachteten die umliegenden Tische. Schließlich sagte Karen: »Samantha, ich glaube, du machst einen Fehler. Du kannst nicht einfach für ein Jahr von der Bildfläche verschwinden. Was ist mit deiner Wohnung? Und mit deinen Freunden?«