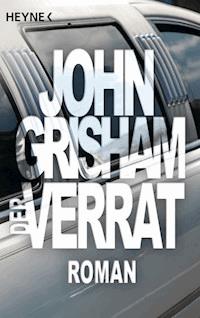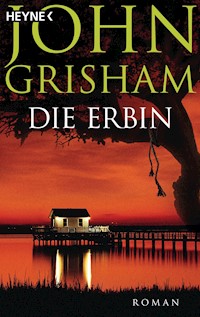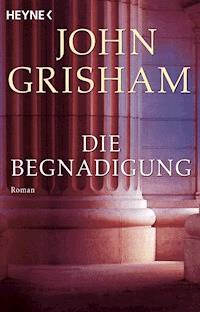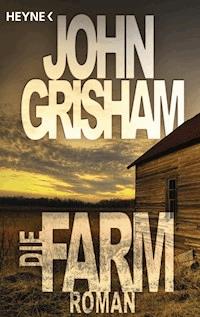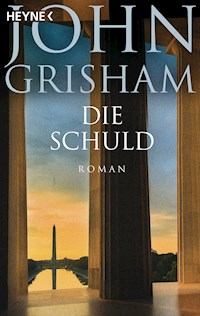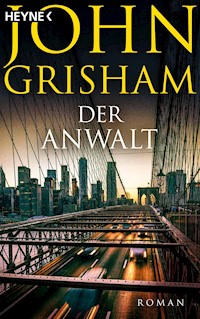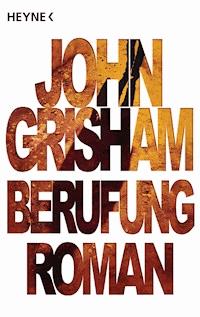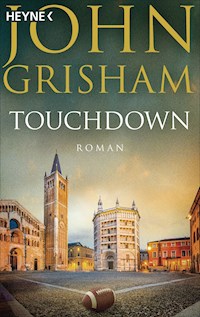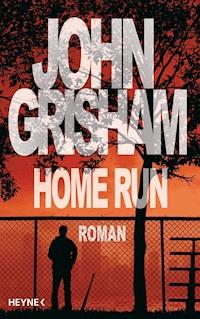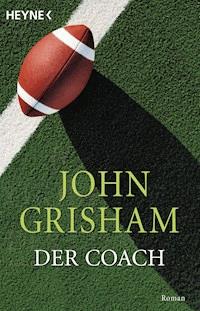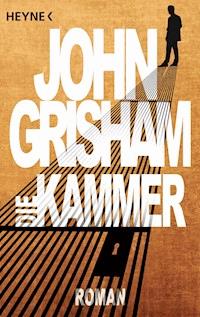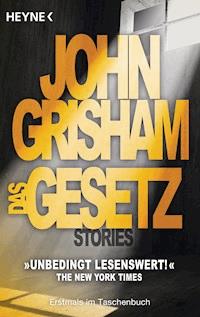9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Zweifel gegen den Angeklagten
Sebastian Rudd ist kein typischer Anwalt. Seine Kanzlei ist ein Lieferwagen, eingerichtet mit Bar, Kühlschrank und Waffenschrank. Er arbeitet allein, sein einziger Vertrauter ist sein Fahrer, der zudem als Leibwächter und Golfcaddie fungiert. Sebastian Rudd verteidigt jene Menschen, die andere als den Bodensatz der Gesellschaft bezeichnen. Warum? Weil er Ungerechtigkeit verabscheut und überzeugt ist, dass jeder Mensch einen fairen Prozess verdient.
Mit Sebastian Rudd hat John Grisham seinen brillantesten, eigenwilligsten und lebendigsten Helden geschaffen. Der Gerechte ist hart, clever und packend und zeigt den Meister des Justizthrillers in Höchstform.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Buch
Sebastian Rudd ist Anwalt. Seine Kanzlei ist ein Lieferwagen, eingerichtet mit Bar, Kühlschrank und Waffenschrank. Rudd arbeitet allein, sein einziger Vertrauter ist sein Fahrer. Rudd verteidigt jene Menschen, die von anderen als Bodensatz der Gesellschaft bezeichnet werden. Warum? Weil er Ungerechtigkeit verabscheut und überzeugt ist, dass jeder Mensch einen fairen Prozess verdient.
Mit Sebastian Rudd hat John Grisham seinen brillantesten, eigenwilligsten und lebendigsten Helden geschaffen. Der Gerechte ist hart, clever und packend und zeigt den Meister des Justizthrillers in Höchstform.
Zum Autor
John Grisham hat 28 Romane, ein Sachbuch, einen Erzählband und fünf Jugendbücher veröffentlicht. Seine Bücher wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Er lebt in Virginia.
JOHN
GRISHAM
DER GERECHTE
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Kristiana Dorn-Ruhl,
Bea Reiter und Imke Walsh-Araya
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
Rogue Lawyer bei Doubleday, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt
und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen
unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie
die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung,
Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung,
insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann
straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten,
so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung,
da wir uns diese nicht zu eigen machen,
sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt
der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Copyright © 2015 by Belfry Holdings, Inc.
Copyright © 2016 der deutschen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Oliver Neumann
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie
Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung
eines Fotos von © Thomas J. Peterson/Getty Images
Satz: Leingärtner, Nabburg
Herstellung: Helga Schörnig
e-ISBN 978-3-641-18816-0V001
www.heyne.de
Teil 1
MISSACHTUNG DES GERICHTS
1
Mein Name ist Sebastian Rudd, und ich bin Strafverteidiger. Obwohl ich ziemlich prominent bin, werden Sie meinen Namen weder auf Werbetafeln, Bussen noch in großen Lettern auf dem Einband der Gelben Seiten finden. Ich zahle nicht dafür, ins Fernsehen zu kommen, dennoch bin ich oft auf dem Bildschirm zu sehen. Mein Name steht in keinem Telefonbuch. So etwas wie eine herkömmliche Kanzlei habe ich nicht. Ich trage legal eine Waffe, weil mein Name und mein Gesicht die Sorte von Menschen anziehen, die selbst Waffen tragen und kein Problem damit haben, sie zu benutzen. Ich lebe allein und schlafe für gewöhnlich auch allein. Für Freundschaften fehlen mir Geduld und Verständnis. Die Justiz ist mein Leben, was rund um die Uhr vollen Einsatz verlangt und hin und wieder von Erfolg gekrönt ist. Jemand hat einmal den Satz geprägt, die Justiz sei wie eine eifersüchtige Geliebte. Für mich ist sie mehr wie eine herrische Ehefrau, die das Budget kontrolliert. Es gibt kein Entrinnen.
Zurzeit muss ich in billigen Motels nächtigen, jede Woche in einem anderen. Nicht dass ich Geld sparen will. Nein, ich versuche, am Leben zu bleiben. Es gibt jede Menge Leute, die mich umbringen wollen, und einige davon haben das ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht. Im Studium sagt einem keiner, dass man vielleicht eines Tages jemanden verteidigt, dessen Verbrechen so abscheulich ist, dass selbst friedliche Bürger den Drang verspüren, zur Waffe zu greifen und zu drohen, den Angeklagten, dessen Rechtsanwalt und auch gleich noch den Richter zu erschießen.
Ich wurde schon häufiger bedroht. Das gehört dazu, wenn man ausschließlich echte Übeltäter verteidigt, eine Nische, in die ich mehr oder weniger per Zufall hineingeriet. Als ich vor zehn Jahren mit dem Studium fertig war, gab es kaum Arbeit für frischgebackene Anwälte. Zähneknirschend nahm ich einen Teilzeitjob als Pflichtverteidiger an. Danach landete ich in einer kleinen, unrentablen Kanzlei, die nur Strafsachen machte. Als die Kanzlei wenige Jahre später pleiteging, stand ich auf der Straße, wie viele andere, die ebenfalls verzweifelt versuchten, sich über Wasser zu halten.
Durch einen Fall wurde ich dann bekannt. »Berühmt« kann man es nicht nennen, denn welcher Anwalt in einer Stadt mit einer Million Einwohnern kann schon von sich sagen, er sei berühmt? Es gibt natürlich jede Menge kleine Lichter im Ort, die sich für superprominent halten. Sie betteln auf Werbetafeln mit Zahnpastalächeln um Firmenpleiten oder bringen in Fernsehwerbespots wortreich ihre Sorge um den Gesundheitszustand potenzieller Mandanten zum Ausdruck. Allerdings müssen sie für ihre Auftritte bezahlen – im Gegensatz zu mir.
Die billigen Motels wechseln wöchentlich. Ich stecke mitten in einem Prozess in einem trostlosen Kaff namens Milo, zwei Stunden entfernt von der Stadt, in der ich wohne. Ich habe die Pflichtverteidigung für Gardy Baker übernommen, einen achtzehnjährigen retardierten Schulversager, dem vorgeworfen wird, zwei kleine Mädchen umgebracht zu haben. Es geht um eines der schlimmsten Verbrechen, die ich je erlebt habe, und ich habe schon viele gesehen. Meine Mandanten sind fast immer schuldig, also verschwende ich nicht viel Zeit damit, mir Gedanken darüber zu machen, ob sie ihr Urteil verdienen. Gardy jedoch ist unschuldig, was allerdings keinen interessiert. Für Milo zählt nur, dass er zum Tode verurteilt und hingerichtet wird, damit sich die Stadt endlich besser fühlen und zur Normalität übergehen kann. Welche Normalität? Ich habe keine Ahnung, und es ist mir auch egal. Dieser Ort bewegt sich seit fünfzig Jahren rückwärts in der Zeit, und ein lausiges Urteil wird daran nichts ändern. Man hört und liest, dass Milo einen »Schlussstrich« brauche, was immer das heißen soll. Man muss schon sehr beschränkt sein, um zu glauben, dass diese Stadt plötzlich blühen und gedeihen und mehr Toleranz entwickeln wird, nur weil Gardy die Nadel gesetzt bekommt.
Mein Auftrag ist vielschichtig und kompliziert und zugleich ziemlich einfach. Ich werde vom Staat dafür bezahlt, einen Angeklagten zu verteidigen, der eines Kapitalverbrechens beschuldigt wird, erstklassig und nach allen Regeln der Kunst, in einem Gerichtssaal, in dem mir niemand zuhört. Gardy wurde praktisch am Tag seiner Verhaftung verurteilt, sein Prozess ist nur noch eine Formalität. In tumbem Eifer erfanden die Polizisten alle Anklagepunkte und fälschten Beweismittel. Der Staatsanwalt weiß das, hat aber kein Rückgrat, zumal er nächstes Jahr wieder ins Amt gewählt werden will. Der Richter schläft. Die Geschworenen sind nette, einfache Menschen, die mit großen Augen der Verhandlung folgen und mehr als bereit sind, die Lügen ihrer Staatsvertreter im Zeugenstand zu glauben.
Milo verfügt zwar über eine Reihe billiger Motels, doch ich kann mich unmöglich in der Stadt aufhalten. Man würde mich lynchen oder häuten oder auf dem Scheiterhaufen verbrennen, bestenfalls würde mir ein Heckenschütze eine Kugel zwischen die Augen jagen, dann wäre es wenigstens schnell vorbei. Beamte der State Police, nicht lokale Polizisten, sollen mich während des Prozesses beschützen, doch ich habe den Eindruck, dass sie ihre Aufgabe nicht ernst nehmen. Sie starren mich genauso an wie die meisten anderen Menschen in Milo. Für sie bin ich ein Eiferer mit langen Haaren, der krank im Kopf sein muss, weil er sich für die Rechte von Kindermördern und dergleichen Abschaum einsetzt.
Momentan hause ich in einem Hampton Inn fünfundzwanzig Autominuten von Milo entfernt, für sechzig Dollar die Nacht, die ich später vom Staat erstattet bekommen werde. Im Zimmer nebenan wohnt Partner, mein ständiger Begleiter. Partner ist von massiger Statur, stets schwer bewaffnet und trägt immer schwarze Anzüge. Er ist mein Chauffeur, Bodyguard, Vertrauter, Assistent, Golfcaddie und einziger Freund. Seit ihn eine Jury für nicht schuldig befunden hat, einen verdeckten Drogenermittler getötet zu haben, ist er mir treu ergeben. Wir verließen den Gerichtssaal Arm in Arm und sind seither unzertrennlich. Mindestens zweimal haben Polizisten außer Dienst versucht, ihn umzubringen. Einmal hatten sie es auf mich abgesehen.
Noch haben wir uns nicht kleinkriegen lassen. Auch wenn wir immer mit gesenktem Kopf herumlaufen.
2
Um acht Uhr morgens klopft Partner an meine Tür. Es ist Zeit. Wir wünschen uns einen guten Morgen und steigen in meinen Wagen, einen aufwendig umgebauten, großen schwarzen Ford-Transporter. Da mir das Fahrzeug als Büro dient, wurden die Rücksitze so angepasst, dass man sie an einen Tisch drehen kann, der sich an die Wand klappen lässt. Es gibt ein Sofa, auf dem ich des Öfteren die Nacht verbringe. Alle Fensterscheiben sind geschwärzt und kugelsicher. Außerdem zur Ausstattung gehören ein Fernseher, eine Stereoanlage, Internet, Kühlschrank, eine Bar, zwei Schusswaffen und ein Satz Kleidung zum Wechseln. Ich setze mich neben Partner auf den Beifahrersitz, und wir wickeln Frühstückssandwichs mit Würstchen aus der Packung, während wir vom Parkplatz rollen. Zwei Polizeiwagen in Zivil eskortieren uns nach Milo, einer vor uns, der andere hinter uns. Die letzte Todesdrohung kam vor zwei Tagen per E-Mail.
Partner redet nur, wenn er angesprochen wird. Ich habe diese Regel nicht aufgestellt, aber ich finde sie großartig. Es macht ihm überhaupt nichts aus, wenn lange Pausen im Gespräch entstehen, ebenso wenig wie mir. Nachdem wir jahrelang praktisch gar nicht miteinander gesprochen haben, haben wir gelernt, uns über Nicken und Zwinkern wortlos zu verständigen. Auf halbem Weg nach Milo schlage ich eine Akte auf und fange an, mir Notizen zu machen.
Der Doppelmord war so abscheulich, dass keiner der ortsansässigen Anwälte sich darauf einlassen wollte. Dann wurde Gardy verhaftet. Ein Blick genügt, und man weiß, er war es. Lange, pechschwarz gefärbte Haare, ein erstaunliches Sortiment von Piercings vom Hals aufwärts und Tattoos über den restlichen Körper verteilt, passende Stahlohrringe, farblose kalte Augen und ein Grinsen, das nichts anderes sagt als: »Klar, ich hab’s getan, na und?« Als zum ersten Mal in der Lokalzeitung von Milo über ihn berichtet wurde, hieß es, er sei »Mitglied einer satanischen Sekte, die für sexuellen Missbrauch von Kindern bekannt ist«.
So viel zum Thema objektive Berichterstattung. Gardy war nie Mitglied einer Sekte, und der angebliche Kindesmissbrauch ist nicht das, wonach es aussieht. Doch von diesem Moment an war Gardy schuldig, und ich kann immer noch nicht fassen, dass wir bis jetzt durchgehalten haben. Sie wollten ihn schon vor Monaten aufknüpfen.
Natürlich hatte jeder Anwalt in Milo die Tür verriegelt und das Telefon abgestellt. Es gibt in der Stadt kein staatlich finanziertes Büro für Pflichtverteidiger, dafür ist sie zu klein. Mittellose Mandanten werden vom Richter freischaffenden Anwälten zugewiesen. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass die jungen Anwälte diese schlecht bezahlten Fälle übernehmen, weil (1) irgendjemand sie erledigen muss und weil (2) die älteren das auch gemacht haben, als sie jung waren. Doch niemand erklärte sich bereit, Gardy zu verteidigen, und wenn ich ehrlich bin, kann ich ihnen das nicht verdenken. Es ist ihre Stadt, ihr Leben, und sich an die Seite eines Psychomörders zu stellen kann eine Karriere im Keim ersticken.
Als Gesellschaft wollen wir glauben, dass auch jemand, der ein schweres Verbrechen begangen hat, einen fairen Prozess verdient. Doch manche haben Probleme mit der Vorstellung, dass man dafür einen kompetenten Verteidiger braucht. Anwälte wie ich hören immer wieder die Frage: »Wie kann man so einen Abschaum vertreten?«
»Jemand muss es tun«, entgegne ich dann, ehe ich mich abwende.
Wollen wir wirklich faire Prozesse? Nein. Wir wollen Gerechtigkeit, und das schnell. Und was ist Gerechtigkeit? Das, was wir von Fall zu Fall dafür halten.
Es könnte genauso gut sein, dass wir nicht an faire Prozesse glauben, weil wir so etwas gar nicht haben. Die Unschuldsvermutung gilt längst nicht mehr. Die Beweislast ist nichts als eine Posse, weil die Beweise allzu oft lügen. Hinreichende Schuld bedeutet: Wenn es hinreichend wahrscheinlich ist, dass er die Tat begangen hat, wird er von der Straße geholt.
Jedenfalls machten sich sämtliche Anwälte aus dem Staub, sodass Gardy keinen hatte. Es sagt viel über meinen Ruf aus – das kann man positiv oder negativ sehen –, dass es nicht lange dauerte, bis mein Telefon klingelte. In diesem Winkel des Bundesstaats weiß in Justizkreisen jeder: Wenn du sonst niemanden findest, ruf Sebastian Rudd an. Der übernimmt jeden Fall.
Nachdem Gardy verhaftet worden war, strömte vor dem Gefängnis eine Meute zusammen, die nach Gerechtigkeit rief. Während die Polizei ihn in Ketten zu dem Transporter führte, der ihn zum Gericht bringen sollte, beschimpfte ihn die Menge und bewarf ihn mit Tomaten und Steinen. Das Lokalblatt berichtete ausführlich darüber, und sogar die regionalen Abendnachrichten brachten einen Beitrag. Ich bettelte den Richter um eine Verlegung des Gerichtsortes an, mindestens hundertfünfzig Kilometer entfernt, damit wir wenigstens ein paar Geschworene finden würden, die den Jungen nicht beworfen oder am Abendbrottisch über ihn geschimpft hatten. Vergeblich. Alle Anträge, die ich im Vorfeld des Verfahrens einreichte, wurden abgelehnt.
Die Stadt will Gerechtigkeit. Die Stadt will einen Schlussstrich ziehen.
Als wir auf der Rückseite des Gerichts in eine kurze Einfahrt einbiegen, ist zwar kein Mob da, aber ein paar der üblichen Agitatoren haben sich eingefunden. Sie stehen hinter einer Polizeibarrikade in der Nähe und halten deprimierende Transparente mit schlauen Sprüchen hoch wie: »Hängt den Babykiller«, »Satan wartet schon« und »Rudd raus aus Milo«. Es sind etwa ein Dutzend arme Irre, die sich versammelt haben, um mir entgegenzujohlen und, noch wichtiger, ihren Hass auf Gardy zu demonstrieren, der in etwa fünf Minuten eintreffen wird. In den Anfangstagen des Prozesses zog das Grüppchen noch Kameras an, und ein paar der Demo-Teilnehmer schafften es sogar in die Zeitung, mitsamt ihren Schildern. Das spornte sie natürlich an, und seither sind sie jeden Morgen da. Fat Susie hält das »Rudd raus«-Schild hoch und macht ein Gesicht, als wollte sie mich sofort erschießen. Bullet-Bob behauptet, mit einem der toten Mädchen verwandt gewesen zu sein (die Schwestern waren), und wird mit einem Satz zitiert, der sinngemäß bedeutet, dass der Prozess sowieso Zeitverschwendung sei.
Leider hat er damit recht.
Als der Van gehalten hat, steigt Partner aus und eilt auf meine Seite, wo sich drei junge Polizeibeamte zu ihm gesellen, die genauso breit sind wie er. Ich steige aus und begebe mich bestens abgeschirmt zur Hintertür des Gerichtsgebäudes, während Bullet-Bob mich als »Hure« beschimpft. Wieder einmal geschafft. Mir ist nicht bekannt, dass in jüngerer Zeit ein Strafverteidiger während eines laufenden Verfahrens auf dem Weg ins Gericht niedergeschossen wurde. Aber ich habe mich mit dem Gedanken vertraut gemacht, dass es für alles ein erstes Mal gibt.
Wir steigen eine schmale Hintertreppe hoch, und ich werde in die Wartezelle geführt, einen kleinen fensterlosen Raum, wo früher Gefängnisinsassen warten mussten, ehe sie dem Richter vorgeführt wurden. Wenige Minuten später erscheint Gardy, unverletzt. Partner verlässt den Raum und schließt die Tür.
»Wie geht’s?«, frage ich, als wir allein sind.
Gardy lächelt und reibt sich die Handgelenke, die für ein paar Stunden nicht gefesselt sein werden. »Ganz gut, glaube ich. Hab nicht viel geschlafen.« Er hat auch nicht geduscht, weil er sich vor dem Duschen fürchtet. Hin und wieder hat er es versucht, doch sie stellen das warme Wasser nicht für ihn an. Also stinkt Gardy nach altem Schweiß und dreckigen Laken, und ich bin dankbar, dass er von der Jury weit genug entfernt ist. Die schwarzen Haare entfärben sich allmählich, und seine Haut wird zunehmend blasser. Er bleicht vor den Augen der Geschworenen förmlich aus, was die als ein weiteres Zeichen für seine animalische Seite und sein Faible für Satan nehmen.
»Was passiert heute?«, fragte er mit fast kindlicher Neugier. Mit einem IQ von siebzig ist er nur ganz knapp überhaupt schuldfähig und für eine Hinrichtung qualifiziert.
»Leider wieder nur das Gleiche, Gardy. Immer wieder das Gleiche.«
»Können Sie nicht machen, dass die aufhören zu lügen?«
»Nein.«
Der Staat hat keine objektiven Beweise, die Gardy mit den Morden in Verbindung bringen. Nicht einen einzigen. Statt aber diesen Mangel an Beweisen zu berücksichtigen und den Fall neu zu überdenken, tut der Staat, was er häufig tut: mit Lügen und Falschaussagen alles niederwalzen.
Gardy hat sich zwei Wochen lang im Gerichtssaal mit geschlossenen Augen die Lügen angehört und dazu den Kopf geschüttelt. Er kann den Kopf stundenlang schütteln. Die Geschworenen müssen ihn für geisteskrank halten. Ich habe ihm gesagt, dass er damit aufhören soll, dass er sich gerade hinsetzen und einen Stift in die Hand nehmen soll, mit dem er etwas auf einen Block kritzelt, als hätte er ein Hirn und wollte sich wehren. Doch das kann er einfach nicht, und ich darf bei Gericht keinen Streit mit meinem Mandanten vom Zaun brechen. Ich habe ihm auch gesagt, dass er die Tattoos an Armen und Hals bedecken soll, doch er trägt sie mit Stolz. Ich habe ihm gesagt, er soll die Piercings ablegen, doch er besteht darauf, er selbst zu sein. Die schlauen Leute, die das Gefängnis von Milo leiten, verbieten Piercings aller Art, außer natürlich man heißt Gardy und ist auf dem Weg in seine eigene Verhandlung. Dann darf man sie überall im Gesicht tragen. Sieh möglichst schaurig und krank und satanisch aus, Gardy, dann fällt es deinen Mitmenschen noch leichter, dich schuldig zu sprechen.
An einem Nagel hängt ein Kleiderbügel mit dem weißen Hemd und der Baumwollhose, die er bis jetzt jeden Tag anhatte. Ich habe das billige Outfit bezahlt. Langsam öffnet er den Reißverschluss seines orangefarbenen Gefängnisoveralls und steigt hinaus. Er trägt keine Unterwäsche, was mir gleich am ersten Tag aufgefallen ist und was ich seither zu ignorieren versuche. Es dauert, bis er sich angezogen hat. »So viele Lügen«, sagt er.
Und er hat recht. Der Staat hat bislang neunzehn Zeugen aufgerufen, und kein Einziger davon konnte der Versuchung widerstehen, Lügen zu erzählen oder zumindest hier und da etwas auszuschmücken. Der Pathologe, der die Autopsie im kriminaltechnischen Labor gemacht hat, erklärte der Jury, die beiden kleinen Opfer seien ertrunken; allerdings sei die »stumpfe Gewalteinwirkung« auf ihre Köpfe ein »erschwerender Faktor« gewesen. Der Staatsanwaltschaft ist es am liebsten, wenn die Jury glaubt, die Mädchen seien vergewaltigt und bewusstlos geprügelt worden, ehe sie in den Teich geworfen wurden. Es gibt keinerlei objektive Beweise dafür, dass sie sexuell missbraucht wurden, doch das hat die Staatsanwaltschaft nicht im Mindesten davon abgehalten, diesen Punkt für ihre Argumentationslinie zu verwenden. Ich zankte mich drei Stunden lang mit dem Pathologen, doch es ist schwer, mit einem Fachmann zu streiten, selbst wenn er noch so inkompetent ist.
Da der Staat keine Beweise hat, muss er welche erfinden. Die absurdeste Zeugenaussage kam von einem Knastspitzel namens Smut. Smut ist ein erfahrener Lügenerzähler, der regelmäßig vor Gericht aussagt und alles erzählt, was der Staatsanwalt von ihm hören will. In Gardys Fall war es so, dass Smut gerade wegen einer Drogensache wieder einmal hinter Gittern saß und eine Haftzeit von zehn Jahren vor sich hatte. Die Polizei brauchte Aussagen, und selbstverständlich stand Smut gern zu ihrer Verfügung. Sie lieferten ihm Einzelheiten des Verbrechens und verlegten Gardy anschließend von einer regionalen Haftanstalt in das Bezirksgefängnis, in dem Smut einsaß. Gardy hatte keine Ahnung, warum er transferiert wurde und dass er geradewegs in eine Falle tappte. (Das war, ehe ich hinzukam.) Sie steckten Gardy in Smuts kleine Zelle, der ihm jede erdenkliche Hilfe anbot. Er behauptete, er hasse die Cops und kenne ein paar gute Anwälte. Er habe von den Morden an den beiden Mädchen gelesen und wisse unter Umständen, wer sie wirklich getötet habe. Da Gardy nichts über die Morde wusste, konnte er dazu nichts sagen. Dennoch behauptete Smut vierundzwanzig Stunden später, dass er ein Geständnis gehört habe. Die Polizei holte ihn aus der Zelle, und Gardy sah ihn nicht wieder – bis zum Prozess. Als Zeuge erschien Smut ordentlich in Hemd und Krawatte mit frischem Haarschnitt, die Tattoos vor den Geschworenen verborgen. Erstaunlich detailgetreu berichtete er von Gardys »Ausführungen« darüber, wie der den beiden Mädchen in den Wald gefolgt sei, sie von ihren Fahrrädern gestoßen, geknebelt und gefesselt habe, sie dann gequält, missbraucht und geprügelt habe, um sie schließlich in den Teich zu werfen. In Smuts Version war Gardy mit Drogen vollgepumpt und hatte Heavy Metal gehört.
Was für ein Auftritt. Ich wusste, dass alles gelogen war, ebenso wie Gardy und Smut sowie die Polizeibeamten und der Staatsanwalt, und vermutlich hatte auch der Richter seine Zweifel. Die Geschworenen indessen schluckten schwer vor Entsetzen und starrten hasserfüllt auf meinen Mandanten, der das mit geschlossenen Augen und Kopfschütteln hinnahm. Nein, nein, nein. Smuts Aussage war so atemberaubend grausam und mit Details gespickt, dass es wirklich kaum zu glauben war, dass er alles erfunden hatte. Niemand kann so lügen wie er.
Ich nahm Smut acht Stunden lang in die Zange, einen ganzen zermürbenden Tag lang. Der Richter war schlecht gelaunt, die Jury übernächtigt, doch ich hätte eine ganze Woche so weitermachen können. Ich fragte ihn, wie oft er schon in Strafverfahren ausgesagt habe. Er meinte, vielleicht zweimal. Ich holte die Unterlagen hervor, half seinem Gedächtnis auf die Sprünge und ging alle anderen neun Prozesse durch, in denen er für unsere aufrichtigen und gerechten Staatsanwälte ebenfalls Wunder vollbracht hatte. Nachdem seine vage Erinnerung wieder etwas geschärft war, fragte ich ihn, wie oft seine Strafe schon reduziert worden sei, nachdem er vor Gericht gelogen habe. Er sagte, nie, also ging ich noch einmal alle neun Verfahren durch. Ich legte die Akten vor, um allen, insbesondere den Geschworenen, klarzumachen, dass Smut ein notorischer Lügner war, der Falschaussagen lieferte und im Gegenzug Strafmilderung bekam.
Ich gebe zu, ich kann mich bei Gericht ereifern, und das ist oft kontraproduktiv. Bei Smut verlor ich die Nerven und hackte so erbarmungslos auf ihn ein, dass einige der Geschworenen Mitleid bekamen. Irgendwann forderte mich der Richter auf, zur Tagesordnung überzugehen, doch ich folgte nicht. Ich hasse Lügner, vor allem solche, die schwören, die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit, und dann falsch aussagen, dass sich die Balken biegen, um meinen Mandanten ans Messer zu liefern. Ich brüllte Smut an, der Richter brüllte mich an, und eine Zeit lang schien es, als würden alle ziellos durcheinanderbrüllen. Das war Gardys Sache nicht gerade zuträglich.
Man sollte meinen, der Staatsanwalt hätte in seiner Parade aus Lügnern wenigstens einen glaubwürdigen Zeugen zu bieten, doch dazu wäre eine gewisse Intelligenz nötig. Sein nächster Zeuge war ebenfalls ein Häftling, wieder ein Junkie, der aussagte, dass er in der Nähe von Gardys Zelle im Flur gestanden und dessen Geständnis gegenüber Smut gehört habe.
Lügen über Lügen.
»Bitte machen Sie, dass die aufhören«, sagt Gardy.
»Ich versuche es, Gardy. Ich tue, was ich kann. Wir müssen los.«
3
Ein Polizeibeamter führt uns in den Gerichtssaal, der wieder voller Menschen ist und vor angespannter Besorgnis vibriert. Es ist der zehnte Tag der Zeugenaussagen, und inzwischen glaube ich, dass in diesem Kaff sonst nichts passiert. Wir bieten Abwechslung! Der Saal ist bis auf den letzten Platz besetzt, sogar an den Wänden stehen Besucher. Zum Glück ist es draußen kühl, sonst würde uns allen der Schweiß auf der Stirn stehen.
Bei Mordprozessen müssen immer zwei Verteidiger zugegen sein. Mein Kollege Trots ist ein dicker, dummer Junge, der seine Lizenz lieber verbrennen und den Tag verfluchen sollte, an dem er beschlossen hat, vor einem Gericht aufzutreten. Er stammt aus einer Kleinstadt dreißig Kilometer entfernt, weit genug, wie er dachte, um ihn vor den Unannehmlichkeiten zu schützen, die mit dem Gardy-Albtraum einhergehen. Trots hatte sich freiwillig für die Prozessvorbereitung gemeldet und eigentlich geplant abzuspringen, sollte es tatsächlich zu einem Prozess kommen. Der Plan ging allerdings schief. Er vermasselte die Vorbereitung wie ein echter Anfänger und versuchte dann, sich aus der Affäre zu ziehen. Doch der Richter ließ ihn nicht. Trots freundete sich mit der Idee an, in der zweiten Reihe zu sitzen, um Erfahrungen zu sammeln, den Druck eines echten Prozesses zu spüren und so weiter, doch nach mehreren Todesdrohungen gab er auf. Zu meinem Alltag gehören Todesdrohungen genauso wie mein Morgenkaffee und lügende Polizisten.
Ich reichte drei Anträge ein, um Trots loszuwerden, die selbstverständlich alle abgelehnt wurden. Und so haben Gardy und ich einen Volltrottel am Hals, der alles andere als eine Hilfe ist, ganz im Gegenteil. Trots hat sich so weit wie möglich von uns weggesetzt, was ich ihm angesichts von Gardys mangelnder Hygiene nicht einmal verdenken kann.
Gardy hat mir erzählt, dass Trots bei seiner ersten Vernehmung im Bezirksgefängnis regelrecht empört war, als er sagte, er sei unschuldig. Sie hätten sich deswegen sogar gestritten. Verhält sich so ein engagierter Verteidiger?
Und so sitzt Trots am anderen Ende des Tisches, den Kopf über sein nutzloses Gekritzel gebeugt, ohne zu sehen oder zu hören, und spürt die Blicke all derer im Nacken, die uns hassen und uns mitsamt unserem Mandanten aufknüpfen wollen. Trots glaubt, dass auch dieser Kelch an ihm vorübergehen wird und er mit Leben und Laufbahn weitermachen kann, sobald dieser Prozess abgeschlossen ist. Aber da hat er sich geschnitten. Ich werde sobald wie möglich eine Beschwerde bei der Anwaltskammer einreichen, in der ich ihm »unzureichende juristische Assistenz« im Vorfeld und während des Prozesses bescheinigen werde. Ich habe so etwas schon öfter getan, und ich weiß, wie das aussehen muss, damit es nachhaltig wirkt. Ich trage meine eigenen Kämpfe mit der Kammer aus und weiß, wie es läuft. Wenn ich mit Trots fertig bin, wird er nichts anderes mehr wollen, als seine Lizenz abzugeben und sich einen Job bei einem Gebrauchtwagenhändler zu suchen.
Gardy sitzt in der Mitte des Tisches. Trots sieht seinen Mandanten nicht an und spricht auch nie mit ihm.
Staatsanwalt Huver kommt auf uns zu und reicht mir ein Blatt Papier. Grußlos. Wir sind so weit jenseits selbst der hohlsten Höflichkeitsphrasen, dass schon das leiseste Brummen eine Überraschung wäre. Ich hasse diesen Mann genauso, wie er mich hasst, doch ich habe einen Vorteil in diesem Spiel. Ich habe beinahe monatlich mit selbstgerechten Staatsanwälten zu tun, die lügen, betrügen, mauern, vertuschen, die berufsethischen Richtlinien ignorieren und alles für einen Schuldspruch tun, selbst wenn sie die Wahrheit kennen und wissen, dass sie im Unrecht sind. Ich kenne die Brut also, diese Unterklasse von Juristen, die über dem Recht zu stehen glauben, weil sie sich für das Recht halten. Huver dagegen kommt selten in Berührung mit Kalibern wie mir, weil er – gewiss zu seinem Leidwesen – selten mit Sensationsfällen zu tun hat und praktisch nie mit Angeklagten, die sich von einem Pitbull wie mir beschützen lassen. Wenn er öfter mit solchen Fällen konfrontiert würde, dann würde er uns vermutlich souveräner hassen. Ich hingegen habe darin mehr Übung, weil für mich der Hass zum täglichen Leben gehört.
Ich nehme das Blatt und frage: »Wer ist heute Ihr Lügner des Tages?«
Ohne zu antworten, geht er die wenigen Meter zurück zu seinem Tisch, wo seine kleine Assistentenbande in dunklen Anzügen sitzt und wichtig die Köpfe zusammensteckt und für die eigenen Fans posiert. Das hier ist die größte Show ihrer erbärmlichen Provinzkarriere, und ich habe immer wieder den Eindruck, dass jeder aus dem Büro des Bezirksstaatsanwalts, der gehen, sprechen, einen billigen Anzug und eine neue Aktenmappe tragen kann, sich mit an diesen Tisch klemmen darf, um dem Recht zum Sieg zu verhelfen.
Der Gerichtsdiener kläfft, ich erhebe mich, Richter Kaufman tritt ein, wir setzen uns. Gardy weigert sich, zu Ehren des großen Mannes aufzustehen. Anfangs war der Richter deswegen sauer. Am ersten Tag des Prozesses – es kommt mir vor, als wäre das Monate her – fuhr er mich an: »Mr. Rudd, würden Sie Ihrem Mandanten bitte sagen, dass er sich erheben soll?«
Ich folgte der Aufforderung, doch Gardy weigerte sich. Das wiederum war peinlich für den Richter, und wir sprachen später in seinem Büro darüber. Er drohte, meinen Mandanten wegen Missachtung des Gerichts während des gesamten Prozesstages in der Zelle zu lassen. Ich ermutigte ihn dazu, ließ jedoch durchblicken, dass eine derartige Überreaktion in einem Berufungsverfahren gewiss große Beachtung finden würde.
Gardy bemerkte dazu nur weise: »Was können die mir denn antun, was sie mir nicht schon angetan haben?« Und so beginnt Richter Kaufman jeden Morgen die Zeremonie mit einem langen, bösen Blick auf meinen Mandanten, der sich für gewöhnlich auf seinem Stuhl fläzt und in der Nase bohrt oder mit geschlossenen Augen nickt. Es ist unmöglich zu sagen, wen Kaufman mehr hasst, Anwalt oder Mandant. Ganz wie der Rest von Milo ist er seit Langem von Gardys Schuld überzeugt. Und wie alle anderen in diesem Gerichtssaal hat er mich vom ersten Tag an verachtet.
Aber das macht nichts. In meiner Branche hat man selten Verbündete und macht sich sehr schnell Feinde.
Da er genauso wie Huver nächstes Jahr im Amt bestätigt werden will, setzt Kaufman sein falsches Politikerlächeln auf und begrüßt die Anwesenden zu einem neuen spannenden Tag auf der Suche nach der Wahrheit. Berechnungen zufolge, die ich einmal in der Mittagspause gemacht habe, als der Saal leer war, sitzen jetzt etwa dreihundertzehn Menschen hinter mir. Alle bis auf zwei, nämlich Gardys Mutter und Schwester, beten fieberhaft für seine rasche Hinrichtung. Die zu ermöglichen liegt ganz bei Richter Kaufman, dem Richter, der bislang sämtliche Falschaussagen der Staatsanwaltschaft zugelassen hat. Manchmal scheint es mir, als fürchtete er, jedes Mal eine Stimme zu verlieren, wenn er einem meiner Einsprüche stattgibt.
Als alle sitzen, werden die Geschworenen hereingeholt. Es sind vierzehn Personen – die zwölf Auserwählten plus zwei Ersatzkandidaten, falls einer krank wird oder etwas falsch macht. Sie sind nicht kaserniert (obwohl ich das beantragt habe), dürfen also nach Hause gehen und beim Abendessen über Gardy und mich herziehen. Der Richter ermahnt sie jeden Tag, bevor sie gehen, kein Wort über den Fall zu verlieren, doch man hört sie förmlich im Auto auf dem Heimweg lästern. Ihre Entscheidung ist längst gefallen. Wenn sie jetzt abstimmen würden, noch bevor wir einen einzigen Zeugen der Verteidigung gehört haben, würden sie Gardy für schuldig befinden und seine Hinrichtung fordern. Dann würden sie als Helden heimkehren und den Rest ihres Lebens von seinem Prozess erzählen. Wenn Gardy die Nadel bekommt, werden sie stolz sein auf die besondere Rolle, die sie bei der Urteilsfindung gespielt haben. Sie werden jemand sein in Milo. Sie werden in ihrer Kirche Anerkennung finden, man wird ihnen gratulieren, sie auf der Straße ansprechen.
Immer noch verschnupft, begrüßt Kaufman sie, bedankt sich dafür, dass sie ihre staatsbürgerliche Pflicht erfüllen, und fragt mit ernster Miene, ob ein Dritter versucht habe, Kontakt zu ihnen aufzunehmen, mit dem Ziel, sie zu beeinflussen. Darauf folgen meist ein paar Blicke in meine Richtung, als hätte ich die Zeit, Kraft und Dummheit, abends auf den Straßen von Milo herumzustreichen, um den Geschworenen aufzulauern und sie (1) zu bestechen, (2) einzuschüchtern oder (3) anzuflehen. Inzwischen gilt das Dogma, dass ich der einzige Abtrünnige im Saal bin, trotz der mannigfaltigen Sünden, die von der anderen Seite begangen werden.
Die Wahrheit ist: Hätte ich genügend Geld, Zeit und Personal, würde ich tatsächlich sämtliche Geschworenen bestechen und/oder einschüchtern. Wenn der Staat mit seinen unbegrenzten Ressourcen einen Scheinprozess führt, in dem bei jeder Gelegenheit betrogen wird, ist Betrug legitim. Dann gibt es keine Chancengleichheit und keine Fairness, und die einzige ehrenhafte Alternative für den Verteidiger eines unschuldigen Mandanten ist der Betrug.
Wird ein Verteidiger beim Betrügen ertappt, muss er oder sie mit Sanktionen des Gerichts rechnen, mit Abmahnung oder gar Klage durch die Anwaltskammer. Wird ein Staatsanwalt erwischt, dann wird er entweder wiedergewählt oder zum Richter befördert. Unser System zieht schlechte Staatsanwälte nicht zur Verantwortung.
Die Geschworenen versichern dem Richter, dass alles bestens sei. »Mr. Huver«, verkündet er in feierlichem Ton, »bitte rufen Sie Ihren nächsten Zeugen auf.« Nun sagt ein fundamentalistischer Pfarrer aus, der das alte Chrysler-Autohaus in den »World Harvest Temple« umgebaut hat und jetzt zu täglichen sogenannten Betathlons größere Menschenmengen um sich schart. Ich habe ihn einmal im Regionalfernsehen gesehen, und das hat mir gereicht. Er ist heute hier, weil er in einem seiner abendlichen Jugendgottesdienste auf Gardy getroffen sein will. Seiner Geschichte zufolge trug Gardy das T-Shirt einer Heavy-Metal-Band mit einer nicht näher benannten satanischen Botschaft, und mithilfe dieses T-Shirts habe der Teufel den Gottesdienst unterminieren können. Der spirituelle Unfrieden, der in der Luft gelegen habe, habe dem Herrgott nicht gefallen, doch dank göttlicher Weisung sei es ihm, dem Pfarrer, gelungen, die Quelle des Bösen zu verorten, woraufhin er die Musik gestoppt und Gardy hinausgeworfen habe.
Gardy sagt, er sei nie auch nur in der Nähe dieser Kirche gewesen. Er versichert, dass er in seinem ganzen achtzehnjährigen Leben nie in einer Kirche gewesen sei. Seine Mutter bestätigt das. Gardys Familie sind »fiese Heiden«, wie man hier auf dem Land sagt.
Warum die Aussage in diesem Mordprozess zugelassen wird, ist ganz und gar unbegreiflich, denn sie ist absurd und grenzenlos dumm. Angenommen, es kommt zu einer Verurteilung, wird dieser ganze Mist in etwa zwei Jahren von einem leidenschaftslosen Revisionsgericht in hundertfünfzig Kilometer Entfernung erneut durchgekaut werden. Die neuen Richter, die auch nur unwesentlich intelligenter sind als Kaufman – man wird ja bescheiden –, werden mit trüben Augen auf diesen Provinzpfarrer und seine Lügengeschichte über einen Vorfall blicken, der angeblich dreizehn Monate vor den Morden stattgefunden hat.
Einspruch, Euer Ehren. Abgewiesen. Einspruch, Euer Ehren! Abgewiesen!
Huver braucht jedoch den Satan für seine These. Nachdem Richter Kaufman vor einigen Tagen alles erlaubt hat, ist jetzt alles möglich. Allerdings nur so lange, bis ich mit meinen Zeugen komme. Wenn wir Glück haben, werden von uns vielleicht hundert Worte in die Akten aufgenommen.
Der Pfarrer hat Steuerschulden in einem anderen Staat. Er weiß nicht, dass ich das herausgefunden habe, und so werden wir beim Kreuzverhör ein bisschen Spaß haben. Nicht dass das etwas ändern wird. Die Jury hat längst abgeschlossen. Gardy ist ein Monster, das in die Hölle gehört. Ihre Aufgabe ist es, ihn möglichst schnell dort hinzuschicken.
Er beugt sich zu mir und flüstert: »Mr. Rudd, ich schwöre, ich war nie in der Kirche.«
Ich nicke lächelnd, weil das alles ist, was ich tun kann. Ein Verteidiger darf nicht immer glauben, was ihm sein Mandant erzählt, doch wenn Gardy sagt, dass er nie in der Kirche war, glaube ich ihm.
Der Pfarrer ist ein Choleriker, und ich habe ihn recht schnell auf hundertachtzig. Ich nutze die nicht bezahlte Steuer, um ihn zu reizen, und sobald er richtig sauer ist, bleibt er das auch. Ich verwickle ihn in Debatten über die Unfehlbarkeit der Bibel, die Dreifaltigkeit, die Apokalypse, darüber, wie es ist, in fremden Zungen zu sprechen, mit Schlangen zu spielen, Gift zu trinken, und darüber, wie viel Einfluss satanische Sekten in der Gegend um Milo haben. Huver brüllt »Einspruch!«, Kaufman gibt statt. Einmal schließt der Pfarrer mit rot angelaufenem Gesicht frömmlerisch die Augen und hebt die Hände hoch über den Kopf. Instinktiv ducke ich mich und sehe zur Decke, als ob mich gleich der Blitz treffen könnte. Später nennt er mich »Atheist« und prophezeit mir, ich würde in die Hölle fahren.
»Sie haben also die Macht, Leute in die Hölle zu schicken?«, feuere ich zurück.
»Gott sagt mir, dass Sie in die Hölle kommen werden.«
»Dann schalten Sie ihn auf Lautsprecher, damit wir das alle hören können.«
Zwei Geschworene grinsen. Wir haben den ganzen Vormittag mit diesem scheinheiligen kleinen Arschloch und seiner Falschaussage verschwendet, doch er ist nicht der erste Einheimische, der sich einen Weg in diesen Prozess gebahnt hat. Die Stadt ist voll mit Möchtegern-Helden.
4
Die Mittagspause ist immer ein Genuss. Da es für uns nicht sicher ist, den Saal, geschweige denn das Gebäude zu verlassen, bleiben Gardy und ich am Tisch der Verteidigung sitzen und essen dort ein Sandwich. Wir bekommen das gleiche Essen wie die Jury. Es werden sechzehn Mahlzeiten gebracht; sie werden gemischt, dann werden unsere beiden willkürlich ausgewählt und die übrigen an die Geschworenen verteilt. Das war meine Idee, weil ich ungern vergiftet werden möchte. Gardy hat keinen Schimmer von alldem, er ist einfach nur hungrig. Er sagt, das Essen im Gefängnis sei so, wie man es erwarte, und er traue den Wärtern nicht. Folglich isst er dort gar nichts und lebt praktisch nur von diesem Sandwich. Ich habe Richter Kaufman gefragt, ob das County vielleicht die Portion vergrößern und dem Jungen zwei Gummihuhn-Sandwichs mit extra Pommes und Gurken geben könne. Mit anderen Worten, zwei Portionen statt einer. Abgelehnt.
Und so bekommt Gardy die Hälfte meines Sandwichs und alle meine koscher eingelegten Gurken. Wenn ich nicht selbst kurz vor dem Verhungern wäre, würde ich ihm meine komplette Portion geben.
Partner kommt und geht im Verlauf des Tages. Er will unseren Transporter nicht zu lange an einer Stelle stehen lassen, um aufgeschlitzte Reifen und eingeschlagene Scheiben zu vermeiden. Außerdem hat er ein paar Aufgaben zu erledigen, unter anderen die, sich gelegentlich mit dem Bischof zu treffen.
In Fällen, bei denen ich auf vermintes Gebiet muss, also etwa in eine Kleinstadt, die sich längst verbündet hat, um einen der ihren für ein schreckliches Verbrechen zu töten, dauert es eine Weile, bis ich einen Kontakt gefunden habe. Der Kontakt ist stets ein Anwalt, ortsansässig, der ebenso wie ich wöchentlich Kriminelle und Arschlöcher gegen Polizei und Staatsanwaltschaft verteidigt. Irgendwann meldet sich der Kontakt, vorsichtig, weil er fürchtet, als Verräter entlarvt zu werden. Er weiß, was wirklich passiert ist, zumindest ungefähr. Er kennt die Beteiligten, die Bösewichte und den einen oder anderen Guten. Da sein Überleben davon abhängt, dass er mit Polizei, Gerichtsangestellten und Staatsanwaltschaft auskommt, kennt er das System.
In Gardys Fall heißt mein Maulwurf Jimmy Bressup. Wir nennen ihn »Bischof«. Ich bin ihm nie begegnet. Wir halten Kontakt über Partner, und die beiden treffen sich an den ausgefallensten Orten. Partner sagt, er sei um die sechzig, habe langes, schütteres graues Haar, fluche gern lautstark, kleide sich schlecht, sei streitlustig und dem Alkohol zugetan. »Eine ältere Version von mir?«, fragte ich. »Nicht ganz«, erwiderte er weise. Trotz seines großen Mundwerks und Gepolters wagt es der Bischof nicht, Gardys Verteidiger zu nahe zu kommen.
Der Bischof sagt, Huver und seine Bande wüssten inzwischen, dass sie den Falschen haben; sie hätten aber zu viel investiert, um ihren Irrtum jetzt noch zuzugeben. Er meint, es habe vom ersten Tag an Gerüchte über den wahren Täter gegeben.
5
Es ist Freitag, und alle im Saal sind erschöpft. Ich rede eine Stunde lang auf einen pickligen, dummen kleinen Rotzlöffel ein, der behauptet, bei dem Jugendgottesdienst gewesen zu sein, wo Gardy angeblich die Dämonen gerufen und den Frieden gestört habe. Ganz ehrlich, ich habe schon wirklich üble Falschaussagen erlebt, aber das hier übertrifft alles. Nicht nur, dass die Aussage falsch ist, sie ist auch noch völlig irrelevant. Kein anderer Staatsanwalt würde sich damit aufhalten. Kein anderer Richter würde sie überhaupt zulassen. Kaufman verkündet schließlich eine Vertagung der Verhandlung über das Wochenende.
Gardy und ich treffen uns wieder in der Wartezelle, wo er seinen Gefängnisoverall anzieht, während ich Gemeinplätze von mir gebe und ihm ein schönes Wochenende wünsche. Ich reiche ihm zehn Dollar für die Snackautomaten. Er sagt, dass morgen seine Mutter kommen und ihm Zitronenkekse bringen werde, seine Lieblingskekse. Manchmal ließen die Wärter die Kekse durchgehen, erzählt er, manchmal behielten sie sie. Man wisse es nie genau. Die Wärter wiegen jeder etwa hundertvierzig Kilo, sie werden die gestohlenen Kalorien wohl brauchen. Ich trage Gardy auf, er soll sich übers Wochenende duschen und die Haare waschen.
»Mr. Rudd«, sagt er. »Wenn ich eine Rasierklinge finde, bin ich weg.« Er fährt sich mit dem Zeigefinger über das Handgelenk.
»Sag so was nicht, Gardy.« Er hat das schon öfter gesagt, und er meint es ernst. Der Junge hat nichts, wofür es sich zu überleben lohnt, und er ist schlau genug, um zu wissen, was auf ihn zukommt. Ein Blinder mit Krückstock würde das sehen. Wir geben uns die Hand, und ich eile die Treppe hinunter. Partner und die Polizeibeamten erwarten mich am Hinterausgang und begleiten mich zum Wagen. Wieder mal geschafft, heil rauszukommen.
Außerhalb von Milo nicke ich ein und schlafe bald fest. Zehn Minuten später vibriert mein Telefon, und ich nehme ab. Wir folgen dem Polizeiwagen zu unserem Motel, wo wir unsere Sachen packen und auschecken. Bald sind wir allein und auf dem Weg in die Stadt.
»Hast du den Bischof gesehen?«, frage ich Partner.
»Ja. Es ist Freitag, und ich denke, er fängt freitags gegen Mittag an zu trinken. Nur Bier, das war ihm wichtig mitzuteilen. Also habe ich ein Sixpack gekauft, und wir sind rumgefahren. Die Kneipe ist ein echtes Bumslokal, Richtung Osten, am Stadtrand. Er meint, Peeley ist dort Stammgast.«
»Du hattest also auch schon ein paar Bier? Soll ich fahren?«
»Nur eins, Chef. Ich habe dran genippt, bis es irgendwann warm war. Der Bischof hat seine geleert, solange sie kalt waren. Drei Flaschen hintereinander.«
»Sollen wir diesem Mann glauben?«
»Ich mache nur meine Arbeit. Einerseits ist er glaubwürdig, weil er sein ganzes Leben hier verbracht hat und jeden kennt. Andererseits sondert er so viel Mist ab, dass man ihm am liebsten kein Wort abkaufen würde.«
»Wir werden sehen.« Ich schließe die Augen und versuche, wieder zu schlafen. Während eines Mordprozesses ist an Schlaf praktisch nicht zu denken, und ich habe gelernt, jede Gelegenheit für ein Nickerchen zu nutzen. In der Mittagspause habe ich mir zehn Minuten auf einer harten Sitzbank im Gerichtssaal gegönnt, nachdem ich morgens um drei in meinem schäbigen Motelzimmer hellwach auf und ab gewandert bin. Oft döse ich mitten im Satz ein, während Partner am Steuer sitzt und der Motor schnurrt.
Irgendwann auf dem Weg zurück in unsere Version von Zivilisation nicke ich ein.
6
Es ist der dritte Freitag im Monat, und an diesem Abend habe ich regelmäßig ein Date, wenn man zwei Drinks in einem Lokal mit einer Frau so bezeichnen möchte. Es fühlt sich jedenfalls mehr an, als müsste ich zu einer Wurzelbehandlung. Die Wahrheit ist, dass Judith Whitly unter anderen Umständen nicht einmal unter vorgehaltener Waffe mit mir ausgehen würde, und diese Gefühle beruhen auf Gegenseitigkeit. Doch wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Wir treffen uns immer in derselben Bar, an dem Tisch, wo wir in einem anderen Leben zum ersten Mal zusammen gegessen haben. Mit Nostalgie hat das nichts zu tun, mehr mit Bequemlichkeit. Die Bar gehört zu einer Kette, doch das Ambiente ist nicht schlecht, und an Freitagabenden ist immer viel los.
Judith kommt immer als Erste und besetzt unsere Nische. Erst wenn sie allmählich ungeduldig wird, erscheine ich. Sie ist noch nie zu spät gekommen und betrachtet Unpünktlichkeit als Schwäche. Ihrer Ansicht nach zeige ich viele Anzeichen von Schwäche. Sie ist Anwältin wie ich, und so haben wir uns auch kennengelernt.
»Du siehst fertig aus«, sagt sie ohne eine Spur von Mitgefühl. Ihr Gesicht weist ebenfalls Spuren von Müdigkeit auf, dennoch ist sie mit ihren neununddreißig Jahren immer noch umwerfend schön. Jedes Mal wenn ich sie sehe, weiß ich wieder, warum es mich damals so hart getroffen hat.
»Danke. Du siehst toll aus wie immer.«
»Danke.«
»Noch zehn Tage, dann geht uns der Sprit aus.«
»Irgendwas Positives?«
»Noch nicht.« Sie weiß grundsätzlich über Gardys Fall und den Prozess Bescheid, und sie kennt mich. Wenn ich glaube, dass der Junge unschuldig ist, reicht ihr das. Doch sie hat ihre eigenen Mandanten, die ihr den Schlaf rauben. Wir bestellen das Gleiche wie immer, sie ein Glas Chardonnay und ich Whiskey Sour.
Wir trinken zwei Gläser in einer knappen Stunde, dann war’s das wieder für einen Monat. »Wie geht’s Starcher?«, frage ich. Ich hoffe immer noch, dass mir der Name meines Sohnes eines Tages über die Lippen geht, ohne dass ich mich fast übergeben muss. Mein Name auf seiner Geburtsurkunde weist mich als seinen Erzeuger aus, doch ich war nicht in der Nähe, als er zur Welt kam. Deshalb hat Judith den Namen gewählt. Es sollte ein Nachname sein, falls er überhaupt jemals benutzt wird.
»Gut«, sagt sie süffisant, weil sie das Leben des Kindes voll und ganz teilt und ich nicht. »Ich habe letzte Woche mit seiner Lehrerin gesprochen, und sie ist zufrieden mit seinen Fortschritten. Sie meint, er ist ein ganz normaler Zweitklässler, liest gut und hat Spaß am Leben.«
»Das freut mich«, sage ich. Das Schlüsselwort in diesem kurzen Bericht ist »normal«, und zwar wegen unserer gemeinsamen Vergangenheit. Starcher hat alles andere als eine normale Kindheit. Er verbringt die Hälfte der Zeit mit Judith und ihrer Lebensgefährtin und die andere Hälfte mit ihren Eltern. Vom Kreißsaal hat Judith das Baby mit in die Wohnung genommen, die sie mit Gwyneth teilte, der Frau, für die sie mich verlassen hatte. Die folgenden drei Jahre versuchten die zwei, Starcher offiziell zu adoptieren, wogegen ich mich mit Klauen und Zähnen wehrte. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren. Ich konnte nur Gwyneth nicht ausstehen. Und ich behielt recht. Es dauerte nicht lange, und die beiden trennten sich nach einem heftigen Streit, den ich von meiner linken Ecke aus weidlich genoss.
Doch es wird noch komplizierter. Die Getränke kommen, aber wir warten nicht aufeinander, um uns höflich »zum Wohl« zu wünschen. Das wäre nur Zeitverschwendung. Wir brauchen den Alkohol sofort.
Ich überbringe schlechte Nachrichten. »Meine Mutter kommt nächste Woche, und sie möchte Starcher gern sehen. Schließlich ist er ihr Enkelkind.«
»Das weiß ich«, faucht sie. »Es ist dein Wochenende. Du kannst machen, was du willst.«
»Das stimmt, aber du verkomplizierst die Dinge gern. Ich will nur keinen Ärger, das ist alles.«
»Deine Mutter ist der personifizierte Ärger.«
Das sind wahre Worte, und ich nicke ergeben. Es wäre eine dramatische Untertreibung zu sagen, dass Judith und meine Mutter sich von Beginn an gehasst haben. Es ging so weit, dass meine Mutter drohte, sie würde mich enterben, wenn ich Judith heiratete. Zu dem Zeitpunkt hatte ich selbst schon meine Zweifel an unserer Beziehung und einer gemeinsamen Zukunft, und diese Drohung bestärkte mich. Ich rechne zwar damit, dass meine Mutter mindestens hundert wird, doch ihr Nachlass ist ein Traum. Ein Typ mit meinem Einkommen braucht etwas, wovon er träumen kann.
Eine Fußnote in dieser Geschichte ist, dass meine Mutter ihr Testament oft benutzt, um ihre Kinder zu gängeln. Meine Schwester wurde enterbt, weil sie einen Republikaner geheiratet hat. Zwei Jahre später wurde der Republikaner, der in Wahrheit ein richtig netter Kerl ist, Vater der tollsten Enkelin der Weltgeschichte. Und jetzt ist meine Schwester wieder als Erbin eingesetzt. Das nehmen wir zumindest an.
Jedenfalls stand ich kurz davor, mit Judith Schluss zu machen, als sie mit der niederschmetternden Nachricht kam, dass sie schwanger sei. Statt ihr die Gretchenfrage zu stellen, akzeptierte ich meine Vaterschaft ohne Weiteres. Später erfuhr ich die brutale Wahrheit, nämlich dass sie zu der Zeit schon mit Gwyneth zusammen war. Ein echter Schlag unter die Gürtellinie. Bestimmt hat es Anzeichen gegeben, dass meine Liebste in Wirklichkeit eine Lesbe ist, doch die sind mir allesamt entgangen.
Wir heirateten, worauf Mom postwendend erklärte, sie werde ihr Testament umschreiben lassen und ich würde keinen Cent sehen. Fünf quälende Monate lang lebten wir mehr oder weniger zusammen, fünfzehn weitere dauerte unsere Ehe offiziell, dann trennten wir uns, um nicht endgültig den Verstand zu verlieren. Starcher wurde mitten in den Rosenkrieg hineingeboren, ein Kollateralschaden von Geburt an, und seither fauchen wir uns gegenseitig an. Unser Ritual, einmal im Monat etwas zusammen trinken zu gehen, ist eine Hommage an zivilisiertes Benehmen.
Ich glaube, meine Mutter hat mich inzwischen wieder ins Testament aufgenommen.
»Und was möchte die Omi mit meinem Kind unternehmen?«, fragt sie. Es ist nie »unser« Kind. Sie hat noch nie widerstehen können, diese kindischen kleinen Spitzen gegen mich loszulassen. Sie kratzt am Wundschorf, aber nicht auf clevere Art und Weise. Es ist praktisch unmöglich, darauf nicht zu reagieren; doch ich habe gelernt, mir auf die Zunge zu beißen. Meine Zunge hat schon Narben.
»Ich glaube, sie wollen in den Zoo.«
»Sie geht immer mit ihm in den Zoo.«
»Was ist so schlimm daran, in den Zoo zu gehen?«
»Na ja, nach dem letzten Mal hatte er Albträume mit Pythons.«
»Okay, ich werde sie bitten, etwas anderes mit ihm zu unternehmen.« Und schon macht sie wieder Ärger. Was ist falsch daran, mit einem halbwegs normalen Siebenjährigen in den Zoo zu gehen? Ich weiß nicht, warum wir uns immer noch sehen.
ENDE DER LESEPROBE