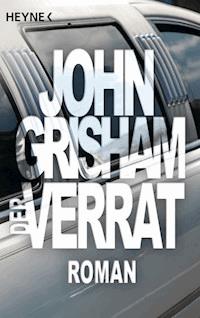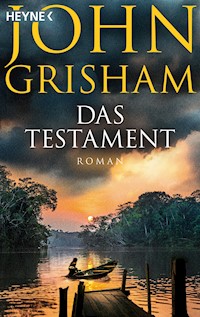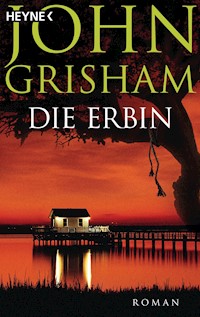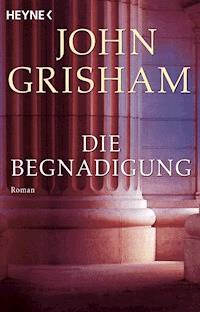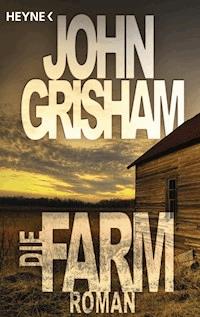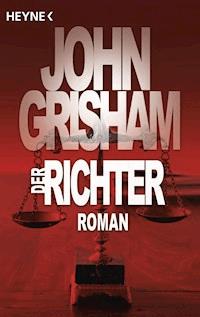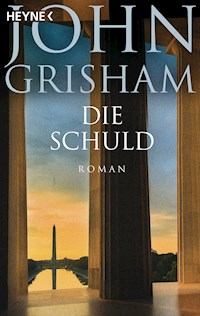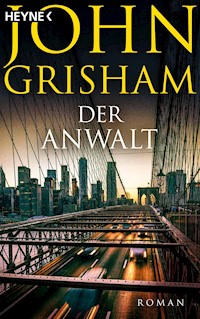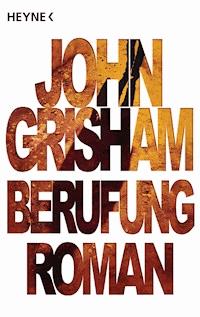9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der SPIEGEL-Bestseller erstmals im Taschenbuch
Als Harvard-Absolvent David Zinc Partner bei einer der angesehensten Großkanzleien Chicagos wird, scheint seiner Karriere nichts mehr im Weg zu stehen. Doch der Job erweist sich als die Hölle. Fünf Jahre später zieht David die Reißleine und kündigt. Stattdessen heuert er bei Finley & Figg an, einer auf Verkehrsunfälle spezialisierten Vorstadt-Kanzlei, deren chaotische Partner zunächst nicht wissen, was sie mit ihm anfangen sollen. Bis die Kanzlei ihren ersten großen Fall an Land zieht. Der Prozess könnte Millionen einspielen – die Feuertaufe für David.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 673
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
JOHNGRISHAM
VERTEIDIGUNG
JOHNGRISHAM
VERTEIDIGUNG
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Bea Reiter und Imke Walsh-Araya
Die Originalausgabe erschien unter dem TitelThe Litigators bei Doubleday, New York
Copyright © 2011 by Belfry Holdings, Inc.Copyright © 2012 der deutschen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHLektorat: Oliver NeumannUmschlaggestaltung: David Hauptmann,HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich,unter Verwendung zweier Fotos von plainpicture/Elektrons 08Satz: C. Schaber Datentechnik, WelsISBN 978-3-641-11030-7www.heyne.de
1
Die Kanzlei Finley & Figg nannte sich gern »Boutiquekanzlei«. Sooft es ging, wurde die irreführende Bezeichnung in Gesprächen wie beiläufig fallen gelassen. Hin und wieder tauchte sie auch in dem Werbematerial für die verschiedenen Aktionen auf, mit denen sich die beiden Partner um neue Klienten bemühten. Geschickt verwendet, suggerierte der Begriff, dass die Kanzlei Finley & Figg mehr war als der übliche Zweimannbetrieb. Boutique, das bedeutete klein, talentiert und auf ein bestimmtes Fachgebiet spezialisiert. Boutique war cool und chic – und das auch noch auf Französisch. Boutique signalisierte: überglücklich darüber, so klein, wählerisch und erfolgreich zu sein.
Bis auf die Größe traf allerdings nichts davon auf die Kanzlei zu. Finley & Figg bearbeitete überwiegend Personenschäden, eine tägliche Plackerei, die wenig Können oder Kreativität erforderte und beim besten Willen nicht für cool oder sexy gehalten werden konnte. Die Gewinne waren genauso schwer definierbar wie das gesellschaftliche Prestige. Die Kanzlei war klein, weil sie es sich nicht leisten konnte, größer zu werden. Sie war nur deshalb so wählerisch, weil niemand dort arbeiten wollte, einschließlich der beiden Männer, denen sie gehörte. Und mit einem vietnamesischen Massagesalon zur Linken und einem Betrieb für Rasenmäherreparaturen zur Rechten war schon nach einem flüchtigen Blick klar, dass Finley & Figg alles andere als erfolgreich war. Auf der anderen Straßenseite, direkt gegenüber, befand sich eine weitere Boutiquekanzlei – verhasste Konkurrenz –, und um die Ecke gab es noch mehr Anwälte. Genau genommen wimmelte es in der Gegend von Anwälten, von denen einige allein, andere in kleinen Kanzleien und wieder andere in ihrer eigenen Version einer Boutiquekanzlei arbeiteten.
Finley & Figg lag in der Preston Avenue, einer stark befahrenen Straße mit alten Bungalows, die umgebaut worden waren und für alle möglichen gewerblichen Tätigkeiten genutzt wurden. Es gab Einzelhandel (Spirituosen, chemische Reinigung), Dienstleistungen (Anwälte, Zahnärzte, Reparatur von Rasenmähern, Massagen) und Gastronomie (Enchiladas, Baklava und Pizza zum Mitnehmen). Oscar Finley hatte das Gebäude vor zwanzig Jahren bei einem Prozess zugesprochen bekommen. Was der Adresse der Kanzlei an Prestige fehlte, machte sie durch ihre Lage wett. Zwei Türen weiter kreuzten sich drei Straßen – Preston, Beech und Thirty-eighth – in einem chaotischen Aufeinandertreffen von Asphalt und Verkehr, das pro Woche mindestens einen lukrativen Unfall garantierte, häufig gleich mehrere. Finley & Figg deckte seine Fixkosten mit Verkehrsunfällen, die sich in weniger als einhundert Meter Entfernung zur Kanzlei ereigneten. Von Zeit zu Zeit schlichen Vertreter anderer Kanzleien – Boutique und sonstige – durch die Gegend, in der Hoffnung, einen billigen Bungalow mieten zu können, in dem gierige Anwälte das Kreischen von Reifen und das Knirschen von Metall hören konnten.
Da die Kanzlei nur aus zwei Anwälten/Partnern bestand, lag es nahe, dass einer Seniorpartner und der andere Juniorpartner war. Der Seniorpartner war Oscar Finley, zweiundsechzig Jahre alt, gut dreißig Jahre Erfahrung in der hemdsärmeligen Variante der Juristerei, die in dieser verrufenen Gegend im Südwesten Chicagos praktiziert wurde. Oscar war früher Streifenpolizist gewesen, aber aus dem Dienst entlassen worden, weil er ein paar Schädel zu viel eingeschlagen hatte. Um ein Haar wäre er im Gefängnis gelandet, doch stattdessen hatte er ein Erweckungserlebnis und ging erst aufs College und dann an die juristische Fakultät. Als ihn nach Abschluss seines Studiums keine Kanzlei einstellen wollte, machte er seinen eigenen Laden auf und fing an, jeden zu verklagen, der in seine Nähe kam. Zweiunddreißig Jahre später konnte er es kaum glauben, dass er seine Karriere damit verschwendete, ausstehende Forderungen einzuklagen und Blechschäden, Schmerzensgeldansprüche und Blitzscheidungen zu bearbeiten. Er war immer noch mit seiner ersten Frau verheiratet, einer furchtbaren Person, von der er sich am liebsten scheiden lassen würde. Aber er konnte es sich nicht leisten. Nach zweiunddreißig Jahren als Anwalt konnte sich Oscar Finley so gut wie nichts leisten.
Sein Juniorpartner – Oscar sagte gern »Darum wird sich mein Juniorpartner kümmern«, wenn er Richter, andere Anwälte und vor allem potenzielle Mandanten beeindrucken wollte – war Wally Figg, fünfundvierzig. Wally hielt sich für einen knallharten Prozessanwalt, und in seiner marktschreierischen Werbung versprach er alle möglichen Arten von aggressivem Verhalten. »Wir kämpfen für Ihre Rechte!« und »Wir sind der Schrecken der Versicherungsgesellschaften!« und »Wir meinen es ernst!«. Wallys Anzeigen prangten auf Parkbänken, Stadtbussen, Taxis, Programmen von Footballspielen der Highschools, ja selbst auf Telefonmasten, obwohl er damit gleich gegen mehrere Verordnungen verstieß. Zwei entscheidende Werbeträger waren allerdings tabu – Fernsehen und Plakatwände. Diesbezüglich stritten sich Wally und Oscar regelmäßig. Oscar weigerte sich, Geld dafür auszugeben – beides war ausgesprochen teuer –, und Wally war noch bei der Planung. Er träumte davon, sein lächelndes Gesicht in einem Fernsehspot zu sehen, und stellte sich vor, wie er Schauergeschichten über Versicherungsgesellschaften erzählte und verletzten Fernsehzuschauern – die so schlau waren, bei der eingeblendeten gebührenfreien Telefonnummer anzurufen – gewaltige Summen aus Schadenersatzklagen versprach.
Aber Oscar wollte nicht einmal für eine Plakatwand zahlen … dabei hatte sich Wally schon eine ausgesucht. Sechs Häuserblocks von der Kanzlei entfernt, an der Ecke Beech und Thirty-second, hoch über dem tosenden Verkehr, auf dem Dach eines vierstöckigen Mietshauses stand sie, die beste Plakatwand im Stadtgebiet von Chicago. Zurzeit wurde gerade billige Unterwäsche angepriesen (allerdings an einem sehr attraktiven Model, wie Wally zugeben musste). Aber die Plakatwand wartete nur darauf, seinen Namen und sein Gesicht zu tragen. Trotzdem weigerte sich Oscar.
Wally hatte an der renommierten juristischen Fakultät der University of Chicago studiert. Oscars Abschluss in Jura stammte von einem obskuren, inzwischen nicht mehr bestehenden Institut, das Abendkurse angeboten hatte. Beide mussten dreimal zur Anwaltsprüfung antreten. Wally hatte vier Scheidungen hinter sich; Oscar konnte nur von Scheidung träumen. Wally wollte den ganz großen Fall, den großen Coup, der ihm ein paar Millionen Dollar an Honorar einbrachte. Oscar wollte nur zwei Dinge – sich scheiden lassen und in den Ruhestand gehen.
Wie die beiden Männer Partner einer Kanzlei geworden waren, die in einem umgebauten Wohnhaus in der Preston Avenue residierte, war eine andere Geschichte. Und wie sie es schafften, sich nicht ständig an die Gurgel zu gehen, war jeden Tag aufs Neue ein Rätsel.
Ihre Schiedsrichterin war Rochelle Gibson, eine kräftige Schwarze mit Esprit und gesundem Menschenverstand, Eigenschaften, die sie sich dort erworben hatte, wo sie herkam. Ms. Gibson kümmerte sich um die Organisation der Kanzlei – Telefon, Empfang, die neuen Mandanten, die voller Hoffnung eintraten, die schlecht gelaunten Mandanten, die verärgert wieder gingen, gelegentlich anfallende Schreibarbeiten (allerdings hatten ihre Chefs gelernt, dass es erheblich schneller ging, wenn sie sich selbst an die Tastatur setzten), den Bürohund und – was am wichtigsten war – die ständigen Auseinandersetzungen zwischen Oscar und Wally.
Ms. Gibson war vor Jahren bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, an dem sie keine Schuld trug. Um für die Schmerzen und die erlittene Unbill entschädigt zu werden, hatte sie sich durch die Kanzlei Finley & Figg vertreten lassen, wenn auch nicht ganz freiwillig. Vierundzwanzig Stunden nach dem Unfall war Ms. Gibson im Krankenhaus aufgewacht, vollgepumpt mit Schmerzmitteln, durch zahlreiche Gipsverbände zur Bewegungsunfähigkeit verdammt, und hatte das grinsende Gesicht von Wally Figg über sich gesehen. Er trug aquamarinblaue OP-Kleidung, hatte ein Stethoskop um den Hals hängen und spielte sehr überzeugend Arzt. Wally brachte sie mit einem Trick dazu, eine Vertretungsvollmacht zu unterschreiben, und versprach ihr das Blaue vom Himmel. Dann schlich er sich so leise aus dem Zimmer, wie er gekommen war, und schaffte es tatsächlich, ihren Fall zu verpfuschen. Sie bekam gerade einmal vierzigtausend Dollar, die ihr Mann innerhalb weniger Wochen vertrank und verspielte, was zu einer Scheidungsklage führte, in der sie von Oscar Finley vertreten wurde. Er kümmerte sich auch um ihre Insolvenz. Ms. Gibson war von keinem der beiden Anwälte sonderlich beeindruckt und drohte, sie wegen Verletzung der Anwaltspflichten zu verklagen. Das schreckte die beiden auf – man hatte sie schon öfter mit derartigen Klagen gepeinigt –, und sie gaben sich alle Mühe, ihre renitente Mandantin versöhnlich zu stimmen. Als sich Ms. Gibsons Beschwerden häuften, war sie so oft in der Kanzlei, dass sie schon fast zum Inventar gehörte, und mit der Zeit gewöhnten sich die drei aneinander.
Finley & Figg war kein einfacher Arbeitsplatz für eine Sekretärin. Das Gehalt war lausig, die Mandanten waren in der Regel unausstehlich, die gegnerischen Anwälte am Telefon unhöflich, die Arbeitszeiten lang. Doch das Schlimmste waren die beiden Partner. Oscar und Wally hatten es mit älteren Sekretärinnen versucht, aber die konnten mit dem Stress nicht umgehen. Sie hatten es mit jungen Sekretärinnen versucht, was ihnen eine Klage wegen sexueller Belästigung eingebracht hatte – Wally hatte ein vollbusiges junges Ding begrapscht. (Sie einigten sich außergerichtlich auf einen Vergleich und zahlten fünfzigtausend Dollar an die junge Dame, konnten aber nicht verhindern, namentlich in den Zeitungen erwähnt zu werden.) Rochelle Gibson war zufällig in der Kanzlei, als eines Morgens wieder einmal eine Sekretärin das Handtuch warf und zur Tür hinausstürmte. Während das Telefon ununterbrochen klingelte und die beiden Partner einander anbrüllten, setzte sich Ms. Gibson an den Empfang und glättete die Wogen. Dann kochte sie Kaffee. Am nächsten Tag war sie wieder da. Und am übernächsten auch. Acht Jahre später war sie immer noch Büroleiterin der Kanzlei.
Ihre Söhne saßen im Gefängnis. Wally hatte sie vertreten, wobei fairerweise gesagt werden muss, dass es niemanden gab, der sie hätte retten können. Als Teenager hielten die beiden Wally mit einer ganzen Reihe von Festnahmen wegen verschiedener Drogensachen in Atem. Sie rutschten immer tiefer in die Dealerszene, und Wally warnte sie wiederholt, dass sie auf das Gefängnis oder den Tod zusteuerten. Das sagte er auch zu Ms. Gibson, die wenig Einfluss auf ihre Söhne hatte und oft darum betete, dass sie im Gefängnis landeten. Als der Crackring der beiden aufflog, wurden sie hinter Gitter geschickt. Wally schaffte es, das Schuldmaß von zwanzig Jahren auf zehn zu reduzieren, was ihm allerdings keinen Dank von den Jungs einbrachte. Ms. Gibson dagegen bedankte sich unter Tränen. In der ganzen Zeit hatte Wally ihr keine einzige Rechnung für die anwaltliche Vertretung ihrer beiden Söhne geschickt.
Im Laufe der Jahre hatte es viele Tränen in Ms. Gibsons Leben gegeben, die häufig hinter verschlossener Tür in Wallys Büro vergossen wurden. Er gab ihr Ratschläge und versuchte zu helfen, wo es ging, doch sein größtes Verdienst bestand darin, dass er ihr zuhörte. Bei Wallys unstetem Lebenswandel konnte es allerdings schnell passieren, dass sich die Rollen umkehrten. Als seine letzten beiden Ehen den Bach runtergingen, war Ms. Gibson diejenige, die zuhörte und Zuspruch spendete. Und als es mit seiner Trinkerei immer schlimmer wurde, scheute sie sich nicht, ihn damit zu konfrontieren. Obwohl sie sich jeden Tag in den Haaren lagen, waren ihre Streitereien nie von langer Dauer und fanden häufig nur statt, um die Grenzen abzustecken.
Bei Finley & Figg gab es Zeiten, in denen alle drei grummelten oder schmollten, was meist finanzielle Gründe hatte. Der Markt war übersättigt, es gab zu viele Anwälte, die nach Mandanten suchten.
Ein weiterer Anwalt war das Letzte, was die Kanzlei gebrauchen konnte.
2
David Zinc verließ die Linie L an der Quincy Station im Stadtzentrum Chicagos, und er schaffte es auch, die Treppe hinunterzugehen, die zur Wells Street führte – doch mit seinen Füßen stimmte etwas nicht. Sie wurden immer schwerer und seine Schritte immer langsamer. An der Ecke Wells und Adams blieb er stehen und starrte auf seine Schuhe, als könnte er dort einen Anhaltspunkt dafür finden, was mit ihm los war. Nichts, nur die Schnürschuhe aus schwarzem Leder, die von jedem männlichen Anwalt in seiner Kanzlei getragen wurden und von einigen der Frauen auch. Sein Atem ging stoßweise, und trotz der Kälte waren seine Achselhöhlen nass vor Schweiß. Er war einunddreißig Jahre alt, mit Sicherheit zu jung für einen Herzinfarkt, und obwohl er seit fünf Jahren nicht mehr genügend Schlaf bekam, hatte er gelernt, mit der ständigen Müdigkeit zu leben. Das dachte er zumindest. Er bog um eine Ecke und sah den Trust Tower vor sich, ein glitzerndes, an einen Phallus erinnerndes Ungetüm, das dreihundertdreißig Meter in die Wolken und den Nebel ragte. Als er stehen blieb, den Kopf in den Nacken legte und nach oben starrte, begann sein Herz zu rasen. Ihm wurde schlecht. Passanten rempelten ihn an, als sie sich an ihm vorbeidrängten. Er überquerte die Adams in einer dichten Menschentraube und trottete weiter.
Das Atrium des Trust Tower war nach oben offen, mit Unmengen von Marmor und Glas und einer abstrakten Skulptur, die Wärme ausstrahlen sollte, in Wirklichkeit jedoch kalt und unnahbar wirkte, zumindest auf David. Sechs kreuzweise angeordnete Rolltreppen beförderten Horden müder Krieger zu ihren Arbeitsplätzen in den Großraumbüros. David versuchte es, doch seine Füße weigerten sich, ihn zu einer Rolltreppe zu bringen. Stattdessen setzte er sich auf eine lederbezogene Bank neben einem Haufen großer, bemalter Steinbrocken und versuchte zu verstehen, was mit ihm geschah. Menschen eilten an ihm vorbei, grimmig aussehend, mit tiefen Ringen unter den Augen, dabei war es doch erst 7.30 Uhr an diesem grauen Morgen.
»Ausrasten« ist natürlich kein medizinischer Fachbegriff. Experten bedienen sich einer weitaus komplexeren Sprache, um den Moment zu beschreiben, in dem es jemandem zu viel wird. Trotzdem ist es etwas Reales. Es kann in Sekundenbruchteilen geschehen, als direkte Folge eines traumatischen Ereignisses. Es kann aber auch der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt, der traurige Höhepunkt eines Prozesses, in dessen Verlauf der Druck immer größer wird, bis Körper und Geist ein Ventil finden müssen. David Zinc gehörte zu letzterer Kategorie. An jenem Morgen, nach fünf Jahren harter Arbeit mit Kollegen, die er nicht ausstehen konnte, geschah etwas mit ihm, während er neben den bemalten Steinbrocken saß und zusah, wie die gut gekleideten Zombies nach oben fuhren, um wieder einen ganzen Tag lang völlig sinnlose Arbeit zu verrichten. Er rastete aus.
»Hallo, Dave. Willst du nach oben?«, sagte jemand. Es war Al aus der Antitrust-Abteilung.
David schaffte es, zu lächeln, zu nicken und etwas zu murmeln. Dann stand er aus irgendeinem Grund auf und ging hinter Al her. Al war ihm einen Schritt voraus, als sie eine der Rolltreppen betraten, und redete über das Spiel der Blackhawks vom Abend zuvor. David nickte hin und wieder, während sie durch das Atrium nach oben schwebten. Unter und hinter ihm waren Dutzende einsamer Gestalten in dunklen Mänteln, andere junge Anwälte, die nach oben fuhren, stumm und düster, fast wie Sargträger auf einer Beerdigung im Winter. David und Al gesellten sich zu einer Gruppe, die vor den Fahrstühlen auf der ersten Ebene stand. Während sie warteten, hörte David dem Gerede über Eishockey zu, doch ihm drehte sich der Kopf, und schlecht war ihm auch schon wieder. Sie zwängten sich in den Fahrstuhl und standen Schulter an Schulter mit zu vielen anderen da. Stille. Al schwieg. Niemand sagte etwas; niemand stellte Blickkontakt her.
David sagte zu sich: »Das war’s. Ich war zum letzten Mal in diesem Fahrstuhl. Das schwöre ich.«
Der Fahrstuhl ruckelte und summte. Dann blieb er im neunundsiebzigsten Stock stehen, dem Territorium von Rogan Rothberg. Drei Anwälte stiegen aus, drei Gesichter, die David schon einmal gesehen hatte, aber nicht mit Namen kannte, was nichts Ungewöhnliches war, da die Kanzlei auf den Stockwerken neunundsechzig bis neunundneunzig sechshundert Anwälte hatte. Im dreiundachtzigsten Stock stiegen zwei weitere Anzugträger aus. Als der Fahrstuhl weiterfuhr, begann David erst zu schwitzen und dann zu hyperventilieren. Sein winziges Büro war im zweiundneunzigsten Stock, und je näher er kam, desto angestrengter pumpte sein Herz. Im neunundachtzigsten und im neunzigsten Stock verließen noch mehr düstere Gestalten den Fahrstuhl, und mit jedem Halt fühlte sich David schwächer und schwächer.
Im zweiundneunzigsten Stock waren sie nur noch zu dritt – David, Al und eine hochgewachsene Frau, die hinter ihrem Rücken »Lurch« genannt wurde, wie der Butler aus Die Addams Family. Der Fahrstuhl blieb stehen, ein dezenter Glockenton war zu hören, die Tür glitt auf, und Lurch stieg aus, gefolgt von Al. David wollte sich nicht bewegen; genau genommen konnte er sich nicht bewegen. Sekunden verstrichen. Al warf einen Blick über die Schulter und sagte: »He, Dave, das ist unser Stockwerk. Komm schon.«
Keine Antwort von David, nur der starre, leere Blick von jemandem, der gerade ganz woanders war. Die Tür begann sich zu schließen, und Al schob den Aktenkoffer dazwischen. »Alles in Ordnung mit dir?«, fragte er.
»Ja, klar«, murmelte David und schaffte es endlich, einen Schritt nach vorn zu machen. Die Tür ging wieder auf, die Glocke ertönte erneut. Er stieg aus und sah sich nervös um, als wäre er noch nie hier gewesen. Dabei war er erst vor zehn Stunden zum letzten Mal hier gewesen.
»Du siehst blass aus«, sagte Al.
Um David drehte sich alles. Er hörte die Stimme seines Kollegen, verstand aber nicht, was er sagte. Lurch war einige Meter von ihnen entfernt stehen geblieben und starrte sie verwirrt an, als würde sie gerade Zeugin eines Verkehrsunfalls werden. Der Fahrstuhl bimmelte wieder, dieses Mal mit einem anderen Ton, und die Tür begann sich zu schließen. Al sagte noch etwas, streckte sogar die Hand aus, als wollte er helfen. Plötzlich warf sich David herum, und seine bleiernen Füße erwachten zum Leben. In dem Moment, in dem sich die Fahrstuhltüren schlossen, hechtete er zurück in die Kabine. Die hysterische Stimme von Al war das Letzte, was er von draußen hörte.
Als der Fahrstuhl sich nach unten bewegte, fing David Zinc zu lachen an. Der Schwindel und die Übelkeit waren verschwunden. Der Druck auf seiner Brust ließ nach. Er hatte es getan! Er flüchtete aus dem Hamsterrad von Rogan Rothberg und beendete den Albtraum. Von all den unglücklichen Anwälten und Juniorpartnern, die in den Wolkenkratzern der Kanzlein im Stadtzentrum von Chicago arbeiteten, hatte ausgerechnet er, David Zinc, den Mut gefunden, an diesem düsteren Morgen einfach zu gehen. Er setzte sich auf den Boden des leeren Fahrstuhls, sah mit einem breiten Grinsen im Gesicht zu, wie die leuchtend roten Digitalziffern der Stockwerke rasend schnell nach unten zählten, und versuchte, Ordnung in seine Gedanken zu bringen. Die Menschen: erstens seine von ihm sträflich vernachlässigte Frau, die unbedingt schwanger werden wollte, was aber nicht klappte, weil ihr Mann zum Sex zu müde war, zweitens sein Vater, ein bekannter Richter, der ihn quasi gezwungen hatte, Jura zu studieren, natürlich in Harvard, weil das die Universität war, die auch der Richter besucht hatte, drittens sein Großvater, der Tyrann der Familie, der in Kansas City eine Megakanzlei aus dem Nichts aufgebaut hatte und selbst mit zweiundachtzig noch jeden Tag zehn Stunden arbeitete, und viertens Roy Barton, der Partner, für den er arbeitete, sein Chef, ein kompletter Vollidiot, der den ganzen Tag lang nur brüllte und fluchte und vielleicht der unausstehlichste Mensch war, den David Zinc je kennengelernt hatte. Als er an Roy Barton dachte, musste er wieder lachen.
Der Fahrstuhl hielt im neunundsiebzigsten Stock, wo zwei Sekretärinnen einstiegen. Sie zögerten kurz, als sie David sahen, der in einer Ecke saß, den Aktenkoffer neben sich. Vorsichtig stiegen sie über seine Beine und warteten darauf, dass sich die Tür schloss.
»Alles in Ordnung mit Ihnen?«, fragte die eine.
»Mir geht’s blendend«, antwortete David. »Und Ihnen?«
Keine Antwort. Die Sekretärinnen standen steif wie Bretter da und sagten während der kurzen Fahrt kein einziges Wort mehr. Im sechsundsiebzigsten Stock flüchteten sie. Als David wieder allein war, fing er an, sich Sorgen zu machen. Und wenn sie hinter ihm herkamen? Al würde sicher schnurstracks zu Roy Barton marschieren und ihm erzählen, dass Zinc ausgerastet sei. Was würde Barton tun? Für zehn Uhr war eine wichtige Besprechung mit einem erbosten Mandanten angesetzt, einem bekannten Firmenchef … Als David später über das Ganze nachdachte, kam er zu dem Schluss, dass die zu erwartende Auseinandersetzung mit dem Mandanten vermutlich der Auslöser für sein Ausrasten gewesen war. Roy Barton war nicht nur ein unangenehmer Mensch, sondern auch ein Feigling. Er brauchte David Zinc und die anderen, um sich hinter ihnen zu verstecken, wenn der Firmenchef mit einer langen Liste völlig berechtigter Beschwerden zur Tür hereinrauschte.
Vielleicht schickte ihm Roy den Sicherheitsdienst hinterher. Der bestand aus dem üblichen Aufgebot alternder Wachleute in Uniform, aber er war auch ein firmeninterner Spionagering, der Türschlösser austauschte, alles und jeden filmte und alle möglichen verdeckten Maßnahmen durchführte, damit keiner der Anwälte aus der Reihe tanzte. David sprang auf, nahm seinen Aktenkoffer und starrte nervös auf die digitalen Ziffern, die auf der Anzeigetafel blinkten. Der Fahrstuhl schwankte leicht, während er im Zentrum des Trust Tower nach unten rauschte. Als er anhielt, stieg David aus und hastete zu den Rolltreppen hinüber, auf denen sich immer noch die traurigen Gestalten stauten, die stumm nach oben schwebten. Die abwärts führenden Rolltreppen waren fast leer, und David rannte eine davon hinunter. Jemand rief: »He, Dave, wo willst du hin?« David lächelte und winkte in die Richtung der Stimme, als wäre alles in schönster Ordnung. Er ging an den bemalten Steinbrocken und der bizarren Skulptur vorbei durch eine Glastür. Dann war er draußen, und in der Luft, die kurz vorher noch feucht und trostlos gerochen hatte, lag das Versprechen eines neuen Anfangs.
David machte einen tiefen Atemzug und sah sich um. Nicht stehen bleiben. Er lief die LaSalle Street entlang und wollte vor lauter Angst keinen Blick über die Schulter werfen. Mach dich nicht verdächtig. Ganz ruhig. Das ist einer der wichtigsten Tage in deinem Leben, sagte er zu sich, also vermassele es nicht. Er konnte nicht nach Hause, weil er noch nicht bereit war für die Konfrontation mit seiner Frau. Und er konnte nicht auf der Straße bleiben, weil er dort Gefahr lief, jemanden zu treffen, den er kannte. Wo konnte er sich für eine Weile verstecken, über alles nachdenken, den Kopf freibekommen, einen Plan schmieden? Er sah auf die Uhr: 7.51. Genau die richtige Zeit zum Frühstücken. In einem Durchgang zwischen zwei Gebäuden sah er eine blinkende Neonreklame mit dem Schriftzug Abner’s in Rot und Grün. Als er darauf zuging, konnte er nicht genau erkennen, ob es ein Café oder eine Bar war. Vor der Tür sah er sich schnell um und vergewisserte sich, dass ihm der Sicherheitsdienst nicht gefolgt war. Dann betrat er die warme, dunkle Welt von Abner’s.
Es war eine Bar. Die Sitznischen zu seiner Rechten waren leer. Sämtliche Stühle waren umgedreht auf die Tische gestellt worden und warteten darauf, dass jemand den Boden putzte. Abner, der Besitzer, stand hinter der langen, blank polierten Theke aus Holz und lächelte süffisant, als wollte er sagen: »Was haben Sie hier zu suchen?«
»Haben Sie geöffnet?«, fragte David.
»War die Tür verriegelt?«, gab Abner zurück, der eine weiße Schürze trug und gerade ein Bierglas abtrocknete. Er hatte muskulöse, haarige Unterarme und trotz seiner schroffen Art das vertrauenerweckende Gesicht eines erfahrenen Barkeepers, der alle Geschichten dieser Welt schon einmal gehört hatte.
»Ich glaube nicht.« David ging langsam zur Theke. Als er einen Blick nach rechts warf, sah er einen Mann, der offenbar die Besinnung verloren hatte, aber immer noch sein Glas umklammert hielt.
David zog seinen anthrazitfarbenen Mantel aus und hängte ihn über die Lehne eines Barhockers. Dann setzte er sich, musterte die ordentlich in Reih und Glied stehenden Spirituosenflaschen vor sich, betrachtete die Spiegel und die Zapfhähne für das Bier und die zahllosen Gläser, die Abner perfekt arrangiert hatte. Als er sich alles angesehen hatte, sagte er: »Was empfehlen Sie vor acht Uhr?«
Abner sah den Mann an, dessen Kopf auf der Theke lag, und sagte: »Wie wär’s mit Kaffee?«
»Den hatte ich gerade. Gibt’s bei Ihnen Frühstück?«
»Ja. Heißt bei uns Bloody Mary.«
»Das nehme ich.«
Rochelle Gibson lebte in einer Sozialwohnung, zusammen mit ihrer Mutter, einer Tochter, zwei Enkeln, wechselnden Konstellationen von Nichten und Neffen und manchmal auch dem einen oder anderen Cousin, der gerade keinen Platz zum Schlafen hatte. Um dem Chaos zu entkommen, floh sie häufig an ihren Arbeitsplatz, obwohl es dort manchmal schlimmer zuging als zu Hause. Jeden Morgen kam sie gegen 7.30 Uhr in die Kanzlei, holte die beiden Zeitungen von der Veranda, machte das Licht an, stellte den Thermostat ein, kochte Kaffee und sah nach AJ, dem Firmenhund. Während sie ihren Pflichten nachging, summte sie, und manchmal sang sie auch leise. Obwohl sie es keinem ihrer beiden Chefs gegenüber je zugegeben hätte, war sie sehr stolz darauf, Rechtsanwaltssekretärin zu sein, auch wenn es nur eine Kanzlei wie Finley & Figg war. Fragte man sie nach ihrem Beruf, antwortete sie immer: »Rechtsanwaltssekretärin.« Keine gewöhnliche Sekretärin, nein, Rechtsanwaltssekretärin. Was ihr an Ausbildung fehlte, machte sie durch Erfahrung wett. Acht Jahre Berufspraxis in diesem Teil der Stadt hatten sie eine Menge über die Juristerei und noch mehr über Anwälte gelehrt.
AJ war ein Mischling, der in der Kanzlei lebte, weil niemand ihn mit nach Hause nehmen wollte. Er gehörte allen dreien – Rochelle, Oscar und Wally – zu gleichen Teilen, doch praktisch war Rochelle diejenige, die sich um ihn kümmerte. Der Hund war ein Streuner gewesen und hatte sich Finley & Figg vor einigen Jahren als Zuhause ausgesucht. Tagsüber schlief er in einem Körbchen in der Nähe von Rochelle, nachts streifte er durch die Kanzlei und bewachte das Haus. Er war ein passabler Wachhund und hatte mit seinem Bellen schon Einbrecher, Vandalen und sogar verärgerte Mandanten in die Flucht geschlagen.
Rochelle fütterte ihn und füllte seine Schüssel mit frischem Wasser. Dann holte sie einen Becher Erdbeerjoghurt aus dem kleinen Kühlschrank in der Küche. Als der Kaffee durchgelaufen war, nahm sie sich eine Tasse und rückte einige Dinge auf ihrem Schreibtisch zurecht, auf dem stets mustergültige Ordnung herrschte. Der Schreibtisch war aus Glas und Chrom, ein beeindruckendes Möbelstück und das Erste, was die Mandanten sahen, wenn sie zur Tür hereinkamen. Oscars Büro war einigermaßen aufgeräumt. Wallys war eine Müllkippe. Die beiden Anwälte konnten sich hinter geschlossenen Türen verstecken, doch Rochelles Arbeitsplatz sah jeder.
Sie schlug die Sun-Timesauf und fing mit der Titelseite an. Während AJ hinter ihr schnarchte, las sie, nippte an ihrem Kaffee, löffelte den Joghurt und summte leise vor sich hin. Rochelle genoss die wenigen ruhigen Minuten am frühen Morgen. Schon bald würde das Telefon zu klingeln beginnen, die Anwälte würden eintreffen und später – wenn sie Glück hatten – die Mandanten, einige mit Termin, andere ohne.
Um von seiner Frau wegzukommen, ging Oscar Finley jeden Morgen um sieben Uhr aus dem Haus, doch er war nur selten vor neun im Büro. Zwei Stunden lang fuhr er in der Stadt herum: Er hielt bei einem Polizeirevier an, wo einer seiner Cousins die Unfallberichte bearbeitete, schaute auf einen Sprung bei einem Abschleppunternehmen vorbei, um ein kleines Schwätzchen mit den Fahrern zu halten und die neuesten Gerüchte über die letzten Verkehrsunfälle zu erfahren, trank einen Kaffee mit einem Mann, der zwei Bestattungsinstitute der unteren Preisklasse betrieb, brachte Donuts zu einer Feuerwache und unterhielt sich mit den Fahrern der Rettungswagen. Gelegentlich streifte er auch durch seine Lieblingskrankenhäuser, wo er durch die Korridore ging und mit geübtem Auge jene Patienten ausfindig machte, die aufgrund der Fahrlässigkeit anderer verletzt worden waren.
Oscar war immer um neun in der Kanzlei. Bei Wally, dessen Leben weitaus weniger straff organisiert war, wusste man nie genau, wann er auftauchen würde. Er konnte um 7.30 Uhr durch die Tür stürmen, randvoll mit Koffein und Red Bull und bereit, jeden zu verklagen, der ihm über den Weg lief, oder sich bis elf Uhr Zeit lassen, um sich dann mit verschwollenen Augen und einem Kater in die Kanzlei zu schleppen und in seinem Büro zu verschwinden.
An diesem denkwürdigen Tag kam Wally jedoch kurz vor acht mit einem breiten Lächeln und klaren Augen in die Kanzlei. »Guten Morgen, Ms. Gibson«, sagte er vernehmlich.
»Guten Morgen, Mr. Figg«, erwiderte sie laut und deutlich. Das Betriebsklima bei Finley & Figg war nicht gerade das beste, und ein beiläufiger Kommentar genügte, um eine lautstarke Auseinandersetzung auszulösen. Worte wurden mit Bedacht gewählt und mit Argwohn gehört. Schon bei der Begrüßung am Morgen waren alle auf der Hut, da sie den Boden für Zank und Streit bereiten konnte. Die Anrede »Mr.« und »Ms.« klang zwar etwas gekünstelt, doch selbst dafür gab es einen Grund. Als Rochelle noch Wallys Mandantin gewesen war, hatte er einmal den Fehler gemacht, »Mädchen« zu ihr zu sagen, etwa in folgendem Zusammenhang: »Hören Sie, Mädchen, ich tue für Sie, was ich kann.« Er hatte das sicher nicht böse gemeint, und ihre überzogene Reaktion war fehl am Platz gewesen. Von diesem Moment an hatte sie darauf bestanden, mit »Ms. Gibson« angesprochen zu werden.
Sie war ein wenig gereizt, weil ihre Ruhe gestört worden war. Wally unterhielt sich kurz mit AJ und rubbelte ihm den Kopf, und als er zur Kaffeemaschine ging, fragte er: »Steht was Interessantes in der Zeitung?«
»Nein«, sagte sie, weil sie nicht über die Nachrichten reden wollte.
»Das überrascht mich nicht«, erwiderte er – die erste Spitze des Tages. Sie las die Sun-Times, er die Tribune, und jeder attestierte dem anderen schlechten Geschmack bei der Auswahl der jeweiligen Informationsquelle.
Die zweite Spitze kam nur wenige Augenblicke später, als Wally sich vor ihren Schreibtisch stellte. »Wer hat den Kaffee gekocht?«
Sie ignorierte ihn.
»Er ist ein bisschen dünn, finden Sie nicht auch?«
Rochelle blätterte langsam die Zeitung um. Dann aß sie einen Löffel Joghurt.
Wally schlürfte an seinem Kaffee, schmatzte mit den Lippen und verzog das Gesicht, als hätte er Essig geschluckt. Schließlich nahm er seine Zeitung und setzte sich an den Tisch. Bevor Oscar das Haus bei einem Prozess zugesprochen worden war, hatte jemand mehrere Wände im Erdgeschoss entfernt und dadurch einen offenen Eingangsbereich geschaffen. Auf der einen Seite, in der Nähe der Kanzleitür, hatte Rochelle ihren Arbeitsplatz. Einige Meter von ihr entfernt standen ein paar Stühle für wartende Mandanten und ein langer Tisch, der früher irgendwo als Esstisch gedient hatte. Im Laufe der Jahre hatte es sich eingebürgert, dass an diesem Tisch Zeitung gelesen und Kaffee getrunken wurde, und manchmal nahmen sie hier sogar beeidete Aussagen auf. Wenn Wally nichts zu tun hatte, schlug er an dem Tisch gern die Zeit tot, weil es in seinem Büro aussah wie in einem Schweinestall.
Mit so viel Lärm wie möglich schlug er die Tribune auf. Rochelle ignorierte ihn weiter und summte leise vor sich hin.
Einige Minuten verstrichen, dann klingelte das Telefon. Ms. Gibson schien es nicht zu hören. Es klingelte weiter. Nach dem dritten Klingeln ließ Wally die Zeitung sinken und sagte: »Ms. Gibson, wollen Sie denn nicht rangehen?«
»Nein«, erwiderte sie kurz angebunden.
Es klingelte zum vierten Mal.
»Und warum nicht?«, wollte er wissen.
Sie ignorierte ihn. Nach dem fünften Klingeln warf Wally die Zeitung hin, sprang auf und marschierte zu einem Telefon, das neben dem Kopiergerät an der Wand hing. »Wenn ich Sie wäre, würde ich nicht abnehmen«, sagte Ms. Gibson.
Er blieb stehen. »Warum nicht?«
»Das ist ein Inkassobüro.«
»Woher wissen Sie das?« Wally starrte das Telefon an. Auf dem Display stand UNBEKANNT.
»Ich weiß es eben. Das Büro ruft jede Woche um diese Zeit an.«
Das Telefon verstummte, und Wally kehrte zum Tisch und zu seiner Zeitung zurück. Er versteckte sich dahinter und fragte sich, welche Rechnung nicht bezahlt worden war, welcher Lieferant so wütend war, dass er einen Anwalt anrief und andere Anwälte unter Druck setzen ließ. Rochelle wusste es natürlich, da die Buchführung zu ihren Aufgaben gehörte und sie sowieso fast alles wusste, aber er wollte lieber nicht fragen. Wenn er fragte, würde es nicht lange dauern, bis sie anfingen, sich über Rechnungen und ausstehende Honorarzahlungen und ihre schlechte Finanzlage im Allgemeinen zu streiten, was in eine heftige Diskussion über die Gesamtstrategie der Kanzlei, deren Zukunft und die Unzulänglichkeiten der beiden Partner ausarten konnte.
Das wollte keiner von beiden.
Abner war sehr stolz auf seine Bloody Marys. Er benutzte genau bemessene Mengen Tomatensaft, Wodka, Meerrettich, Zitrone, Limone, Worcestersoße, Pfeffer, Tabasco und Salz. Und immer gab er zwei grüne Oliven ins Glas und dekorierte mit einem Stück Stangensellerie.
David hatte schon lange nicht mehr so ein gutes Frühstück gehabt. Nach zwei von Abners Meisterwerken, die er schnell hintereinander konsumierte, grinste er wie ein Honigkuchenpferd und war stolz auf seine Entscheidung, alles hinzuwerfen. Der Betrunkene am anderen Ende der Theke schnarchte friedlich. Außer ihm und David waren keine anderen Gäste da. Abner ging seinen Aufgaben hinter der Theke nach: Er spülte und trocknete Cocktailgläser ab, überprüfte die Spirituosenvorräte und polierte die Zapfhähne, während er sich mit seinem Gast über verschiedene Themen unterhielt.
Irgendwann meldete sich Davids Mobiltelefon. Es war Lana, seine Sekretärin. »Mist«, sagte er.
»Wer ist es?«, fragte Abner.
»Mein Büro.«
»Ein Mann hat das Recht darauf, in Ruhe zu frühstücken.«
David grinste wieder und nahm das Gespräch an. »Hallo?«
»David, wo sind Sie? Es ist 8.30 Uhr«, sagte Lana.
»Ich weiß, wie spät es ist, meine Liebe. Ich frühstücke gerade.«
»Ist mit Ihnen alles in Ordnung? Man erzählt sich hier, dass Sie schon im Gebäude waren, aber in einen Fahrstuhl gehechtet und verschwunden sind.«
»Das ist nur ein Gerücht, meine Liebe, nur ein Gerücht.«
»Okay, gut. Wann kommen Sie? Roy Barton hat schon angerufen.«
»Lassen Sie mich erst mal zu Ende frühstücken.«
»Selbstverständlich. Aber bleiben Sie bitte erreichbar.«
David legte sein Telefon aus der Hand, sog kräftig an seinem Strohhalm und verkündete dann: »Noch eine, bitte.«
Abner runzelte die Stirn. »Sie sollten vielleicht etwas langsamer machen.«
»Tue ich doch schon.«
»Okay.« Abner griff nach einem sauberen Glas hinter sich und fing zu mixen an. »Dann gehen Sie wohl heute nicht mehr ins Büro?«
»Korrekt. Ich habe gekündigt. Ich haue ab.«
»Wo arbeiten Sie denn?«
»In einer Anwaltskanzlei. Rogan Rothberg. Kennen Sie den Laden?«
»Hab schon mal davon gehört. Große Kanzlei, stimmt’s?«
»Sechshundert Anwälte in Chicago. Mehrere Tausend weltweit. Zurzeit die Nummer drei, was die Größe der Kanzlei angeht, die Nummer fünf bei Umsatz pro Anwalt, die Nummer vier, wenn man sich den Nettogewinn pro Partner ansieht, die Nummer zwei, wenn man die Gehälter der angestellten Anwälte vergleicht, und mit Sicherheit die Nummer eins, wenn man die Arschlöcher pro Quadratmeter zählt.«
»Ich hätte besser nicht gefragt.«
David nahm sein Mobiltelefon in die Hand. »Sehen Sie das?«
»Ich bin ja nicht blind.«
»Dieses Ding hat mein Leben die letzten fünf Jahre beherrscht. Ohne das Telefon kann ich nirgendwohin. Vorschrift. Ich muss es immer dabeihaben. Es hat mich beim Abendessen im Restaurant unterbrochen. Es hat mich aus der Dusche geholt. Es hat mich mitten in der Nacht aufgeweckt. Einmal hat es mich sogar beim Sex mit meiner armen, vernachlässigten Frau unterbrochen. Letzten Sommer war ich mit zwei Freunden vom College bei einem Spiel der Cubs, super Plätze, erste Hälfte des zweiten Innings, und plötzlich fängt dieses Ding zu vibrieren an. Es war Roy Barton. Habe ich Ihnen schon von Roy Barton erzählt?«
»Noch nicht.«
»Mein Chef. Partner in der Kanzlei, ein bösartiger kleiner Giftzwerg. Vierzig Jahre alt, verqueres Ego, Gottes Geschenk an die Juristenzunft. Verdient eine Million Dollar im Jahr und kriegt den Hals trotzdem nicht voll. Arbeitet fünfzehn Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, weil bei Rogan Rothberg alle erfolgreichen Partner ununterbrochen arbeiten. Und Roy hält sich für einen sehr erfolgreichen Partner.«
»Scheint ein netter Kerl zu sein.«
»Ich hasse ihn. Ich hoffe, ich sehe ihn nie wieder.«
Abner schob die dritte Bloody Mary über die Theke. »Sieht ganz so aus, als wären Sie auf dem richtigen Weg. Prost.«
3
Das Telefon klingelte wieder, und diesmal entschloss sich Rochelle, den Hörer abzunehmen. »Kanzlei Finley & Figg«, meldete sie sich. Wally unterbrach die Zeitungslektüre nicht. Sie hörte einen Moment zu und sagte dann: »Es tut mir leid, aber in Immobiliensachen werden wir nicht tätig.«
Als Rochelle vor acht Jahren in die Kanzlei gekommen war, hatte die Kanzlei noch Immobiliensachen bearbeitet. Allerdings war ihr bald klar geworden, dass dieses Gebiet des Rechts kaum Geld einbrachte und der Sekretärin eine Menge Arbeit machte, während die Anwälte fast keinen Finger rühren mussten. Rochelle lernte schnell, und sie entschied, dass sie Immobilien nicht mochte. Da sie alle eingehenden Anrufe entgegennahm, konnte sie eine Vorauswahl treffen, und es dauerte nicht lange, bis Finley & Figgs Immobilienabteilung die Mandate ausgingen. Oscar war außer sich und drohte Rochelle mit Kündigung, gab aber klein bei, als sie wieder einmal erwähnte, dass sie die Kanzlei wegen Verletzung der Anwaltspflichten verklagen wolle. Wally handelte einen Waffenstillstand aus, doch mehrere Wochen lang war die Atmosphäre in der Kanzlei noch gespannter als sonst.
Auch andere Spezialgebiete waren ihrer gründlichen Auslese zum Opfer gefallen. Mit Strafrecht war es vorbei; Rochelle gefiel es nicht, weil ihr die Mandanten nicht gefielen. Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steuer war in Ordnung, da es sehr häufig passierte. Solche Mandate brachten gutes Geld und verlangten nur minimale Beteiligung ihrerseits. Insolvenzen mussten aus dem gleichen Grund dran glauben wie Immobilien – magere Honorare und zu viel Arbeit für die Sekretärin. Im Laufe der Jahre war es Rochelle gelungen, die Tätigkeitsbereiche der Kanzlei drastisch zu reduzieren, was immer noch Probleme verursachte. Oscars Theorie – die ihm gut dreißig Jahre lang kein Geld eingebracht hatte – besagte, dass die Kanzlei jeden Mandanten nehmen sollte, der durch die Tür kam, dass es am besten war, ein weites Netz zu werfen und dann durch den Fang zu wühlen, in der Hoffnung, einen guten Personenschaden zu finden. Wally war anderer Meinung. Er war auf der Suche nach dem ganz großen Fall. Obwohl er wegen der Fixkosten gezwungen war, alle möglichen profanen juristischen Aufgaben zu übernehmen, träumte er immer davon, auf eine Goldgrube zu stoßen.
»Gut gemacht«, sagte er, als Rochelle auflegte. »Immobilien konnte ich noch nie leiden.«
Sie ignorierte ihn und widmete sich wieder ihrer Zeitung. Plötzlich begann AJ zu knurren. Er hatte sich in seinem Körbchen aufgerichtet, die Nase steil in die Höhe gereckt, den Schwanz kerzengerade und die Augen schmal vor Konzentration. Sein Knurren wurde lauter, dann, wie auf Kommando, zerriss die Sirene eines Rettungswagens die Stille des Morgens. Sirenen schafften es immer, Wally in Aufregung zu versetzen, und ein oder zwei Sekunden lang erstarrte er, während er den Ton analysierte. Polizei, Feuerwehr oder Rettungswagen? Das war immer das Wichtigste, und Wally konnte die drei auf Anhieb identifizieren. Sirenen von Löschfahrzeugen und Streifenwagen hatten nichts zu bedeuten und wurden ignoriert, doch wenn er die Sirene eines Rettungswagens hörte, schlug sein Puls schneller.
»Rettungswagen«, sagte er. Dann legte er die Zeitung auf den Tisch, stand auf und ging wie beiläufig zur Haustür. Auch Rochelle verließ ihren Platz. Sie lief zum Fenster und verstellte die Lamellen der Jalousie, um kurz nach draußen zu sehen. AJ knurrte immer noch, und als Wally die Tür aufmachte und auf die Veranda trat, folgte ihm der Hund. Auf der anderen Straßenseite kam Vince Gholston aus seiner kleinen Boutiquekanzlei und warf einen erwartungsvollen Blick auf die Kreuzung von Beech und Thirty-eighth. Als er Wally sah, zeigte er ihm den Stinkefinger, und Wally beeilte sich, den Gruß zu erwidern.
Der Rettungswagen fuhr mit quietschenden Reifen die Beech hinunter und zwängte sich durch den dichten Verkehr, während der Fahrer aggressiv hupte und mehr Chaos und Gefahren verursachte als der Unfall, zu dem er gerufen worden war. Wally starrte dem Rettungswagen hinterher, bis er außer Sicht war. Dann ging er wieder hinein.
Die Zeitungslektüre wurde ohne weitere Unterbrechungen fortgesetzt – keine Sirenen, keine Anrufe von potenziellen Mandanten oder Inkassobüros. Um neun Uhr ging die Tür auf, und der Seniorpartner der Kanzlei trat ein. Oscar trug wie gewöhnlich einen langen, dunklen Mantel und hielt einen vollgestopften Aktenkoffer aus schwarzem Leder in der Hand, als hätte er die ganze Nacht durchgearbeitet. Außerdem hatte er seinen Schirm dabei, wie immer – egal, was für Wetter herrschte oder angesagt war. Oscar war alles andere als ein erfolgreicher, gut verdienender Anwalt, doch er konnte wenigstens so tun, als ob. Dunkle Mäntel, dunkle Anzüge, weiße Hemden und Seidenkrawatten. Seine Frau ging für ihn einkaufen und bestand darauf, dass er wie ein angesehener Anwalt aussah. Wally dagegen trug das, was er gerade in die Finger bekam.
»Morgen«, sagte Oscar schroff in die Richtung von Ms. Gibsons Schreibtisch.
»Guten Morgen«, erwiderte sie.
»Steht was Interessantes in der Zeitung?« Oscar interessierte sich nicht für Spielergebnisse, Börsenberichte oder die neuesten Nachrichten aus dem Nahen Osten.
»In einer Fabrik in Palos Heights wurde ein Gabelstaplerfahrer zerquetscht«, antwortete sie prompt. Wenn sie keinen Unfall fand, um ihm den Morgen zu versüßen, würde seine schlechte Laune nur noch schlimmer werden.
»Gefällt mir«, sagte er. »Ist er tot?«
»Noch nicht.«
»Großartig. Das gibt eine Menge Schmerzensgeld. Machen Sie eine Notiz. Ich kümmere mich später darum.«
Ms. Gibson nickte, als wäre der bedauernswerte Mann bereits ihr Mandant. Das war er natürlich nicht. Und er würde es auch nicht werden. Die Anwälte von Finley & Figg kamen nur selten als Erste an einen Unfallort. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde die Frau des Gabelstaplerfahrers bereits von aggressiveren Anwälten verfolgt, von denen einige dafür bekannt waren, dass sie die Familien von Geschädigten mit Bargeld und anderen Anreizen köderten.
Beflügelt von diesen guten Nachrichten, trat Oscar an den Tisch. »Guten Morgen.«
»Morgen, Oscar«, antwortete Wally.
»Hat es einer deiner Mandanten in die Traueranzeigen geschafft?«
»So weit bin ich noch nicht.«
»Du solltest mit den Traueranzeigen anfangen.«
»Danke, Oscar. Hast du noch mehr Tipps, wie man eine Zeitung lesen sollte?«
Oscar war bereits auf dem Weg in sein Büro. »Was steht für heute in meinem Terminkalender?«, fragte er über die Schulter.
»Das Übliche. Scheidungen und Betrunkene.«
»Scheidungen und Betrunkene«, murmelte Oscar vor sich hin, während er sein Büro betrat. »Ich brauche unbedingt einen schönen Unfall.« Er hängte seinen Mantel an die Rückseite der Tür, steckte den Schirm in den Ständer neben seinem Schreibtisch und fing an, seinen Aktenkoffer auszupacken.
Es dauerte nicht lange, bis Wally mit der Zeitung in der Hand neben ihm stand. »Sagt dir der Name Chester Marino was?«, fragte er. »Traueranzeige. Siebenundfünfzig, Frau, Kinder, Enkel, Todesursache nicht genannt.«
Oscar kratzte sich den kurz geschnittenen grauen Schopf und sagte: »Vielleicht. Könnte ein Testament gewesen sein.«
»Er ist bei Van Easel & Sons. Aufbahrung heute Abend, Beerdigung morgen. Ich werde hingehen und mich ein bisschen umhören. Willst du Blumen schicken, wenn er einer von unseren Mandanten ist?«
»Erst wenn wir wissen, um wie viel es bei dem Nachlass geht.«
»Guter Einwand.« Wally hielt immer noch die Zeitung in der Hand. »Die Sache mit dem Taser läuft aus dem Ruder. In Joliet werden ein paar Polizisten beschuldigt, einen siebzigjährigen Mann getasert zu haben. Er ist in einen Walmart gegangen, um ein Schnupfenmittel für sein Enkelkind zu besorgen. Der Apotheker glaubte, der Alte würde das Zeug für ein Meth-Labor kaufen, daher hat er als guter Staatsbürger die Polizei gerufen. Die Polizisten hatten gerade neue Taser bekommen, also halten fünf von diesen Schwachköpfen den alten Mann auf dem Parkplatz an und brennen ihm mit ihren Tasern eins drauf.«
»Dann beschäftigen wir uns jetzt also wieder mit Taser-Mandaten?«
»Du hast es erfasst. Das sind gute Fälle, Oscar. Wir müssen uns unbedingt ein paar davon besorgen.«
Oscar setzte sich und seufzte laut. »Diese Woche sind es Taser-Waffen. Letzte Woche war es Windelausschlag – du wolltest den Hersteller von Pampers verklagen, weil ein paar Tausend Babys Windelausschlag haben. Letzten Monat waren es giftige Gipskartonplatten.«
»In der Sammelklage in Sachen Gipskartonplatten wurden bereits vier Milliarden Dollar gezahlt.«
»Ja, aber wir haben keinen Cent davon gesehen.«
»Genau das meine ich, Oscar. Mit den Sammelklagen müssen wir jetzt endlich mal Ernst machen. Da ist eine Menge Geld zu holen. Anwaltshonorare in Millionenhöhe, gezahlt von Unternehmen, die Gewinne in Milliardenhöhe machen.«
Die Tür stand offen, und Rochelle hörte jedes Wort mit.
Wally wurde immer lauter. »Wir schnappen uns ein paar von diesen Fällen, und dann tun wir uns mit einer Kanzlei zusammen, die sich auf Sammelklagen spezialisiert hat. Wir geben den Kollegen ein Stück vom Kuchen ab, hängen uns an sie dran, bis der Vergleich steht, und bekommen einen Haufen Kohle. Das ist leicht verdientes Geld, Oscar.«
»Windelausschlag?«
»Okay, das hat nicht funktioniert. Aber die Sache mit dem Taser ist eine Goldgrube.«
»Noch eine Goldgrube, Wally?«
»Genau. Ich werd’s dir beweisen.«
»Tu das.«
Der Betrunkene am anderen Ende der Theke hatte sich etwas erholt. Er konnte den Kopf heben und die Augen ein wenig öffnen. Abner servierte ihm Kaffee und versuchte, ihn davon zu überzeugen, dass es jetzt Zeit zu gehen war. Ein Teenager fegte mit einem Besen den Boden und rückte Tische und Stühle zurück. Das kleine Pub erwachte langsam zum Leben.
David, dessen Gehirn in Wodka schwamm, starrte sein Spiegelbild an und bemühte sich vergeblich, seine Situation einzuschätzen. Mal war er aufgeregt und stolz auf seine mutige Flucht aus dem Todesmarsch von Rogan Rothberg, dann wieder hatte er Angst vor seiner Frau, seiner Familie, seiner Zukunft. Doch der Alkohol machte ihm Mut, und daher beschloss er weiterzutrinken.
Sein Telefon vibrierte wieder. Es war Lana aus dem Büro. »Hallo«, sagte er leise.
»David, wo sind Sie?«
»Ich frühstücke noch.«
»Sie hören sich gar nicht gut an. Ist mit Ihnen alles in Ordnung?«
»Mir geht’s gut.«
Eine Pause, dann: »Haben Sie getrunken?«
»Natürlich nicht. Es ist erst halb zehn.«
»Okay, wie Sie meinen. Roy Barton hat gerade das Büro verlassen, und er war furchtbar wütend. Derart vulgäre Ausdrücke habe ich noch nie gehört. Er hat alle möglichen Drohungen ausgestoßen.«
»Sagen Sie Roy, er kann mich am Arsch lecken.«
»Wie bitte?«
»Sie haben mich schon richtig verstanden. Sagen Sie Roy, er kann mich am Arsch lecken.«
»Das sind die Nerven, David. Es stimmt also doch. Sie sind ausgerastet. Überrascht mich nicht. Ich habe es kommen sehen. Ich habe es gewusst.«
»Ich bin völlig in Ordnung.«
»Sie sind nicht in Ordnung. Sie sind betrunken und drehen durch.«
»Okay, das mit dem betrunken könnte stimmen, aber …«
»Ich glaube, Roy Barton kommt zurück. Was soll ich ihm sagen?«
»Dass er mich am Arsch lecken kann.«
»Warum sagen Sie ihm das nicht selbst? Sie haben doch ein Telefon. Rufen Sie Mr. Barton an.« Damit beendete sie das Gespräch.
Abner näherte sich unauffällig, weil er wissen wollte, was der Telefonanruf zu bedeuten hatte. Er putzte schon wieder die Holztheke, bereits das dritte oder vierte Mal, seit David sich an der Bar niedergelassen hatte.
»Das Büro«, sagte David. Abner runzelte die Stirn, als wäre das für sie beide eine schlechte Nachricht. »Der bereits erwähnte Roy Barton sucht nach mir. Er wirft mit Gegenständen um sich. Da würde ich jetzt gern Mäuschen spielen. Ich hoffe, er bekommt einen Hirnschlag.«
Abner kam noch näher. »Ich habe Ihren Namen vorhin nicht verstanden.«
»David Zinc.«
»Freut mich. David, der Koch ist gerade gekommen. Sie sollten etwas essen. Am besten etwas, das vor Fett geradezu trieft. Pommes frites, Zwiebelringe, vielleicht einen schönen Hamburger?«
»Ich hätte gern eine doppelte Portion Zwiebelringe und eine große Flasche Ketchup.«
»Ausgezeichnete Wahl.« Abner verschwand. David leerte seine Bloody Mary und machte sich auf die Suche nach der Toilette. Als er zurückkam, setzte er sich wieder, sah auf die Uhr – 9.28 – und wartete auf seine Zwiebelringe. Er konnte riechen, dass sie in der Küche hinter der Theke in heißem Öl frittiert wurden. Der Betrunkene rechts von ihm schüttete Kaffee in sich hinein und versuchte krampfhaft, die Augen offen zu halten. Der Teenager fegte immer noch den Boden und schob Tische und Stühle hin und her.
Sein Telefon, das auf der Theke lag, vibrierte. Es war seine Frau. David rührte sich nicht vom Fleck. Als es aufhörte zu vibrieren, wartete er. Dann rief er seine Mobilbox an.
»David, dein Büro hat schon zweimal angerufen. Wo bist du? Was tust du? Wir machen uns alle Sorgen um dich. Ist alles in Ordnung? Ruf mich bitte so schnell wie möglich an.«
Seine Frau promovierte gerade an der Northwestern University, und als er sich um 6.45 Uhr an diesem Morgen mit einem Kuss von ihr verabschiedet hatte, lag sie noch im Bett. Nachdem er am Abend zuvor um 22.05 Uhr heimgekommen war, hatten sie einen Rest Lasagne vor dem Fernseher gegessen, bevor er auf dem Sofa eingeschlafen war. Helen war zwei Jahre älter als er und wollte unbedingt schwanger werden, was angesichts der Dauermüdigkeit ihres Mannes allerdings immer unwahrscheinlicher wurde. In der Zwischenzeit machte sie ihren Doktor in Kunstgeschichte, beeilte sich aber nicht sonderlich damit.
Das Mobiltelefon piepste leise. Sie hatte ihm eine SMS geschickt. »Wo bist du? Alles okay? Bitte melde dich.«
David zog es vor, erst in ein paar Stunden mit ihr zu reden, denn er würde zugeben müssen, dass er dem Druck nicht mehr standhalten konnte, woraufhin sie verlangen würde, dass er sich professionelle Hilfe holte. Ihr Vater war Psychiater, ihre Mutter Eheberaterin und die ganze Familie der festen Überzeugung, dass sämtliche Probleme und Mysterien mit ein paar Stunden Therapie zu lösen wären.
Doch da er den Gedanken nicht ertrug, dass sie sich um ihn sorgte, schickte er ihr eine SMS. »Mir geht’s gut. Ich musste für eine Weile aus dem Büro. Bin okay. Mach dir keine Sorgen.«
Die Zwiebeln kamen, ein riesiger Haufen goldbrauner Ringe, umhüllt von schwerem, fettigem Teig, frisch aus der Fritteuse. Abner stellte sie vor David und sagte: »Die sind wirklich gut. Was halten Sie von einem Glas Wasser?«
»Ein Bier wäre mir jetzt lieber.«
»In Ordnung.« Abner nahm ein Bierglas und ging zum Zapfhahn.
»Meine Frau sucht mich«, sagte David. »Sind Sie verheiratet?«
»Fragen Sie lieber nicht.«
»Tut mir leid. Meine Frau ist großartig. Sie will ein Kind, aber es sieht nicht so aus, als würden wir es hinbekommen. Letztes Jahr habe ich viertausend Stunden gearbeitet. Ist das nicht unglaublich? Viertausend Stunden. In der Regel bin ich um sieben Uhr morgens im Büro und bleibe bis zehn Uhr abends. Das ist ein normaler Arbeitstag, aber es ist auch nicht ungewöhnlich, dass ich bis nach Mitternacht arbeite. Daher schlafe ich sofort ein, wenn ich nach Hause komme. Letzten Monat hatten wir, meine ich, einmal Sex. Schwer zu glauben. Ich bin einunddreißig. Sie ist dreiunddreißig. Wir sind beide im besten Alter und wollen schwanger werden, aber ich schaffe es einfach nicht, wach zu bleiben.« Er machte den Ketchup auf und kippte ein Drittel der Flasche auf sein Essen.
Abner stellte ein eiskaltes Pint Lager vor ihn. »Wenigstens verdienen Sie eine Menge Kohle.«
David schälte einen Zwiebelring, tunkte ihn in Ketchup und steckte ihn sich in den Mund. »O ja, sie bezahlen mich gut. Warum würde ich mich derart misshandeln lassen, wenn sie mich nicht gut bezahlen würden?« Er sah sich um und vergewisserte sich, dass niemand zuhörte – natürlich nicht, sie waren allein. Er senkte die Stimme, während er auf dem Zwiebelring herumkaute. »Ich bin Senioranwalt, seit fünf Jahren dabei, letztes Jahr habe ich dreihunderttausend verdient. Vor Steuern. Das ist eine Menge Geld, und da ich keine Zeit habe, es auszugeben, liegt es auf der Bank und wird immer mehr. Aber jetzt rechnen Sie mal nach: Ich habe viertausend Stunden gearbeitet, doch nur dreitausend Stunden abgerechnet. Dreitausend Stunden, so viel wie kein anderer in der Kanzlei. Der Rest ist für Firmenaktivitäten und Pro-bono-Mandate draufgegangen. Können Sie mir folgen, Abner? Sie sehen irgendwie gelangweilt aus.«
»Ich höre Ihnen zu. Sie sind nicht der erste Anwalt, den ich hier als Gast habe. Ich weiß, wie langweilig ihr seid.«
David trank einen großen Schluck Lager und schmatzte. »Es gefällt mir, dass Sie so direkt sind.«
»Ich mache nur meine Arbeit.«
»Die Kanzlei stellt dem Mandanten für meine Arbeit fünfhundert Dollar die Stunde in Rechnung. Multipliziert mit dreitausend. Das sind 1,5 Millionen für Rogan Rothberg, und mir zahlen sie lumpige dreihunderttausend. Multiplizieren Sie das mit sechshundert Anwälten, die alle in etwa das Gleiche tun wie ich, dann verstehen Sie, warum so viele intelligente junge Menschen Jura studieren: Sie wollen für eine große Kanzlei arbeiten und träumen davon, irgendwann Partner und damit reich zu werden. Langweile ich Sie?«
»Nein. Das ist alles sehr spannend.«
»Möchten Sie einen Zwiebelring?«
»Nein, danke.«
David steckte sich noch einen großen Zwiebelring in den ausgetrockneten Mund und spülte ihn mit einem halben Pint hinunter. Vom anderen Ende der Bar drang ein dumpfer Knall zu ihnen. Der Betrunkene hatte den Kampf gegen die Schwerkraft verloren. Sein Kopf lag wieder auf der Theke.
»Wer ist der Kerl?«, fragte David.
»Er heißt Eddie. Seinem Bruder gehört die Hälfte der Bar, daher lässt er anschreiben, zahlt aber nie. Ich habe den Kerl so satt.« Abner ging zu Eddie und sprach ihn an, doch er antwortete nicht. Schließlich nahm Abner die Kaffeetasse und wischte um Eddie herum die Theke. Langsam arbeitete er sich bis zu David vor.
»Sie verzichten also auf dreihunderttausend im Jahr«, sagte Abner. »Wie sieht Ihr Plan aus?«
David lachte zu laut. »Mein Plan? So weit bin ich noch nicht. Vor zwei Stunden bin ich wie immer zur Arbeit erschienen; jetzt steuere ich geradewegs auf einen Nervenzusammenbruch zu.« Noch ein Schluck. »Mein Plan sieht so aus: Ich werde hier sitzen bleiben und versuchen, meinen Nervenzusammenbruch zu analysieren. Helfen Sie mir dabei?«
»Das gehört zu meinen Aufgaben.«
»Ich zahle meine Rechnung. Versprochen. Und die von Eddie auch.«
»Hört sich gut an.«
»Noch ein Bier, bitte.«
4
Nachdem Rochelle Gibson etwa eine Stunde lang Zeitung gelesen, Joghurt gegessen und Kaffee getrunken hatte, machte sie sich widerstrebend an die Arbeit. Ihre erste Aufgabe bestand darin, in der Mandantenkartei nach einem gewissen Chester Marino zu suchen, der jetzt im Bestattungsinstitut Van Easel & Sons in einem Bronzesarg der unteren Preisklasse ruhte. Oscar hatte recht. Vor sechs Jahren hatte die Kanzlei ein Testament für Mr. Marino aufgesetzt. Sie fand die dünne Akte im Abstellraum neben der Küche und brachte sie Wally, der an seinem überfüllten Schreibtisch saß und fleißig arbeitete.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!