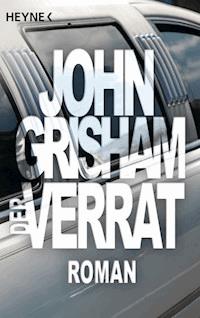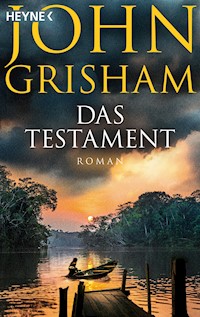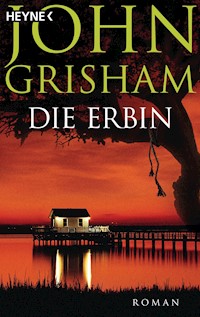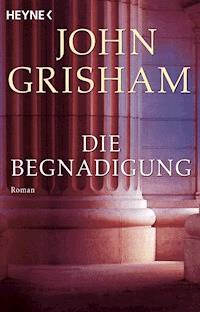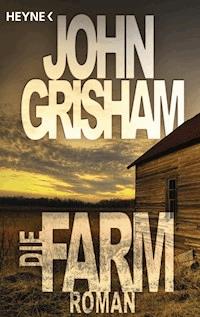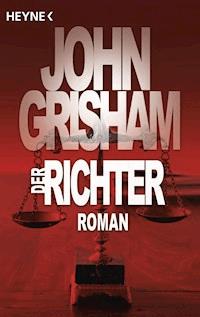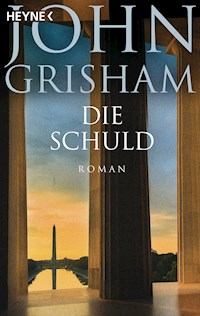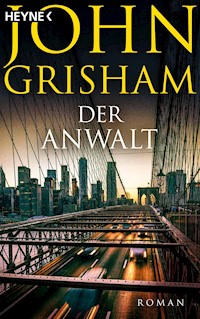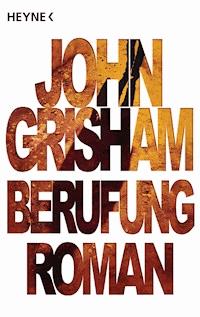9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Ein erzählerischer Triumph, eine stilistische Freude.« Daily Telegraph
Bevor sie die Falle zuschnappen ließen, hatten sie Danilo Silva rund um die Uhr bewacht. Er führte ein ruhiges Leben in einem heruntergekommenen Viertel in einer kleinen Stadt in Brasilien. Nichts deutete darauf hin, dass er neunzig Millionen Dollar beiseite geschafft hatte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 612
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
In einer brasilianischen Kleinstadt führt Daniel Silva ein ruhiges, unauffälliges Leben, bis ihn seine Vergangenheit einholt: Er wird von einigen Leuten gekidnappt, die wissen wollen, wo er die neunzig Millionen Dollar versteckt hat, die er vor vier Jahren auf die Seite geschafft hat. Damals war er als Patrick Lanigan Partner in einer renommierten Anwaltskanzlei in Mississippi; eine große Karriere schien vorgezeichnet, bei der ihm seine attraktive Frau und seine Tochter zur Seite stehen würden. Doch ein schrecklicher Autounfall, bei dem er angeblich den Tod gefunden hatte, setzte eine Lawine von Ereignissen in Bewegung. Nachdem er aus der Entfernung seine eigene Beerdigung beobachtet hatte, verschwand er – und mit ihm das Geld vom Geheimkonto seiner Kanzlei.
Doch seine Tarnung war nicht gut genug, seine Gegner haben ihn entdeckt und bedrohen ihn ebenso wie seine Geliebte, die brasilianische Anwältin Eva Miranda. Eine Jagd auf Leben und Tod beginnt.
Inhaltsverzeichnis
Für David Gernert Freund, Herausgeber, Agent
1
Sie spürten ihn in Ponta Porã auf, einem verschlafenen Nest in Brasilien, an der Grenze zu Paraguay, einer Gegend, die auch heute noch einfach nur das Grenzland genannt wird.
Sie stellten fest, daß er zurückgezogen in einem Ziegelsteinhaus in der Rua Tiradentes lebte, einer breiten Straße mit Bäumen auf dem Mittelstreifen und einer Horde barfüßiger Jungen, die Fußball spielend über das heiße Pflaster tobte.
Sie stellten fest, daß er, soweit sie erkennen konnten, allein lebte. Während der acht Tage, die sie auf der Lauer lagen und ihn ausspähten, kam und ging gelegentlich eine Putzfrau.
Sie stellten fest, daß er ein angenehmes, aber keineswegs luxuriöses Leben führte. Das Haus strahlte Bescheidenheit aus und hätte jedem x-beliebigen einheimischen Kaufmann gehören können. Der Wagen, ein 1983er Käfer, Massenfabrikat, in São Paulo gebaut, war rot, sauber und auf Hochglanz poliert. Ihr erstes Foto von ihm war ein Schnappschuß, der ihn hinter dem Tor zur Auffahrt seines Hauses beim Einwachsen des Käfers zeigte.
Sie stellten fest, daß er abgenommen hatte. Die hundertfünfzehn Kilo, die er mit sich herumgeschleppt hatte, als er zum letztenmal gesehen worden war, waren verschwunden. Sein Haar und seine Haut erschienen dunkler; sein Kinn war vergrößert und seine Nase verfeinert worden. Perfekte plastisch-kosmetische Korrekturen des Gesichts. Sie hatten dem Schönheitschirurgen in Rio, der zweieinhalb Jahre zuvor die Operation vorgenommen hatte, ein kleines Vermögen für die Informationen bezahlen müssen.
Sie spürten ihn nach vier Jahren ebenso gewissenhafter wie ermüdender Suche auf, vier Jahren, in denen sie sich in Sackgassen verrannt hatten, vier Jahren kalt gewordener Spuren und falscher Hinweise, vier Jahren, in denen viel Geld geflossen war und, wie es schien, gutes Geld schlechtem hinterhergeworfen worden war.
Aber sie fanden ihn. Und sie warteten. Anfangs drängte sie alles zum schnellen Zugriff, drängte es sie, ihn zu betäuben und in ein sicheres Haus nach Paraguay zu schmuggeln, ihn zu schnappen, bevor er sie sah oder bevor ein Nachbar argwöhnisch wurde. Aber nach zwei Tagen beruhigten sie sich und warteten. Sie hielten sich, wie die Einheimischen gekleidet, an verschiedenen Stellen entlang der Rua Tiradentes auf, tranken Tee im Schatten, mieden die Sonne, aßen Eis, unterhielten sich mit den Kindern und beobachteten sein Haus. Sie folgten ihm, wenn er zum Einkaufen in die Innenstadt fuhr, und sie fotografierten ihn über die Straße hinweg, als er die Apotheke verließ. Auf einem Obstmarkt schoben sie sich so nahe an ihn heran, daß sie hören konnten, wie er sich mit einem Verkäufer unterhielt. Er sprach ein ausgezeichnetes Portugiesisch, mit einem kaum wahrnehmbaren Akzent eines Amerikaners oder eines Deutschen, der sich große Mühe mit dem Erlernen der Sprache gegeben hatte. Er bewegte sich schnell und zielstrebig durch die Innenstadt, erledigte seine Einkäufe und kehrte nach Hause zurück, wo er das Tor sofort wieder hinter sich abschloß. Sein kurzer Ausflug zum Einkaufen lieferte ein Dutzend guter Fotos.
In seinem früheren Leben hatte er gejoggt; aber in den Monaten vor seinem Verschwinden war seine Laufleistung in dem Maße geschrumpft, wie sein Gewicht nach oben gegangen war. Jetzt, wo sein Körper sich am Rande der Auszehrung bewegte, waren sie nicht überrascht, ihn wieder laufen zu sehen. Er verließ sein Haus, schloß das Tor hinter sich ab und bewegte sich in langsamem Trab die Rua Tiradentes hinunter. Neun Minuten für die erste Meile, als die Straße völlig gerade verlief und die Häuser weiter auseinander rückten. Am Stadtrand ging das Pflaster in Schotter über, und ungefähr in der Mitte der zweiten Meile war sein Tempo auf acht Minuten pro Meile gestiegen, und Danilo war ganz hübsch ins Schwitzen geraten. Es war Oktober, um die Mittagszeit, die Temperatur betrug ungefähr fünfundzwanzig Grad, und er wurde noch schneller, als er vorbei an einer kleinen, mit jungen Müttern überfüllten Klinik und vorbei an einer kleinen Kirche, die die Baptisten gebaut hatten, die Stadt verließ. Die Straßen wurden staubiger, als er mit sieben Minuten pro Meile in die offene Landschaft lief.
Er nahm die Sache mit dem Laufen sehr ernst, ein Umstand, der sie mit tiefer Genugtuung erfüllte. Daniel würde ihnen praktisch in die Arme laufen.
Am Tag, nachdem sie ihn zum erstenmal zu Gesicht bekommen hatten, wurde von einem Brasilianer, der Osmar hieß, eine kleine, heruntergekommene Hütte am Rand von Ponta Porã gemietet, und innerhalb kurzer Zeit trudelte der Rest des Verfolgerteams dort ein. Es bestand zu gleichen Teilen aus Amerikanern und Brasilianern, wobei Osmar die Befehle auf portugiesisch gab und Guy Kommandos auf englisch zu bellen pflegte. Osmar beherrschte beide Sprachen und fungierte als so etwas wie der offizielle Dolmetscher des Teams.
Guy kam aus Washington. Er war ein ehemaliger Secret-Service-Mann, angeheuert, um Danny Boy zu finden, wie sie ihn unter sich nannten. Manche Leute hielten Guy für ein Genie auf seinem Gebiet. Gesichtslos und ohne Spuren zu hinterlassen, war Guy ein Mann ohne Vergangenheit. Sein fünfter Einjahresvertrag, Danny Boy aufzuspüren, lief, und für das Ergreifen der Beute winkte ihm ein hübscher Bonus. Obwohl er es stets gut zu verbergen wußte, drohte Guy unter dem Druck, Danny Boy nicht finden zu können, über die Jahre langsam den Verstand zu verlieren.
Vier Jahre und dreieinhalb Millionen Dollar. Und nichts, was man hätte vorweisen können.
Aber jetzt hatten sie ihn aufgespürt.
Osmar und seine Brasilianer hatten nicht die geringste Ahnung von Danny Boys Sünden, aber jeder auch nur halbwegs mit Verstand Begabte konnte sehen, daß er untergetaucht sein und sich mit ihm entschieden zu viel Geld in Luft aufgelöst haben mußte. Osmar hatte rasch gelernt, keine Fragen zu stellen. Guy und die Amerikaner hatten zu diesem Thema nichts zu sagen.
Die Fotos von Danny Boy wurden auf zwanzig mal fünfundzwanzig vergrößert und an eine Wand in der Küche der heruntergekommenen kleinen Hütte geheftet, wo sie wieder und wieder von Männern mit harten Augen verbissen studiert wurden, Männern, die Kette rauchten und angesichts der Fotos die Köpfe schüttelten. Sie flüsterten miteinander und verglichen die neuen Fotos mit den alten, denen aus seinem früheren Leben. Dünnerer Mann, eigenartiges Kinn, andere Nase. Sein Haar war kürzer und seine Haut dunkler. War es wirklich ihr Mann?
Sie hatten das alles schon einmal durchgemacht, in Recife, an der Nordostküste, neunzehn Monate zuvor, wo sie eine Wohnung gemietet und ebenfalls Fotos an einer Wand betrachtet hatten, bis beschlossen wurde, den Amerikaner zu greifen und seine Fingerabdrücke zu überprüfen. Falsche Fingerabdrücke. Falscher Amerikaner. Sie pumpten noch ein paar Drogen mehr in ihn hinein und entsorgten ihn in einem Straßengraben.
Sie scheuten davor zurück, allzu tief in das gegenwärtige Leben von Daniel Silva einzudringen. Wenn er tatsächlich ihr Mann war, dann verfügte er ausreichend über Geld. Und Bargeld, das wußten sie, wirkte bei den einheimischen Behörden stets Wunder. Jahrzehntelang hatten sich Nazis und andere Deutsche, die sich in Ponta Porã eingenistet hatten, mit Bargeld ausgesprochen erfolgreich Schutz erkaufen können.
Osmar wollte einen schnellen Zugriff. Guy sagte, sie würden warten. Am vierten Tag verschwand er urplötzlich, und sechsunddreißig Stunden lang herrschte in der heruntergekommenen kleinen Hütte ein ziemliches Chaos.
Sie sahen noch, wie er in den roten Käfer stieg. Er hatte es eilig, lautete der Bericht. Er raste durch die Stadt zum Flughafen, ging im letzten Augenblick an Bord einer kleinen Maschine, und weg war er. Sein Wagen blieb auf dem einzigen Parkplatz des Flugplatzes zurück, wo sie ihn in den nächsten Tagen keine Sekunde aus den Augen ließen. Das Flugzeug flog mit vier Zwischenlandungen in Richtung São Paulo.
Sofort gab es den Plan, in sein Haus einzudringen und alles zu inventarisieren. Es mußte ganz einfach Unterlagen geben. Irgendwie mußte das Geld ja verwaltet werden. Guy sah es direkt vor sich; er träumte davon, Bankunterlagen zu finden, Belege für telegrafische Überweisungen, Kontoauszüge; alle möglichen Dokumente, alles fein säuberlich in Ordnern abgeheftet, die ihn direkt zu dem Geld führen würden.
Aber er wußte es besser. Wenn Danny Boy ihretwegen die Flucht ergriff, dann würde er auf keinen Fall irgendwelches Beweismaterial zurücklassen. Und wenn er tatsächlich ihr Mann war, dann war sein Haus bestimmt sorgfältig gesichert. Danny Boy würde, wo immer er war, vermutlich sofort Bescheid wissen, wenn sie seine Haustür oder ein Fenster öffneten.
Sie warteten. Sie fluchten und stritten und litten noch stärker unter dem Zwang zum Erfolg. Guy rief täglich in Washington an, eine unerfreuliche Aufgabe. Sie beobachteten den roten Käfer. Jedes eintreffende Flugzeug ließ sie die Ferngläser und Handys zücken. Sechs Flüge am ersten Tag. Fünf am zweiten. In der heruntergekommenen kleinen Hütte wurde es heiß und stickig. Die Männer flüchteten ins Freie – die Amerikaner dösten im mickrigen Schatten eines Baumes auf dem Hinterhof vor sich hin. Die Brasilianer spielten, am Zaun im Vorgarten sitzend, Karten.
Guy und Osmar unternahmen eine ausgedehnte Fahrt und schworen sich, daß sie sofort zuschlagen würden, sollte er jemals zurückkehren. Osmar äußerte sich zuversichtlich, daß er wieder auftauchen würde. Vermutlich war er nur kurz geschäftlich unterwegs, was immer das auch heißen mochte. Sie würden ihn schnappen, ihn identifizieren, und sollte sich herausstellen, daß er der Falsche war, würden sie ihn einfach in irgendeinem Straßengraben abladen und verschwinden. Wie beim letztenmal.
Am fünften Tag kam er zurück. Sie folgten ihm in die Rua Tiradentes, und alle waren glücklich.
Am achten Tag leerte sich die heruntergekommene kleine Hütte; alle Brasilianer und alle Amerikaner gingen auf Position.
Die Laufstrecke war sechs Meilen lang. Er hatte sie seit seiner Rückkehr jeden Tag zurückgelegt, war fast immer zur gleichen Zeit gestartet, trug die gleichen blau-orangenen Laufshorts, abgetragenen Nikes, Socken, kein Hemd.
Die ideale Stelle für den Zugriff lag zweieinhalb Meilen von seinem Haus entfernt, hinter einer kleinen Anhöhe auf einem Schotterweg, nicht weit vom Wendepunkt seiner Laufstrecke entfernt. Danilo kam nach zwanzigminütigem Lauf über die Anhöhe, ein paar Sekunden früher als erwartet. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund war er schneller als gewöhnlich. Vielleicht wegen der Wolken.
Auf der anderen Seite der Anhöhe stand ein Kleinwagen mit einem scheinbar platten Reifen und blockierte, hinten aufgebockt, die Straße. Sein Fahrer, ein kräftiger, untersetzter junger Mann, tat so, als wäre er vom Anblick des asketisch wirkenden Mannes überrascht, der schwitzend und keuchend auf der Anhöhe erschien. Daniel verlangsamte für eine Sekunde sein Tempo. Rechts war mehr Platz.
»Bom dia«, sagte der stämmige junge Mann und tat einen Schritt auf Daniel zu.
»Bom dia«, sagte Daniel, sich dem Wagen nähernd.
Der Fahrer holte plötzlich eine großkalibrige Pistole aus dem Kofferraum und hielt sie Daniel zwischen die Augen. Dieser erstarrte; seine Augen fixierten die Pistole, er atmete schwer mit offenem Mund. Der Fahrer hatte massige Hände und lange, kräftige Arme. Er packte Daniel am Genick, riß ihn mit einem Ruck zum Wagen hin und drückte ihn dort neben der Stoßstange auf den Boden. Die Pistole verschwand in einem Halfter, und ehe Daniel sich versah, fand er sich in den Kofferraum des Wagens verfrachtet. Danny Boy wehrte sich und trat um sich, aber er hatte nicht den Hauch einer Chance.
Der Fahrer schlug den Kofferraumdeckel zu, ließ den Wagen herunter, warf den Wagenheber in den Straßengraben und fuhr davon. Nach etwa einer Meile bog er in einen schmalen Feldweg ein, wo man bereits unruhig auf ihn wartete.
Sie schlangen Nylonseile um Danny Boys Handgelenke und verbanden ihm mit einem schwarzen Tuch die Augen, dann wuchteten sie ihn auf die Rückbank eines Vans. Osmar saß zu seiner Rechten, ein weiterer Brasilianer zu seiner Linken. Jemand griff sich seine Schlüssel aus der mit Klettband befestigten Velcros-Bauchtasche, die er um die Taille trug. Daniel sagte nichts, als der Van startete und Fahrt aufnahm. Er schwitzte noch immer und atmete sehr schwer.
Als der Van auf einer staubigen Straße neben einer landwirtschaftlich genutzten Fläche abrupt anhielt, brachte Danilo seine ersten Worte hervor. »Was wollt ihr?« fragte er auf portugiesisch.
»Kein Wort!« kam die Antwort von Osmar, auf englisch. Der Brasilianer links neben Daniel holte eine Spritze aus einem kleinen Metallkasten und zog ein schnell wirkendes Beruhigungsmittel auf. Osmar hielt Danilos Handgelenke fest zusammengepreßt, während der andere Mann ihm die Nadel in den Oberarm jagte. Daniel versteifte sich und versuchte sich loszureißen, dann wurde ihm klar, daß es hoffnungslos war. Er entspannte sich sogar ein wenig, als der Rest des Mittels in seinen Körper ging. Seine Atmung verlangsamte sich, sein Kopf begann zu schwanken. Als ihm das Kinn auf die Brust gesackt war, hob Osmar sanft mit dem rechten Zeigefinger die Shorts an Danilos rechtem Oberschenkel und fand genau das, was er erwartet hatte. Blasse Haut.
Das Laufen hielt ihn schlank, und es hielt ihn auch braun.
Entführungen waren im Grenzgebiet keine Seltenheit. Amerikaner waren leichte Opfer. Aber weshalb gerade ich, fragte sich Daniel, als er immer benommener wurde und ihm die Augen zufielen. Er lächelte, während er durch den Weltraum stürzte, Kometen und Meteoren auswich, nach Monden griff und ganze Galaxien angrinste.
Sie stopften ihn unter ein paar mit Melonen und Früchten gefüllte Pappkartons. Die Grenzposten winkten sie durch, ohne sich von ihren Stühlen zu erheben, und Danny Boy war nun in Paraguay, obwohl ihm im Moment nichts gleichgültiger sein konnte als das. Er ließ sich glücklich auf dem Boden des Vans liegend durchrütteln, als die Straßen schlechter und die Landschaft unwegsamer wurde. Osmar rauchte Kette und deutete gelegentlich in diese oder jene Richtung. Eine Stunde nach dem Zugriff bogen sie ein letztes Mal in einen unscheinbaren Feldweg ab. Die Hütte lag in einer Schlucht zwischen zwei steil aufragenden Bergen, von der schmalen Landstraße aus kaum zu sehen. Sie schleppten ihn wie einen Mehlsack hinein und luden ihn auf einem Tisch ab; dann machten sich Guy und der Fingerabdruck-Experte ans Werk.
Danny Boy schnarchte, während ihm von allen acht Fingern und den beiden Daumen Abdrücke genommen wurden. Die Amerikaner und die Brasilianer drängten sich um ihn und registrierten jeden Handgriff. In einem Karton neben der Tür standen ungeöffnete Whiskeyflaschen, für den Fall, daß dies der richtige Danny Boy sein sollte.
Der Fingerabdruck-Experte verließ mit den frischen Abdrücken den Raum und begab sich in sein auf der Rückseite des Hauses gelegenes Zimmer, wo er sich einschloß und die frischen Abdrücke vor sich ausbreitete. Er justierte die Lampe und holte den Vergleichssatz hervor, jene Abdrücke, die Danny Boy so bereitwillig geliefert hatte, als er noch wesentlich jünger war, damals, als er Patrick hieß und seine Zulassung als Anwalt im Staat Louisiana beantragt hatte. Merkwürdig, dieses Abnehmen der Fingerabdrücke bei Anwälten.
Beide Sätze waren in sehr gutem Zustand, und es war bereits auf den ersten Blick erkennbar, daß sie perfekt übereinstimmten. Aber er prüfte akribisch alle zehn. Er hatte keine Eile. Sollten die da draußen doch warten. Er genoß den Augenblick. Endlich öffnete er die Tür und starrte das Dutzend erwartungsvolle Gesichter mit steinerner Miene an. Dann lächelte er. »Er ist es«, sagte er auf englisch, und sie klatschten erlöst Beifall.
Guy genehmigte zur Feier des Tages den Whiskey, aber nur in Maßen. Es gab schließlich noch einiges mehr zu tun. Danny Boy, immer noch apathisch vor sich hin dämmernd, wurde, mit einem weiteren Schuß ruhiggestellt, in ein kleines Schlafzimmer gebracht, ohne Fenster und mit einer massiven Tür, die von außen abgeschlossen werden konnte. Hier drinnen würde man ihn verhören und, falls erforderlich, auch foltern.
Die barfüßigen Jungen, die auf der Straße Fußball spielten, waren zu sehr mit sich und ihrem Ball beschäftigt, um irgend etwas Ungewöhnliches zu bemerken. An Danny Boys Schlüsselbund hingen lediglich vier Schlüssel, und deshalb war das kleine Tor zur Straße hin schnell aufgeschlossen und blieb angelehnt. Ein Komplize in einem Mietwagen hielt unter einem großen, vier Häuser entfernten Baum. Ein anderer, auf einem Motorrad, stellte seine Maschine am anderen Ende der Straße ab und begann, sich intensiv mit deren Bremsanlage zu beschäftigen.
Sollte eine Alarmanlage losheulen, würde der Eindringling einfach die Flucht ergreifen und sich nie wieder blicken lassen. Wenn nicht, dann würde er sich drinnen einschließen und Danny Boys Hab und Gut inventarisieren.
Die Tür ließ sich ohne Probleme öffnen. Kein Alarm ertönte. Die Schalttafel an der Wand informierte jeden, der es wissen wollte, daß die Alarmanlage ausgeschaltet war. Er holte tief Luft und verharrte eine Minute lang absolut regungslos, dann begann er mit seiner Arbeit. Er entfernte die Festplatte aus Danny Boys PC und sammelte sämtliche Disketten ein. Er durchstöberte die Papiere auf dem Schreibtisch, fand aber nichts außer den üblichen Rechnungen, einige davon bezahlt, andere noch offen. Das Faxgerät war billig und ohne auffällige Sonderausstattung. Der Anzeige zufolge war es nicht betriebsbereit. Routiniert fotografierte er die Räumlichkeiten. Er machte Fotos von Kleidung, Nahrungsmitteln, Möbeln, Bücherregalen, Zeitschriftenständern.
Fünf Minuten nach dem Öffnen der Eingangstür wurde auf Danilos Dachboden ein stummes Signal ausgelöst, und es erfolgte ein Anruf bei einer privaten Sicherheitsfirma, elf Blocks entfernt, in der Innenstadt von Ponta Porã. Der Anruf blieb ohne Antwort, da der diensthabende Wachmann gerade sanft in einer Hängematte hinter dem Haus schaukelte. Eine Tonbandstimme aus Danilos Haus informierte jeden, der von Rechts wegen hätte zuhören müssen, davon, daß gerade ein Einbruch stattfand. Fünfzehn Minuten vergingen, bis ein menschliches Ohr die Meldung hörte. Als der Wachmann zu Danilos Haus raste, war der Einbrecher bereits wieder verschwunden. Und von Mr. Silva weit und breit keine Spur. Alles schien in Ordnung zu sein, Käfer auf dem Stellplatz inklusive. Das Haus und das Tor zum Anwesen waren verschlossen.
Die Anweisungen in den Unterlagen ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Bei einem solchen Alarm nicht die Polizei informieren. Zuerst versuchen Mr. Silva ausfindig zu machen, und falls er nicht sofort aufzufinden war, eine Nummer in Rio anrufen. Eva Miranda verlangen.
Mit kaum zu unterdrückender Erregung tätigte Guy seinen täglichen Routineanruf nach Washington. Er schloß sogar die Augen dabei und lächelte, als er die Worte »Er ist es« hervorstieß. Seine Stimme war eine Oktave höher als gewöhnlich.
Stille am anderen Ende der Leitung. Dann: »Sind Sie sicher?«
»Absolut. Die Fingerabdrücke stimmen perfekt überein.«
Neuerlich Stille, während der Stephano in Washington seine Gedanken ordnete, ein Vorgang, der normalerweise nur Bruchteile von Sekunden in Anspruch nahm. »Das Geld?«
»Wir haben noch nicht angefangen. Er steht noch immer unter Drogen.«
»Wann?«
»Heute abend.«
»Ich bleibe in der Nähe des Telefons.« Stephano legte auf, obwohl er am liebsten stundenlang weitergeredet hätte.
Guy fand einen Platz auf einem Baumstumpf hinter der Hütte. Die Vegetation war dicht, die Luft dünn und kühl. Die leisen Stimmen glücklicher Männer wehten zu ihm herüber. Die Schinderei hatte ein Ende – der größte Teil zumindest.
Er hatte gerade fünfzigtausend Dollar verdient. Das Auffinden des Geldes würde ihm einen weiteren Bonus einbringen, und er war sich absolut sicher, daß er das Geld finden würde.
2
Rio, Innenstadt. In einem hübschen kleinen Büro im zehnten Stock eines Hochhauses umklammerte Eva Miranda den Telefonhörer mit beiden Händen und wiederholte langsam die Worte, die sie gerade gehört hatte. Der stumme Alarm hatte das Wachpersonal herbeigerufen. Mr. Silva sei nicht zu Hause, aber sein Wagen stünde in der Auffahrt, und das Haus sei abgeschlossen.
Jemand war eingedrungen und hatte den Alarm ausgelöst, und es konnte kein Fehlalarm gewesen sein, weil er immer noch aktiviert war, als der Wachmann eintraf.
Daniel war verschwunden.
Vielleicht war er joggen gegangen und hatte gegen den gewohnten Ablauf verstoßen. Dem Bericht des Wachmannes zufolge war der Alarm vor einer Stunde und zehn Minuten ausgelöst worden. Aber Daniel joggte weniger als eine Stunde – sechs Meilen bei einem Tempo von sieben bis acht Meilen pro Minute, also maximal fünfzig Minuten. Keine Ausnahmen. Sie wußte über seine Gewohnheiten genau Bescheid.
Sie rief in seinem Haus in der Rua Tiradentes an, aber niemand meldete sich. Sie rief die Nummer eines Handys an, das er manchmal mit sich führte. Abermals Fehlanzeige, niemand meldete sich.
Vor drei Monaten hatte er versehentlich den Alarm ausgelöst und ihnen beiden damit einen fürchterlichen Schrecken eingejagt. Aber ein kurzer Anruf ihrerseits hatte die Angelegenheit aufgeklärt.
Was seine Sicherheit anging, war er viel zu sorgfältig, um leichtsinnig zu werden. Zu vieles hing davon ab.
Sie wiederholte die Telefonroutine. Das Ergebnis blieb unverändert. Es gibt eine Erklärung für all das, redete sie sich ein.
Sie wählte die Nummer des Apartments in Curitiba, der Hauptstadt des Staates Paraná, einer Stadt mit anderthalb Millionen Einwohnern. Ihres Wissens wußte niemand etwas von diesem Apartment. Es war unter einem anderen Namen angemietet worden und diente als Aufbewahrungsort für wichtige Unterlagen und gelegentlich auch als Treffpunkt. Manchmal verbrachten Daniel und sie dort ein gemeinsames Wochenende; für Eva leider nicht oft genug.
Sie rechnete nicht wirklich damit, daß jemand den Hörer abnahm. Keine Antwort. Daniel würde nicht dorthin fahren, ohne sie vorher zu verständigen.
Als sie mit den Anrufen fertig war, schloß sie die Tür ihres Büros ab und blieb eine Weile mit geschlossenen Augen gegen sie gelehnt. Aus der Eingangshalle drangen die Geräusche des üblichen geschäftigen Treibens der Anwälte und Sekretärinnen zu ihr. Zur Zeit arbeiteten dreiunddreißig Anwälte in der Kanzlei, der zweitgrößten in Rio mit einer Filiale in São Paulo und einer weiteren in New York. Das Zirpen und Wispern der Telefone, Faxgeräte und Kopierer verband sich zu einem fernen geschäftigen Chor.
Mit einunddreißig Jahren war sie eine erfahrene, seit fünf Jahren bei der Kanzlei angestellte Anwältin; so erfahren, daß sie gewohnt war, zahlreiche Überstunden zu machen und auch samstags zu arbeiten. Vierzehn Partner betrieben die Kanzlei, aber nur zwei davon waren Frauen. Sie hatte sich vorgenommen, dieses Verhältnis zu ändern. Zehn der neunzehn angestellten Anwälte waren Frauen, ein Beweis dafür, daß in Brasilien, ebenso wie in den Vereinigten Staaten, immer mehr Frauen in diesen Beruf drängten. Sie hatte an der Pontificia Universidade Católica in Rio studiert, die ihrer Ansicht nach zu den besseren zu zählen war. Ihr Vater lehrte dort noch immer Philosophie.
Er hatte darauf bestanden, daß sie nach dem Jurastudium in Rio in Georgetown weiterstudierte. Georgetown war seine Alma mater. Sein Einfluß, verbunden mit ihren beeindruckenden Bewerbungsunterlagen, ihrem blendenden Aussehen und ihrem fließenden Englisch ließen das Finden eines hochkarätigen Jobs bei einer erstklassigen Kanzlei zu einem Kinderspiel werden.
Sie trat ans Fenster und zwang sich zu Gelassenheit. Zeit war plötzlich von entscheidender Bedeutung. Die nächsten Schritte erforderten höchste Konzentration. Sie würde verschwinden müssen. In einer halben Stunde hatte sie eine Besprechung, aber die mußte verschoben werden.
Der Ordner befand sich in einem kleinen, feuerfesten Safe. Sie holte ihn heraus und las abermals das Blatt mit den Anweisungen; Schritten, die sie und Daniel viele Male zusammen durchgegangen waren.
Er hatte gewußt, daß sie ihn finden würden.
Eva hatte es stets vorgezogen, diese Möglichkeit zu ignorieren.
Ihre Gedanken schweiften ab, während sie sich Sorgen um ihn machte. Das Telefon läutete. Sie schreckte hoch. Es war nicht Daniel. Ein Mandant wartet, sagte ihre Sekretärin. Der Mandant war zu früh dran. Sie wies die Sekretärin an, sie bei dem Mandanten zu entschuldigen; sie solle höflich um einen neuen Termin ersuchen; außerdem wolle sie ab jetzt unter gar keinen Umständen mehr gestört werden.
Das Geld lag gegenwärtig an zwei Orten: auf einer Bank in Panama und bei einem Off-shore-Holding-Trust auf den Bermudas. Ihr erstes Fax autorisierte die sofortige Überweisung des Geldes in Panama auf eine Bank in Antigua. Ihr zweites Fax verteilte Geld auf drei Banken auf Grand Cayman. Das dritte transferierte das Geld von den Bermudas auf die Bahamas.
In Rio war es fast zwei Uhr. Die europäischen Banken hatten geschlossen, deshalb würde sie gezwungen sein, das Geld ein paar Stunden lang in der Karibik von einem Ort zum anderen zu bewegen, bis der Rest der Welt erneut für Banktransfers zur Verfügung stand.
Danilos Anweisungen waren eindeutig, aber allgemein gehalten. Details waren ihre Sache. Die Ausgangsüberweisungen waren von Eva vorgenommen worden. Sie hatte entschieden, welche Banken wieviel Geld bekamen. Sie hatte die Liste der fiktiven Firmennamen erstellt, die als Tarnung für das Geld fungierten; eine Liste, die Daniel nie zu Gesicht bekommen hatte. Sie verteilte, streute und überwies Kapital hierhin und dorthin. Es war etwas, was sie viele Male geprobt hatten, aber ohne je genau ins Detail zu gehen.
Daniel wußte nicht, wohin das Geld ging. Nur Eva. Sie war autorisiert, in diesem Moment und unter diesen extremen Umständen, das zu tun, was sie für richtig hielt. Sie war auf Handelsrecht spezialisiert. Die meisten ihrer Mandanten waren brasilianische Geschäftsleute, die in die Vereinigten Staaten und nach Kanada exportieren wollten. Sie wußte Bescheid über ausländische Märkte, Währungen, Bankgepflogenheiten. Was sie über das Zirkulierenlassen von Geld in der ganzen Welt noch nicht gewußt hatte, hatte ihr Daniel beigebracht.
Immer wieder schaute sie auf die Uhr. Seit dem Anruf aus Ponta Porã war mittlerweile mehr als eine Stunde vergangen.
Ein weiteres Fax wurde abgeschickt, das Telefon läutete erneut. Bestimmt war das Daniel, endlich, mit einer verrückten Geschichte, und all das hier war umsonst gewesen. Vielleicht nur eine Übung, eine Probe, um festzustellen, wie sie unter Druck reagierte. Aber er war eigentlich kein Mensch, der zu unnötigen Spielereien neigte.
Am anderen Ende war ein Partner, ziemlich aufgebracht, weil sie für eine weitere Zusammenkunft bereits zu spät dran war. Sie entschuldigte sich mit knappen Worten und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Fax zu.
Mit jeder Minute, die verging, stieg der Druck. Immer noch kein Wort von Daniel. Keine Reaktion auf ihre wiederholten Anrufe. Wenn sie ihn tatsächlich gefunden hatten, dann würden sie nicht lange damit warten, ihn zum Sprechen zu bringen. Davor fürchtete er sich am meisten. Und das war auch der Grund, weshalb sie von hier verschwinden mußte.
Anderthalb Stunden. Die neue Realität machte ihr schwer zu schaffen. Daniel war verschollen. Er würde nie verschwinden, ohne sie vorher davon zu unterrichten. Dazu war er in seinen Planungen zu sorgfältig, immer in Angst vor den Schatten. Ihr schlimmster Alptraum war wahr geworden.
Von einem Münzfernsprecher in der Lobby des Bürogebäudes aus tätigte Eva zwei Anrufe. Der erste galt dem Verwalter des Hauses, in dem sie wohnte; sie wollte wissen, ob irgend jemand in ihrer Wohnung in Leblon gewesen war, einem Stadtteil im südlichen Teil Rios, in dem die Reichen lebten und die Schönen sich vergnügten. Die Antwort war nein, aber der Verwalter versprach, die Augen offenzuhalten. Der zweite Anruf ging an das Büro des FBI in Biloxi, Mississippi. Es sei äußerst dringend, erklärte sie so gelassen wie möglich und fast akzentfreies Englisch sprechend. Sie wartete, wohl wissend, daß es von diesem Augenblick an keinen Weg zurück gab.
Jemand hatte Daniel aufgespürt. Seine Vergangenheit hatte ihn schließlich doch eingeholt.
»Hallo?« Die Stimme am anderen Ende klang, als wäre sie nur einen Häuserblock weit entfernt.
»Agent Joshua Cutter?«
»Ja.«
Sie zögerte eine Sekunde. »Sind Sie für den Fall Patrick Lanigan zuständig?« Sie wußte genau, daß er zuständig war.
Nach einer kleinen Pause. »Ja. Wer sind Sie?«
Sie würden den Anruf nach Rio verfolgen, und das würde ungefähr drei Minuten dauern. Dann würde sich ihre Spur in einer Stadt mit zehn Millionen Einwohnern verlieren. Aber sie schaute sich trotzdem nervös um.
»Ich rufe aus Brasilien an«, sagte sie, sich an das Drehbuch haltend. »Sie haben Patrick entführt.«
»Wer?« fragte Cutter.
»Ich kann Ihnen einen Namen nennen.«
»Ich höre«, sagte Cutter mit plötzlich deutlich nervös gewordener Stimme.
»Jack Stephano. Kennen Sie ihn?«
Eine Pause, während Cutter offenkundig versuchte, den Namen unterzubringen. »Nein. Wer ist das?«
»Ein Privatagent in Washington. Er hat die letzten vier Jahre nach Patrick gesucht.«
»Und Sie sagen, jetzt hat er ihn gefunden, richtig?«
»Ja. Seine Leute haben ihn gefunden.«
»Wo?«
»Hier. In Brasilien.«
»Wann?«
»Heute. Und ich halte es für möglich, daß sie ihn umbringen.«
Cutter dachte eine Sekunde darüber nach, dann fragte er: »Was können Sie mir sonst noch sagen?«
Sie gab ihm Stephanos Telefonnummer in Washington, dann legte sie auf und verließ das Gebäude.
Guy sah sorgfältig die Papiere durch, die sie aus Danny Boys Haus mitgenommen hatten, und staunte über das Fehlen jeglicher Spuren. Ein Monatsauszug einer lokalen Bank wies ein Guthaben von dreitausend Dollar aus, nicht gerade das, was sie im Sinne hatten. Die einzige Einzahlung belief sich auf achtzehnhundert Dollar, die monatlichen Ausgaben betrugen weniger als tausend. Danny Boy lebte offenkundig sehr bescheiden. Strom- und Telefonrechnung waren unbezahlt, aber noch nicht wirklich in Verzug. Ein Dutzend weitere kleinere Rechnungen trugen den Vermerk »bezahlt«.
Einer von Guys Leuten überprüfte sämtliche Nummern auf Danny Boys Telefonrechnung, förderte aber nichts Interessantes zutage. Ein anderer nahm sich die Festplatte des Computers vor und stellte rasch fest, daß Danny Boy kein großer Hacker war. Da gab es ein ausführliches Tagebuch über seine Abenteuer im brasilianischen Dschungel. Der letzte Eintrag lag ungefähr ein Jahr zurück.
Die Dürftigkeit der gefundenen Papiere an sich war schon verdächtig. Nur ein Kontoauszug? Wer in aller Welt bewahrte nur den letzten Kontoauszug seiner Bank im Haus auf? Was war mit dem Monat davor? Danny Boy mußte irgendwo außerhalb seines Hauses über einen Ort verfügen, wo er seine Unterlagen aufbewahrte. Das würde zu einem Mann auf der Flucht passen.
Bei Anbruch der Dunkelheit wurde Danny Boy, immer noch bewußtlos, bis auf seine kurze Baumwollunterhose ausgezogen. Seine schmutzigen Laufschuhe und die schweißgetränkten Socken wurden abgestreift. Zum Vorschein kamen Füße, die blendend weiß waren. Seine dunkle Haut war nur vorgetäuscht. Sie legten ihn auf eine drei Zentimeter dicke Sperrholzplatte neben seinem Bett. In die Platte waren Löcher gebohrt worden, um seine Knöchel, seine Knie, seine Taille, seinen Brustkorb und seine Handgelenke mit Nylonseilen fixieren zu können. Ein breites Band aus schwarzem Plastik wurde straff um seine Stirn geschnallt. Der Tropf für die Infusion hing direkt über seinem Gesicht. Der Schlauch führte zu einer Vene oberhalb seines linken Handgelenks.
Eine Spritze wurde gesetzt, um Danny Boy aufzuwecken. Sein Atmen wurde schneller, und als sich seine Augen öffneten, waren sie blutunterlaufen und glasig und brauchten eine Weile, bis sie den Tropf erkennen konnten. Der brasilianische Arzt trat ins Bild und stach wortlos eine weitere Nadel in Danny Boys linken Arm. Es war Natrium-Thiopental, eine barbarische Droge, die manchmal benutzt wird, um Leute zum Reden zu bringen. Wahrheitsserum. Es wirkte am besten, wenn es Dinge gab, die der Gefangene gestehen wollte. Die perfekte Droge, die alles ans Licht brachte, mußte erst noch erfunden werden.
Zehn Minuten vergingen. Er versuchte, den Kopf zu bewegen, ohne Erfolg. Er konnte zu beiden Seiten ein paar Füße sehen. Das Zimmer war dunkel bis auf eine kleine Lampe irgendwo in einer Ecke hinter ihm.
Die Tür öffnete und schloß sich wieder. Guy kam allein herein. Er ging direkt auf Danny Boy zu, stützte die Hände auf den Rand der Sperrholzplatte und sagte: »Hallo, Patrick.«
Patrick schloß die Augen. Daniel Silva lag ein für alle Mal hinter ihm, für immer. Wie ein vertrauenswürdiger alter Freund war er verschwunden, einfach so. Das einfache Leben in der Rua Tiradentes löste sich zusammen mit Daniel in nichts auf; seiner kostbaren Anonymität war mit den freundlichen Worten ›Hallo, Patrick‹ kurz und schmerzlos ein Ende gesetzt worden.
Vier Jahre lang hatte er sich immer wieder gefragt, was er wohl empfand, wenn sie ihn erwischen würden. Würde es ein Gefühl der Erleichterung sein? Der Gerechtigkeit? Irgendwelche Erregung angesichts der Aussicht, nach Hause zurückzukehren, um für alles geradestehen zu müssen?
Ganz und gar nicht! Im Augenblick war Patrick beinahe besinnungslos vor Angst. Praktisch nackt und gefesselt wie ein Tier, wußte er, daß die nächsten Stunden unerträglich werden würden.
»Können Sie mich hören, Patrick?« fragte Guy, auf ihn herabschauend, und Patrick lächelte, nicht weil er es wollte, sondern weil etwas in ihm, das er nicht kontrollieren konnte, alles amüsant fand.
Die Droge begann zu wirken, stellte Guy fest. Natrium-Thiopental ist ein kurzzeitig wirkendes Barbiturat, das in sorgfältig kontrollierten Dosen verabreicht werden muß. Es ist überaus schwierig, genau den Grad an Bewußtsein herzustellen, in dem jemand für ein erfolgreiches Verhör bereit ist. Eine zu kleine Dosis, und der Widerstand wird nicht gebrochen. Ein bißchen zuviel, und das Opfer sackt einfach weg.
Die Tür öffnete und schloß sich erneut. Ein weiterer Amerikaner glitt ins Zimmer, um dem Verhör beizuwohnen, aber Patrick konnte ihn nicht sehen.
»Sie haben drei Tage geschlafen, Patrick«, sagte Guy. Es waren nur etwa fünf Stunden gewesen, aber wie konnte Patrick das wissen? »Haben Sie Hunger oder Durst?«
»Durst«, sagte Patrick.
Guy schraubte den Deckel einer kleinen Flasche ab und goß behutsam Mineralwasser zwischen Patricks Lippen.
»Danke«, sagte er, dann lächelte er wieder.
»Haben Sie Hunger?« fragte Guy noch einmal.
»Nein. Was wollen Sie?«
Guy stellte langsam die Flasche mit dem Mineralwasser auf einen Tisch und beugte sich dann dicht über Patricks Gesicht. »Lassen Sie uns vorher etwas klarstellen, Patrick. Während Sie schliefen, haben wir Ihnen Fingerabdrücke abgenommen. Wir wissen genau, wer Sie sind, also können wir uns bitte jedes Leugnen sparen, was das angeht?«
»Wer bin ich?« fragte Patrick, abermals lächelnd.
»Patrick Lanigan.«
»Von wo?«
»Biloxi, Mississippi. Geboren in New Orleans. Jurastudium in Tulane. Verheiratet, eine sechsjährige Tochter. Seit nunmehr gut vier Jahren vermißt.«
»Bingo! Der bin ich.«
»Sagen Sie, Patrick, haben Sie Ihrer eigenen Beerdigung zugeschaut?«
»Ist das ein Verbrechen?«
»Nein. Nur ein Gerücht.«
»Ja. Ich habe zugeschaut. Ich war richtig gerührt. Wußte gar nicht, daß ich so viele Freunde hatte.«
»Wie nett. Wo haben Sie sich nach Ihrer Beerdigung versteckt?«
»Mal hier, mal dort.«
Ein Schatten kam von links ins Bild, und eine Hand stellte die Infusion neu ein.
»Was ist das?« fragte Patrick.
»Ein Cocktail«, antwortete Guy, wobei er dem anderen Mann zunickte, der sich daraufhin in die Ecke zurückzog.
»Wo ist das Geld, Patrick?« fragte Guy mit einem Lächeln.
»Welches Geld?«
»Das Geld, das Sie haben mitgehen lassen.«
»Ach, das Geld«, sagte Patrick und holte tief Luft. Seine Augen schlossen sich plötzlich, und sein Körper wurde schlaff. Sekunden vergingen, und sein Brustkorb bewegte sich nur noch langsam auf und ab.
»Patrick«, sagte Guy und schüttelte leicht dessen Arm. Keine Reaktion, nur die Geräusche eines tief Schlafenden.
Die Dosis wurde sofort reduziert, und sie warteten.
Die FBI-Akte über Jack Stephano war schnell überflogen: ehemals Detective in Chicago mit zwei bestandenen Examen in Kriminologie; dann hochkarätiger Kopfgeldjäger, hervorragender Schütze, Spezialist auf den Gebieten Recherche und Spionage. Gegenwärtig Inhaber einer zwielichtigen Firma in Washington, die gegen stattliche Honorare das Aufspüren vermißter Personen und kostspielige Überwachungen organisierte.
Die FBI-Akte über Patrick Lanigan füllte acht Kästen. Es lag nahe, daß die eine Akte die andere anzog. Es herrschte kein Mangel an Leuten, die wollten, daß Patrick gefunden und in die Vereinigten Staaten zurückgebracht wurde. Stephanos Gruppe war offensichtlich angeheuert worden, um eben genau das zu tun.
Stephanos Firma, Edmund Associates, war im obersten Stockwerk eines unauffälligen Gebäudes in der K-Street untergekommen, sechs Block vom Weißen Haus entfernt. Zwei Agenten warteten in der Halle neben dem Fahrstuhl, während zwei weitere Stephanos Büro stürmten. Sie gerieten fast in ein Handgemenge mit dessen schwergewichtiger Sekretärin, die behauptete, daß Mr. Stephano im Moment zu beschäftigt sei, um ihren Besuch zu empfangen. Sie fanden ihn an seinem Schreibtisch, allein, angeregt telefonierend. Sein Lächeln verschwand, als sie mit gezückten Ausweisen hereinplatzten.
»Was zum Teufel soll das?« wollte Stephano wissen. Die Wand hinter seinem Schreibtisch wurde von einer Weltkarte mit kleinen roten Lämpchen, die auf grünen Kontinenten blinkten, eingenommen. Welches davon bezeichnete wohl Patrick?
»Wer hat Sie beauftragt, Patrick Lanigan zu finden?« fragte Agent eins.
»Das ist vertraulich«, erklärte Stephano mit einem leisen Anflug von Hohn. Er war jahrelang bei der Polizei gewesen und durch nichts so leicht einzuschüchtern.
»Wir erhielten heute nachmittag einen Anruf aus Brasilien«, sagte Agent zwei.
Ich auch, dachte Stephano fassungslos; dennoch versuchte er, sich nichts anmerken zu lassen. Seine Kinnlade klappte leicht nach unten. Blitzartig ging er alle Möglichkeiten durch, die eine Erklärung dafür boten, warum diese beiden Burschen hier aufgetaucht waren. Er hatte mit Guy gesprochen. Mit niemandem sonst. Guy war absolut zuverlässig. Guy würde nie mit jemandem reden, schon gar nicht mit dem FBI. Guy konnte es unmöglich gewesen sein.
Guy hatte ein Autotelefon benutzt und aus dem Gebirge im Osten Paraguays angerufen. Den Anruf abzuhören war unmöglich.
»Sind Sie noch da?« fragte Agent zwei bissig.
»Ja«, sagte er, ohne die Frage richtig gehört zu haben.
»Wo ist Patrick?« fragte Agent eins.
»Vielleicht in Brasilien.«
»Wo in Brasilien?«
Stephano gelang mühsam die Andeutung eines Achselzuckens. »Keine Ahnung. Es ist ein großes Land.«
»Wir haben einen Haftbefehl für ihn«, sagte Agent eins. »Er gehört uns.«
Stephano zuckte abermals die Achseln, diesmal schon ein wenig lockerer, als wollte er sagen: »Na, wenn schon«.
»Wir wollen ihn haben«, verlangte Agent zwei. »Und zwar sofort.«
»Ich kann Ihnen nicht helfen.«
»Sie lügen«, fuhr ihn Agent eins an, und beide bauten sich vor Stephanos Schreibtisch auf und fixierten ihn. Agent zwei übernahm das Reden. »Wir haben Männer unten in der Halle, draußen, um das gesamte Gebäude herum und auch vor Ihrem Haus in Falls Church. Wir werden von jetzt ab jeden Ihrer Schritte überwachen, bis wir Lanigan haben.«
»Schön. Wie wäre es, wenn Sie verschwinden würden.«
»Und tun Sie ihm nichts. Es würde uns eine Freude sein Sie festzunageln, wenn unserem Jungen auch nur das geringste zustößt.«
Sie marschierten aus dem Zimmer, und Stephano schloß die Tür hinter ihnen. Sein Büro hatte keine Fenster. Er trat vor seine Weltkarte. Brasilien hatte drei Lämpchen, was wenig bedeutete. Er schüttelte den Kopf. Er begriff es einfach nicht.
Hatte er nicht genug Zeit und Geld darauf verwendet, seine Spuren zu verwischen?
Seiner Firma eilte in gewissen Kreisen der Ruf voraus, die beste zu sein, wenn es darauf ankam, Probleme der etwas ungewöhnlicheren Art diskret und effizient zu lösen. Er war noch nie zuvor erwischt worden. Noch nie hatte jemand auch nur geahnt, hinter wem Stephano gerade her war.
3
Eine weitere Spritze, um ihn zurück in die Wirklichkeit zu holen. Dann eine, um seine Nerven zu stimulieren.
Die Tür wurde aufgerissen, und das Zimmer war mit einemmal in gleißende Helligkeit getaucht. Es füllte sich mit den Stimmen vieler Männer, geschäftigen Männern, die offensichtlich genau wußten, was sie zu tun hatten. Schweres Stiefelwerk. Der Holzboden knarrte. Guy erteilte Befehle, und jemand knurrte etwas auf portugiesisch.
Patrick öffnete die Augen und schloß sie sofort wieder. Dann taten die Drogen ihre Wirkung, und er öffnete sie endgültig. Sie scharten sich um ihn, überall schienen geschäftige Hände. Seine Unterhose wurde ziemlich grob aufgeschlitzt und entfernt. Er lag unangenehm nackt und völlig schutzlos da. Ein elektrischer Rasierapparat begann zu summen, fuhr scharf über ausgewählte Stellen an Brust, Lenden, Oberschenkel und Waden. Er biß sich auf die Lippen und verzog das Gesicht, sein Herz begann zu rasen, obwohl ihm die wirklichen Schmerzen doch erst noch bevorstanden.
Guy stand neben ihm, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Seine Augen folgten den Vorbereitungen mit gespannter Wachsamkeit.
Patrick unternahm keinerlei Anstrengung, etwas zu sagen. Um sicherzugehen, daß das so blieb, erschienen von oben herab Hände über ihm und klebten ihm einen breiten Streifen silbriges Isolierband über den Mund. Sich kalt anfühlende Elektroden wurden mit Krokodilklemmen an den rasierten Stellen angebracht, und er hörte eine laute Stimme, die irgend etwas über ›Strom‹ sagte. Dann wurde Isolierband über die Elektroden geklebt. Er glaubte, acht scharfe Punkte auf seinem Fleisch zu zählen. Vielleicht auch neun. Seine Nerven zuckten. Umnachtet wie er war, konnte er die Hände fühlen, die sich über ihm bewegten. Das Band klebte fest auf seiner Haut.
Zwei oder drei Männer waren in einer Ecke des Raumes damit beschäftigt, ein Gerät zum Laufen zu bringen, das Patrick nicht sehen konnte. Drähte wie für eine Weihnachtsbaumbeleuchtung streiften seinen Körper.
Sie würden ihn nicht umbringen, sagte er sich immer wieder, obwohl ihm der Tod irgendwann im Verlauf der nächsten paar Stunden möglicherweise willkommen sein würde. Er hatte sich während der letzten vier Jahre den Alptraum tausendfach vorgestellt. Er hatte gebetet, daß es nie passieren würde, aber immer gewußt, daß es so kommen mußte. Er hatte immer befürchtet, daß sie da draußen waren, irgendwo im Schatten, ihm nachspürten, Leute bestachen und gewissermaßen jeden Stein auf der Suche nach ihm umdrehten.
Patrick hatte es immer gewußt. Eva war einfach zu naiv gewesen.
Er schloß die Augen, versuchte, gleichmäßig zu atmen, versuchte, seine Gedanken unter Kontrolle zu halten, während sie über ihm hantierten und seinen Körper für das präparierten, was ihn wie ein bösartiges Tier anspringen würde. Die Drogen ließen seinen Puls rasen. Seine Haut juckte.
Ich weiß nicht, wo das Geld ist. Ich weiß nicht, wo das Geld ist. Es fehlte nicht viel, und er hätte es laut deklamiert. Er dankte Gott für das Band über seinem Mund. Ich weiß nicht, wo das Geld ist.
Er rief Eva jeden Nachmittag zwischen vier und sechs Uhr an. Jeden Tag. Sieben Tage die Woche. Keine Ausnahmen, sofern keine geplant waren. Er wußte tief im Inneren seines wie wild schlagenden Herzens, daß sie das Geld inzwischen transferiert und an mindestens zwei Dutzend Stellen überall in der Welt sicher versteckt hatte. Er selbst wußte nicht, wo das Geld war.
Aber würden sie ihm das glauben?
Die Tür öffnete sich, und zwei oder drei Leute verließen das Zimmer. Die Aktivitäten rings um seine Folterbank aus Sperrholz flauten ab. Dann war mit einem Mal alles still. Er öffnete die Augen und sah, daß der Tropf verschwunden war.
Guy blickte auf ihn herab. Er ergriff eine Ecke des silbrigen Isolierbandes über Patricks Mund und zog es behutsam ab, so daß Patrick sprechen konnte, wenn er wollte.
»Danke«, sagte Patrick.
Linker Hand erschien abermals der brasilianische Arzt und stach eine Kanüle in Patricks Arm. Die Spritze war groß und enthielt nichts als gefärbtes Wasser, aber woher sollte Patrick das wissen?
»Wo ist das Geld, Patrick?« fragte Guy.
»Ich habe kein Geld«, erwiderte Patrick. Sein Kopf schmerzte, weil er auf das Sperrholz gepreßt wurde. Das straff gespannte Plastikband auf seiner Stirn brannte. Er hatte sich seit Stunden nicht bewegt.
»Sie werden es mir sagen, Patrick, ich verspreche Ihnen, daß Sie es mir sagen werden. Sie können es gleich tun oder in zehn Stunden, wenn Sie halbtot sind. Machen Sie es sich leicht.«
»Ich will nicht sterben, okay?« sagte Patrick mit angsterfüllten Augen. Sie werden mich nicht umbringen, sagte er sich.
Guy ergriff ein kleines, in seiner Schlichtheit um so häßlicher wirkendes Gerät, das neben Patrick auf der Sperrholzplatte gelegen hatte, und hielt es ihm vors Gesicht. Es war ein Chromhebel mit einer schwarzen Gummispitze, auf einem kleinen, quadratischen schwarzen Block montiert, von dem zwei Drähte ausgingen. »Sehen Sie sich das an«, sagte Guy, als ob Patrick eine andere Wahl gehabt hätte. »Wenn der Hebel oben ist, ist der Stromkreis unterbrochen.« Guy nahm die Gummispitze zwischen Daumen und Zeigefinger und senkte sie langsam herab. »Aber wenn er sich nach unten bewegt, wird der Stromkreis geschlossen, und der Strom fließt durch die Drähte zu den an Ihrer Haut befestigten Elektroden.« Er stoppte den Hebel ein paar Millimeter vom Kontakt entfernt. Patrick hielt den Atem an. Das Zimmer war still.
»Möchten Sie erleben, was passiert, wenn …?« fragte Guy.
»Nein.«
»Also, wo ist das Geld?«
»Ich weiß es nicht. Ich schwöre es.«
Dreißig Zentimeter von Patricks Gesicht entfernt schob Guy den Hebel bis zum Kontakt. Der Schock kam übergangslos und war grauenhaft – heiße Stromstöße jagten in Patricks Fleisch. Durch seinen Körper ging ein Ruck, und die Nylonseile strafften sich. Er kniff die Augen zu und biß die Zähne zusammen, fest entschlossen, nicht zu schreien, gab es aber Sekundenbruchteile später wieder auf und stieß einen durchdringenden Schrei aus, der in der ganzen Hütte zu hören war.
Guy zog den Hebel zurück, wartete ein paar Sekunden, bis Patrick wieder einigermaßen normal atmete und seine Augen öffnete, dann sagte er: »Das war der erste Grad, der schwächste. Ich habe fünf Grade, und ich werde sie alle benutzen, falls es erforderlich sein sollte. Acht Sekunden des fünften Grades töten Sie, und mir würde es nichts ausmachen, Sie sterben zu sehen, wenn es sich als nötig erweisen sollte. Hören Sie mir zu, Patrick?«
Sein Fleisch brannte immer noch von der Brust bis zu den Knöcheln. Sein Herz raste wie verrückt, und er atmete flach, aber stoßweise aus.
»Hören Sie mir zu?« wiederholte Guy.
»Ja.«
»Ihre Lage ist im Grunde sehr einfach. Sie sagen mir, wo das Geld ist, und Sie verlassen dieses Zimmer lebend. Irgendwann bringen wir Sie nach Ponta Porã zurück, und Sie können dort weiterleben wie bisher. Wir haben nicht die Absicht, das FBI zu informieren.« Guy machte um des Effekts willen eine Pause und spielte sachte mit dem Chromhebel. »Wenn Sie sich dagegen weigern sollten, mir zu sagen, wo das Geld ist, werden Sie dieses Zimmer nicht lebend verlassen. Haben Sie das verstanden, Patrick?«
»Ja.«
»Gut. Wo ist das Geld?«
»Ich schwöre, ich weiß es nicht. Wenn ich es wüßte, würde ich es Ihnen sagen.«
Guy drückte wortlos den Hebel herunter, und der Stromstoß traf ihn wie kochende Säure. »Ich weiß es nicht!« schrie Patrick gequält. »Ich schwöre, ich weiß es nicht.«
Guy schob den Hebel in die Ausgangsposition zurück und wartete ein paar Sekunden, damit Patrick sich erholen konnte. Dann fragte er ruhig: »Wo ist das Geld?«
»Ich schwöre, ich weiß es nicht.«
Ein weiterer Schrei gellte durch die Hütte und drang durch die offenen Fenster in die Schlucht zwischen den Bergen, wo er leise widerhallte, bevor er sich im Dschungel verlor.
Das Apartment in Curitiba lag in der Nähe des Flughafens. Eva wies den Taxifahrer an, auf der Straße zu warten. Sie ließ ihre Reisetasche im Kofferraum, nahm nur ihren Aktenkoffer mit.
Sie fuhr mit dem Fahrstuhl in den neunten Stock. Der Flur lag ruhig und dunkel vor ihr. Es war fast elf Uhr abends. Sie bewegte sich vorsichtig vorwärts und schaute sich prüfend um. Sie schloß die Wohnungstür auf, dann schaltete sie rasch mit einem weiteren Schlüssel die Alarmanlage aus.
Daniel war nicht in der Wohnung; das war zwar keine Überraschung, aber doch eine Enttäuschung. Keine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Nirgendwo ein Lebenszeichen von ihm. Ihre Angst wuchs.
Sie konnte nicht lange bleiben, weil die Männer, die Daniel in ihrer Gewalt hatten, vielleicht schon auf dem Weg hierher waren. Obwohl sie genau wußte, was sie zu tun hatte, wirkten ihre Bewegungen gezwungen und langsam. Die Wohnung bestand nur aus drei Zimmern, und sie durchsuchte sie schnell.
Die Papiere, denen ihr Interesse galt, lagen in einem verschlossenen Aktenschrank im Wohnzimmer. Sie öffnete die drei schweren Schubladen und packte deren Inhalt in einen eleganten Lederkoffer, den Patrick in einer Abstellkammer in der Nähe aufbewahrte. Der weitaus größte Teil des Materials bestand aus Finanzunterlagen, obwohl es für ein derart großes Vermögen nicht gerade viele waren. Er hatte seine Spuren auf Papier stets so gering wie möglich gehalten. Er kam einmal im Monat hierher, um Unterlagen aus seinem Haus zu verstecken, und mindestens einmal im Monat wanderte überflüssig gewordenes Papier in den Reißwolf.
Fürs erste konnte Daniel nicht mehr wissen, wo sich seine Papiere befanden.
Sie schaltete die Alarmanlage wieder ein und verließ das Apartment. Keiner in dem engverwinkelten Gebäude hatte sie gesehen. Sie nahm ein Zimmer in einem kleinen Hotel in der Innenstadt, in der Nähe des Museums für zeitgenössische Kunst. Die Banken in Asien hatten geöffnet, und in Zürich war es fast vier Uhr. Sie packte ein kleines Faxgerät aus und schloß es an den Telefonanschluß in ihrem Zimmer an. Wenig später war ihr kleines Bett mit Anweisungen und Vollmachten für telegrafische Überweisungen bedeckt.
Sie war müde, aber an Schlaf war jetzt nicht zu denken. Daniel hatte gesagt, sie würden sie suchen. Sie konnte nicht nach Hause. In Gedanken war sie nicht bei dem Geld, sondern bei ihm. Lebte er noch? Und wenn ja, wie sehr mußte er leiden? Wieviel hatte er ihnen bereits erzählt, und um welchen Preis?
Sie strich sich über die Augen und begann, die Papiere zu sortieren. Sie hatte keine Zeit für Tränen.
Beim Foltern erzielt man nach etwa drei Tagen periodisch wiederkehrender Behandlung die besten Ergebnisse. Auch der stärkste Wille wird langsam gebrochen. Das Opfer denkt, während es auf die nächste Sitzung wartet, nur noch an die Schmerzen, die in seinem Kopf ein immer größeres Ausmaß annehmen. Drei Tage, und die meisten Leute zerbrechen, lösen sich gewissermaßen psychisch in ihre Bestandteile auf.
Guy hatte keine drei Tage. Sein Gefangener war nicht jemand, den man in einem Krieg gefangengenommen hatte, sondern ein vom FBI gesuchter amerikanischer Staatsbürger.
Gegen Mitternacht ließen sie Patrick für ein paar Minuten allein, damit er leiden und über die nächste Runde nachdenken konnte. Sein Körper war schweißgebadet, seine Haut von den Stromstößen und der Hitze gerötet. Unter dem Band auf seiner Brust, wo die Elektroden viel zu fest aufgeklebt worden waren und sich bereits in sein Fleisch gebrannt hatten, sickerte Blut hervor. Er rang nach Luft und leckte sich die trockenen, ausgedörrten Lippen. Die Nylonseile an seinen Handgelenken und Knöcheln hatten die Haut wundgescheuert.
Guy kehrte allein zurück und ließ sich auf einem Schemel neben der Folterbank aus Sperrholz nieder. Eine Minute lang war es beinahe vollkommen still im Zimmer; das einzige Geräusch war Patricks Atem, während er versuchte, wieder zu Verstand zu kommen. Er hielt die Augen fest geschlossen.
»Sie sind ein Dickschädel«, sagte Guy schließlich.
Keine Antwort.
Die ersten zwei Stunden hatten nichts gebracht. Bei jeder Frage war es um das Geld gegangen. Er wußte nicht, wo es war, hatte er hundertmal gesagt. Existierte es überhaupt? Nein, hatte er mehrfach gesagt. Was war damit passiert? Er wußte es nicht.
Guys Erfahrungen mit Folterpraktiken waren äußerst begrenzt. Er hatte einen Experten konsultiert, einen Sadisten, der so etwas tatsächlich zu genießen schien. Er hatte ein einschlägiges Handbuch gelesen, mußte aber feststellen, daß die Umsetzung in die Tat ziemlich schwierig war.
Jetzt, wo Patrick wußte, wie grauenhaft die Dinge werden konnten, war es wichtig, ihn ein wenig aufzumuntern.
»Wo waren Sie, als Ihre Beerdigung stattfand?« fragte Guy.
Patricks Muskeln entspannten sich ein wenig. Endlich eine Frage, die nicht das Geld betraf. Er zögerte und dachte darüber nach. Was konnte es schaden? Er war erwischt worden. Seine Geschichte würde ohnehin ans Licht kommen. Vielleicht würden sie mit den Stromstößen aufhören, wenn er kooperierte.
»In Biloxi«, sagte er.
»Versteckt?«
»Ja, natürlich.«
»Und Sie haben bei Ihrer Beerdigung zugeschaut?«
»Ja.«
»Von wo aus?«
»Ich saß auf einem Baum, mit einem Fernglas.« Er hielt die Augen geschlossen und die Fäuste geballt.
»Und wohin sind Sie von dort aus gegangen?«
»Nach Mobile.«
»War das Ihr Versteck?«
»Ja, eines von mehreren.«
»Wie lange sind Sie dort geblieben?«
»Mehrere Monate, mit Unterbrechungen.«
»So lange? Wo haben Sie in Mobile gewohnt?«
»In billigen Motels. Ich war ständig auf Achse. Habe mich entlang der Golfküste bewegt. Destin. Panama City Beach. Zurück nach Mobile.«
»Sie haben Ihr Äußeres verändert.«
»Ja. Ich habe mich rasiert, mir das Haar gefärbt, fünfundzwanzig Kilo abgenommen.«
»Haben Sie eine Sprache gelernt?«
»Portugiesisch.«
»Sie haben also gewußt, daß Sie hierher kommen würden?«
»Wo ist hier?«
»Lassen Sie uns annehmen Brasilien.«
»Okay. Ich dachte mir, es wäre ein gutes Land, um sich zu verstecken.«
»Wohin ging es von Mobile aus?«
»Nach Toronto.«
»Weshalb Toronto?«
»Ich mußte doch irgendwo untertauchen. Toronto ist ein geeigneter Ort dafür.«
»Haben Sie sich dort neue Papiere besorgt?«
»Ja.«
»In Toronto sind Sie also zu Daniel Silva geworden?«
»Ja.«
»Und haben sich weiter damit beschäftigt, Portugiesisch zu lernen?«
»Ja.«
»Und noch mehr abgenommen?«
»Ja. Noch einmal fünfzehn Kilo.« Er hielt die Augen geschlossen und versuchte, die Schmerzen zu ignorieren oder wenigstens für den Augenblick mit ihnen zu leben. Die Elektroden auf seiner Brust glühten regelrecht und schnitten immer tiefer in seine Haut ein.
»Wie lange sind Sie dort geblieben?«
»Drei Monate.«
»Sie haben Toronto also im Juli ’92 verlassen?«
»So ungefähr.«
»Anschließend gingen Sie …?«
»Nach Portugal.«
»Weshalb Portugal?«
»Ein hübsches Land. Ich kannte es noch nicht.«
»Waren Sie lange dort?«
»Zwei Monate.«
»Und dann. Weiter!«
»Nach São Paulo.«
»Warum São Paulo?«
»Zwanzig Millionen Menschen. Ein wundervoller Ort, um sich zu verstecken.«
»Wie lange waren Sie dort?«
»Ein Jahr.«
»Erzählen Sie mir, was Sie dort gemacht haben.«
Patrick holte tief Luft, dann verzog er das Gesicht, weil er seine Knöchel bewegt hatte. »Ich bin in der Stadt untergetaucht. Ich engagierte einen Lehrer und vervollkommnete meine Sprachkenntnisse. Nahm noch ein paar Kilo ab. Zog von einer Wohnung in die nächste.«
»Was haben Sie mit dem Geld gemacht?«
Eine Pause. Ein Muskelzucken. Wo war dieser fürchterliche kleine Chromhebel? Weshalb konnten sie sich nicht einfach weiter unterhalten und das Geld aus dem Spiel lassen?
»Mit welchem Geld?« fragte er; es war ein halbwegs gelungener Versuch, verzweifelt zu klingen.
»Das wissen Sie ganz genau, Patrick. Die neunzig Millionen Dollar, die Sie Ihrer Kanzlei und Ihrem Mandanten gestohlen haben.«
»Ich habe es Ihnen schon gesagt. Ihr habt den falschen Mann.«
Guy brüllte plötzlich in Richtung Tür. Sie wurde sofort aufgerissen, und der Rest der Amerikaner stürzte herein. Der brasilianische Arzt pumpte den Inhalt zweier weiterer Spritzen in Patricks Venen, dann verschwand er wieder. Zwei Männer kauerten neben dem Apparat in der Ecke. Das Tonbandgerät wurde eingeschaltet. Guy beugte sich mit dem Chromhebel in der Hand über Patrick. Seine Miene hatte sich schlagartig verfinstert. Er war wütend und mehr denn je fest entschlossen, Patrick zu töten, wenn er nicht reden sollte.
»Das Geld ging per telegrafischer Überweisung auf dem Auslandskonto Ihrer Kanzlei in Nassau ein, und zwar um genau zehn Uhr fünfzehn Eastern Standard. Datum, der 26. März 1992, fünfundvierzig Tage nach Ihrem Tod. Sie waren dort, Patrick, verdammt fit und gebräunt und gaben sich für jemand anderes aus. Wir haben Fotos, die von der Überwachungskamera der Bank aufgenommen wurden. Sie hatten perfekt gefälschte Papiere. Kurze Zeit nach seinem Eingang hat das Geld sich in Luft aufgelöst, wurde per telegrafischer Überweisung auf eine Bank nach Malta transferiert. Sie, Patrick, haben es gestohlen. Wo ist es? Sagen Sie es mir, dann lasse ich Sie am Leben.«
Patrick warf einen letzten Blick auf Guy und einen letzten Blick auf den Hebel, dann kniff er die Augen fest zusammen, verspannte sich und sagte: »Ich schwöre, ich weiß nicht, wovon Sie reden.«
»Patrick, Patrick …«
»Bitte, tun Sie es nicht!« flehte er. »Bitte!«
»Das, Patrick, ist nur der dritte Grad. Halbzeit, wenn Sie so wollen. Sie sind bei der Hälfte angekommen.« Guy schob den Hebel nach unten und schaute ungerührt zu, wie sich der Körper auf der Sperrholzplatte aufbäumte und verkrampfte.
Patrick schrie markerschütternd, und es war ein so durchdringender und grauenhafter Schrei, daß Osmar und seine Brasilianer vor dem Haus für eine Sekunde innehielten. Ihre Unterhaltung im Dunkeln erstarb. Einer von ihnen sprach ein stummes Gebet.
Ein Stück die Straße hinunter, ungefähr hundert Meter entfernt, saß ein Brasilianer mit einer Waffe und hielt nach herankommenden Fahrzeugen Ausschau. Man rechnete nicht wirklich damit, daß jemand auftauchte. Die nächsten bewohnten Häuser waren meilenweit entfernt. Auch er sprach ein kleines Gebet, als das Schreien von neuem begann.
4
Es war entweder der vierte oder der fünfte Anruf von einem Nachbarn, der Mrs. Stephano endgültig die Nerven verlieren ließ und Jack zwang, seiner Frau die Wahrheit zu sagen. Die drei Männer in dunklen Anzügen, die in dem direkt vor ihrem Haus geparkten Wagen saßen, waren FBI-Agenten. Er erklärte ihr, weshalb diese dort ihre Zeit totschlugen. Er erzählte ihr den größten Teil von Patricks Geschichte. Ein schwerer Verstoß gegen sein Berufsethos. Mrs. Stephano stellte sonst nie Fragen.
Es kümmerte sie nicht im geringsten, was ihr Mann in seinem Büro tat. Aber es machte ihr ungeheuer viel aus, was die Nachbarn unter den gegebenen Umständen denken konnten. Dies war schließlich Falls Church, und man durfte sicher sein, daß die Leute reden würden.
Sie und ihr Mann gingen gegen Mitternacht zu Bett. Jack legte sich auf das Sofa im Wohnzimmer und stand alle halbe Stunde auf, um einen Blick durch die Jalousie zu werfen und zu sehen, was sie da draußen taten. Er war nur kurz eingenickt, als es um drei Uhr morgens an der Tür klingelte.
Er öffnete, mit einem Trainingsanzug bekleidet. Vier von ihnen standen vor der Tür, und in einem von ihnen erkannte er sofort Hamilton Jaynes, den stellvertretenden Direktor des FBI. Die Nummer zwei im Bureau. Er wohnte nur vier Blocks entfernt und gehörte demselben Golfklub wie Stephano an. Die beiden waren sich dort nie begegnet.
Titel der Originalausgabe THE PARTNER erschien 1997 im Verlag Doubleday (Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc.) New York
Taschenbucherstausgabe 9/99
Copyright © 1997 by John GrishamCopyright © 1998 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Die Hardcover-Ausgabe erschien im Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg
Umschlagillustration: Bildagentur Mauritius/nonstock, Mittenwald Umschlaggestaltung: Hauptmann und Kampa Werbeagentur, CH-Zug Satz: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
ISBN 3-641-11034-5
http://www.heyne.de
www.randomhouse.de