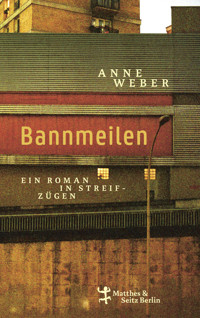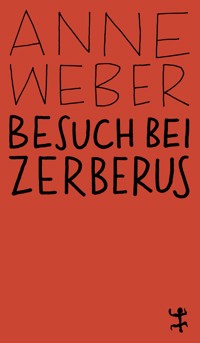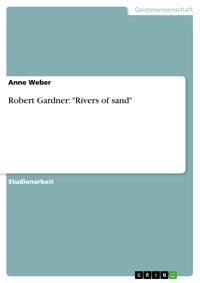Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit dem Deutschen Buchpreis 2020 ausgezeichnet Was für ein Leben! Geboren 1923 in der Bretagne, aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, schon als Jugendliche Mitglied der kommunistischen Résistance, Retterin zweier jüdischer Jugendlicher — wofür sie von Yad Vashem später den Ehrentitel »Gerechte unter den Völkern« erhalten wird –, nach dem Krieg Neurophysiologin in Marseille, 1959 zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt wegen ihres Engagements auf Seiten der algerischen Unabhängigkeitsbewegung… und noch heute an Schulen ein lebendiges Beispiel für die Wichtigkeit des Ungehorsams. Anne Weber erzählt das unwahrscheinliche Leben der Anne Beaumanoir in einem brillanten biografischen Heldinnenepos. Die mit großer Sprachkraft geschilderten Szenen werfen viele Fragen auf: Was treibt jemanden in den Widerstand? Was opfert er dafür? Wie weit darf er gehen? Was kann er erreichen? Annette, ein Heldinnenepos erzählt von einer wahren Heldin, die uns etwas angeht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne Weber
Annette, ein Heldinnenepos
Anne Beaumanoir ist einer ihrer Namen.
Es gibt sie, ja, es gibt sie auch woanders als auf
diesen Seiten, und zwar in Dieulefit, auf Deutsch
Gott-hats-gemacht, im Süden Frankreichs.
Sie glaubt nicht an Gott, aber er an sie.
Falls es ihn gibt, so hat er sie gemacht.
Sie ist sehr alt, und wie es das Erzählen will,
ist sie zugleich noch ungeboren. Heute,
da sie fünfundneunzig ist, kommt sie
auf diesem weißen Blatt zur Welt –
in eine undurchdringliche Leere, in die sie
lange runde Maulwurfblicke wirft und die sich
nach und nach mit Formen und mit Farben,
mit Vater Mutter Himmel Wasser Erde füllt.
Himmel und Erde sind bleibende Erscheinungen,
das Wasser aber kommt und geht, es strömt
ins trockne Bett des Flusses Arguenon, wo es
zweimal am Tag die Boote aufrichtet, die schon seit
Stunden auf der Flanke liegen. Zweimal am Tag
zieht sichs ins Meer zurück, Ärmelkanal
nennt man es hier, auch kurz La Manche, Der
Ärmel, obwohl es kein Kanal und auch kein Ärmel ist,
nichts Hohles also, eher schon ein Arm: der
Meeresarm, den der Atlantik zur
Nordsee rüberstreckt. Sachte legen sich die
Boote wieder seitlich auf den Bauch.
Im All des Zimmers, dem noch unbewohnten,
schwimmen vier und auch manchmal sechs
glänzende Gestirne oder Augen. Wie in der Dunkelkammer
langsam Konturen aus dem Nichts aufsteigen,
beginnen sich um die Gestirne
Gesichter abzuzeichnen. Mutter. Großmutter.
Vater. Das Kind, das Anne heißt und alle
Annette nennen (sprich Annett) bringt diese
Planeten zum Kreisen.
Von Annette ist Anne (die Heutige) dem Alter nach
doppelt so weit entfernt, wie ihre
Großmutter es damals war, aber irgendwo
erstaunlich fern und nah
gibt es noch dieses Kind. Es ist eins mit ihr,
ist nicht verkümmert und nicht tot, es schläft,
es ist noch da.
Geboren wird Annette in einer Sackgasse,
und das nicht bloß im übertragnen Sinne
wie wir alle. Das Haus der Großmutter schließt
eine Reihe unverputzter Fischerhäuschen ab, die
mit ihm unvermittelt endet vor dem Fluss.
Ein jedes Häuschen hat unten einen Wohnraum
und rechts und links eine Kammer unterm Dach.
»Das Haus der Großmutter« heißt nicht, dass es
das ihre wäre. Sie wohnt zur Miete. Die Unterkunft
ist kümmerlich, und dementsprechend
niedrig ist die Miete, doch das Geringe ist
noch viel für sie, die früh verwitwet ihre Kinder
mit dem Ertrag der pêche à pied oder des
Fischens ohne Boot herangezogen hat:
Tag für Tag macht sie sich bei Ebbe auf den Weg
und stöbert ausdauernd im nassen Sand allerlei
Meeresgetier auf: Venusmuscheln Strandkrabben
Teppichmuscheln Wellhornschnecken, die sie
in einem Korb auf ihrem Rücken in viele Dörfer der
Umgebung trägt und dort – in Saint-Éniguet,
La Ville Gicquel, Le Tertre, Notre-Dame-du-Guildo
oder Le Bouillon – verkauft.
Die Mutter ihrer Mutter ist im 19. Jahrhundert
in der Bretagne, also gewissermaßen
noch zwei Jahrhunderte zuvor geboren, als
eines vieler Kinder habeloser Bauern, die ihre
Kinder nicht ernähren können und sie daher
eins nach dem anderen bei Reicheren in Dienst geben.
Die kleine Kuhmagd ist sehr arm. Lange Zeit trägt sie
– o Schock später für ihre kleine Enkelin! –
keine Unterhose. Sie hatte keine. Schlief im Stroh. Ihr
Jahreslohn war ein Paar neue Holzschuhe, und alle
zwei Jahre gabs entweder einen Umhang und dazu
ein Paar Strümpfe oder auch einen Rock und eine Jacke, was
deshalb schon kein Luxus war, weil sie noch gar nicht
ausgewachsen war. Sie ging nie zur Schule. Illettré
sagt man dazu, wenn eine ihresgleichen oder einer
weder des Lesens noch des Schreibens kundig ist.
Mit fünfzig Jahren wird ihr erstmals klar – Annette
ist vielleicht sieben –, dass sie von ihrer Mutter
nie einen Kuss bekam, und sie, die bisher
nie geklagt hat, bricht in Tränen aus. So
sitzen sie, Großmutter und Enkelin,
und küssen sich und küssen sich und küssen sich
und weinen. Von ihrem Vater weiß sie nur,
wie grob er war. Ihre Geschwister, Kinderknechte
und -mägde wie sie selbst, erwähnt sie nie,
sie sind vielleicht inzwischen tot oder verschollen
oder sie leben in der Nähe. Annette
liebt über alles diese Großmutter, die
reich ist nicht an Gütern und gebildet
nicht durch Lektüren.
Wie jeder von uns hat sie
noch eine zweite. Die liebt sie weniger.
Es ist die Mutter ihres Vaters, eine Beaumanoir,
was Schönes Herrenhaus bedeutet und
in der Tat d i e bessere Familie ist in einem Ort,
der keine wirklich hohen Kreise kennt.
Auch Madame Beaumanoir ist Witwe und sie ist
Tochter des Notars. In ihren ersten Lebensjahren
bekommt Annette Großmutter zwei
nicht zu Gesicht. Die Brücken zwischen
ihr und deren Sohn sind abgebrochen
am Tag, an dem sie ihm verboten hat, das Mädchen
aus dem Fischerhäuschen – eine der Töchter von
Großmutter eins – zur Frau zu nehmen,
worunter Madame Beaumanoir sicher
gelitten haben mag, aber was tun?
Alles in ihr sträubte sich gegen
die ungleiche Verbindung, der dann
zu ihrem Leidwesen auch prompt
eine Annette entsprang. Sie hält den Sohn
für etwas Besseres und sie hat recht damit,
er ist auch etwas Besseres, denn er verzichtet
auf ihre achtbare Gesellschaft und sein Erbe
zugunsten seiner Liebsten. Zu diesem Zeitpunkt
sind die beiden fast noch Kinder, nicht volljährig
nach dem Gesetz und ohne elterliche Zustimmung
zur Heirat unfähig, so dass Annette ganz wie in einem
Märchen – einem bretonischen – im armen
Fischerhäuschen von Großmutter eins und
außerhalb der Ehe, aber nicht außerhalb der Liebe
geboren und vorläufig in kein Geburtsregister
eingetragen wird.
Sie hat glückliche Eltern, möchte man
behaupten, aber ist das denn richtig und
so allgemein gesprochen möglich?
Heißt es nicht immer, einen Glückszustand gäbs
höchstens für Momente? Sie aber sind glücklich
jederzeit, und wer Beweise hat fürs Gegenteil, der
möge widersprechen, jetzt ist dazu Gelegenheit.
Glück ist der Grundton ihres Alltags. Von Anfang an
durchdrungen von dieser unhörbaren wärmenden Musik,
ausgestattet mit den hellen Augen und dem
unerschrocknen Herzen ihrer Eltern
tritt Annette auf.
Die Eltern sind nicht nur, was man so
glücklich nennt, sie sind auch noch das
Gegenteil vom jeweils anderen. Jean ist groß und
Petite Marthe ist klein, er ist bedächtig und gelassen,
sie redefreudig-wuselig, aber vernünftig
ist sie auch, dazu eine Erzählerin, der man lauscht,
mit offnem Mund. Er nennt sie gerne
»meine Suffragette«, womit er nicht so sehr ihren
Feminismus meint, als ihre Neigung, sich über Unrecht
heftig zu erzürnen und vor Wut zu schnauben; in ihrem
eigenen Idiom wäre sie soupe au lait oder auch
milchsuppig, von jener Suppenart auf jeden Fall, die
sehr schnell überkocht. Sie hat sich alles selber beigebracht,
und »alles« ist vielleicht nicht alles, aber doch sehr viel,
die Leselust, das Pingpongspielen, nur Autofahren
glückt ihr nicht, weil sie dazu zu stürmisch ist.
Kein Wunder, könnte man jetzt denken, bei diesen
günstigen Bedingungen, dass aus der Tochter wurde,
was dann aus ihr wurde und was der Klappentext, schon
weil die Fülle von Jahrzehnten Taten Mühen weit über
jeden Buchdeckel hinausragen, nur schlecht zusammenfasst.
Wenn es so wäre, dass die Bedingungen allein die
Zukunft vorgeben, wären wir jegliche Verantwortung,
jedes Gefühl für Schuld, jedes Gewissen los. So
einfach ist es aber nicht. Die Hauptsache
kommt immer noch; sie bleibt zu tun.
Vorerst ist Annette fast fünf, ja, sie hat bald
Geburtstag, aber wird sie ihn erleben? Von
heute aus gesehen eine blöde Frage,
doch damals ist die Antwort durchaus
ungewiss. Denn sie ist sehr schwer krank
und gar nicht bei Bewusstsein,
aber dann wacht sie auf und sieht als Erstes
gleich das Fahrrad, das man ihr zum
Geburtstag schenkt. Von der Weltwirtschaftskrise
haben ihre Eltern nicht Notiz genommen, sie hatten
ihre eigne Große Depression, saßen am Bett der
einzigen Tochter und beteten nicht, sondern
befolgten mit verzweifelter Genauigkeit die
Vorschriften des Arztes, der selbst nicht
wirklich daran glaubte, dass das Kind noch zu retten sei.
Hirnhautentzündung. – Das Schlimmste
ist vorbei. Annette ist bei sich, was aber nicht
per Knopfdruck geht, sondern ein
langsamer Prozess ist, denn noch
neunzig Jahre später weiß sie, dass ihre
Muskeln Haut Gelenke Sehnen und
Gedärme sich als Erste wieder meldeten,
und erst, als auch das Ohr sich wieder einfand,
konnte sie die Stimmen ihrer Eltern hören.
Am Lager der Genesenden findet ein
Gipfeltreffen statt mit beiden Großmüttern.
Madame Beaumanoir trifft auf La Mère Brunet,
wie Großmutter eins im Dorf genannt wird.
Enchantées, ja, überaus enchantées sind die beiden,
allerdings hauptsächlich über die
Heilung dieser Kleinen. Annettes Eltern
sind inzwischen volljährig und verheiratet.
Annette trägt jetzt den Namen ihres Vaters
und der versöhnten Großmutter zwei
und heißt auf dem Papier Raymonde Marcelle
Anne Beaumanoir. Das Fischerhäuschen hat sie
längst verlassen und ist mit ihren Eltern und Mémère
jenseits der Eisenbrücke über den Arguenon
oder Pont du Guildo gezogen, die mitzubauen
Mémères Mann, ein Schmied, hierhergekommen war,
doch schon fünf Jahre und drei Kinder später war er
(Schwindsucht) tot. Das neue Haus, das wieder
nur ein Häuschen ist, steht am anderen Ufer, ihrem
Geburtshaus gegenüber. Vom Fluss, der
die zwei Häuser trennt – bei Hochwasser ein
breiter Strom –, bleiben bei Ebbe nur zwei Rinnsale.
Sieh da, die Glückshäuser, könnte wohl
einer denken, der heute auf der
Brücke stünde und auf die beiden Häuschen blickte
rechts und links. Im Flur des zweiten,
zwischen der Eingangstür und der des elterlichen
Schlafzimmers, welche als Tore dienen, spielt die
Familie vor dem Abendessen Fußball,
bis das zehnte Tor gefallen ist.
Danach entbrennt ein Ringkampf,
wie es in Glückshäusern passieren kann,
wo es ein Zeichen ist – na ja, von Glück.
Wenn Ball ist und aufgespielt wird unten
an der Brücke, tanzen Mémère und Annette
bei offnem Fenster in der Küche Polka.
Jean, Annettes Vater, ist ein Sozialist,
aber der Pfarrer – wir sind in der Bretagne
und der Pfarrer ist katholisch –
also monsieur le curé kommt öfter mal
zum Abendessen, was nicht weiter
erstaunlich ist, sobald man weiß, dass er
sofort bei Amtsantritt die gleiche Kerze für alle,
vielmehr die gleiche Kerzengröße eingeführt hat.
Bis dahin trug bei Kommunionsfeiern – je
nachdem, wie reich die Eltern waren – einer
ein fingergroßes Kerzlein, der andere
– der kleine Dibonnet z. B. –
eine Art Kerzenpfahl so vor sich her.
Der Vater kommt gut aus mit diesem Pfarrer,
und um ihm keinen Kummer zu bereiten,
schickt er Annette zur ersten Kommunion
(die Mutter, Marthe, ist davon nicht sehr
angetan, aber sie mag den Pfarrer auch). Daraus
ergeben sich zwei Wochen »explosiver Mystik«
(Zitat Annette), was gewiss nicht nichts, doch
über beinahe ein Jahrhundert weg
doch eher wenig ist. Vorher und nachher:
nichts. Wie in Dumas’ Roman
gibt es im Ort die Blauen und die Weißen,
also die Republikaner und die Royalisten,
wobei Letztere nicht mehr unbedingt
Royalisten, aber doch Traditionalisten
und katholisch sind. Die Blauen sind
weiterhin Republikaner, und Laizisten
sind sie auch, was heißt, dass sie die Kirche
trennen wollen, von sich natürlich und
vor allem von dem Staat, und wenn es geht
soll sie auch nichts zu sagen haben.
Das ist in der Bretagne noch ein frommer
oder eher unfrommer Wunsch. In Le Guildo
gibts eine Mädchenschule, die katholisch ist, in die
die meisten Kinder gehen, sogar die
Töchter der paar reichen Bauern und die der Pächter
fürstlicher Ländereien, denn einen Fürsten
gibt es auch und dazu noch ein Schloss.
In der zweiten Schule, die der Staat betreibt, treffen sich
die ärmeren bis bitterarmen Töchter von
Seeleuten au long cours oder auf großer Fahrt,
die vor Neufundland Kabeljau in großen Mengen fischen,
den sie Monate drauf als Stockfisch, eingesalzen also,
mit nach Hause bringen. Auch Küstenfischer-
Töchter sind dazwischen und zwei, drei
Bauernkinder, insgesamt dreißig Mädchen, also eine Klasse,
zu mehr reicht es nicht in der école laïque.
Annette lernt dort das Lesen und das Schreiben, und
kaum weiß sie in etwa, wie das geht, da
fängt sie an, Mémère zu unterrichten, die
tatsächlich weder das eine noch das andre kann.
Als Klassenzimmer bietet sich die Höhle
unter Annettes Bettdecke gut an. Es dauert ein paar
Monate, dann können beide lesen oder sagen wir:
entziffern. Mit Annettes Hilfe schreibt Mémère
den denkwürdigen Satz: »Heute
habe ich mit den Kartoffeln und dem Lauch
aus dem Garten eine Suppe gekocht.« Ihrem
Schwiegersohn liest sie zwar etwas mühsam,
aber immerhin eine Erklärung vor
aus einem Wörterbuch, leider ohne dass
überliefert wäre, um welches Wort es ging.
Aber man sieht: Unter der Bettdecke
hat das Wort Aufklärung noch einen Sinn.
Ein Vierteljahrhundert später liegt die Großmutter
im Sterben. Annette ist bei ihr, und
um den Abschied zu ertragen, hält sie sich
an dem Buch fest, das sie gerade liest
d. h. eigentlich nicht liest, sondern
dabeihat. Es ist von Arthur Koestler
und heißt Darkness at Noon, ins Deutsche übersetzt
unter dem Titel Sonnenfinsternis. Auf dem Umschlag
der französischen Ausgabe steht Le zéro
et l’infini, Die Null und die Unendlichkeit,
drei Titel also, denen dieses Sterbezimmer
jeweils eine neue Bedeutung verleiht.
Die Sterbende streckt ihre abgezehrte
Hand aus nach dem Buch, betrachtet es
sehr lange und zeigt dann – ein Lächeln, angedeutet,
auf den Lippen – mit ihrem knorrigen und
kleinen Finger auf das z von zéro, und ganz leise
und ein bisschen schalkhaft sagt sie: An den
konnt ich mich nicht erinnern.
Pause.
Zurück zum Anfang, denn das Leben der
Annette hat gerade erst begonnen. Wie gesagt
ist sie 1929 bereits im Besitz eines Fahrrads,
was zweifellos nicht jede Fünfjährige von sich
sagen kann, zumal wenn sie wie Annette keine
besonders reichen Eltern hat, doch
ist nicht jedes Kind in ihrem Alter die
Tochter eines Fahrradchampions,
also gut, Champions ist zu viel gesagt,
aber doch eines Sportlers, der bei der
Tour de France teilgenommen hat, und zwar
Anfang der 20er, noch vor Annettes Geburt.
Am Quai du Guildo, gleich unterhalb des
Hauses an der Brücke, hat er später ein Geschäft
für Fahr- und sonstige Räder aufgemacht –
CYCLES ET PETITES MACHINES AGRICOLES
steht auf dem Schild. Danach hat er das
einzige, nein, zweiteinzige Automobil im Dorf,
allerdings benützt er es im Wesentlichen dazu,
wechselnde Nachbarn da- und dorthin zu chauffieren:
In Le Guildo gab es bis dahin großen Mangel
an einem Gratistaxi. Ein Stückchen weiter an dem
selben Quai wohnen im Winter in drei Planwagen
was früher mal Zigeuner waren und auf Französisch
romanichels, eine Zirkusfamilie, der er ebenfalls umsonst
das Einrad und was sonst noch anfällt repariert
und mit deren Tochter – einer der Töchter –
Annette gerne spielt, obwohl Mémère
nicht davon abzubringen ist, dass diese
Läuse hat. Hätte der Papst das Gegenteil
behauptet, hätte sie ihm nicht geglaubt,
und sie ist die Einzige in der Familie,
die ihm überhaupt was glaubt.
Vergeblich strengt sich Mémère an,
damit die beiden ihre Köpfe nicht
zusammenstecken, und sie bearbeitet die Kleine
sachte mit ihrem feinen Kamm,
wonach sie sie mit Crêpes verwöhnt.
Man sieht, die drei Generationen und
vier Personen Beaumanoir sind gute, eigentlich
die besten vorstellbaren Nachbarn, und die
Zigeunerfrauen segnen sie am laufenden Band.
Wie ihre Eltern sind die Kinder in der Schule
zweigeteilt: Es gibt die vom Land
und die vom Meer,
die Bauern und die Seeleute,
die, die mit Wörtern gurgeln und
neben denen sich die übrigen wie
zivilisierte Menschen vorkommen.
Wer an der Mündung des Flusses wohnt, ist,
auch ohne selbst zur See zu fahren, dem
Meer, dem Offnen zugewandt.
Die Flut bringt kleine Frachtschiffe den
Fluss hinauf, die schnell, bevor das Wasser
sich zurückzieht, entladen werden müssen.
Oft springen Seeleute an Land, die
kein Mensch versteht und mit denen man
sich trotzdem unterhält. La maîtresse,
die Volksschullehrerin, ist Witwe eines Handelsmarine-Offiziers,
dessen Schiff mitsamt
Besatzung der nordwestliche Atlantik vor
Island irgendwann verschlang.
Sie selbst steht jeden Morgen unverschlungen
vor der Klasse, in der zwei kleine Mädchen
namens Germaine ungefähr gleich schlecht sind,
doch zieht die maîtresse nur eine der beiden
zur Strafe an den Zöpfen. Welche davon
mag wohl die Bürgermeisterstochter sein?
Dass Annette früh einen Sinn für
Ungerechtigkeit bekommt, ist unter
anderem dem einschneidenden Einfluss
dieser ersten Lehrerin zu verdanken.
Sie wird interne im Collège von Dinan,
der öffentlichen Schule für die Schüler
ab elf Jahren. Interne heißt, dass sie
in der Schule wohnt und isst und nur
alle zwei Wochen heimkommt zu den
Eltern und Mémère. Im Bus beäugt sie
einen Jungen namens Jean-Baptiste, nein
wie er wirklich heißt, das weiß sie nicht,
aber sie nennt ihn so, weil er so schmal und
dunkellockig wie Johannes der Täufer ist.
Das fängt ja früh an! Aber der Junge merkt es nicht.
Mit dreizehn Jahren, 1936, verbringt sie
ihren letzten Sommer im Elternhaus am
Meer. Mais qu’est-ce que c’est que
tout ce monde? Was wollen, lieber Himmel,
diese ganzen Leute hier? Die Sozialisten und
die Kommunisten haben den bezahlten
Urlaub eingeführt, bloß vierzehn Tage,
aber immerhin, es lebe die Volksfront,
der Front Populaire. Sie steigen massenhaft
aus Bummelzügen, Kleinbussen, aus allem,
was da rollt, sie schwenken Fangnetze und
Schippchen und tragen Urlaubskleider, die
eine spezielle Sorte Sonntagskleider und
eingeschwärzt vom Rauch der Dampfloks sind.
Und sie sind überall, sie singen, spielen Ball.
Wo einmal Meeresfront war, ist jetzt nur eine
breite Volksfront. Die Besucher werden,
wo immer sie auch herkommen, Pariser,
also nicht was Sie denken, sondern Parisiens,
anders gesagt, Hauptstädter genannt.
Sommer ’36. Was in Deutschland los ist,
ist bekannt. Über Italien herrscht Mussolini.
In Spanien fängt der Bürgerkrieg an.
Von einer Dreizehnjährigen in einem
kleinen Ort in der Bretagne scheint das alles
weiter weg als heute von uns Syrien oder
der Tschad, doch der Schein trügt,
wie es seine Gewohnheit ist, denn schon
tauchen die ersten Spanier auf, genau
genommen Spanierinnen, deren Männer tot,
verletzt oder gefangen sind und die mit ihren
Kindern in der Bretagne Zuflucht finden.
Annette ist nicht länger interne, seit ihre Eltern
das Flussmündungsdasein aufgegeben
und sich in Dinan niedergelassen haben,
wo sie den geflüchteten Spanierinnen helfen
und außerdem ein Café-Restaurant betreiben,
was im Grunde auch nichts wesentlich
anderes ist als das Empfangskomitee,
in dem sie ehren- oder vielmehr
freundlichkeitshalber mitmachen. Annette
ist Pazifistin, bis sie mit fünfzehn
lieber Terroristin werden will. Ihr hat es
Ch’en, eine der Hauptfiguren aus Malraux’
La condition humaine angetan, der ’27 in Shanghai
während eines Aufstands von Arbeitern und Kommunisten
über den Mord zum Selbstmordanschlag kam. So
lebt der Mensch, indem er stirbt. Indem er stirbt
für andere? Oder indem er sterben, nichts als
sterben will. Das Sterben-Wollen rettet ihn vorm
Sterben-Müssen und somit vor der condition humaine.
Malraux bekommt den Prix Goncourt und ist, wenn
wir dem Binnenreim und der Kritik hier Glauben schenken,
eine recht zwielichtige Figur. Aber peu importe, darum
geht es hier jetzt nicht, sondern um die exaltation,
das Mitgerissen-Sein und das Gefühl, für eine
Kausa einen Zweck ein Ideal sein Leben
hingeben zu müssen. ’38 kommt der erste
deutsche Flüchtling an, der eine Flüchtlingin ist und
Else heißt. »Obwohl sie Deutsche war und also Feindin
auf den ersten Blick, war sie sehr hübsch.« (Zitat Annette)
Else ist aus Berlin, redet nicht viel und wenn, dann
schlechtes Französisch, aber verstehen tut sie
doch einiges, z. B. dass ihr Misstrauen entgegenschlägt,
und so erzählt sie dann von ihrem Onkel, der
in seinem eigenen Geschäft von ein paar Kerlen,
die dort ein und aus gingen, gelyncht wurde.
Es ist klar, dass sie die Wahrheit sagt.
Darauf beginnt ein Krieg, der, wenigstens
in Frankreich, noch gar keiner ist, eher
ein Stillehalten oder -sitzen, und den
die Franzosen, obwohl er rein gar nichts
Amüsantes hat, la drôle de guerre, den
komischen Krieg nennen. Nicht, dass sie so viel
mehr Humor hätten als ihre Nachbarn, aber
Asse in Fremdsprachen sind sie nun grade nicht,
und so haben sie statt phoney war, also falscher Krieg,
wie die Engländer dafür sagen, funny war verstanden.
Dann kommt der unkomische Krieg ins Land.
Die Offensive fängt am 10. Mai 1940 an und ist
am 22. Juni abgeschlossen. Diese sechs Wochen
– dass es sechs Wochen sind und nicht
wenigstens Monate und dass die deutschen Truppen
statt auf Beton auf Butter stoßen – sitzen den
Franzosen achtzig Jahre später noch immer
in den Knochen. Im Juli marschieren die Deutschen
im pas de l’oie oder Gänsemarsch, auf Deutsch Parade-
oder Stechschritt, durch Dinans Straßen.
Annette ist siebzehn und sieht sich das mal lieber
aus der Nähe an. Jetzt, in diesen Wochen, entscheidet
sich für sie etwas – falls es sich nicht viel früher schon
an der Flussmündung des Arguenon entschieden hat.
Wenn das Meer herandrängt, leistet der Fluss ihm
Widerstand. Im Frühling und im Herbst schlagen
Flut und Ebbe weiter aus denn je, man sagt dazu
les grandes marées oder auch die lebendigen Gewässer,
les vives-eaux. Wo das salzige Wasser und das süße
wuchtig aufeinanderstoßen, kommt es vor, dass sich
unvermutet eine Wand aus Wasser, ein wandernder
Wasserdamm, ein sogenannter mascaret erhebt.
Es fängt klein an. Sie ist siebzehn, es sind
Sommerferien, jemand spricht sie an, ein Mann.
So könnte eine Liebe ihren Anfang nehmen, aber
nein. Der Mann heißt S., ist Kriegsgefangener,
und mit zwei anderen, die wie er für die
Kommandantur Übersetzungsdienste leisten,
wird er durch die Stadt geführt. Die Männer werden
eher nachlässig bewacht. S. kann mit Annette,
die gerade da vobeikommt, ein paar
unauffällige Worte wechseln. Es geht darum,
vor der Mauer der ehemaligen Kaserne –
jetzt Gefangenenlager – einige Päckchen
in Empfang zu nehmen und zu der
Adresse zu befördern, die auf dem kleinsten
davon steht (auf den anderen stehn
Fantasie-Adressen). Würde sie das wohl
machen? Na, was denken Sie? Genau: Sie
machts. An der bezeichneten Adresse wohnt
eine schöne, tapfere Schneiderin, die aus
nichts etwas zu machen weiß, also doch wohl
erst recht aus diesen Päckchen. Sie hat ihr
blondes Haar zu einem Diadem geflochten
und steht im Ruf, eine vie de folie, ein verrücktes
oder vielmehr -werfliches Leben in Paris
hinter sich zu haben, von dem ein Sohn zeugt,
der nun Gefangener in Deutschland ist.
Annette sieht S. noch zwei, drei Mal,
bevor er sich davonmacht, und zwar nach
London, wie es sich Jahre später rausstellt.
Er überlässt ihr unter anderem Die Hoffnung,
L’Espoir, was schon wieder ein Roman Malraux’ ist
– über den spanischen Bürgerkrieg, den S.
von innen kennt –, und noch ein paar
andere Bücher aus seinem Gepäck.
Dann ist er weg. Nun lernt sie
neue Leute kennen, die sie mit Mitgliedern der
Résistance zusammenbringen, einen instit z. B., also einen
Volksschullehrer, für den sie dann in diesem und im
nächsten Sommer allerlei mit dem Fahrrad hier- und
dorthin transportiert. Denn wie das meiste
ist auch das Widerstehen anders, als man es sich
denkt, nämlich kein einmaliger Entschluss,
kein klarer, sondern ein unmerklich langsames
Hineingeraten in etwas, wovon man
keine Ahnung hat. Das Erste, dems
zu widerstehen gilt, das ist man selbst.
Der eigenen Angst. Was, wenn ihr jemand auf die
Spur kommt und sie erwischt mit Schriften
oder Gütern, die verboten sind? Sie lernt, dass
Angst was ist, was überwunden werden kann.
Ein Jahr verstreicht, und sie ist immer noch blutjung.
Gehts vielleicht auch ein bisschen schneller mit dem
Erwachsenwerden? Wie lange soll das alles noch
auf diese öde, für ihren Geschmack viel zu
tatenlose Weise weitergehen? Halbherzig
fängt sie in Rennes ein Studium an, und zwar
der Medizin, während sie ganzherzig von einem
Schicksal träumt, von Opfern und von Heldentaten.
Leider fehlts an Gelegenheiten. Zwar
hat sie über den instit ein paar »Kontakte«, die
anders als die heutigen nicht jeder x-beliebige
Bekannte, sondern im Gegenteil nur ein paar
wenige verlässliche Personen mit gleichen oder
ähnlich heimlichen Absichten sind. Doch wann
wirds endlich ernst, warum vertraut ihr keiner
eine wichtige Mission an? Wann werden diese
Grünspanfarbenen, die vert-de-gris, wie die
deutschen Soldaten heißen, fortgejagt? Und
warum sieht es in Rennes’ Straßen nicht längst aus wie
in den revolutionsgeschüttelt-kantonesischen aus
dem Roman Die Eroberer, Les conquérants, schon
wieder von André Malraux? Der Gegner
ist nur nebenbei ein deutscher Nazi und im
Hauptberuf Imperial-, Kapital- und Nationalist.
Einstweilen gilt leider: abwarten und radfahren.
Eine Minimission führt Annette ins Zentrum der
Bretagne, zu einem Weiler in der Nähe von Uzel,
der so klein ist und so unscheinbar, dass er seither
gar nicht mehr aufzufinden ist. Dort steht bereits
ein Fahrrad in der Scheune, seltsam, das ihres Vaters
sieht ganz ähnlich aus, ach … es ist seins … da
kommt er. Er also … auch? Er gibt ihr zu verstehen,
dass niemand, auch nicht die Mutter alias
Petite Marthe, von ihrem zufälligen
klandestinen Treffen zu erfahren braucht.
Das alles ist schon schön und gut, aber
doch eindeutig zu wenig abenteuerlich.
»Es ist unmenschlich« (Zitat Annette), jemanden
so lange zappeln zu lassen, der entschlossen ist,
sein Leben für eine ferne Zukunft, nein, noch
nicht einmal für eine Zukunft, sondern für ein
Ideal, für etwas also, was nicht zu erreichen ist,
aufs Spiel zu setzen. An der Uni trifft sie schließlich
Ze Ha, Trotzkist. Der schickt sie zu einer
Versammlung nach Brest, wo es regnet, wie es
zu erwarten ist. Die schwarzblauen Kriegsmarine-
Männer verschmelzen mit der Nacht. Annette biegt
von einer dunklen Gasse in eine noch dunklere,
klopft erst vier Mal, dann zwei Mal an eine Tür
und sagt: Hier ist Dinan! So ist es ausgemacht.
Sie ist Dinan, die würdige Verkörperung der Stadt.
Dann zwingt die Sperrstunde die Anwesenden
(paar Männer und drei Frauen mit Annette),
den Rest der Nacht zu diskutieren. Was dabei
rauskommt, ist ein halbwegs auf Deutsch verfasster
Aufruf an die grünspanfarbenen Soldaten,
sich von den Braunhemden & Schwarzröcken zu
distanzieren. Wie? Diese Nachtschwärmer wollen
tatsächlich die deutschen Soldaten überreden,
sich abzukoppeln? Ihrer Regierung abzuschwören?
Ist das an Naivität denn noch zu überbieten?
In einem Park, in dem das deutsche Fußvolk gerne
rumspaziert, soll Annette diese Flugblätter verteilen,
doch zu unserem Glück und ihrem Ärger
wartet sie umsonst auf deren Lieferung. Leere
Versprechungen! Kümmerlich-kühne Initiativen,
die aber im Sommer 42 zu Verhaftungen in ihrem
Umkreis führen. Die Vorsicht gebietet – und
manchmal gehorcht Annette ihr gar –,
Rennes zu verlassen. Sowieso sehnt sie sich
nach ernsthafteren Taten und hat längst begonnen,
in Richtung PC zu schielen. Der ist weder der
personal computer noch die political correctness,
die er heute meint, sondern eine Partei, die
seit September 39 verboten ist.
»Wenn man mit sechzehn keine starken
Überzeugungen hat« (Zitat Annette), »hat man
gute Chancen, nie welche zu haben« (Zitat
Nichtannette). Vor Toten und Terror und was
aus Revolutionen gewöhnlich sonst noch so wird,
verschließt man die Augen, »man hofft und
rennt los« (in der Überstürzung: Zitanette),
und zwar auf einen Ort zu, den es gar nicht gibt
und auch nie geben wird, den Ort, wo
Frieden, Freiheit und Brüderlichkeit nicht
herrschen, sondern eher … walten? Paris
heißt ein solcher Ort eher nicht, doch dies
ist ausgerechnet die Stadt, wo die
Losrennende jetzt landet und bald tätig wird.
Ihr Zimmer liegt am Boulevard Kellermann,
ein Elsässer, der mit Dumouriez zusammen die
Preußen in Valmy besiegte. Jetzt, im September 42,
liegt am Boulevard, der seinen stolzen Namen trägt,
– Annettes Unterkunft quasi gegenüber – eine
Fabrik mit Namen Gnome et Rhône, was beinahe
nach Verbrüderung, nach deutsch-französischer