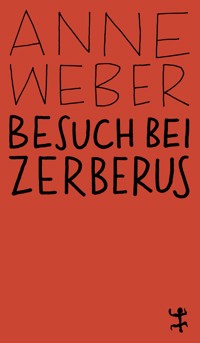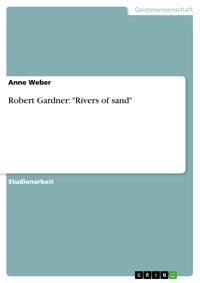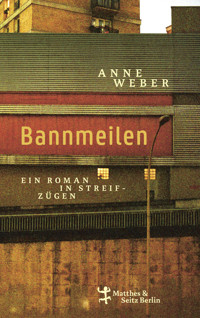
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wo die Stadt aufhört und die Vorstadt anfängt, ist in Paris klar markiert durch den Périphérique, den zu überschreiten Anne Webers Erzählerin bisher kaum in den Sinn gekommen ist. Denn was gibt es dort, in den verruchten Banlieues, außer einem Geflecht aus Schienen, Schnellstraßen und Autobahnen, zwischen denen Lagerhallen, gewaltige Supermärkte und Baustellen und Millionen von Menschen eingeklemmt sind? Außer der so notorischen Not, Gewalt und Armut? Als ihr alter Freund Thierry ihr jedoch vorschlägt, ihn für einen Film durch die Vorstädte des Départments Seine-Saint-Denis zu begleiten, die vor den Olympischen Spielen 2024 einem tiefgreifenden Wandel unterzogen werden, muss sie sich eingestehen, dass sie für die nächste Nähe jahrzehntelang blind gewesen ist. Da sind zum Beispiel der von Schrotthalden umgebene muslimische Friedhof von Bobigny, auf dem ein algerischer Olympiasieger der 1920er-Jahre begraben liegt; die beiden kreisrunden Sozialwohnungsbauten von Noisy-le-Grand, die einander wie gigantische Camemberts gegenüberstehen; und tausend andere von Kolonialismus und Leid, von Hoffnung und Fortschritt erzählende Orte. Und auch Thierry selbst entpuppt sich mit der Zeit als Teil dieser widersprüchlichen, ihrem Blick bislang verborgenen Welt. Mit leisem Witz und großer Beobachtungsgabe öffnet sich Anne Weber in Bannmeilen dem Unvertrauten und Anderen mitten unter uns und entwirft damit nicht nur das Bild einer komplexen Freundschaft, sondern zugleich die Geschichte einer vielschichtigen Gesellschaft in der so noch nicht gesehenen Vorstadt der Liebenden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bannmeilen
ANNE WEBER
Bannmeilen
EIN ROMAN IN STREIFZÜGEN
Inhalt
Rückblickendes Vorspiel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
ANNE WEBER BEI MATTHES & SEITZ BERLIN
Rückblickendes Vorspiel
Thierry ist der einzige Franzose, den ich je im sogenannten Passé simple habe sprechen hören, einer Vergangenheitsform, die im Französischen schon lange nur noch in der Schriftsprache überlebt. Im Deutschen gibt es dafür keine Entsprechung, doch die Wirkung ist ungefähr, als würde jemand sagen: In diesem Haus ward meine Mutter geboren. Es war befremdlich, ihn so reden zu hören. Und es war komisch, denn er verwendete diese altertümlichen Verbformen ohne jedes ironische Lächeln, als sei dies die übliche Art, sich auszudrücken.
Nicht, dass er ständig derart gestelzt gesprochen hätte. Es ist eine ferne Erinnerung, die jetzt, da ich über ihn nachdenke und von ihm erzählen will, in mir aufsteigt und eine neue Bedeutung erlangt. Ich habe ihn nur ein paar Wochen und nicht einmal in Frankreich, sondern in Guatemala so sprechen gehört. Thierry träumte damals davon, einen Film über die 1944 bei einer Demonstration erschossene guatemaltekische Lehrerin María Chinchilla zu drehen, und er war zu Recherchezwecken längere Zeit dort unterwegs. Zusammen mit Nadia, einer gemeinsamen Freundin, über die ich ihn kennengelernt hatte, war ich für drei Wochen zu ihm gestoßen und dort, vor den Maya-Tempeln von Calakmul, Nakum, Aguateca, Ixkun und Tikal, deren Geschichte er uns erklärte, hatte er unvermittelt angefangen, im Passé simple zu sprechen. Wie ein Buch. Nicht im Sinne von: am laufenden Band, sondern so korrekt, wie nur Bücher klingen können. Warum fällt mir das heute wieder ein? Vielleicht, weil mir nun erst bewusst wird, was ich zwar damals schon hätte wissen können, worüber ich mir aber nicht viele Gedanken gemacht hatte, nämlich womit dieses Wie-ein-Buch-Reden womöglich zu tun hatte: Thierrys Vater konnte weder lesen noch schreiben. Er war Algerier und 1958, als Siebzehnjähriger, mitten im Unabhängigkeitskrieg von einem Onkel mit nach Frankreich genommen worden, wo er bei Renault arbeiten sollte. Die ersten Jahre wohnte er in den bidonvilles oder Slums der Pariser Vorstadt Nanterre.
Anders als bei Nadia und mir, die wir aus kleinbürgerlichen, aber eben doch aus bürgerlichen Verhältnissen stammen, hatte es bei Thierry zu Hause keine Bücher gegeben, und heute glaube ich, dass das der Grund war, warum er wie ein Buch sprach. Er war sich der Gebildeten- oder auch nur der korrekten Sprache nicht sicher, weshalb er einmal gelesene Erläuterungen – zur Geschichte Guatemalas in diesem Fall – nicht frei nacherzählte, sondern wie auswendig gelernt aufsagte. Nadia und ich amüsierten uns heimlich über seine Sprechweise, ohne uns über ihn lustig machen zu wollen, dafür mochten wir ihn viel zu gern, außerdem spürten wir wohl, woher diese gesprochene Schriftsprache kam. Auf undeutliche Weise hatte sie mit seiner Herkunft zu tun, mit seinem algerischen Vater und mit seinem damaligen Wohnort – Drancy, eine der vierzig nordöstlichen Vorstädte von Paris, die das Département Seine-Saint-Denis, wegen seiner mit 93 beginnenden Postleitzahl auch le neuftrois, »das Neun-Drei«, genannt, bilden. Er lebte »im Neun-Drei«, war in einer der Gemeinden des Neun-Drei, in Le Bourget, zur Schule gegangen und in einer anderen, in La Courneuve, geboren. Und heute lebt er immer noch im Neun-Drei, und zwar in Pantin. Er ist viel gereist und zugleich aus dem Neun-Drei nie herausgekommen.
So wenig wie wir uns Gedanken darüber machten, woher diese gesprochene Schriftsprache kam, so wenig fragten wir uns, ob es mit unserer Herkunft zu tun hatte, dass wir, Nadia und ich und auch fast all unsere Freunde, innerhalb von Paris wohnten. Nicht im Zentrum, aber doch in der Stadt. In winzigen Wohnungen oder Zimmern zwar, aber eben in der Stadt. Thierry hingegen wohnte mit seiner damaligen Freundin in der Banlieue, und zwar in einem Häuschen mit kleinem Garten. Wir besuchten einander, luden uns gegenseitig zum Essen ein; Nadia und mir schien es jedes Mal eine Expedition, bis zu ihm nach Drancy zu gelangen, denn das hieß, erst einmal mit mindestens einer Metrolinie, dann mit der Vorstadtbahn, dann mit dem Bus zu fahren. Thierry war diese langen Fahrten gewohnt, zudem besaß er, wie viele Banlieue-Bewohner, ein Auto. Auch das war für uns etwas Erstaunliches, wir hätten uns kein Auto leisten können und brauchten auch keines, mit der Metro war man schnell überall – überall jedenfalls, wo es uns hinzog. Fast wären wir bereit gewesen, die Vorstadtbewohner für privilegiert zu halten: Na, wenn sie ein Auto haben …
Nadias Eltern kamen beide aus der Provinz, wie die Franzosen alles nennen, was weder Paris noch Banlieue ist. Sie ist in Poitiers geboren und früh, zum Studium, nach Paris gegangen. Nie hätte es sie in die Vorstädte verschlagen, lieber hätte sie in zehn Quadratmetern mit Blick auf einen düsteren Pariser Hinterhof gewohnt als in einer Vorstadt so weit »ab vom Schuss«. Mir ging es ähnlich. Für Thierry aber stellte sich die Frage offenbar nicht. Er war dort geboren und geblieben.
Wo die Stadt aufhört und die Vorstadt anfängt, ist in Paris klar definiert, da gibt es keine fließenden Übergänge. Die Stadt ist recht klein für eine europäische Hauptstadt: Nur was innerhalb des Périphérique, des Autobahnrings, liegt, gehört dazu, jenseits davon beginnt die Banlieue. Wer die Stadt meint, spricht daher auch gerne von Paris intra muros, von dem Paris innerhalb der Stadtmauern. Von ihnen ist zwar nicht mehr viel übrig, doch gibt es weiterhin andere, unsichtbare Mauern, die den städtischen Raum in »drinnen« und »draußen«, in Die-drinnen und Die-draußen einteilen – und vor allem gibt es eben den Périphérique.
Der Film über die guatemaltekische Lehrerin ist nie zustande gekommen, doch Thierry ist tatsächlich Filmemacher geworden. Im Moment bereitet er einen Film über die Olympischen Spiele vor, nicht über die Wettbewerbe selbst, sondern über die Veränderungen, die sich dadurch in den Vorstädten, seinen Vorstädten, anbahnen, und das nicht bloß in unmittelbarer Umgebung der Wettbewerbsorte. Es ist eine Auftragsarbeit, die ihm nur halb zuzusagen scheint. Vor einiger Zeit hat er angefangen, zu recherchieren und sich auf die Suche nach möglichen Drehorten zu machen. Als er mir vorschlug, ihn doch einmal auf einen dieser Streifzüge zu begleiten, war ich sofort dabei; gleichzeitig begann ich mir ein paar Fragen zu stellen, die mir durchaus schon früher durch den Kopf gegangen, aber nie Anlass für eine Verunsicherung oder wenigstens zu eingehenderem Nachdenken gewesen waren: Wie war es eigentlich dazu gekommen, dass ich mich, wenn ich vor die Tür ging, so gut wie immer in Richtung Stadtmitte oder von einem Stadtviertel zum anderen und so gut wie nie über die unsichtbaren Stadtmauern hinaus bewegte? Wie kam es, dass ich, die ich früher eine Zeit lang in der Nähe des südlichen Périphérique gelebt hatte und nun schon seit zwölf Jahren bloß eine Viertelstunde Fußweg von der Porte de Pantin, also des nördlichen Périphérique, und damit nah an der Vorstadt Pantin, also in nächster Nähe des Neun-Drei-Départements, lebte, nur ausnahmsweise diese Richtung einschlug und mich vorzugsweise in die entgegengesetzte Richtung aufmachte? Wie kam es, dass diese nahen und doch fremden Gegenden offenbar gar keine Anziehungskraft auf mich ausübten?
Natürlich gibt es einfache Antworten: Hier, im Zentrum, sind die Kinos, Läden, Museen, zu denen es mich wie viele andere zieht, hier sind die schönen alten Häuser und die Ufer der Seine, hier sind die meisten Freunde, hier ist das Zu-Fuß-unterwegs-Sein angenehm. Und natürlich gibt es einfache Gegenfragen: Was soll ich denn da draußen? Weiß ich nicht von meinen seltenen Besuchen oder vom Durchqueren des Gebiets mit der RER B, die zum Flughafen fährt, wie es aussieht in diesen Banlieues? Ist vielleicht irgendetwas Anziehendes an diesem Geflecht aus Schienen, Schnellstraßen und Autobahnen, zwischen denen Lagerhallen, gewaltige Supermärkte (sogenannte »Hypermärkte«), Wohnblöcke und eine Vielzahl pavillons de banlieue, also Vorstadthäuschen, klemmen? Die nordöstlichen Vorstädte des Départements Seine-Saint-Denis gehören zu den ärmsten Gegenden des Landes, dort kommt man nicht zum Flanieren oder Besichtigen hin. Und falls es mich doch dorthin gezogen hätte, hätte ich mich fehl am Platz und als Eindringling, wenn nicht gar als Voyeurin gefühlt: Wollen wir doch mal schauen, wie die Leute in diesen berüchtigten Gegenden leben, von denen im Jahr 2005 die Aufstände, die dann auf Vorstädte in ganz Frankreich übergriffen, ausgegangen sind. So etwa? Nein, nein, eine solche Neugier hätte ich abstoßend gefunden. Doch wahrscheinlicher, ja schlimmer noch scheint mir heute, dass ich gar keine Neugier empfand. Jeder lebte für sich, die einen drinnen und die anderen draußen, und es schien mir selbstverständlich, dass die Vorstädter zur Arbeit oder in ihren freien Stunden in die Stadt hineinfuhren, die Städter aber nicht aus ihr hinaus oder wenn, dann Augen zu und durch den Vorstadtgürtel hindurch, um so schnell wie möglich in die Normandie oder in den Süden oder wo auch immer es schön ist, nur bloß in keine Vorstadt zu gelangen.
Als Thierry mir also den Vorschlag machte, ihn einmal zu begleiten, vielleicht aber auch erst, als wir den ersten Streifzug hinter uns hatten, der uns dreiundzwanzig Kilometer kreuz und quer durch mehrere Neun-Drei-Vororte führte, dämmerte es mir allmählich, dass ich jahrzehntelang in unmittelbarer Nähe einer fremden Welt gelebt hatte, ohne ihr das geringste Interesse entgegenzubringen. Ich hatte ferne Kontinente bereist, hatte Städte erforscht und Inseln erwandert, aber für das Fremde und Andere in nächster Nähe war ich blind geblieben.
1
Wir sind verabredet im Untergeschoss des Gare du Nord, vor der Sperre zu den Vorstadtbahnen der Linie B in Richtung Flughafen. Es ist nicht unsere erste Tour, aber wir stehen, ohne es zu wissen, noch am Anfang unserer Streifzüge. Ich bin wie meist etwas zu früh, er, wie sich herausstellen wird, oft zu spät – süd- und nordländische Klischees, von denen wir uns offenbar beide nicht befreien können oder wollen. Mich stört das nicht, ich stehe neben den Fahrscheinautomaten und schaue den mindestens zur Hälfte dunkelhäutigen Passanten nach, die die Sperren in beide Richtungen passieren, ein Strom, der gleichzeitig flussaufwärts und flussabwärts fließt. Warum, frage ich mich, gelingt es allen immer so gut auszuweichen und warum kommt es so selten zu Karambolagen? Rechts oder links: Es gibt bloß zwei Möglichkeiten, aneinander vorbeizukommen, nur ich, so scheint es mir, weiche meistens genau in jene Richtung aus, in die sich auch mein Gegenüber wendet, und so kommt es zu einer Stockung, manchmal sogar zu einer Berührung. Das Gegenüber lächelt nie, es wirkt verärgert, als sei es meine Schuld, und auch mir ist klar, dass ich es bin, die etwas falsch gemacht hat: Vor lauter vorauseilender Rücksichtnahme schieße ich über das Ziel hinaus, und statt aus dem Weg zu gehen, stelle ich mich quer.
Im Kopf sehe ich die schnell sich kreuzenden Passanten aus einer hier im Untergeschoss von keinem Vogel eingenommenen Perspektive. Ich sehe, wie flüssig sie aneinander vorbeigleiten, ohne sich dabei anzuschauen; ihre lang erprobte Städter-Wahrnehmung erfasst die kaum merklichen Körperbewegungen der Entgegenkommenden und nimmt sie vorweg, ihr steter Fluss hat etwas Hypnotisches, und irgendwann, den Strom mühelos querend, kommt Thierry auf mich zugeschlendert und lächelt schief. Er will mir heute zeigen, wo er geboren wurde und die ersten Jahre seines Lebens verbracht hat.
An der Station La Courneuve – Aubervilliers angekommen, sind wir lediglich drei Kilometer von Paris entfernt, und doch muss es jedem, der hier aussteigt, klar sein, dass dies nicht mehr Paris ist. Keine siebenstöckigen Häuser aus dem 19.Jahrhundert der Haussmann-Epoche, kaum ältere Gebäude und noch weniger reich dekorierte Fassaden. Stattdessen Gleise, unansehnliche Neubauten, weiter weg Hochhäuser, sehr nah eine Unterführung: Der Vorstadtbahnhof liegt direkt neben einer Autobahn, der A86, die eine Art zweiten Périphérique bildet, nur in größerer Entfernung zur Stadt. In einem Winkel der Bahnhofsfassade hat sich ein Obdachloser ein Haus aus allen möglichen Materialien gebaut, vorzüglich aus Plastikplanen, auch ein Teddybär ist zu sehen und Geschirr, aber nicht der Bewohner. Wir nehmen die Rue Honoré de Balzac, die sich ehrenwerter anhört, als sie aussieht.
Auf dem Weg zu Thierrys Kindheitsort kommen wir an einem kleinen Platz vorbei, in dessen Mitte eine flache, unauffällige Kapelle aus den Sechzigerjahren steht, aus der Zeit also, in der auch Thierrys Wohnsiedlung entstand. Später werde ich merken, dass all den Betonhochhäusern, die in jenen Jahren aus dem Vorstadtboden schossen, eine kleine Kirche hinzugesellt ist. Diese Kirchen muten winzig an im Vergleich zu den Monumentalbauten, die dem irdischen Leben zugedacht sind, und zeugen davon, dass die katholische Kirche damals zwar noch mitgedacht wurde, aus dem täglichen Leben der Vorstadtbewohner aber eigentlich längst verschwunden war.
An einem Haus des kleinen Platzes hängen vor dem Gitter eines Erdgeschossfensters zwei in durchsichtige Plastikfolie verpackte, völlig vertrocknete Blumensträuße, darüber ein rotes Schild: »Espace Sid Ahmed. Jeune Courneuvien assassiné 1994–2005«. Ein elfjähriger Junge ist hier getötet worden.
Thierry, der in den 2000er-Jahren längst nicht mehr in der Gegend wohnte, weiß über den Tod des Jungen auch nicht mehr als ich, und erst später bringe ich in Erfahrung, dass Sid Ahmed Hammache vor dem Wohnblock Balzac der Siedlung Cité des 4000, wo er wohnte, von einer verirrten Kugel getötet wurde, als er gerade dabei war, das Auto seines Vaters zu waschen. Er geriet in einen Schusswechsel, in dem es den später Angeklagten zufolge um die Schwester eines der jungen Männer, wahrscheinlich aber auch, oder sogar hauptsächlich, um Drogen ging. Nicht der Vorfall selbst ist den Franzosen und auch mir in Erinnerung geblieben, sondern die Reaktion des damaligen Innenministers und späteren Präsidenten Nicolas Sarkozy, der sich zu der Wohnsiedlung hatte fahren lassen und dort verkündete, die Gangster würden verschwinden und er würde nun diese Siedlung »mit dem Kärcher reinigen«. Worauf mir einfällt, dass derselbe Sarkozy dieser Tage zu drei Jahren Haft, darunter eines ohne Bewährung, verurteilt wurde, aber das führt zu weit, nämlich in einen vornehmen Vorort im Westen der Stadt, Neuilly; wir sind und bleiben in La Courneuve, Thierry und ich.
Der Kärcher-Satz von Sarkozy, der noch in aller Gedächtnis ist und häufig zitiert wird, klang so – und sollte vermutlich so klingen –, als sei dies keine Wohngegend, sondern ein Schweinestall, der endlich mal ordentlich ausgemistet und gesäubert gehöre. (Dabei war der Junge, als er getötet wurde, gerade dabei, ein Auto zu waschen.)
Wir nähern uns den Überresten der Cité des 4000, die so heißt, weil hier einmal in vier Gebäuden viertausend Menschen untergebracht werden konnten, ach was, nicht viertausend Menschen, viertausend Wohnungen hatten darin Platz – wie viele Menschen mögen das gewesen sein? Zwanzigtausend? Fünfundzwanzigtausend? In jedem der Gebäude waren tausend Wohnungen. Tausend Wohnungen! Man muss einen solchen Block aus der Nähe gesehen haben, um sich die Dimensionen eines derartigen Ungetüms vorstellen zu können. Neben dem einzigen dieser Monstren, das noch steht, Barre du Mail de Fontenay genannt, ist lediglich ein 26-stöckiger bewohnter Betonturm aus jener Zeit übrig, und mir wird klar, dass die zwei trockenen Blumensträuße nicht am Tatort, sondern vor jenem kleinen Haus am kleinen Platz hängen, weil das Hochhaus, in dem der getötete Junge zu Hause war und vor dem er gestorben ist, längst abgerissen wurde. Auch der Block Debussy (für den Nachmittag eines kingkongartigen Stahlbetonfauns geeignet), in dem Thierry seine frühe Kindheit verbracht hat, wurde schon 1987, gute zwanzig Jahre nach seiner Entstehung, wieder abgerissen. Was war das für eine gar nicht ferne Zeit, in der man gigantische Wohnfabriken aus dem Boden stampfte, um sie dann gleich wieder zu zerstören und damit niedrigeren Mietshäusern Platz zu machen, die auch schon wieder heruntergekommen wirken?
2005, als der Junge getötet wurde und Sarkozy seinen Kärcher-Satz losließ, hätte ich zwar ungefähr sagen können, wo die Vorstadt La Courneuve liegt, doch wäre mir die Entfernung nicht viel größer erschienen, hätte der Vorfall in Tours oder in Marseille stattgefunden. Dabei ist dieser Ort nur ein paar Vorstadtbahnstationen weg, vom Gare du Nord aus ist man in zwanzig Minuten hier, von meiner Wohnung könnte ich in einer Stunde zu Fuß hergelangen.
Dem Betonturm den Rücken kehrend, gehen wir an dem letzten noch übrig gebliebenen Riesenquader entlang, und Thierry erklärt mir Ahnungsloser, was es mit den abgewrackten Bürosesseln auf sich hat, die an den Hausecken stehen, und vor allem mit den jungen Männern oder Jungs, die auf oder neben diesen Sesseln herumlümmeln. Dass es nämlich sogenannte chouffeurs, also Späher, sind, die Alarm schlagen, sobald die Polizei auftaucht, um Drogendealer einzuschüchtern oder zu fassen. Er ist noch dabei, mir diese einfachen Sachverhalte zu erklären, über die hier jedes Kind Bescheid weiß, wenn es nicht gar darin verwickelt ist, als sich hinter uns eine tiefe Männerstimme zu einem lang gezogenen Ruf erhebt und bald darauf, etwas weiter weg, eine zweite und eine dritte an wieder anderer Stelle, Stimmen, die keineswegs panisch klingen, eher nach einem Klagegesang. Es ist ein Chor, ein Kanon, ein Echoraum, der da entsteht. Der Vergleich scheint mir absurd, aber ich muss an Alphörner denken, die einander über ein Tal hinweg antworten. Das also sind die Alarmsignale der chouffeurs?
Ich bleibe stehen und schaue mich um und sehe wirklich einen Polizeiwagen mit vier Polizisten darin langsam heranrollen. Thierry gibt mir ein Zeichen, und wir gehen in unserem bisherigen Tempo weiter, bis wir die Siedlung hinter uns gelassen haben. Kaum, dass wir abseits sind, erklärt er mir, es sei ratsam, an Orten, an denen der Drogenhandel floriere, nicht stehen zu bleiben, sondern gelassen weiterzugehen, als habe man ein hinter der Siedlung gelegenes Ziel, und tatsächlich hatte ich gar nicht vorgehabt, stehen zu bleiben, sondern mich ganz dem Verhalten meines Freundes anpassen wollen, doch als ich hörte, wie sich aus allen Ecken die vielstimmigen, klangvollen Klagerufe erhoben, konnte ich nicht anders, als innezuhalten und mich umzuschauen. Mir fällt ein, dass Thierry gelegentlich Reiseführer war in jungen Jahren. Und das Sprichwort, das er gerne zitiert: Il ne faut jamais voyager dans un pays sans ses habitants – bereise nie ein Land ohne seine Bewohner. Ich bin ihm dankbar, dass ich diese Reise mit ihm machen kann, alleine hätte ich sie sicher nicht unternommen.
Thierry merkt, wie betört ich immer noch bin von diesem unerhörten Gesang und beglückwünscht mich dazu, gleich bei einem unserer ersten Streifzüge in den Genuss eines solchen Konzerts gekommen zu sein, doch gleich darauf fängt er an, sich über mich feinsinnige Touristin lustig zu machen, die das, was für andere Kriminalität oder elementare Vorsichtsmaßnahme zum Schutz vor Festnahmen ist, offenbar für eine ästhetische Darbietung, eine Konzertvorstellung, ein überraschendes Schauspiel hält. Ich muss lachen, zumal er sich nicht auf boshafte Weise mokiert, und zugleich frage ich mich, ob es wohl nicht nur lächerlich, sondern auch schockierend sei, in etwas Schönheit zu sehen – oder in diesem Fall zu hören –, was für andere, für die meisten Bewohner der Siedlung zum Beispiel, die es sich nicht leisten können, woanders hinzuziehen, eine tägliche Belästigung und Bedrohung darstellt. Ich komme zu keinem eindeutigen Ergebnis, zumal wir weitergehen und sich bald andere Besonderheiten oder Schönheiten vor mir auftun, von denen viele in den Augen der meisten Menschen wohl hässlich, abstoßend, wenn nicht gar furchterregend sein mögen – aber es hilft ja nichts, sich selbst einzureden: Das ist schlimm, das ist hässlich, wenn es sich nun mal (auch) als Schönheit offenbart. Zudem merke ich jetzt bereits, dass ich in Thierry einen Führer habe – im Deutschen ein kaum verwendbares Wort, Führer, aber welches andere wählen für einen Menschen, der dir eine Welt zugänglich macht, die du ohne sie oder ihn nicht betreten hättest? –, dass ich in Thierry also jemanden habe, der für die Schönheiten des gemeinhin als hässlich Geltenden weitaus empfänglicher ist als ich und dem das Erschrockensein, die Wut oder die Scham über das Gesehene dessen Schönheit, wenn eine solche denn spürbar ist, nicht verhüllen kann.
Thierry war sechs Jahre alt, als seine Eltern 1969 aus der Siedlung wegzogen, er hat nicht viele Erinnerungen an die Cité des 4000. Drogen habe es keine gegeben, überhaupt sei es nicht gefährlich gewesen, die Männer hätten keine Kapuzenpullis, sondern Anzüge und Schlips getragen, und die Frauen Kleider, im Übrigen hätten keineswegs nur Ausländer in diesen Hochhäusern gelebt, und wenn, dann hauptsächlich europäische, Portugiesen zum Beispiel. Alles sei gerade erst fertiggestellt gewesen und habe neu gerochen, manches habe noch nicht richtig funktioniert, bis es dann bald nicht mehr funktionierte, aber da habe er nicht mehr hier gewohnt, seine Eltern seien mit ihm und seinen Geschwistern in ein Häuschen in Le Bourget gezogen. In der Cité habe es keine Spielplätze gegeben, die Kinder hätten zwischen den Wohnblöcken und den Parkplätzen gespielt, einmal sei ein Freund von ihm von einem Auto angefahren worden.
Aber war diese neue Siedlung für deinen Vater nicht besser als die Slums in Nanterre? Wo es noch nicht mal fließendes Wasser gab, sondern nur Baracken mit schlecht zusammengeflickten Wellblechdächern?
Mein Vater hätte lieber in seinem Dorf in Algerien bleiben sollen, da lief er barfuß, er hatte keine Schuhe, aber er brauchte auch keine, er war glücklich, also gut, was heißt glücklich, keine Ahnung, aber es ging ihm gut. Dann hat man ihm eingeredet, er müsse hier in Frankreich arbeiten und Geld verdienen, und da es viele so machten, hat er es auch gemacht, er war sehr jung, und schon die Reise war ein Abenteuer, zudem das fremde, reiche Land. Algerien gehörte noch zu Frankreich, er brauchte kein Visum, es war leicht, viel leichter als heute, hierher zu gelangen. Trotzdem, er hätte besser zu Hause bleiben sollen.
Bist du sicher? Dann gäbe es dich nicht.
Ja, dann würden wir jetzt nicht rumlaufen und nach den viertausend oder zwanzigtausend Gespenstern suchen, die hier mal gehaust haben.
Am Abend schickt mir Thierry einen Link zu einem Film, in dem die Cité des 4000 kurz nach ihrer Entstehung zu sehen ist. Der Film ist offensichtlich im Winter gedreht worden, das Licht ist grau, die Betonblöcke stehen nah beieinander und sind ebenfalls grau und glatt und so groß, dass sie gar nicht ins Bild passen, die Durchgänge sind dunkel, irgendwo gibt es eine Einkaufspassage, die Männer tragen tatsächlich Anzüge, man spaziert durch diese Passage, andere Freizeitbeschäftigungen gibt es nicht.
Wir sind jetzt an einer breiten, befahrenen Straße angelangt, der Nationale 186, und bald darauf an einem Kreisel, vor dem sich die Ruine eines Hochhauses erhebt, dessen Fassaden mit Schriftzeichen bedeckt sind wie die Seiten eines Buchs, ein aufrecht stehendes, würdiges Gerippe, durch dessen hohle Augen der Wind pfeift – ein Wahrzeichen, aber für was? Für Vernachlässigung, Verwahrlosung? Zwanzig breite, fensterlose Stockwerke, Aufzugtüren, hinter denen keine Kabine, sondern nur der gähnende Schacht wartet, Besetzer, die regelmäßig ausquartiert werden. Thierry zufolge steht das Gebäude schon seit zwanzig Jahren leer, im Keller sammelt sich das Wasser, Ratten breiten sich aus, die Nachbarn beschweren sich. Tatsächlich steht gleich neben dem Wrack ein Wohnblock, der sicher ein paar Hundert Wohnungen umfasst. Abends lese ich einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 2017, der ankündigt, anlässlich der bevorstehenden Olympischen Spiele werde die Ruine nun endlich abgerissen. 2023 steht sie immer noch und wird uns Wanderern noch häufig zur Orientierung dienen.
Ein Stück weiter stoßen wir bereits auf die nächste Autobahn, die A1 ist es diesmal, die nach Norden, nach Lille führt: La Courneuve ist eingeklemmt zwischen zwei Autobahnen. Auch hier stehen riesige Wohnanlagen, und zwischen Autobahn und Wohnhäusern liegt – wie soll man es nennen – eine Grünfläche? Garten oder Park wäre zu viel gesagt, aber es wächst Gras hier und es wachsen auch ein paar Bäume, die grasbewachsene Fläche steigt an zur Autobahn, die von unten nicht sichtbar, sondern nur zu hören ist. Ein paar junge Typen streifen mit Furcht einflößenden Hunden durch diese Grünzone, ich kann einen Pitbull und einen Schäferhund erkennen, doch Thierry scheint vor Hunden keine Angst zu haben, und das lindert auch meine Ängste. Wir steigen den Abhang hinauf, von wo aus die Autobahn auf der einen, die Wohnblöcke auf der anderen Seite zu sehen sind; in einiger Entfernung der hohle braune Turm mit den vielen leeren Fensteraugen. Auf der Steintreppe, die den Abhang wieder hinunterführt, zeigt Thierry auf eine benutzte Spritze, verstreut daneben liegt weiterer Abfall, und vor der Wohnanlage häuft sich der Sperrmüll. Mir fallen diese Müllberge hier nicht zum ersten Mal auf, und auf meine Frage danach antwortet Thierry, es sei wohl gerade Sperrmülltag, doch insgeheim weiß er vermutlich, was mir erst allmählich klar werden wird: dass nämlich in den großen Wohnanlagen jeder Tag Sperrmülltag ist. Die Leute werfen vor die Tür, was sie nicht mehr brauchen können, neben »Sperrmüll abladen verboten«-Schildern türmt sich haufenweise Sperrmüll, Sperrmüll ist überall. Anfangs frage ich Thierry noch: Aber warum liegt hier dieser ganze Kram, warum verwandeln sie ihre eigene Wohngegend in eine Müllhalde, doch schon bald fällt mir nichts mehr dazu ein. Warum erwarte ich von Menschen, die in solchen Betonkisten neben der Autobahn leben müssen, dass sie sich mit der Reinlichkeit und Ordnung ihrer Umgebung befassen?
Wir gehen weiter und kommen an der Grundschule Robespierre vorbei. Innerhalb von Paris heißen die Schulen anders, doch auch an die Namen der Straßen, Schulen und sonstigen Einrichtungen in diesen nördlichen, ehemals und manchmal heute noch von Kommunisten regierten Vorstädten werde ich mich noch gewöhnen. Häufig tauchen hier die Namen sowjetischer Astronauten auf, angefangen bei Gagarin, zudem natürlich die Nicht-Astronauten Marx und Lenin (weder Trotzki noch Stalin), die Straßen heißen Rue de la Révolution, Rue de l’Internationale oder Rue de l’Égalité. Auch Danton und Saint-Just dienen vielfach als Namensgeber. Ich werde mich daran gewöhnen, aber hier, vor dieser Schule, überkommt mich ein Schauer. Vermutlich, weil es eine Grundschule ist, die diesen Namen trägt: Robespierre, eine zwiespältige Figur, auf der linken Schale der Waage liegen zum Beispiel das allgemeine Wahlrecht, die Abschaffung der Todesstrafe und der Sklaverei, auf der rechten Dantons Kopf und zigtausende andere Köpfe. Die linke Schale wiegt schwer, so schwer wie die rechte mit den vielen abgehackten Köpfen, zu denen sich am Ende Robespierres eigener gesellt hat und die ich nicht mit den kleinen Kindern einer école élémentaire in Verbindung bringen möchte. Aber die Schule heißt nun einmal so, sie steht nah der Autobahn und ist hinter einer hohen Mauer verborgen.
Auf dem Weg nach Le Bourget, wo Thierrys Eltern hinzogen, als sie sich ein Häuschen leisten konnten, kommen wir an Lagerhallen vorbei, Niederlassungen von Bauunternehmen. Vor einer der Einfahrten wartet ein Grüppchen Männer ungewisser Herkunft; alle haben sie Kapuzenjacken an und Rucksäcke dabei. Des clandos, sagt Thierry, was heißt: des clandestins – illegale Einwanderer, die darauf hoffen, dass sie vielleicht auf einer Baustelle gebraucht werden. Ohne ausländische Schwarzarbeiter läge in Frankreich das Baugewerbe brach, kann man in der Zeitung lesen, aber wer es in der Zeitung liest, stellt sich nicht vor, dass diese unerlaubt nach Frankreich eingereisten Arbeiter in abgelegenen Pariser Vorortecken Morgen für Morgen in aller Frühe vor der Einfahrt eines Bauunternehmens in der Kälte ausharren, ohne jede Gewissheit, Arbeit zu finden für den Tag. Manche stehen offensichtlich in der Mittagszeit immer noch da und warten, dass sie angeheuert werden, und wenn sie dort stehen, wird das wohl heißen, dass sie vielleicht noch jemand holen kommt. Dass es jedenfalls nicht ausgeschlossen ist.
Es ist jetzt halb zwei und wir haben Hunger, doch etwas Essbares zu finden, ist wie immer nicht leicht. Wer von einer Vorstadt zur anderen geht, stößt oft lange auf keinen Laden, noch weniger auf ein Lokal, wo er einkehren und vielleicht auch einmal die Toilette benutzen könnte, was gerade Frauen auf Wanderschaft sehr gelegen käme – aber natürlich begegnen wir keinen Frauen auf Wanderschaft –, und wenn, dann sind es reine Männerkneipen, an denen wir jedes Mal lieber vorbeiziehen.
Wie machen das denn die Frauen bei dir, wenn sie außer Haus sind und mal aufs Klo müssen?, frage ich Thierry (es hat sich zwischen uns eingebürgert, dass »bei ihm« hier in den Vorstädten und »bei mir« Paris ist).
Unsere Frauen sind nicht außer Haus, und wenn, dann müssen sie nicht aufs Klo. Draußen-aufs-Klo-Gehen ist haram, sagt er mit einiger Ironie in der Stimme, denn es hat sich außerdem zwischen uns so eingebürgert, dass er die Rolle des gläubigen, traditionellen Algeriers spielt, der er nicht ist, und ich die der weißen, westlichen, privilegierten Frau, die ich bin.
In Le Bourget angekommen, führt er mich in eine ruhige einspurige Straße, die auf beiden Seiten von Einfamilienhäuschen flankiert ist. In einem davon, einem einfachen Backsteinhaus, das vielleicht hundert Jahre alt und mit einem Minimum an Zierrat versehen ist – ein Mosaikhalbkreis über dem einzigen nennenswerten Fenster in der Obergeschossfassade –, wohnten seine französischen Großeltern. Er sagt immer »meine französischen Großeltern«, obwohl er gar keine anderen hatte, ich meine: obwohl er seine anderen, die algerischen Großeltern, als Kind nicht kannte und auch später nie kennenlernen sollte. In ein schlichtes weißes Haus ein paar Straßen weiter waren seine Eltern Ende der Sechziger gezogen, hier ist er groß geworden.
So unheimlich es mir vorhin war, mir Thierry als kleinen Jungen, als vier-, fünfjähriges Kind zwischen den Megaklötzen der Cité des 4000 vorzustellen, so friedlich und geradezu anheimelnd wirkt jetzt auf mich – vielleicht auch nur im Gegensatz – diese neue Umgebung. Das kaum befahrene Sträßchen könnte auch durch irgendeine verlorene französische Kleinstadt führen; nichts, außer vielleicht die vielen nahen Flugzeuge am Himmel, lässt erahnen, dass rings umher Millionen leben.
Thierrys Vater arbeitete erst in der Fabrik, dann auf dem Bau, später, in den Siebzigerjahren, gründete er als Elektriker seine eigene Firma, bald konnte er das Häuschen abbezahlen, und sobald es ging, ab Ende der Siebziger, fuhr er einen Mercedes. Thierrys Mutter arbeitete anfangs als Sekretärin, sein Großvater bei der Bahn, die Großmutter war zu Hause und kümmerte sich viel um Thierry. Dies sind die einfachen Tatsachen, die ich schon länger kenne, aber nun, da ich hier stehe und an den dazugehörigen Orten darüber nachsinne, tun sich mir Fragen auf, zum Beispiel: Wie haben Thierrys französische Großeltern den algerischen Schwiegersohn aufgenommen? Wie hat sein Vater sich an die französischen Verhältnisse angepasst? Wie hat Thierry selbst diese zweifache Herkunft erlebt?
Seine Großeltern hätten sich ihren Schwiegersohn anders vorgestellt gehabt, sagt Thierry, aber eine ihrer Töchter sei eben von einem Algerier schwanger geworden, und so sei ihnen nichts anderes übrig geblieben, als so schnell wie möglich eine Heirat zu organisieren. Pech gehabt.
Ich suche nach einer vorsichtigen Ausdrucksweise: Kann es sein, dass eine Heirat mit einer Französin für deinen Vater auch einen sozialen Aufstieg bedeutet hat?
Klar, sein Vater sei von Anfang an darauf aus gewesen, sich so schnell wie möglich zu einem Franzosen zu machen, in der Masse der Franzosen unterzugehen, bloß niemandem als Algerier aufzufallen. Seine kleine Elektrofirma habe einen sehr französischen Namen getragen. Seinen eigenen Nachnamen habe er zu seinem Leidwesen zwar offiziell nicht loswerden können, doch niemand habe ihn je unter seinem wirklichen Vornamen Ahmed gekannt. Bei all seinen Freunden habe er sich immer als Marcel ausgegeben. Die meisten hätten gar nicht gewusst, dass er Algerier war. Und selbst bei ihnen zu Hause sei über Algerien nie gesprochen worden. NIE hätten seine Eltern das Wort Algerien in den Mund genommen. Kaum, dass er, der Sohn, gewusst habe, dass er Algerier ist, also halber Algerier. Wenn es in der Schule nicht manchmal so blöde Sprüche gegeben hätte, sale Arabe, Mohammed, so was, hätte er es glatt überhaupt nicht mitbekommen. Sein Vater jedenfalls habe seine Wurzeln abgeschnitten und sich sein Leben lang den Franzosen angedient.
Und deine Großeltern?
Der Großvater sei ein Haustyrann gewesen, er habe seine Frau und seine Kinder terrorisiert, sobald er zu Hause gewesen sei, und von dem Schwiegersohn, dem Araber, habe er erst mal gar nichts wissen wollen. Der Algerienkrieg sei gerade erst zu Ende gewesen, einer seiner Söhne sei früh eingezogen worden und 1956 mit einer Verletzung zurückgekommen. Es sei keine schwere Verletzung gewesen, eher eine, über die man im Nachhinein froh sei, weil man danach zu Hause bleiben könne. Thierrys Großvater habe immer gesagt: Die Algerier wollten nicht länger zu Frankreich gehören, gut, alles klar, das haben wir kapiert, wir sind abgezogen und haben sie in ihrer Scheiße sitzen lassen, aber jetzt sollen sie uns bitte schön auch in Ruhe lassen und bei sich zu Hause bleiben, was wollen sie noch hier bei uns? So habe er auch noch geredet, als er längst einen algerischen Schwiegersohn gehabt habe, und durchaus auch in dessen Beisein. Denn dieser, Thierrys Vater also, habe stets eingestimmt! Er habe sich damals schon für französischer als die Franzosen gehalten, immer habe er den Superfranzosen gemimt, widerlich sei das gewesen. Und der Großvater schien bald vergessen zu haben, dass er sonntagmittags einen Araber mit am Tisch sitzen hatte, er habe ihn nach einer Weile sogar seinen übrigen Schwiegersöhnen vorgezogen, diesen Nieten, wie er immer gesagt habe, weil sie in seinen Augen nicht so tüchtig gewesen seien wie Thierrys Vater und keinen Mercedes gefahren hätten, sondern nur einen Renault 4. Dabei sei Thierrys Vater weniger tüchtig als schlau gewesen, er habe genau gewusst, wie man die Rechnungen aufbläst, gerade älteren Leuten habe er Gott weiß was aufgeschwatzt, Alarmanlagen, elektrische Türöffner, lauter solchen Quatsch, und seine paar Angestellten habe er ausgebeutet, die hätten noch nicht mal den Mindestlohn gekriegt, wenn er sie nicht gar für ein paar Groschen habe schwarzarbeiten lassen.
Während er sich so in Rage redet, sind wir bis zu einer Kirche gelangt, die Thierry mir zeigen will, weil er darin getauft worden ist.
Du bist getauft?
Er sei getauft worden, ja, aber erst, als seine Eltern hierher, nach Le Bourget, in die Nähe der Großeltern gezogen seien, da sei er schon sieben gewesen. Der Großvater habe sogar darauf bestanden, dass er zum Katechismus-Unterricht gehe und seine Erstkommunion mache wie die anderen Enkel.
Und dein Vater hat nichts dazu gesagt.
Doch! Der war sehr dafür!
Wir treten in die kleine Kirche ein, Saint-Nicolas du Bourget. Wir sind die einzigen Besucher.
Und dein typisch französischer Vorname, was ist mit dem?
Den hat mein Vater ausgesucht.
Eine steinerne Madonna aus dem 20.Jahrhundert sticht mir ins Auge, Notre-Dame des Ailes, Unsere Liebe Frau der Flügel, kunsthistorisch wahrscheinlich völlig wertlos, aber auffälligerweise eingerahmt von zwei langen hölzernen Propellerflügeln oder Luftschrauben, die von einem alten Flugzeug stammen müssen. Mir fällt ein, dass der Flughafen von Le Bourget lange Zeit der wichtigste Flughafen von Paris war, bis Roissy-Charles-de-Gaulle in den Siebzigerjahren den Hauptflugverkehr übernahmen. Diese Maria ist eine Flughafenmadonna.
Sie haben dich in der Kirche einer Propellerjungfrau taufen lassen!
Aber selbst durch eine Propellerjungfrau ist Thierry mit seiner Taufe und seinem Großvater nicht zu versöhnen.
Wir schauen uns noch die fünf Wandbilder an, die den 1870er-Krieg illustrieren: Im Oktober und im Dezember 1870, ist auf einer Tafel zu lesen, hätten um diese Kirche herum und sogar in ihr heftige Kämpfe zwischen Preußen und Franzosen stattgefunden. Der französische Kommandant Brasseur habe sich mit seiner Truppe in der Kirche verschanzt. Eines der naiven Wandbilder zeigt, wie aus dem Obergeschoss der Kirche heraus gefeuert wird. Wie auf einem winterlichen Bruegel-Gemälde die Schlittschuhfahrer sind hier auf allen Wänden Nahgefechte dargestellt und eine Vielzahl Toter und Verwundeter am Boden. Es ist ein merkwürdig anrührendes kleines Gotteshaus, in dem niemand mehr – außer dem Gemäuer selbst und für einen Moment wir zwei fremden Besucher – der toten Soldaten gedenkt und vom Fliegen träumt.
Während der Revolution sei die Kirche in einen »Tempel der Vernunft« verwandelt worden, lese ich auf einer anderen Tafel, bevor wir weiterziehen. Für einen kurzen Moment wurde in den Kirchen Frankreichs und also auch hier, in Le Bourget, die Vernunft angebetet sowie »l’Être suprême« – das höchste Wesen, von dem damals bereits keiner so genau wusste, um was es sich dabei handelte, aber bei Gott wusste man das schließlich auch nicht. Das neue höchste Wesen ist ein republikanisches Ideal, weshalb noch heute auf dem Fronton dieser kleinen Flughafenkapelle die Worte LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ eingraviert sind.
Wir gehen weiter in Richtung des Friedhofs, auf dem Thierrys Großeltern begraben liegen, vorbei an einer eigenwillig gestalteten Kreuzung (Ecke Avenue John Fitzgerald Kennedy und Rue de l’Égalité): Neben einer Grabkapelle, die von einer schnörkelig-schmiedeeisernen Tür verschlossen ist, weht die französische Flagge, auch das offenbar zum Gedenken an den 1870er-Krieg, was sicher würdevoller wäre, wenn der Blick auf die kleine Kapelle nicht durch die unmittelbar davor in verschiedenen Höhen und über kunststoffgrünem Untergrund angebrachten Klimmzugstangen und Turnringe beeinträchtigt wäre. Überhaupt scheint die Banlieue ein Ort zu sein, dessen Bewohner man für sportlich hält oder immerhin zum Sport ermuntern möchte – jedenfalls werde ich derartige sportliche Anlagen noch häufig zu sehen bekommen, wenn auch selten gepaart mit militärischen Denkmälern.
Der Friedhof ist nicht groß und von den umliegenden Wohnhäusern aus gut einzusehen. Kurz hinter dem Eingang halten wir an einem steinernen Soldaten mit Käppi, den Thierry wie einen alten Bekannten grüßt, und so bleibe auch ich vor dem Mann stehen und schaue in sein ausdrucksvolles, verwittertes Gesicht, von dem nur noch die Augen, ein Nasenloch und der halbe Mund übrig sind, den Rest hat der Napalm der Zeit zerfressen. Schauerlich ist der Mann anzusehen und zugleich schön, wie ein durch großes Leid Gegangener. Aus seinem Rücken wächst links ein Flügel, oder vielleicht ist es eine Gewehrtasche, aus der die Jahre einen Flügel geformt haben. Keine Inschrift zeugt von seinem Kriegertum.
Thierry glaubt zu wissen, wo das Grab seiner Großeltern ungefähr liegt, doch vergebens grasen wir den Sektor ab, in dem er es vermutet, und entschließen uns schließlich, am Empfang nach Raymond und Marie Dubois zu fragen. In dem Empfangshäuschen sitzen zwei Frauen und ein Mann im Warmen und unterhalten sich angeregt, als wir anklopfen. Eine der Frauen sieht in ihrem Computer nach, die Nummer des Grabes und damit seine Lage sind schnell gefunden und der Weg dorthin ist schnell beschrieben, doch der Mann besteht darauf, uns zu begleiten, das sei schließlich Teil seiner Arbeit. Kaum am Grab, verschwindet er schon wieder – auch Diskretion gehört zu seiner Arbeit.
Mir fällt nicht erst hier auf, wie freundlich Thierry mit Unbekannten spricht. Nicht, dass es irgendwelche Gründe gäbe, unfreundlich zu sein, aber auf einer Skala zwischen förmlich-distanziert und freundlich-einnehmend schlägt Thierrys Verhalten eindeutig auf letztere Seite aus.
An der vorderen Schmalseite der glatten Steinplatte, die von keinerlei Pflanzen oder Blumen, noch nicht einmal künstlichen, verziert wird, ist in goldenen Lettern »Famille DUBOIS« zu lesen. Hinter der Steinplatte ist ein Kreuz angebracht, daneben eines dieser Täfelchen, die es in französischen Bestattungsinstituten schon fertig beschriftet zu kaufen gibt. Dieses hier zieren neben einer Schwalbe und einem Schnörkelherzchen die Worte »A notre Amie Regrettée« – Unserer verstorbenen (beweinten) Freundin, als läge in diesem Familiengrab nur Thierrys Großmutter. Hat den Großvater vielleicht tatsächlich niemand beweint?
Warum steht da Famille Dubois, wenn nur deine Großeltern hier begraben sind?, frage ich.
Ich glaube, da liegen auch noch ein, zwei meiner Onkel und Tanten, sagt er gleichgültig.
Ich frage nicht weiter nach; sein Verhältnis zur Familie scheint nicht das beste gewesen zu sein.
Die waren eigentlich ganz nett, sagt er zu meinem Erstaunen, nachdem er eine Weile schweigend auf das Grab geblickt hat.
Ach so? Sie waren also doch ganz in Ordnung? Er schaut auf.
Ich sprach von denen da, sagt er und zeigt auf das Empfangshäuschen.
Wir müssen beide lachen.
2
Diesmal sind wir direkt vor der Station Le Bourget verabredet, es ist einer der ersten Januartage. Thierry hat Verspätung. Warten in unbekannten Gegenden kann ein Problem sein, doch vor einem Bahnhof oder einer Haltestelle wartet es sich unauffällig. Ich merke trotzdem, dass ich nicht recht weiß, welche Haltung ich einnehmen, wohin ich mich stellen soll, weshalb ich ein wenig um den Bahnhof herumstreune und dabei eine Gedenktafel bemerke, auf der von den 40 000 jüdischen Menschen die Rede ist, die vom nahen Konzentrationslager in Drancy zu diesem Bahnhof gebracht und von hier nach Auschwitz verschleppt worden sind; später, ab Juli 1943, gingen die Deportationen vom nahe gelegenen Bahnhof Bobigny aus weiter. 40 000 Menschen, das kann doch nicht stimmen, denke ich. Wie sollte man am Ende auf eine solche gerade Zahl kommen? Das müssen Schätzungen sein, so genau weiß man es nicht, da hat man einfach abgerundet. Circa drei Prozent haben überlebt, steht auf der Tafel. Drei Prozent, das ist noch nicht einmal eine abgerundete Zahl, es ist ein Anteil, fast eine Abstraktion.
Ich drehe mich um und habe das Gefühl, man müsse mir ansehen, dass ich nicht von hier, dass ich keine Vorstädterin bin. Aber natürlich haben die Passanten anderes zu tun, als mich zu beäugen. Zielstrebig kommen sie aus dem Bahnhof oder gehen auf ihn zu. Schließlich setze ich mich auf einen Betonklotz, den ich ungeschickt erklimme, ziehe ein Bein an und versuche, halbwegs lässig auszusehen. Der gleichgültige Blick einer Frau in meinem Alter streift mich, zwei halbwüchsige Jungs in schwarzen Klamotten streiten sich vor meinem Betonkubus, ohne mich zu bemerken oder auf mich achtzugeben.
Dann kommt Thierry auf mich zu, noch bevor ich ihn bemerke, hat er mich längst gesehen. Wir nehmen die belebte Straße dem Bahnhof gegenüber, auf deren rechter Seite neue Wohnhäuser entstehen, dann eine Route Nationale, die sich vom Stadtrand, von der Porte de la Villette, also ganz in der Nähe meiner Wohnung, mitten durch Le Bourget zieht und bis an die belgische Grenze führt. Größere Bauarbeiten sind hier im Gang. Die Schnellstraße, die durch die Bauarbeiten in ihrer Mitte zu einer Langsam- oder Stau-Straße geworden ist, soll umgewandelt und bepflanzt werden, Fahrradwege und breitere Bürgersteige sollen entstehen, vor allem aber soll ein sogenannter »Boulevard Olympique« daraus werden, der die verschiedenen Anlagen der Olympischen Spiele 2024 miteinander verbindet. Presslufthammer dröhnen uns in den Ohren. Thierry steuert zielsicher auf eine Boulangerie zu – wir haben schon das letzte Mal nichts zu essen bekommen, diesmal sorgt er vor, zudem ist gerade Mittagszeit – und wir kaufen Sandwiches, die wir lieber nicht im Gehen, sondern im Sitzen essen wollen. Auch eine Herausforderung: etwas zum Sitzen zu finden in diesen Gegenden.
Unsere Richtung ist erst einmal der Flughafen Le Bourget, wo mittlerweile hauptsächlich Privatjets abheben. Auf dem Weg dorthin führt mich Thierry erneut am Haus seiner Großeltern vorbei, in dem heute, wie ich am Briefkastenschild sehe, Menschen spanischer Herkunft leben. Erstaunlicherweise entdecken wir gleich am Anfang des Flughafengeländes unverhofft zwei hölzerne Picknickbänke und -tische – allerdings hinter einem hohen Drahtgitterzaun. Die Bänke stehen auf einem Firmengelände, doch an einem windigen Januartag will hier natürlich kein Angestellter sein mitgebrachtes Mittagessen verzehren. Wir würden zwar wollen, kommen aber nicht hin. Am Ende setzen wir uns auf eine etwas von der Straße zurückgesetzte Betonabsperrung, ziehen die Reißverschlüsse unserer Anoraks bis zum Kinn hoch und fangen an, unsere Sandwiches aus gummiartigem Baguettebrot zu mümmeln und eine Cola dazu zu trinken, den Blick auf den Parkplatz und die eingezäunten Picknicktische und auf die Durchgangsstraße dahinter gerichtet.
Thierry sagt, na, hättest du dir auch nicht träumen lassen, dass du mal hier in so einer idyllischen Kulisse vor dem Flughafen Le Bourget zu Mittag speisen würdest.