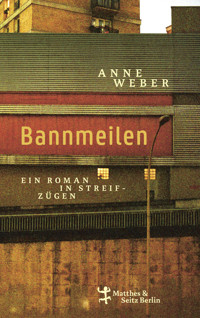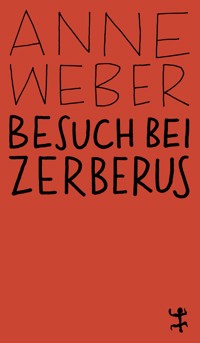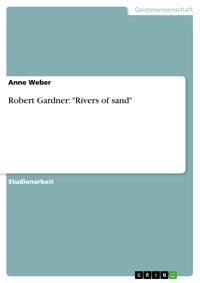Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kirio stellt die Welt auf den Kopf, nicht nur, indem er gerne auf den Händen läuft. Schon vor seiner Geburt in einem Autobahntunnel wurde er der Mutter durch einen anonymen Telefonanruf angekündigt, mit drei Jahren kann er schreiben, bringt aber erst mit sieben seinen ersten Satz hervor, doch vor allem verwirrt er die Menschen durch seine Gutmütigkeit. Nicht weniger rätselhaft als der Protagonist ist der Erzähler, der alles weiß, nur nicht, wer er ist, und der gerne Zeitzeugen von Kirio berichten lässt. So zeichnen mal die Mutter, mal der Lehrer und einige andere das Leben eines Menschen nach, der als Flötist von der Drôme über Lyon nach Paris bis ins Hanau der Gebrüder Grimm umhervagabundiert und zahlreiche Wunder vollbringt, ohne es auch nur zu merken. Mit Kirio führt Anne Weber die Tradition der Heiligenlegende bis in die Gegenwart. Doch kann es in unseren Zeiten überhaupt noch so etwas wie einen Heiligen geben? Wo kommt das Gute her, wenn es kein Gebot verlangt? Spielerisch und sprachgewandt geht Anne Weber in diesem draufgängerischen Roman den großen Fragen nach, um sie ganz gehörig aufzumischen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kirio
Anne Weber
Kirio
INHALT
Who’s who
Wie Kirio den Schatten der Welt erblickte (und wie dieser Licht für ihn war)
Hu’s hu
Wie Kirio das Lycée abbrach(und nicht abriss)
Hu!
Wie das weibliche Geschlecht Kirio entdeckte
Huhu! Anyone in there?
Wie Kirio die Stadt eroberte
Hu? Winter?
Wie Kirio ein Wunder vollbrachte, ohne es zu merken
Juhu!
Wie Kirio ein Romanheld wurde
Uhu
Wie Kirios Geschichte ohne Kirio klingt
Pirou
Wie das Fernsehen um Kirio kam
Hanau
Wie der Tod Kirio nicht fand
Who has the last word?
WHO’S WHO
Wer ich bin? Vielleicht wird es sich im Laufe dieser Geschichte herausstellen. Im Moment wüsste ich es selbst nicht mit Gewissheit zu sagen. Aber ich habe die Hoffnung, einem Detektiv in die Hände gefallen zu sein. Einem Leser mit detektivischem Gespür. Und am besten einem ebensolchen Autor. Wenn ich Glück habe und sie es darauf anlegen, werden sie mir auf die Spur kommen. Und am Ende werden wir alle wissen, mit wem oder was wir es zu tun haben.
Die Welt reist viel in mir herum. Es könnte sein, dass ich ein Botschafter bin. Nur weiß ich nicht, auf wessen Geheiß ich tätig werde oder ob ich in eigenem Auftrag handele. Ich habe das Gefühl, schon immer dagewesen zu sein. Aber hat das nicht jeder? Wer erinnert sich schon daran, wie und wann er in die Welt kam? Auch scheint mir, dass ich in dem Abseits, in dem ich wohne, für die meisten unsichtbar und unhörbar bin. Doch auch das mag für viele andere gelten. Es hat nicht viel Sinn, über meine Identität zu rätseln, solange die Geschichte noch nicht angefangen hat, in der ich eine gewisse, übrigens nicht immer glorreiche Rolle spiele.
Die Erzählung dürfte jetzt unverzüglich beginnen und vermutlich hat sie einen Erzähler. Mindestens einen. Nicht, dass Sie denken, Sie hätten das Rätsel schon gelöst: Ich bin es nicht. Jedenfalls nicht der einzige. Erzähler Nummer Eins liegt noch im Bett. Jetzt, da ich genauer hinsehe, muss ich leider feststellen: Er schläft. Und wenn ich ihn in Ruhe betrachte, wird offensichtlich: Es ist gar kein Erzähler. (Es ist auch kein Flusspferd.) Es ist eine Erzählerin. Um die Zeit bis zu ihrem Erwachen zu überbrücken, springe ich kurz mit einigen Vorbemerkungen ein. Denn auch wenn ich ihm noch nie die Hand geschüttelt und noch nie mit ihm gesprochen habe, kenne ich den Helden dieser Geschichte so gut, als hätte ich ihn selbst erschaffen. Und ich kann versichern, dass er den Namen eines Helden – und nicht etwa nur den eines Protagonisten – verdient.
Wer ist dieser Mann?
Bis er auftauchte, hatte ich von der Gattung Mensch eine recht genaue Vorstellung. Ich sah die Zutaten vor mir, aus denen sie, in variablen Proportionen, zusammengesetzt ist: Bosheit, Güte, Liebes- und Machthunger, Härte, Sanftmut, (Neu-)Gier, Angst und so weiter. Das Menschengeschlecht war mir in seinen verschiedenen Ausführungen, der männlichen und der weiblichen und sogar in einigen Zwischenformen, hinreichend bekannt; auch hatte ich ihm seit einiger Zeit immer häufiger den Rücken gekehrt und mich stattdessen in die erfreulicheren und erstaunlich vielfältigen Erscheinungs- und Lebensformen der Libelle vertieft.
Dann kam Kirio. Kirio warf alles um, angefangen mit sich selbst. Es hielt ihn nie sehr lange auf seinen zwei Beinen. Deshalb erfand er das Rad. Nicht das greifbare, handfeste, das nun einmal schon erfunden ist, sondern ein anderes, das ebenfalls zur Fortbewegung dient: Sooft er konnte und der Gehsteig vor ihm frei war, schlug Kirio Rad, statt wie jedermann einen Fuß vor den anderen zu setzen.
Kirio war weder besonders groß noch besonders klug noch ausgesprochen schön. Erst fiel er nicht weiter auf, doch dann fiel er sehr schnell aus der Reihe und nicht selten auch aus der Rolle. Entgegen allen Gesetzen zwischenmenschlicher Perspektive, wurde er immer gewaltiger, je näher man ihm kam.
Der angehende Erzähler, nein, die Erzählerin, hat Glück, sie weiß noch nicht, was auf sie zukommt, sie schlummert noch süß. Sie wird eine schwierige Aufgabe haben: Genauso gut könnte sie darangehen, eine Wolke mit einem Schmetterlingsnetz einzufangen oder das Rote Meer wie einen Borschtsch mit der Suppenkelle auszuschöpfen. Für Kirio müsste sie die Grammatik sprengen, neue Wörter und am besten ganz neue Buchstaben erfinden. Ein neues Fürwort müsste her: nur für Kirio. Ich du er sie es wir ihr sie. Das soll’s gewesen sein? Damit ließe sich alles erfassen? Da soll alles reinpassen? Auch Kirio, der so anders ist als alle anderen? Mit acht Wörtchen sollen Milliarden Menschen und wer weiß wie viele Billiarden Tiere, sollen alle Erscheinungen dieser Erde und darüber hinaus erfasst werden können? Und zugleich jedes denkbare Verhältnis, in dem jede dieser Erscheinungen zu den jeweils anderen stehen kann? Jeder mögliche Blickwinkel?
Absurd. Vergessen wir es. Vielmehr: Vergessen wir es nicht! Vergessen wir ihn nicht. Es wird Zeit, Erzählerin Nummer Eins zu wecken. Blinzelt sie nicht schon mit verschlafenen Augen?
Womit beginnen? Mit dem beginning.
WIE KIRIO DEN SCHATTEN DER WELT ERBLICKTE (UND WIE DIESER LICHT FÜR IHN WAR)
Bonjour! (Dies ist nicht Kirio speaking, sondern myself, die Erzählerin Number One). Allen, die glauben, auf den kommenden Seiten einen Blick unter die Bettdecke einer halbnackten jungen Dame werfen zu können, sei die Enttäuschung gleich zu Anfang ins Gesicht geschrieben:
Ich bin schon etwas älter.
Um ehrlich zu sein, ich könnte die Mutter des Helden sein.
Um noch ehrlicher zu sein: Ich bin seine Mutter.
Ich weiß gar nicht, warum Sie so erstaunt gucken. Es hat doch wohl nichts Abwegiges, wenn es um die Geburt eines Kindes geht, zunächst einmal dessen Mutter zu befragen.
Also. Fangen wir unverzüglich an.
Das Kind zeichnete sich von Anfang an dadurch aus, dass es nicht in Erscheinung treten wollte. Ich wusste genau, dass es schon da war die ganzen Jahre über, in denen ich nicht schwanger wurde, und ich flehte es an, doch endlich einmal zu wachsen und Gesicht zu zeigen. Vergeblich. Staubkörnchengroß schwamm es in meinem Bauch und weigerte sich, ein unleugbarer Mensch zu werden. Während ich nicht jünger wurde in diesen Jahren, wurde das Kind um keinen Tag älter. Worauf wartete es? Das sollte ich an meinem 37. Geburtstag endlich erfahren. Es war kein gewöhnliches Kind, dessen Entstehung mit der Verschmelzung zweier Keimzellen beginnt und dann einfach seinen sogenannten natürlichen Lauf nimmt. Es wollte angekündigt werden! Und es wurde angekündigt. Am Morgen meines siebenunddreißigsten Geburtstags bekam ich einen Anruf. Es meldete sich eine mir unbekannte Person, die nicht ihren Namen nannte und deren Stimme die sehr tief geratene einer jungen Frau oder auch eine ungewöhnlich zarte Männerstimme hätte sein können.
Verzeihen Sie bitte vielmals, wenn ich Sie störe, sagte die Stimme.
Auserlesene Umgangsformen hat dieser Blumenlieferant, dachte ich. Oder wer sollte das sonst sein.
Darf ich Sie fragen, ob Sie gerade stehen oder sitzen?, fuhr die Stimme fort.
Ich stand.
Wenn Sie so freundlich wären, Platz zu nehmen.
Erstaunt über die eigene Fügsamkeit, setzte ich mich auf den Küchenstuhl.
Haben Sie mir eine gute oder eine schlechte Nachricht zu verkünden?
Im Nachhinein kommt es mir so vor, als hätte die Stimme an dieser Stelle kurz gezögert.
Ich möchte verhindern, dass Sie in die Äpfel fallen, sagte sie schließlich, womit sie, falls es etwa eine französische Stimme gewesen sein sollte, in Ohnmacht fallen gemeint haben könnte.
Die Äpfel fallen nicht weit vom Stamm, murmelte ich in Gedanken vor mich hin.
Täuschen Sie sich nicht!, rief die Stimme. Das genau ist der Grund meines Anrufs. Sie werden es mit einem besonderen Apfel zu tun bekommen.
Mit einem wurmstichigen, meinen Sie?
Nein.
Mit einem, der, kaum vom Stamm gefallen, die Böschung runterrollt?
Nein.
Sondern?
Mit einem, der gar nicht fällt.
Wie das?
Sie werden einen Apfel bekommen, der steigt.
Ich schaute auf die Schale roter, fettig glänzender Äpfel, die vor mir auf dem Küchentisch stand.
Einen Luftballon, meinen Sie?
Auf diese Frage bekam ich keine Antwort mehr.
Das Letzte, was ich von der Stimme hörte, war ein seltsam antiquiertes: Gehaben Sie sich wohl.
Neun Monate später kam Kirio zur Welt.
Vorher musste noch schnell geheiratet und kurz entschlossen eine Hochzeitsreise nach Italien unternommen werden, obwohl der Apfel zu diesem Zeitpunkt schon auf die Größe eines Kürbisses angewachsen war. Es ging mir erstaunlich gut in diesen Wochen und Monaten, auch spürte ich den Bauch kaum als Gewicht, eher verschaffte er mir eine Art leichten Rückenwind. Es war meine erste Schwangerschaft, und so fand ich diesen mir unbekannten Antrieb nicht weiter verwunderlich.
Wenn ich alleine war, redete ich manchmal mit dem Kind – tun das nicht alle angehenden Mütter? Und das Kind antwortete. Damals dachte ich, das täten alle ungeborenen Kinder. Natürlich sagte es keine langen, verschachtelten Sätze, auch gebrauchte es fast nur die Gegenwartsform, und den Konjunktiv II habe ich es nie verwenden hören. Aber es antwortete, da bin ich mir sicher. Ich wandelte mit ihm durch Steineichenwälder und entlang blühender Lavendelfelder, denn wir lebten in der Drôme, in einem Dorf im Süden Frankreichs mit Namen Espeluche (sprich: Äspölüsch), zu einer Zeit, in der in dieser Gegend die Sterne noch nicht die Restaurants bekleideten und die Souvenirläden und Spa-Hotels noch nicht den Bäcker und Metzger ersetzt hatten. Oft fragte ich es an den Abzweigungen, nach welcher Seite ich mich wenden solle, und es antwortete mir nie mit rechts oder links, sondern sagte etwa: »querfeldein« oder »den Hügel hinauf« oder »zu den überwucherten Brunnen«, was im Übrigen eindeutiger war, wenn man seine besondere, zudem wechselnde Lage bedenkt und somit die Tatsache, dass sein Rechts und sein Links nicht unbedingt mit meinen übereinstimmen mussten. Ich nannte ihm im Vorübergehen die Namen der Pflanzen, die Zistrose, den Stechginster, die Wolfsmilch, die Immortellen, den Wacholder und natürlich Rosmarin und Thymian, und es freute sich und bat mich oft innezuhalten, an eines der Gewächse näher heranzutreten und daran zu riechen, als könnte es durch meine Nase an den Wohlgerüchen der provençalischen Pflanzenwelt teilhaben. Immer wieder machte es mich auf Tiere aufmerksam, die mir auf den abschüssigen Wegen oder im Gestrüpp leicht entgangen wären, eine Eidechse, eine Goldammer, eine Binsenjungfer und einmal sogar eine fette kleine Viper, auf die ich beinahe meinen rechten Fuß gesetzt hätte.
Die Schwangerschaft verlief normal, die Hochzeitsreise auch, wenn man unter normal versteht, dass wir uns am ersten Reisetag stritten, am zweiten aus den Augen verloren und erst kurz vor der Heimreise zufällig wieder über den Weg liefen. Natürlich stand man damals noch nicht in ständiger Telefonverbindung, und überhaupt war alles nur halb so schlimm. Wenn sich sein Vater entfernte, hielt ich Zwiesprache mit dem Kind, das sich seinerseits nie entfernte: Es war dabei, wenn wir Zucchiniblüten und Puntarelle aßen, es war dabei, wenn wir tankten und zankten, und es war dabei, wenn wir uns liebten, was mir manchmal ein wenig peinlich war. Bis zum vorgesehenen Datum der Niederkunft waren es noch Wochen hin, als wir uns langsam auf den Heimweg machten, der ebenfalls normal verlief. In Asti gewann das Pferderennen ein Reiter, den sein Pferd schon nach den ersten Metern abgeworfen hatte, was aber nicht weiter störend war, denn den Regeln des dortigen Palio zufolge müssen die Pferde entweder ohne Sattel oder gar nicht geritten werden. In Turin und in Gedanken trafen wir Cesare Pavese, Italo Calvino und Natalia Ginzburg. In Avigliana waren wir nicht weit, als der Heilige Mauritius aus dem Himmel einen Palmzweig gereicht bekam. Keine besonderen Zwischenfälle, wie gesagt, nur Zwischenstationen. Kaum aber hatte uns der Fréjus-Tunnel verschluckt, fing das Apfelkind furchtbar in mir zu ziehen an. Es war ein sonniger, warmer Herbsttag und wir fuhren mit hundertzwanzig Kilometern pro Stunde oder dreiunddreißig Metern pro Sekunde in einen Berg hinein. Der Berg ist groß, der Tunnel lang. In der Mitte des Berges angekommen, hielt der Kindesvater den Wagen in einer Ausweich-Nische an, die leider keine akustische war, und so musste er weiter meine Schreie ertragen. Es kann nicht anders gewesen sein, als dass die Autos an uns vorüberrauschten, doch hätte neben uns eine Pinguinvölkerwanderung stattgefunden, ich hätte ebenso wenig davon mitbekommen. Ich kauerte auf der Rückbank und drückte, nicht so sehr um das Kind als um die unerträglichen Schmerzen loszuwerden, und da der Berg mir Hilfe leistete und mitdrückte, erblickte Kirio innerhalb weniger, endloser Augenblicke den Schatten der Welt. Im Dämmer eines langen Zylinders wurde er geboren; wie einen raschen Seitenblick warfen die vorbeigleitenden Autos einen fahlen Schein auf sein winziges, blutverschmiertes Gesicht; die Schatten, die über ihn hinweghuschten, blendeten ihn, und er kniff die verquollenen Augen zu, als stünde er im grellsten Mittagslicht.
Zu zweit waren wir aufgebrochen, zu dritt kehrten wir heim. Weil seine Großmutter väterlicherseits aus dem bretonischen Ort Plogonnec stammte, wurde der Junge auf den Namen Kirio getauft. Nachdem es mit drei Jahren immer noch kein Wort sprach, entdeckte der Vater die Möglichkeit, dieses Kind könne nicht sein eigenes sein, und ließ mich mit einigen Sorgen und zwei Paar löcheriger Socken allein. In der ersten Zeit schickte er manchmal eine Postkarte und einmal sogar Geld in einer mir unbekannten Währung; eine ordentliche Summe, bevor ich sie umgetauscht hatte. Dann vernahm ich nur noch sein beredtes Schweigen.
Die ersten Lebensjahre des Kindes verliefen normal, wenn man unter normal versteht, dass es schrie und prustete und biss, wenn ich ihm die Brust geben wollte, was auch bei zahnlosem Mund erstaunlich schmerzhaft war, doch gedieh es gleichwohl. Später versuchte ich vergeblich, ihm die Wörter »Mama« und – jedenfalls solange es noch einen solchen gab, auf den man zeigen konnte – »Papa« beizubringen, nahm es aber nicht persönlich, denn mit »Mond«, »Hund« oder »Arm« hatte ich auch nicht mehr Erfolg. Schließlich probierte ich es mit »Differentialgleichung« und »Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom«, und tatsächlich kam da ein Leuchten in Kirios mittlerweile sehr große und runde Augen; aber auch das verflog. Seinem hartnäckigen Schweigen zum Trotz war offensichtlich, dass er das meiste von dem verstand, was von mir oder von wem auch immer in seiner Umgebung gesprochen wurde. Und nicht nur, dass er verstand, er antwortete auch auf seine sprachlose Weise, so dass ich keinen Grund sah, warum er nicht Kernphysiker oder Chefdirigent der Berliner Philharmoniker werden sollte. Für untergeordnete Tätigkeiten schien er mir von Anfang an nicht geeignet, gebe ich zu, was aber weniger mit übertriebenem mütterlichen Ehrgeiz als mit den früh sich ankündigenden außerordentlichen Fähigkeiten des Knaben zu tun hatte. Mit drei Jahren konnte er seinen Namen schreiben, mit vier den Dauphiné libéré lesen, mit fünf nicht nur den Großen und den Kleinen Bären, sondern auch den Bärenhüter, die Kassiopeia und die Andromeda voneinander unterscheiden. Und so war mir schon im Voraus klar, wie der Hörtest ausfallen würde, der ihm schließlich verordnet wurde: Sein Gehör war nicht nur ausgezeichnet, es war, wie alles an ihm, absolut.
Kurz nach seinem siebten Geburtstag meldete ich ihn im Konservatorium von Saint-Paul-Trois-Châteaux in der Klavierklasse an. Er stand dabei, als die Frau, die uns empfing, mich fragte, wie alt er sei, ob er vorher schon ein Instrument gelernt habe und einiges mehr.
Ich möchte lieber Flöte spielen lernen, sagte er.
Also schrieb ich ihn für Flöte ein. Als wir wieder daheim waren, wurde mir klar, dass dies die ersten Worte waren, die ich ihn je, vielmehr seit er von mir getrennt war, hatte sagen hören. Von da an konnte er sprechen, besser gesagt: von da an sprach er. Aber vor allem spielte er Flöte.
HU’S HU
Mütter! Wenn man ihnen Glauben schenkte, müsste die Welt mit Genies bevölkert sein; stattdessen wandert man umher und wundert sich, allenthalben so vielen Trotteln zu begegnen. Niemand will behaupten, dass unsere Mütter, unsere ehrwürdigen, unermüdlich unter Schmerzen und manchmal sogar um den Preis ihres Lebens neue Menschengenerationen hervorbringenden Mütter, lügen. Sie zeugen bloß davon, was sie sehen und hören, und was sie sehen und hören, ist häufig, wie bei anderen Leuten auch, was sie zu sehen und zu hören wünschen.
Ist es also wahr, dass Kirios Mutter ihren Sohn sieben Jahre lang nicht sprechen hören wollte?
Vielleicht hatte sie ihn schon vor der Geburt so viel sprechen gehört, dass sie an seinen Sprachkenntnissen nicht zweifeln konnte.
Aber außer ihr selbst dürfte wohl jeder, der den Jungen kannte, daran gezweifelt haben?
Sie wollte ein ganz besonderes Kind haben.
Und war es das nicht auch?
In gewissem Sinne schon.
(Ich bin offenbar einer, der gerne laut Selbstgespräche führt. Schon mal an einen Irren gedacht?)
In gewissem Sinne? In welchem Sinne, in Gottes Namen? Raus mit der Sprache!
Und so höre ich denn auf zu dialogisieren und behaupte: Das Kind mit Namen Kirio konnte Wunder vollbringen.
Konsterniertes Schweigen rundum. (Ein Irrer, meinten Sie?)
Es konnte Wunder vollbringen, sage ich. Doch es vollbrachte keine.
Aaaaah!
Ich meine, die meiste Zeit über vollbrachte es keine. Einmal aber wenigstens hat es ein Wunder vollbracht, und der Zufall wollte es (und ich wollte es auch, so dass ich mich schon frage, ob ich nicht zufällig der Zufall bin), dass ich dieser Begebenheit beiwohnte und nun also davon berichten kann.
Es war acht Uhr morgens, Kirio hatte vor einiger Zeit sein Fläschchen bekommen und lag nun sachte strampelnd und gurrend in seiner Wiege und war drauf und dran, wieder einzuschlafen. Denn, ja, so wahr ich hier stehe oder schwimme oder schwebe: Das wundersame Ereignis trug sich schon wenige Wochen nach seiner Geburt zu. Nach einer Weile gab das Kind kaum mehr einen Laut von sich, nur die Pupillen fuhren hinter den zu Schlitzen geöffneten Lidern unruhig hin und her.
Dann stieß es den Schrei aus. Einen Schrei, wie man ihn, außer vielleicht in Büchern, noch von keinem Kind vernommen hatte und der durch das ganze Dorf gellte und bis in die Weinkeller und auf die Dachböden drang.
So so, ein Babyschrei. Ein Wunder sieht aber anders aus, oder?
Das war auch nicht das Wunder. Das Wunder war, was im Stockwerk darüber geschah oder vielmehr nicht geschah. Und wovon außer mir bis heute keiner erfuhr.
Denn über Kirio und seiner Mutter lebte ebenfalls ein Sohn, ein erwachsener allerdings, allein mit seiner Mutter. Dem jungen Mann waren in seiner frühen Jugend schizophrene Persönlichkeitsstörungen bescheinigt worden, und seither schluckte er täglich Pillen, die ihn aber seiner festen Überzeugung und dem Beipackzettel nach krank machten und die einzunehmen er an jenem Morgen wie auch schon an den vorhergegangenen Tagen versäumt hatte. Als Kirios Schrei ertönte, war er im Begriff, im Wahn seiner schlafenden Mutter mit der Axt den Schädel zu spalten. Der Schrei riss sie aus dem Schlaf, und sie nahm dem verunsicherten Sohn die Axt ab und verriet bis an ihr Lebensende, das einige Jahre später auf natürliche Weise eintrat, niemandem etwas von dem Mordversuch.
Gewiss werden sich Leute finden, die in einem solchen Ereignis einen Zufall (mich am Werke?) sehen. Ist dann aber nicht alles Zufall, was geschieht? Denn genauso gut könnte das Kind rein zufällig nicht geschrien haben und der Schädel der Mutter folglich gespalten worden sein. Der Zufall ist eine der schönsten Einrichtungen, die wir haben, behaupte ich. (Bin ich Narziss?) Er fällt bald zu unseren Gunsten, bald zu unseren Ungunsten aus, und in den meisten Fällen bleibt er unerkannt.
Aber let’s go back to the point. The point is, dass Kirio, kaum war er auf der Welt, ein Menschenleben rettete, ja, einen Matrizid verhinderte. Gerade noch lag er friedlich in der Wiege und schlummerte. Warum hätte er unvermittelt einen durchdringenden Schrei ausstoßen sollen, wenn nicht, weil er spürte, welches Drama sich über seinem Kopf anbahnte?
Also gut, für die ewigen Skeptiker unter Ihnen will ich noch von einem anderen, weniger spektakulären, aber eindeutigeren Wunder berichten. Die Szene spielte sich ungefähr um die gleiche Uhrzeit ab, kurz nach acht Uhr morgens, aber einige Jahre später, als Kirio bereits zur Schule ging. Die erste Stunde fing um halb neun an, und wie gewöhnlich fuhr Kirio zusammen mit Lucien, einem drallen und etwas einfältigen Jungen aus der Nachbarschaft, mit dem Fahrrad zur Schule, und wie gewöhnlich waren die beiden spät dran, weil sie, also vornehmlich Kirio, sich wieder einmal von einer Eidechse hatten hypnotisieren oder von einem Motorradwrack am Straßenrand hatten in Anspruch nehmen lassen. Da bekam Lucien einen Platten. Der Zwischenfall wäre nicht weiter von Bedeutung gewesen, wenn Lucien nicht so gut wie jeden Tag zu spät gekommen wäre und die nahe Zukunft sich nicht schon als eine schier unbezwingbare Wand aus Strafaufgaben vor ihm aufgebaut hätte.
Sie standen mit ihren Rädern an einer wenig befahrenen Landstraße, und so schaute keiner außer mir zu, als Kirio den Arm ausstreckte und, den Blick auf Luciens leicht offen stehenden Mund gerichtet, seine rechte Hand auf den defekten Reifen legte, der jetzt prall und fest in seiner Handfläche lag.
Vielleicht war er nie defekt gewesen? Vielleicht hatten sie sich getäuscht?
Ich wusste es besser (wer immer ich sonst noch sein sollte: ich bin ein Besserwisser).
Kurz darauf saßen sie wieder auf den Sätteln und zwei Minuten vor Schulanfang betraten sie das Schulgebäude.
Derlei Geschichten gäbe es viele zu erzählen, doch auch von ihrer Anhäufung ließe sich einer, der nicht an Wunder glaubt, und wer tut das schon, nicht überzeugen. Soll denn hier aber jemand von irgendetwas überzeugt werden? Keinesfalls. Es soll in groben Zügen oder vielmehr flinken Strichen das Leben eines Menschen nachgezeichnet werden. Und woraus besteht das Leben eines Menschen, jedenfalls für diejenigen, die es begleitet oder gestreift haben? Am Ende verkürzt es sich auf ein paar erinner- und erzählbare Geschichten. Was hier zu lesen ist, ist einiges von dem, was sich zutrug. Wie sich das Geschehene aber erklären lässt, mag jeder für sich selbst entscheiden – oder im Dunkeln lassen.
Kirios Mutter bekam keine weiteren Kinder mehr, aber sie war häufig von den Kindern umringt, die ihr Nachbarn und Freunde der Nachbarn anvertrauten. Sie war Putz- und Kinderfrau und Zeichnerin. Vom Putzen und Kinderhüten lebte sie; vom Zeichnen lebte sie auch, aber in einem anderen Sinn. Sie zeichnete ein paar Stangen Lauch, eine Küchenschabe, eine Kehrschaufel, einen Korkenzieher, eine Zuckerdose. Sie zeichnete ihre Zahnbürste, die Salatschleuder, das Radio, den an- und den ausgeschalteten Fernseher, später den Computer, als sie einen besaß. Keine Täler, keine Berge, keine Straßen und keine Häuser. Immer nur, was sie aus der Nähe anschauen konnte. (Man muss dazusagen, dass sie kurzsichtig war.) Natürlich zeichnete sie Kirio in verschiedenen Lebensaltern. Mit Zeichnen vertrieb sie sich nicht die Zeit; mit Zeichnen vertrieb sie die Zeit. Anders gesagt: Wenn sie zeichnete, war sie, auch wenn sie eine Uhr zeichnete, nicht mehr in der Zeit. Wo war sie also? Die Zeit ist kein Ort, an dem man sich aufhält oder den man verlässt, und doch scheint mir – ich kann mich täuschen –, als wären wir einander in jenen Momenten näher gewesen als sonst. Soll ich daraus schließen, dass ich abwechselnd eine Zahnbürste, eine Küchenschabe und eine Salatschleuder bin?
So viel zu Kirios Mutter.
Wenn sie zeichnete, nannte Kirio das: weg sein. Als Kind wurde er ärgerlich, wenn sie auf diese Weise weg war; später, als Halbwüchsiger, war sie ihm so am liebsten. Er war auch oft weg und wollte nicht gesucht und nicht gestört werden.
Die Gleichaltrigen mochten ihn; er war gefällig, einfallsreich und immer guter Dinge, im Übrigen fiel er nicht besonders auf – außer vielleicht jemandem wie mir, der von Anfang an ein Auge auf ihn geworfen hatte. Er war weder viel klüger, mutiger, stärker, weder schwächer noch hässlicher als die anderen. Wenn er dabei war, gab es selten Streit, doch führten die anderen das nicht auf seine Gegenwart zurück. Vermutlich dachten sie nicht darüber nach, doch suchten sie unwillkürlich seine Gesellschaft.
Zu seinem zehnten oder elften Geburtstag bekam er von seinem Onkel Jacques, der als reich galt und Zahnarzt in Antibes war, eine Angel geschenkt, eine Smith Dragonbait LX, der man ansah, dass sie teuer gewesen war. Ich bin kein Angler (Ausschlussverfahren), aber so viel kann ich schon sagen, dass Onkel Jacques, der im Alfa Romeo Spider vorgefahren war, sich nicht hatte lumpen lassen.
Zum Angeln fuhren Kirio und seine Freunde mit dem Fahrrad zu einem kleinen Wildfluss namens Le Lez (sprich: Läse), der so breit gefächert und flach ist, dass man ihn leicht durchwaten und im Sommer, von Stein zu Stein springend, trockenen Fußes durchqueren kann. Ist es ein neues Wunder, von dem ich erzählen will? Es ist jedenfalls ein Ereignis, an das sich die Dabeigewesenen noch heute erinnern und das sie in allmählich immer unglaubwürdiger und übertriebener werdenden Fassungen ihren Kindern und Enkeln erzählen, vor allem, wenn diese sich teure Geschenke wünschen.
Seine neue Angel wurde Kirio, gleich als er sie zum ersten Mal mitbrachte, von Serge, einem älteren und recht herrschsüchtigen Jungen, weggenommen. Damit könnte die Geschichte zu Ende sein, zumal Kirio sich nicht wehrte, was zugegebenermaßen keine gute Voraussetzung für eine Fortsetzung ist. Und doch gibt es eine.