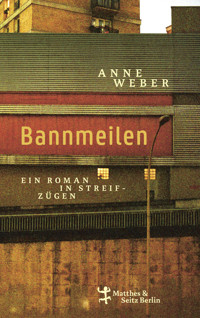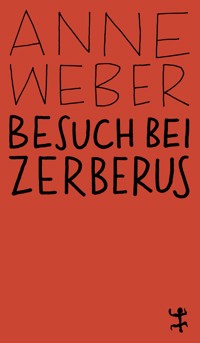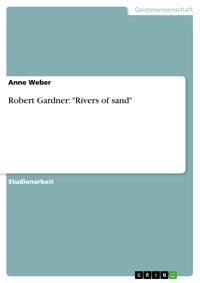Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Paris, der Stadt der Liebe, trifft eine Frau mit Anfang vierzig ihren Märchenprinzen: Nicht mehr so schlank und rank wie in den Filmen, dafür aber aufmerksam, zärtlich und charmant und sogar mit einem Schloss in der französischen Provinz. Die Idylle ist vollkommen, ein gemeinsames Leben und sogar ein Kind könnte es mit etwas Glück und medizinischer Hilfe noch geben. Aber ist das wirklich Liebe, oder doch eher Luft? Auf die Probe der Realität gestellt, zerplatzen die schönen Träume wie Seifenblasen. Und die mit großer Leichtigkeit und funkelnder Ironie erzählte Geschichte nimmt ein Ende, das bei allem Schrecken auch etwas Befreiendes hat. Locker-leicht und humorvoll, aber auch voll Ernsthaftigkeit und mit der ihr eigenen Eleganz schreibt Anne Weber von den Abgründen der Liebe, der harten Realität, wenn die rosarote Brille abgenommen ist und die Ernüchterung über die eigene Gutgläubigkeit übrig bleibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne Weber
Luft und Liebe
Für Dov
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
1
Das letzte Wort ist geschrieben, das Manuskript fertig. Ich hatte darin so tun wollen, als sei das alles nicht mir, sondern einer anderen widerfahren, einer engen Freundin etwa, deren Mißgeschick ich aus nächster Nähe miterlebt und also hätte erzählen können, guter Gott, wie hat die Ärmste sich da nur hineinmanövriert; na, mir jedenfalls wäre das nicht passiert. Verschiebungen dieser Art gelingen noch den plumpesten Romanciers, aus ich mach sie, aus dick mach dünn, aus blond mach schwarz. Und ausgerechnet ich sollte diese dumme, diese idiotische, diese grauenhafte Geschichte nicht glaubhaft einer anderen in die Schuhe schieben können?
Ich habe es versucht, habe die ganze Geschichte unter falschem Namen aufgeschrieben und am Ende feststellen müssen: Tatsächlich, nein, ich kann es nicht.
Es sollte eine Liebesgeschichte werden, und damit niemand auf die Idee käme, die Geschichte sei womöglich mir selbst widerfahren – bin ich nicht viel zu schamhaft, um in aller Öffentlichkeit mein Liebesleben auszuplaudern? –, habe ich damit angefangen, mich Léa zu nennen und katholisch zu taufen und mir die französische Staatsangehörigkeit und eine russische Mutter anzudichten. Léa sah natürlich anders aus als ich, sie war um einen halben Kopf kleiner, dunkelblond und in jedem Sinne blauäugig, während ich es nur in einem Sinne, und auch das nur manchmal bin. Die Geschichte meines Romans oder was es werden sollte spielte zu einem Teil in Paris, was aber noch lange nicht heißen mußte, daß sie mir selbst zugestoßen war, denn ich lebe zwar in dieser Stadt, aber außer mir sind immerhin noch mehrere Millionen anderer liebesgeschichtenfähiger Menschen dort angesiedelt – warum nicht eine Léa?
In dem Romanmanuskript, dem ich den Titel Armer Ritter gegeben hatte und das in fertigem Zustand ebenso imposant wie unbrauchbar ist, trat auch die männliche Hauptfigur unter einem falschen Namen auf, und zwar unter dem seltenen französischen Vornamen Enguerrand, der die Renaissance nur in wenigen adligen Familien überlebt und es zuletzt noch in ein mißratenes Manuskript geschafft hat. Statt an dem Ort, wo sein lebendiges Vorbild lebt und über dessen tatsächliche Lage ich leider auch in diesem Remake keine Auskunft geben kann, war Enguerrand in der Normandie zu Hause, in einem völlig isolierten Haus oder vielmehr Schloß, ja, Schloß, mitten im Wald. So weit war ich immerhin gediehen mit meinem Romancier-Einmaleins, daß ich es einem amerikanischen Milliardär nachtun und ein Schloß Stein für Stein abbauen und vom Burgund oder von der Marne an den Hudson oder auch nur in die Normandie transportieren konnte.
Mich selbst hatte ich zu Léas bester Freundin gemacht, ich spielte eine schon lange in Paris lebende Schriftstellerin, die bald gerührt, bald bestürzt und empört das Liebesglück und -leid ihrer Gefährtin aus nächster Nähe miterlebte und kommentierte, eine Verdoppelung meiner selbst, von der ich mir nicht nur eine zusätzliche Tarnkappe, sondern auch die zum Erzählen unerläßliche Distanz versprach.
Im Schutz meiner zwar rudimentären, aber, wie ich hoffte, doch einigermaßen glaubwürdigen Fiktion erzählte ich munter drauf los, so munter jedenfalls, wie unter den gegebenen Umständen, von denen noch zu lesen sein wird, möglich, bis das Manuskript vollendet war.
Dann warf ich es in den Papierkorb.
2
Und jetzt also alles noch einmal von vorn. Die Geschichte, die ich erlebt hatte und erzählen wollte, war wie geschaffen für einen schlechten Roman, und so hatte ich ihr denn den Gefallen getan und den schlechten Roman, nach dem sie verlangte, auch geschrieben. Damit ist es aber auch genug. Gib dich zufrieden, Geschichte! Es reicht, daß ich dieses seichte Gedusel für dich verfaßt habe, du wirst einsehen, daß ich es nicht auch noch veröffentlichen kann. Ich fange noch einmal von vorne an, und diesmal wird es nach meinem eigenen Willen gehen.
Nehmen wir die Figur der Léa, die mir trotz der Verkleidung, mit der ich sie ausstaffiert hatte, viel zu sehr glich. Was sollte ich mit einer Romanfigur anfangen, die, von der Haarfarbe abgesehen, beinahe mehr Ähnlichkeit mit mir hatte als ich selbst? Natürlich hatte ich Léa hin und wieder ein wenig anders handeln lassen, als ich es in der gleichen Situation getan hatte, und ich hatte sie nicht etwa im 2. Arrondissement, wo meine Wohnung liegt, sondern nahe der Porte de Clichy, also am anderen Ende der Stadt, Rue des épinettes einquartiert. Aber wen hoffte ich mit solch durchsichtigen Finten hinters Licht zu führen?
Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht gebrauchen, jedenfalls nicht so, wie ich dich aus meiner eigenen Rippe geschaffen hatte, sage ich heute zu Léa, die mit dem Manuskript im Papierkorb gelandet ist. Von nun an sage und schreibe ich ich. Und ich ahne, wobei ich mich natürlich auch diesmal wieder irren kann, daß dieses nagelneue Ich mir am Ende unähnlicher sein wird als jene ausgedachte Léa, die mir auf den Leib geschrieben war oder die ich mir vom Leib geschrieben hatte.
3
Die Geschichte stand unter dem Zeichen des Großen Totenansagers. Der Große Totenansager oder Blaps mortisaga ist ein dicker schwarzer Käfer, den ich an einem frühen Wintermorgen in meiner Küche auf dem Boden fand, wo er, wie Kafka auf dem Rücken liegend, langsam, wahrscheinlich schon am Ende seiner Kräfte, in Zeitlupe mit den Beinen strampelte. Diesen Käfer, der mich noch lange nach jenem Morgen in Angst und Schrecken versetzte, schnippte ich aus meiner Küche in den entstehenden Roman und meiner Léa vor die Nase, die, noch benommen und mit schlafverklebten Augen, durch das milchigtrübe Dämmerlicht ihrer Wohnung tappt. Den dunklen Fleck vor dem Bücherregal hält sie zunächst für einen kleinen Gegenstand, einen heruntergefallenen Weinkorken etwa oder einen Staubknäuel. Statt nun ein leeres Konservenglas über das Insekt zu stülpen, ein Blatt Papier unter das Glas zu schieben und anschließend den Käfer zum Fenster hinauszubefördern, öffnet sie den Küchenschrank auf der Suche nach einem Insektenspray, das sie zu besitzen glaubt. Da sie keines findet, nimmt sie die erstbeste Dose, ein Imprägnierspray für Wildlederschuhe, und besprüht damit das wehrlos auf dem Rücken liegende Tier, was aber keineswegs dessen Tod, sondern nur ein beschleunigtes, verzweifelteres Strampeln mit den Beinen zur Folge hat. Ihre Abscheu überwindend, dabei ein hysterisches Aufkreischen unterdrückend, greift sie zu Kehrblech und Besen, und es gelingt ihr, das wild um sich fuchtelnde Insekt in eine Plastiktüte zu befördern und diese zuzuknoten. Aber auch gefangen und mit giftigem Imprägniermittel getränkt gibt das Tier keine Ruhe. Die zugeknotete Plastiktüte beginnt, langsam über den Boden zu kriechen und dabei laut und bedrohlich zu rascheln, so daß Léa halb bekleidet die fünf Stockwerke hinunterlaufen, die Tüte dabei am ausgestreckten Arm von sich weghalten und in der Mülltonne verschwinden lassen muß, wo sie noch lange weiterraschelte und in meiner Vorstellung noch immer weiterraschelt, unbesiegbar.
Wie sollte ich einer Frau namens Léa, die ich soeben erst erfunden hatte und die mir folglich quasi unbekannt war, das ganze Grauen dieses Erlebnisses spürbar machen? Ich mußte mich bemühen, sie in den gleichen Zustand der Angst, des Verfolgt-Werdens und der Bedrohung zu versetzen, in dem ich mich selbst zum Zeitpunkt dieser morgendlichen Begegnung befunden hatte, weshalb mir nichts anderes übrig blieb, als ihr meine, oder zumindest eine ähnliche, Vorgeschichte zuzuschreiben, und genau das war vielleicht zuviel verlangt, denn auch für Romanfiguren gibt es Grenzen, die übrigens viel enger gezogen sind als bei uns Fleisch-und-Blut-Wesen: Es sind die Grenzen des Zumutbaren oder einfach des Wahrscheinlichen. Wollte ich Léa tatsächlich die Geschichten aufbürden, die mir nacheinander widerfahren sind, bliebe mir aus Gründen der Glaubwürdigkeit keine andere Wahl, als sie durch Selbstmord, in einer Anstalt oder eben im Papierkorb enden zu lassen. Heute habe ich eingesehen, daß ich solider bin als meine Léa, und nehme alle Schrecknisse lieber gleich auf mich.
4
Um Armer Ritter schreiben zu können, hatte ich mich aufgespalten in eine Person, die »mitten im Leben« steht und der die unerhörtesten Dinge widerfahren (Léa), und in eine zweite (mich), die im windstillen Auge eines lärmenden Großstadtzyklons an ihrem Schreibtisch sitzt, oft tagelang keinen Menschen sieht und schreibt und übersetzt und wieder schreibt. Aus dem lebendigsten Teil meiner selbst hatte ich eine Kunstfigur gemacht. Diese Aufspaltung war mir natürlich erschienen.
Aber was hatte ich nicht alles über diese Léa erfinden müssen, um eine halbwegs glaubwürdige und von mir getrennte Figur aus mir zu machen! Ich hatte ihr eine Arbeit als Anwaltsgehilfin in der Avenue Wagram besorgt, später erledigte sie für einen kleinen Kunstverlag die Pressearbeit. Willig ließ sie sich von mir in dieses oder jenes Arbeitsverhältnis und in das Bett dieses oder jenes Mannes schicken. Das alles ist nun umsonst, Léa und ich fallen einander in die Arme und verschmelzen wieder zu einer Person. Nimm es mir nicht übel, Léa, aber du warst ohne eigenen Willen und hattest schon deshalb nicht das Zeug zur Romanfigur. Nun aber, da sie ausrangiert werden soll, wird sie plötzlich lebendig und will noch einmal eine neue Chance, einen zweiten Auftritt bekommen. Welcher Autor kann schon seiner eigenen Hauptfigur etwas abschlagen? Also gut, Léa. Du sollst, wenn auch nur als verworfene Romanfigur, gleichsam als Schatten deiner selbst, Eingang in diese Seiten finden.
Eine kurze Vorgeschichte ist nötig, um verständlich zu machen, wie Léa und ich in die eigentliche Geschichte haben hineinrutschen können: Kurz bevor sie Enguerrands Bekanntschaft machte, verliebte sich Léa in einen Russen namens Vladimir Mikoyan, woraus sich eine mehrere Jahre andauernde, unrettbare und unbeendbar scheinende Liebesgeschichte entwickelte, einzureihen in die Vielzahl von Krankheiten, Schwermutszuständen, Unfällen, Naturkatastrophen, die in jedem Menschenleben einzutreten drohen. Wie hätte sie unter diesen Bedingungen einen anderen Mann, sei es einen noch so vornehmen Enguerrand, auch nur wahrnehmen sollen?
In dem Armer-Ritter-Roman begann ihre Geschichte mit Vladimir folgendermaßen:
»Am 26. Januar 1972 explodierte eine Bombe in einer DC-9 der jugoslawischen Fluggesellschaft JAT, die von Kopenhagen nach Zagreb unterwegs war. Die zweiundzwanzigjährige jugoslawische Stewardess Vesna Vulović wurde aus dem Flugzeug geschleudert, fiel ohne Fallschirm aus einer Höhe von 10 160 Metern in der Nähe des tschechischen Dorfes Srbskà Kamenice auf die Erde und überlebte. Léas Chancen, ihre Geschichte mit Vladimir heil zu überstehen, hätte ich ungefähr ebenso hoch eingeschätzt.«
Alle charmanten Unholde, denen ich je begegnet war, hatte ich in der Gestalt des Vladimir vereinigt und Léa abends in einer Brasserie des Boulevard du Montparnasse gegenübergesetzt. Um den beiden die Sache nicht zu leicht zu machen, hatte ich Léa einen Herrn beigesellt, der in dieser Geschichte keine Rolle spielt und deshalb nur als einmaliger Begleiter vorkommt. Vladimir ließ ich allein am Tisch gegenüber Platz nehmen. Nachdem nun alle Figuren im Raum verteilt waren, hatte sich der Leser fast ohne meine Beihilfe vorstellen können, wie Léas Blicke scharf an dem Gesicht ihres Tischgefährten vorbeiglitten und es dabei wie beim Messerwerfen im Zirkus aussparten, um sich in Vladimirs Augen zu versenken, wie dieses Sich-kaum-gefunden-habenund-gleich-schon-wieder-Verlieren, ohne jede Hoffnung auf ein Wiedersehen, schlicht nicht denkbar war und wie Léa, da mit einer Initiative Vladimirs, seinem An-ihren-Tisch-Treten und Ihren-Begleitereinfach-Ignorieren etwa, nicht zu rechnen gewesen war, aufstand und auf ihren langen Beinen an seinem Tisch vorbei und die Treppe hinunter in Richtung »Herren« und »Damen« ging, wie sie sich dann in einer der Kabinen einschloß und aus ihrer Handtasche einen Zettel herauskramte, auf den sie mit dem Bleistift die Worte »Sonntagabend hier« schrieb, wie sie den Papierfetzen dann zusammenfaltete, bis er nicht mehr größer als ein Olivenkern war, die Tür öffnete, nein, erst noch die Spülung betätigte – um die Szene realistischer zu gestalten, ließ ich, kaum, daß Léa an dem Kettchen gezogen hatte, das Klosett überlaufen, so daß sie augenblicklich mit den Fußsohlen im Wasser stand, worum sie sich aber nicht im geringsten scherte, zumal der Leser die weibliche Hauptfigur nicht mit der Behebung eines Wasserschadens, sondern mit dem Kennenlernen des allein am Tisch sitzenden Vladimir beschäftigt sehen wollte –, wie sie schließlich einen kurzen Blick in den Spiegel warf und sich durchs Haar fuhr, bevor sie die Treppe wieder hochstieg und im Vorübergehen, den Blick gerade vor sich gerichtet, aus der halbgeschlossenen, lokker an ihrem Leib herunterbaumelnden Hand mit einer beinahe unsichtbaren Bewegung den gefalteten Papierschnipsel auf Vladimirs Tisch fallen ließ und kurz darauf mit ihrem Begleiter das Lokal verließ. In einer Verfilmung des Romans hätte Léas Rolle von Julia Roberts oder Sharon Stone gespielt werden sollen.
Der Anfang war gemacht. Nun konnte die Vorgeschichte beginnen und das Unglück Nummer eins seinen Lauf nehmen.
5
Ich ließ Léa Vladimir heiraten. Innerhalb von zwei Monaten und siebeneinhalb Manuskriptseiten war das getan. Marry me, stupid, sagte Vladimir zu Léa, eine Anspielung auf den Billy-Wilder-Film Kiss me, stupid, die Léa zwar entging, aber immerhin reichten ihre Englischkenntnisse so weit, daß sie den Satz verstehen und Yes sagen konnte.
Drei Tage nach der Eheschließung hatte ich Vladimir schon so weit gebracht, daß er sich wieder von Léa scheiden lassen, wenn auch nicht trennen wollte. Tatsächlich sind Trennungen und Scheidungen so schmerzlich und brutal, daß man sie, wenn überhaupt, dann lieber nacheinander anberaumen sollte, was die meisten Menschen vernünftigerweise auch tun. Das Besondere an Léas Fall war nur, daß die Scheidung vor der Trennung zustande kam.
Andere, begabtere Autoren mögen über mehr Phantasie verfügen als ich, die ich meine fiktive Léa auch hier nur wieder mit meinem eigenen Erfahrungsschatz, einem reichen Schatz an Wunden, ausgestattet hatte. Tatsächlich wollte der Ehemann, den ich einmal hatte – das Verb »haben« ist allerdings ein bißchen übertrieben, aber wie soll man sagen? –, sich unmittelbar nach der Heirat wieder scheiden lassen. Da wir uns liebten und nicht vorhatten, uns zu trennen, schien mir das unnötig, aber ich konnte es ihm nicht wieder ausreden.
Hättest du dir das nicht ein paar Tage früher überlegen können? fragte ich schließlich doch ein bißchen ärgerlich.
Nein, da habe er mich noch heiraten wollen.
Ich fragte, ob wir nicht einfach weiter in unseren jeweiligen Wohnungen leben und uns lieben könnten.
Ja, schon, aber eine Scheidung müsse sein.
Aber warum bloß?
Weil die Ehe, die Institution Ehe ihn erdrücke, er habe die Bedeutung dieses gesellschaftlichen Symbols nicht richtig eingeschätzt, das sei ein Tonnengewicht, was seither auf ihm laste und ihn daran hindere, wie vorher unbefangen mit mir um- und auf mich zuzugehen. Zudem sei er Künstler und als solcher unfähig, sein Leben mit jemandem zu teilen, sein Leben sei unteilbar, und wenn ich es genau wissen wollte, unlebbar.
Er war der erste Künstler, den ich kennenlernte, und er erfüllte alle meine Erwartungen. Die Unbedingtheit oder Rücksichtslosigkeit, mit der mein Ehemann seine Künstlerlaunen und Seelenzustände auslebte, beeindruckte mich tief.
Wenn es nur das ist, lassen wir uns eben wieder scheiden! rief ich fröhlich. Ich war erleichtert, daß nicht ich es war, die als Tonnengewicht auf ihm lastete, sondern bloß die Institution Ehe.
Das Sich-scheiden-Lassen stellte sich leider als eine viel langwierigere und kostspieligere Angelegenheit heraus, als es die Heirat gewesen war. Sechs Monate mußten wir verstreichen lassen, bevor wir eine Scheidung überhaupt beantragen konnten. Bis die Scheidung dann endlich ausgesprochen wurde, verging noch ein Jahr, so daß mein Ehemann, der äußerlich alles andere als ein Gewichtheber war, im Ganzen anderthalb Jahre unter der Last dieser Institution leben mußte und dabei tatsächlich den Nakken beugte, während ich nur innerlich in die Knie ging und äußerlich neben ihm weiter zu wachsen schien.
Erst allmählich begriff ich, daß ich in einen Nahkampf hineingeraten und im selben Augenblick auch schon unterlegen war. Ich begann, den vielen Clochards und Bettlern Geld zu geben, denen ich auf meinen Wegen durch Paris begegnete, jedoch war es keine Barmherzigkeit, die mich trieb, noch nicht einmal Großzügigkeit, es war die reinste oder unreinste Bestechung. Ich bestach die Bettler, weil ich mir einbildete, mein Liebesglück liege in ihren Händen.
Um meinen Ehemann dafür zu bestrafen, daß er unsere Hochzeitsreise ohne mich angetreten hatte, flog ich allein nach Hong Kong, wo ich zwischen sechs Millionen Chinesen untertauchte und außer mir selbst zehn Tage lang niemandem aufgefallen bin. In Hong Kong war ich wie vom Erdboden verschluckt, einfach nicht mehr vorhanden. Mein Ehemann ist im Baskenland, versuchte ich mir immer wieder zu sagen. Es schien mir inmitten der vielen, ganz selbstverständlich jeder mit sich und seinem eigenen Leben, mit Essen oder Schlafen oder Überdie-Straße-Schlurfen beschäftigten Chinesen unwahrscheinlich, sagenhaft, unfaßbar, daß es das Baskenland gab, und vor allem, daß es diese Inselstadt und ihre Bewohner und gleichzeitig das Baskenland gab, und meinen Ehemann darin.
Schon immer hatte die Gleichzeitigkeit der Geschehnisse auf der Erde, sei es auf unterschiedlichen Erdteilen oder in zwei Zimmern derselben Wohnung, mich in Staunen versetzt. Während ich diesen Satz spreche, dachte ich, fährt unten ein Kind mit dem Fahrrad an einem Mörder vorbei, spiegelt die Sonne sich in einem Dachfenster in Suresnes, läuft in Nowosibirsk eine Maus in die Falle. Das kann sich kein Mensch vorstellen, diesen allen Raum ausfüllenden »Rest der Welt«, der immer gleichzeitig da ist, der nie Ruhe gibt und sich nicht um einen schert.
Von Hong Kong aus war mein Ehemann nicht mehr vorstellbar, und doch lief er immer neben mir her.
6
Daß wir an einem 1. April geschieden wurden, ist ebenfalls keine Erfindung, sondern von einem amtlichen Stempel abzulesen. An diesem Punkt der Erzählung kam mir in dem mißratenen Armer-Ritter-Roman aber wieder Léa sehr zugute, weil ich mit ihr die Scheidung so gestalten konnte, wie ich sie selbst zwar nicht erlebt, wie ich sie mir aber erträumt hatte. Tatsächlich hatte ich mir in den Kopf gesetzt, dieses Ereignis, da es doch keineswegs das unselige Ende einer Liebe oder eines Verzaubertseins, sondern im Gegenteil das Wegfallen eines Gewichts, das Lösen rein administrativer Bande zugunsten der wahren Liebe bedeutete, gebührend zu feiern, es wie eine zweite Hochzeit zu begehen.
Ich zog Léa das lange, lavendelfarbene Samtkleid mit dem geschnürten Ausschnitt an, das ich bei der Trauung im Standesamt des 19. Arrondissements getragen hatte. Ich lud einige Freunde ein, darunter die Trauzeugen, die nun als Scheidungszeugen gefordert waren und die Léa und Vladimir zu ihrem Termin beim Familienrichter im Justizpalast auf der Île de la Cité begleiten und anschließend mit ihnen feiern sollten. Leider wurde der kleinen Schar jedoch vor den hohen, pfeilförmigen Gitterstäben des Justizpalastes Einhalt geboten: Zu einer Scheidung waren keine Festgäste zugelassen. Die republikanische Garde legte mir Steine in den Weg – eine Scheidung als Freudenfest zu gestalten war von amtlicher Seite nicht vorgesehen. Nun gut, dann würden die beiden eben zu zweit feiern. Ich ließ Léa und Vladimir die breite Außentreppe hochsteigen, die ich damals mit meinem zukünftigen Ex-Ehemann erklommen hatte, und durch das linke der drei Tore, das mit dem goldenen Wort Liberté überschrieben war, in das mächtige Gebäude eintreten, wo einst das Revolutionstribunal getagt hatte und wo Marie-Antoinette und Tausende anderer zur Guillotine verurteilt worden waren.
Das Fallbeil ließ ich nicht in einem der imposanten, prunkvollen Gerichtssäle fallen, sondern in einer niedrigen Stube unter dem Dach. Ich wartete ab, bis der Richter Léa gefragt hatte, warum sie sich scheiden lassen wolle und ob sie wirklich fest dazu entschlossen sei. Sie war entschlossen. Wenn schon, sagte sie, dann sei sie lieber mit einem Mann verheiratet, der auch mit ihr verheiratet sein wolle.
Dagegen gab es nicht viel einzuwenden. Während sich die Formalitäten hinzogen, klebte ich aus Langeweile dem Familienrichter unter dem linken Ohr eine Warze an, was aussah, als wüchse ihm an dieser Seite ein zweites Ohrläppchen.