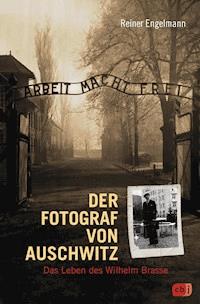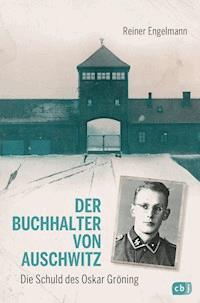8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Mitten unter uns: Rechtsextremismus heute
Irgendwo in einer Kleinstadt mitten in Deutschland treffen sich drei Freunde auf ein Feierabendbier. In den sozialen Netzwerken haben sie sich schon an ausländerfeindlichen Pöbeleien beteiligt. Nun werden sie zu Verbrechern, denn wenige Stunden später werfen sie einen Molotowcocktail in eine Flüchtlingsunterkunft. Die Bewohner, darunter auch Kinder, entkommen nur knapp.
Reiner Engelmann recherchiert die Hintergründe dieser schrecklichen Tat. Er analysiert die Beweggründe und er befragt die Opfer, die sich in Deutschland endlich sicher gefühlt hatten. Dabei wird deutlich: rechtes Gedankengut und Fremdenfeindlichkeit sind in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen und viel zu lange unbeachtet geblieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
REINER ENGELMANN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Für meine Enkelkinder
Paul, Lior, Lionid
1. Auflage 2017
© 2017 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Geviert Grafik & Typographie
Umschlagmotiv: Shutterstock (Ansis Klucis, Neil Lang, Thomas Jasinskis)
kg · Herstellung: AJ
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-20689-5V001
www.cbj-verlag.de
Gewalt bedroht unser Menschsein.
Arno Gruen
Ich weigere mich, ohne Hoffnung zu sein.
Nadine Gordimer
Inhalt
Vorab
Prolog
Vorboten
Teil 1 – Flucht aus …
… Afghanistan
… Somalia
… Syrien
… Pakistan
… Simbabwe
Teil 2 – Die Tat
Der Anschlag
Sicherheit
Der Tag danach
Untersuchungshaft
Entschuldigung
Hinweise – Robert Mühlhaus
Hinweise – Matthias Schmitt
Hinweise – Beate Burg
Hinweise II – Robert Mühlhaus
Mütter
Teil 3 – Im Namen des Volkes
Pressemitteilung
Der Prozess
Das Urteil
Epilog
Nachwort
Glossar
Literatur- und Quellenverzeichnis
Vorab
Dieses Buch beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Tat, die hier beschrieben wird, wurde so tatsächlich verübt. Taten wie diese gab und gibt es viele in Deutschland.
Die betroffenen Geflüchteten habe ich in langen Gesprächen befragt, jedoch habe ich ihre Namen und auch Teile ihrer Geschichten leicht verändert, um sie zu schützen.
Der Kern von dem, was sie mir anvertraut haben, wird hier jedoch wiedergegeben.
Durch meine Recherchen zu dem Fall habe ich auch tiefe Einblicke in die Psychologie der Täter und ihrer Familienangehörigen gewonnen. Die im Buch beschriebenen Innensichten beruhen auf meinen Beobachtungen bei den Gerichtsverhandlungen sowie auf Analysen der Täteraussagen. Sie kommen der Realität also nah, können dieser aber nicht vollständig entsprechen, da ich leider keine Möglichkeit hatte, mit den Tätern und den Familienangehörigen zu reden. Ihre Anwälte haben eine Kontaktsperre verhängt. Die Namen habe ich ebenfalls geändert.
Reine Fiktion sind die Anwälte, deren Handeln ich mit sachkundiger Unterstützung auf der Grundlage immer neuer Erkenntnisse zum Tathergang konstruiert habe.
Fiktion und Realität greifen ineinander über, geben einen tiefen Einblick in die Gedankenwelt von Tätern und vermitteln Ursachen dafür, warum Menschen ihre Heimat verlassen, um in einem anderen Land, in diesem Fall Deutschland, Schutz für das eigene Leben und das der Familie zu suchen.
Prolog
Für den 18. Januar hatten sie zur traditionellen Grünkohlwanderung eingeladen. Das Datum war bewusst gewählt, wird es in ihren Kreisen doch nach wie vor als Gedenktag zur deutschen Reichsgründung gefeiert.
Sie trafen sich außerhalb des Ortes auf einem Wanderparkplatz. Von dort liefen sie über einen Höhenzug, auf dessen Gipfel ein Turm scheinbar bis in den Himmel ragte. Sie bestiegen ihn und genossen nach der einen Seite den Blick über die Wälder, die sich bis zum Horizont erstreckten, und in der anderen Richtung sahen sie hinunter ins Tal. Natur pur. Rundum.
Nach einer Teepause führte ihr Weg sie weiter, vorbei an bizarren Felsgruppen, an heidnischen Kultstätten aus vorchristlicher Zeit bis hin zum nächsten Etappenziel, dem Thingplatz, der zwischen 1933 und 1936 von den Nationalsozialisten als Freilichttheater und für Aufmärsche errichtet wurde, aber nie deren Vorstellungen nach ausreichend genutzt wurde. Einige Teilnehmer hegten den Wunsch, diesem Ort nun endlich die Bedeutung zukommen zu lassen, für den er einmal von den großartigen Vorbildern jener Zeit vorgesehen war.
Von dort traten sie, nach wilden Schneeballschlachten, ihren vorerst letzten Weg an: zu einem Gasthaus in der Region, in dem sie angemeldet waren. Bei Grünkohl und Korn freuten sie sich über diesen Tag.
»Deutsches Land, deutsche Natur, durchwandert von deutschen Männern.« Mit diesen Worten begann einer der Teilnehmer nach dem Essen eine kurze Rede. »Wir wollen dieses Land sauber halten. Erinnert euch an diese Natur, an die klare Luft! Noch nicht verpestet von jenen, die nicht hierhergehören. Hier ist die Natur noch rein und so soll sie auch bleiben, Kameraden!«
Lauter Beifall.
»Ich freue mich, ein paar neue Gesichter zu sehen. Das ist gut! Auf euch kommt es an! Jeder, der bei uns im Aktionsbündnis Hermannsland mitmacht, ist mehr Wert als ein vertrottelter Wähler, der alle vier Jahre bei irgendeiner Partei sein Kreuz macht!«
Wieder tosender Beifall.
»Und deswegen, Kameraden, soll jeder von euch entscheiden, welchen Beitrag er zur Reinhaltung Deutschlands leisten wird. Wir müssen aktiv werden, es ist an der Zeit!«
In Tischgruppen saßen sie noch lange zusammen, tranken Bier und Korn und planten die nächsten Aktionen. Einer der Neuen hatte eine Idee, die er vortrug. Man nickte, klopfte ihm zustimmend auf die Schulter und prostete ihm zu. So viel Zuspruch hatte er nicht erwartet. Nun stand er im Wort. Er wurde gebraucht.
Vorboten
Es war eine kalte Frühlingsnacht. Regen hatte eingesetzt, der von einem heftigen Wind durch die Straßen gepeitscht wurde.
Er zog sich die Kapuze seiner Jacke weit über den Kopf, sodass sie auch Teile seines Gesichtes verdeckte, als er hinaus auf die Straße trat. Das half. Gegen den Wind. Er wollte auch nicht erkannt werden.
Seinen Plan hätte er verschieben können. Auf eine laue Frühlingsnacht. Aber er war niemand, der Vorsätze so leicht aufgab. Außerdem stand er im Wort. Den Kameraden hatte er beim Grünkohlessen versprochen, es zu tun. Nun war es so weit.
Er befühlte noch einmal seine Jackentasche. Es war alles da, was er brauchte.
Für den Weg bis zum Zielort brauchte er fünf Minuten. Diesen Ort fand er für sein Vorhaben strategisch wichtig. Das hatten auch die Kameraden gesagt. Von diesem Ort, der Bushaltestelle, fuhren täglich viele Menschen zur Arbeit oder zur Schule in die Kreisstadt oder zu anderen Orten in der Region. Außerdem lag sie direkt neben dem Haus, in dem die Gemeinde Asylbewerber untergebracht hatte. Diesen Ort hatte er ausgewählt, um seine Botschaft anzubringen. Einzig der starke Wind könnte seinen Plan noch durchkreuzen. Das Wartehäuschen hatte jedoch neben einer Rückwand auch zwei Seitenwände, die ihn schützen würden.
Nachdem er angekommen war, schaute er sich kurz um. Zu dieser Zeit war niemand mehr auf der Straße.
Er zog die Sprayflasche aus der Jackentasche und führte aus, was er zu Hause viele Male geübt hatte. Als er fertig war, trat er ein paar Schritte zurück. Das diffuse Licht der Straßenlampe reichte aus, um sein Werk zu begutachten. Es war ihm perfekt gelungen. Groß, rot und zentral hatte er seine Botschaft auf die Innenseite der Rückwand der Bushaltestelle gesprüht.
Am kommenden Morgen war er einer der ersten am Ort. Nicht zufällig. Auch er musste, wie viele andere, mit dem Bus in die Kreisstadt. Bislang kam er immer gleichzeitig mit dem Bus an der Haltestelle an. Er mochte es nicht zu warten. Anders an diesem Morgen. Er wollte beobachten, Reaktionen einfangen.
Empörung, Kopfschütteln, damit hatte er gerechnet. So kam es auch. An diesem Morgen. Bei seiner nächsten Fahrt drei Tage später kamen noch ähnliche Reaktionen. Nicht mehr so heftig. Drei Monate später war das Hakenkreuz so etwas wie ein Bestandteil der Bushaltestelle geworden. Niemand mehr machte eine Bemerkung, niemand schüttelte mehr den Kopf, niemand ließ es entfernen.
Er freute sich über diesen Erfolg.
Wenige Wochen nach jener verregneten Frühlingsnacht machte sich ein weiterer junger Mann im Schutze der Dunkelheit auf den Weg. Auch er hatte eine Mission zu erfüllen. Auf verschlungenen Wegen hatte er Kontakt zu dem Mitglied einer Partei bekommen, von der er schon gehört hatte, aber bislang niemanden daraus kannte. Bis jemand von dieser Partei herausgefunden hatte, dass er an seinem Heimatort den »Club 18« betrieb. Das Parteimitglied hatte zwar keine Vorstellung davon, was sich hinter diesem Klub verbarg, allein die »18« war für ihn ein Zeichen. Sie trafen sich, tauschten ein paar Informationen aus, und er ließ sich darauf ein, für diese Partei Flugblätter zu verteilen, in denen ausdrücklich gegen die »Asylantenflut« Stellung bezogen wurde. Sie sollten in P. verteilt werden, weil es dort schon Asylanten gab und wahrscheinlich noch mehr aufgenommen werden sollten. Vereinzelter Protest war schon laut geworden.
An jenem Morgen fanden viele Bürger in P. diese Flugblätter in ihrem Briefkasten. In den nächsten Tagen und Wochen hielt er sich öfter in Geschäften und Gaststätten in P. auf. Er wollte herausfinden, ob und wie man über die Flugblätter redete. Aber er konnte nichts feststellen. Auch dann nicht, als er zum zweiten und dritten Mal die Briefkästen mit diesen Informationen versah. Es gab keinerlei Aufschrei in der Bevölkerung, niemand hatte die Presse informiert. Weder der Bürgermeister noch der Pfarrer.
Er war zufrieden.
Was diese beiden jungen Männer nicht wussten:
Zur gleichen Zeit machten sich Menschen aus verschiedenen Ländern auf die Flucht. Sie verkauften, sofern sie noch Zeit dazu hatten, ihr gesamtes Hab und Gut, vertrauten ihr Schicksal Schlepperorganisationen an und hofften, sie würden von ihnen in sichere Länder gebracht werden. Denn dort, wo sie lebten, war ihr Leben in Gefahr. Um sie herum herrschte Krieg, Terror bedrohte sie, oder sie waren in ihrer Heimat nicht sicher, weil sie sich für Freiheitsrechte einsetzten.
Niemand von ihnen wusste, ob sie jemals lebend ein sicheres Land erreichen würden, das ihnen ein Leben ohne Angst ermöglichte. Weder die vierköpfige Familie aus Afghanistan noch die aus Pakistan, weder die Eltern mit ihren drei Kindern aus Syrien noch der Jugendliche, der vor dem Krieg aus Somalia flüchtete, noch die Mutter mit ihren drei Kindern aus Simbabwe, deren Mann Opfer staatlicher Gewalt wurde, weil er sich für freie Wahlen eingesetzt hatte.
Dass sie nach Deutschland kamen, war mehr dem Zufall geschuldet. Am Anfang ihrer Flucht wussten sie oft nicht, wohin der Weg sie führen würde und ob sie an dem Ort, den sie erreichten, auch bleiben könnten. Sie wollten nur einfach weg aus ihrem Land, weg von der täglichen Bedrohung, irgendwo hin, wo sie sicher leben konnten.
Über viele Stationen kamen sie schließlich nach P. Sie hatten ein Ziel erreicht. Sie waren in Sicherheit. Doch wie würde ihr Leben weitergehen? Das konnte niemand von ihnen voraussagen. Sie freuten sich über die Unterstützung durch die einheimische Bevölkerung und auch mit vielen Behörden machten sie bessere Erfahrungen als mit denen in ihren Heimatländern.
Konnten sie es schaffen, an diesem neuen Ort anzukommen?
TEIL 1
Flucht aus …
»Wenn ihr den Krieg
beenden wollt,
sendet Bücher statt Waffen.
Sendet Stifte statt Panzer.
Sendet Lehrer statt Soldaten!«
Malala Yousafzai
… Afghanistan
Nacht für Nacht wacht Frozan auf. Schweißgebadet sitzt sie in ihrem Bett. Es ist immer der gleiche Traum, der ihr den Schlaf raubt. Gut, dass ihre ältere Schwester Zarah noch mit im Zimmer ist. Zu ihr kriecht sie unter die Decke und findet etwas Ruhe. Was könnte sie tun, damit das aufhört? Diese Frage beschäftigt sie. Wie gerne möchte sie sich abends wieder ins Bett legen können und die ganze Nacht durchschlafen. Seit Monaten ist das schon nicht mehr möglich.
Anfangs fragte ihre Schwester noch, was sie geträumt habe.
»Von früher«, hatte sie nur knapp geantwortet, »von früher.«
»Aber wir sind jetzt in Deutschland«, versuchte ihre Schwester sie dann zu beruhigen, »hier sind wir in Sicherheit, hier passiert dir nichts!«
Frozan weiß das. Sie ist froh, in Deutschland zu sein. Wegen der Sicherheit. Aber ihre Heimat, ihre Heimatstadt Masar-e Sharif, in der sie geboren wurde, in der sie die ersten Jahre ihres Lebens verbracht hatte, sie vermisst sie. Trotz allem. Wenn sie darüber nachdenkt, kommt sie sich manchmal vor wie eine Blume, die man auf einer bunten Wiese gepflückt hat und in eine Vase stellt. Sie blüht noch einige Zeit, aber ohne Wurzeln würde sie schnell verwelken.
Nach irgendeiner dieser Nächte, in der ihr Albtraum sie wieder aus dem Schlaf gerissen hatte, konnte sie morgens nicht aufstehen. Sie war erschöpft. Ihre Gedanken waren nicht im Hier und Jetzt, sie lagen weit zurück. In der Zeit vor ihrer Flucht. Dieser Zeit hatte Frozan einen Namen gegeben. Es war die Angstzeit. Von früh bis spät hatte sie Angst gehabt. Wenn sie manchmal rausgehen wollte, um ihre Freundin zu treffen. Die gierigen Blicke der Männer konnte sie kaum ertragen. In solchen Augenblicken verstand sie ihre Mutter, dass sie nur mit einer Burka vor die Tür ging. Am liebsten hätte sie sich auch verschleiert. Diese Blicke – was sagten sie? Blicke alter Männer, mit langen Bärten, viele schon zahnlos. Du bist sicher schon elf Jahre alt und könntest heiraten!
Die Blicke der Männer waren die kleinere Angst. Die große Angst war die vor den Taliban. Sie konnten plötzlich auftauchen und Menschen ermorden. Einfach so. Sie hatte es schon gesehen.
Aber um die Freundin zu sehen, musste sie raus, musste einige Hundert Meter bis zu ihrem Haus die Straße entlanglaufen. Eine gefährliche Strecke! Und wenn die Freundin zu ihr kam, musste sie diese Strecke zurücklegen. Einmal kam sie nicht. Obwohl sie sich fest verabredet hatten. Auf ihre Freundin konnte man sich immer verlassen. Sie kam auch am nächsten und am übernächsten Tag nicht. Frozan hatte Angst um sie. Sollte sie zu ihrem Haus gehen und nach ihr sehen? Vielleicht war sie ja krank! Sie wagte es und machte sich auf den Weg. Die Mutter der Freundin öffnete ihr die Tür.
»Wo ist …?« Weiter kam Frozan nicht. Die Mutter nahm sie in die Arme, drückte sie fest an sich und schluchzte.
»Einer der Männer hat sie …«, sagte sie nach einiger Zeit. Weiter kam sie nicht, wieder fing sie an zu weinen.
»Aber … aber …«, stotterte Frozan, »aber sie ist doch noch ein Kind, genau wie ich!« Frozan war fassungslos.
»Ja, sie ist noch ein Kind«, sagte die Mutter, »und ich lasse sie jetzt nicht mehr vor die Tür. Das ist einfach zu gefährlich.«
Dies war eine von Frozans großen Ängsten. Konnte sie es riskieren, noch mal raus auf die Straße zu gehen, um ihre Freundin zu besuchen?
Die zweite Angst war die um ihre Mutter. Obwohl fast alle Frauen in Masar-e Sharif sich nur verschleiert vor die Tür wagten, kam es oft vor, dass sie vergewaltigt wurden. Oder, wenn sie nicht ordentlich verschleiert waren, mussten sie damit rechnen, dass ihre Gesichter mit einer ätzenden Flüssigkeit begossen wurden. Und ihre Mutter musste raus, fast jeden Tag. Sie musste arbeiten, Geld verdienen. Obwohl nach Ansicht der Taliban Frauen nicht arbeiten sollen. Als sie an einem Abend nach Hause kam, war sie verletzt. Sie hatte eine Stichwunde im Oberschenkel. Blut tropfte auf den Boden, markierte ihren Weg in den Waschraum. Die Mutter wollte nicht darüber reden, nicht erklären, was passiert war. Frozans Fantasie trieb wilde Blüten.
Die größte Angst war aber die um ihren Vater. Er betrieb eine kleine Autowerkstatt, in der er immer viel zu tun hatte. Über die Jahre hin hatte er sich einen festen Kundenstamm erarbeitet. Doch in den letzten Monaten kamen neue Kunden hinzu, Kunden, die darauf bestanden, bevorzugt bedient zu werden. Wenn er ihre Autos repariert hatte, fuhren sie einfach weg, ohne zu bezahlen. Wenn er von ihnen Geld forderte, wurde er bedroht. »Du wirst der Nächste sein!«, kündigten sie an.
An solchen Tagen fehlte ihnen das Geld, um etwas zu essen zu kaufen. Das war aber nicht das Schlimmste. Wie sollten sie mit der Bedrohung umgehen? Konnten sie das einfach so hinnehmen? Würden diese Männer ihren Ankündigungen Taten folgen lassen? Sie wussten keine Lösung, wenn sie abends im Zimmer zusammensaßen und darüber redeten.
Die Bedrohungen wurden schlimmer. An einem Abend kam Vater nach Hause, und auf den ersten Blick sah Frozan schon, dass etwas passiert war. Seine Augen waren zugeschwollen, seine Nase blutete.
Drei Tage konnte er nicht arbeiten, drei Tage waren sie ohne Geld, drei Tage ohne etwas zu essen.
Am Abend des vierten Tages, als er aus seiner Werkstatt nach Hause kam, wirkte er verändert. Irgendwie entschlossen. Gesagt hatte er nichts, zumindest nicht, als sie alle zusammensaßen. In der Nacht unterhielt er sich aber noch lange mit Mutter. Worüber sie redeten, konnte Frozan nicht verstehen, sie hörte nur ihre Stimmen.
In den folgenden Tagen und Wochen bemerkte sie Veränderungen zu Hause. Irgendwelches Geschirr, das sie immer zum Kochen oder Essen benutzt hatten, war auf einmal nicht mehr da. Dann fehlte ein Teppich, dann ein Tuch, dann eine Schlafmatte. Sie hatte keine Erklärung dafür. Hatten ihre Eltern diese Dinge weggeworfen? Wollten sie das Haus neu einrichten? Doch dafür gab es keine Anzeichen.
Als sie nur noch über das Notwendigste verfügten, wurden ihre Schwester und sie in die Pläne der Eltern eingeweiht.
Sie weiß nicht mehr, wie sie sich in diesem Augenblick fühlte. Einerseits war sie froh, endlich hier wegzukönnen, nicht mehr Tag für Tag ans Haus gebunden zu sein. Denn raus wagte sie sich nach dem Vorfall mit ihrer Freundin nur noch ganz selten. Andererseits dachte sie aber auch gerade an sie. Würden sie sich je wiedersehen? Und sie dachte an ihre Onkel und Tanten und an ihre Großeltern, die noch hier in der Stadt lebten. Auch von ihnen würden sie sich trennen müssen. Das alles ging ihr nicht aus dem Kopf. Ein Abschied für immer? Eine Trennung von allem, was ihr in ihrem bisherigen Leben wichtig war? Und wird das Neue, das auf sie zukommen würde, das Gewohnte ersetzen können? Nach Europa würden sie gehen, hatte ihr Vater ihnen gesagt. Europa. So weit weg, so fremd. Von Europa hatte Frozan schon gehört. Früher konnte sie noch zur Schule gehen, abends, heimlich, in eine Mädchenschule. Ihre Mutter hatte sie zweimal in der Woche dorthin gebracht. Für Mädchen gab es keine Schulpflicht, weil sie ja nur Mädchen waren und früh heiraten sollten. Welcher Mann brauchte schon eine gebildete Frau? Männer brauchten Frauen, die ihnen den Haushalt führten und Kinder gebaren.
In dieser Schule hatte ihnen die Lehrerin von Europa erzählt, über die Länder, die verschiedenen Sprachen und davon, dass die meisten Menschen dort reicher waren als hier in Afghanistan. Weil es dort eben Schulen gibt für alle Menschen, gerade auch für Mädchen.
Die letzten Tage zu Hause waren hektisch. Alles, was sie auf die Reise mitnehmen mussten, packten sie in Taschen. Viel durfte das nicht sein, denn sie mussten ja alles selbst tragen.
An einem Abend ging ihr Vater aus dem Haus. Das machte er sonst nie. Frozan sah, wie er einen Bündel Geldscheine einsteckte.
»Woher hat er das viele Geld?«, fragte sie ihre Mutter.
»Wir haben alles verkauft, was wir nicht mitnehmen können.«
»Und die paar Dinge, die wir jetzt weniger in unserem Haus haben, haben so viel Geld eingebracht?« Sie konnte es kaum glauben.
»Nein«, sagte ihre Mutter. Ihre Stimme klang gedämpft. »Für die Werkstatt und das Haus haben wir das meiste Geld bekommen.«
Frozan war schockiert! Sie hatten alles verkauft? Das bedeutete, dass sie nie mehr zurückkehren würden! Zumindest nicht in ihr vertrautes Zuhause! Konnte das sein? War das ein Abschied für immer?
Nach dem nächtlichen Ausflug kam ihr Vater zufrieden zurück. »Es hat alles geklappt«, sagte er freudestrahlend. Andere Pässe hatte er besorgt und auch die Fahrkarten für die erste Strecke gekauft. Außerdem hatte er die Flüge bezahlt und die Tickets dafür in der Tasche. Wo hatte er das alles her? Doch die Antwort interessierte Frozan in dem Augenblick nicht, dafür war alles viel zu aufregend. Das Wort »Fahrkarte« verband sie mit einer Busreise. Wann war sie zuletzt mit einem Bus gefahren? Sie hatte fast keine Erinnerung mehr daran. Doch mit der Vorstellung an eine Busfahrt sollte sie sich gewaltig irren.
Zwei Tage später machte sich die ganze Familie im Morgengrauen auf den Weg. Von ihren Verwandten hatten sie sich am Vortag verabschiedet. Es waren viele Tränen geflossen, sogar bei ihrem Vater und ihrem Opa, die sie noch nie hatte weinen sehen. Und Oma sagte zu ihr: »Ich werde euch nie wiedersehen, meine Kinder!« Ihr ganzer schwerer Körper wurde vom Weinen geschüttelt.
Mit ihren Taschen mussten sie nur ein kurzes Stück laufen. Aber es war schon warm an diesem Morgen, und Frozan bereute es, dass sie noch eine Weste über ihre Bluse angezogen hatte.
»Da vorne ist es schon«, sagte Vater strahlend.
Dort stand aber kein Bus, wie Frozan es erwartet hatte, dort stand ein Lkw mit einer grauen Plane über der Ladefläche und noch einige andere Leute, auch mit Taschen bepackt.
»Damit sollen wir nach Europa fahren?« Frozan war entsetzt.
»Nein.« Ihr Vater lachte und nahm sie in den Arm. »Damit legen wir nur die erste Strecke zurück, bis Pakistan. Von dort fliegen wir nach Europa.«
Frozan war beruhigt. Das klang ja alles ganz einfach. Mit dem Lkw nach Pakistan und von dort nach Europa. Aber von Masar-e Sharif nach Pakistan, das war schon eine lange Strecke. Doch egal, Hauptsache, sie kamen von hier fort.
Dicht gedrängt saßen sie schließlich alle zusammen auf der Ladefläche. Jeder Stein, jedes Schlagloch, rüttelte sie durch. Und davon gab es viele. Der ganze Weg schien nur aus Steinen und Schlaglöchern zu bestehen. Irgendwann war sie müde, hätte gerne ein bisschen geschlafen, aber das war unmöglich. Gerade wenn ihr die Augen zugefallen waren, lag auf der Straße wieder ein Stein, oder sie fuhren durch ein Schlagloch. Es wurde Nachmittag, es wurde Abend, sie kamen in die Berge, und es wurde kalt. Nun war sie froh, dass sie eine Jacke anhatte, eine zweite Jacke hätte ihr aber auch noch gutgetan. Weil sie die aber nicht hatte, rückte sie näher an ihre Schwester, die auch fror, und so wärmten sie sich gegenseitig.
Die Nacht ging vorbei, der neue Tag brach an, und sie waren schon über der Grenze. Gerettet!, dachte sie. Doch dann geschah etwas, womit niemand der Fahrgäste gerechnet hatte. Der Lkw hielt an, Fahrer und Beifahrer sprangen aus dem Führerhaus und forderten alle auf, abzusteigen. Die Reise per Lkw sei für sie hier zu Ende. Den weiteren Weg müssten sie zu Fuß zurücklegen.
Frozans Vater protestierte: »Wir haben doch bezahlt! Sie müssen uns zum Flughafen bringen! So war es vereinbart!«
Das sei für ihn zu gefährlich, meinte der Fahrer, er könne nicht mit einem Lkw voller Menschen dort vorfahren und sie abladen. Alles Bitten und Flehen und selbst Geldangebote der anderen Fahrgäste halfen nicht, der Fahrer blieb dabei. Er erklärte ihnen noch, welchen Weg wir nehmen sollten, dann setzte er sich hinters Steuer und fuhr zurück.
Nun standen sie da, mitten in den Bergen, wie eine Schafherde ohne Schäfer. Konnten sie dem Rat des Lkw-Fahrers trauen? Wie lange müssten sie laufen bis zu ihrem Ziel? Niemand hatte eine Vorstellung. Lautstark beratschlagten die Erwachsenen, was nun zu tun sei. Frozan setzte sich etwas abseits auf einen Stein und ruhte sich aus. Denn geschlafen hatte sie letzte Nacht nur wenig. Und die Aussicht auf einen langen Fußmarsch weckte in ihr nicht die Lebensgeister.
Eine Chance, ihr Ziel zu erreichen, hatten sie nur, wenn sie ihre knappen Wasservorräte und ihren Proviant zusammenlegten. Für einen langen Fußmarsch waren sie nicht ausgestattet, aber so könnte es funktionieren, meinten die Erwachsenen.
Sie machten sich auf den Weg in die Richtung, die der Fahrer ihnen gewiesen hatte. War das eine Straße, ein Verkehrsweg? Würden hier Fahrzeuge vorbeikommen, die sie sogar mitnehmen würden? Oder mussten sie vorsichtig sein, sich hinter Felsen verstecken, wenn sie ein Auto kommen sahen? Sie liefen! Stunde um Stunde. Der Tag wurde heißer und gegen Abend wieder kühler. Vor Einbruch der Dunkelheit suchten sie sich eine geschützte Stelle, an der sie die Nacht verbringen konnten.
Am Nachmittag des nächsten Tages erreichten sie Peshawar. Sie hatten es geschafft. Mit letzter Kraft. Einige ihrer Mitreisenden blieben hier in der Stadt, Frozans Familie und noch zwei andere Familien machten sich auf den Weg zum Flughafen.
Am Flughafen tauchte ein neues Problem auf. Frozans Vater hatte zwar die Flugtickets gekauft, mit denen sie die Türkei erreichen sollten. Aber wie und wo sollte man das richtige Flugzeug finden? Niemand von ihnen war jemals in seinem Leben zuvor auf einem Flughafen gewesen. Was war zu tun? Und noch etwas stellte sich heraus: Alle, mit denen sie unterwegs waren, waren Analphabeten. Niemand konnte ein Hinweisschild lesen, selbst Frozan fiel es in dieser Umgebung schwer, die Wörter auf den Anschlagtafeln zu entschlüsseln.
Sie mussten fragen und wurden geschickt: von hier nach dort und wieder zurück. Als sie endlich den richtigen Ort gefunden hatten, an dem sie einchecken konnten, war es auch höchste Zeit. Sie wurden schon aufgerufen. Doch sie hatten es geschafft. Das allein war wichtig!
Zwei Stunden später hob das Flugzeug ab Richtung Istanbul. Istanbul! Endstation? Würden sie dort bleiben? Vater nahm ihnen die Illusion, ihr Ziel schon fast erreicht zu haben. Istanbul sei nur eine Zwischenstation, Griechenland sei das nächste Ziel.
»Wieso nur das nächste Ziel, können wir nicht in Griechenland bleiben?« Für Frozan hatte ihre Flucht schon lange genug gedauert.
»Wir können es probieren«, meinte Vater, »aber sicher kann man nicht sein.«
In Istanbul mussten sie ihre Reise wieder mit einem Lkw fortsetzen, der in der Nähe des Flughafens auf sie wartete.
»Wir haben es überstanden.« Vater freute sich. Sicher wollte er ihnen mit seinen Worten Mut machen. »Wir werden jetzt zu einem Schiff gebracht, das uns nach Griechenland bringt.«
Seine Worte wirkten. Auf Frozan und auch auf ihre Schwester. Allein Mutter wollte nicht so recht daran glauben.
»Diese Schlepper haben für uns sicher einen Ausflugsdampfer vorgesehen«, meinte sie sarkastisch.
Die Fahrt mit dem Lkw war beschwerlich. Wieder ging es über Berge, wieder war es kalt und unbequem auf der harten Ladefläche. Frozan konnte kaum noch sitzen. Ihr tat alles weh. Klagen wollte sie aber nicht, denn bald würde es ihnen ja besser gehen. Sie glaubte einfach an die Worte ihres Vaters, und nach jedem Schlagloch sagte sie sie leise vor sich hin. Nach stundenlanger Fahrt hielt der Lkw an. Von einem Schiff war weit und breit nichts zu sehen, geschweige denn von einem Meer.
»Machen wir hier Rast?«, fragte Vater den Fahrer, aber der forderte sie schon auf abzusteigen. Auf der einen Seite des Weges erstreckte sich das Festland, auf der anderen Seite ein Sumpfgebiet.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: