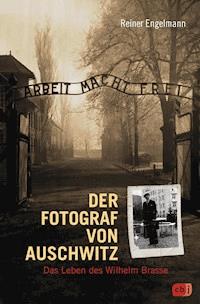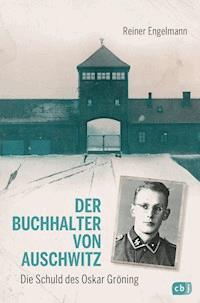6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wer Überlebende des Holocaust trifft, spürt den Abgrund, der sie von anderen Menschen trennt. Sie waren in Auschwitz, Buchenwald, Dachau. Sie haben unsägliches Leid erfahren. Der Tod war ihr ständiger Begleiter. 70 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz gibt es nicht mehr viele Zeitzeugen. Umso wichtiger ist es, ihre Erfahrungen für die Nachwelt zu dokumentieren. Im Gedenken an die Toten, aber auch für den Frieden in der Zukunft. Damit sich die Hölle auf Erden nicht wiederholt.
Reiner Engelmann hat Max Mannheimer, Esther Bejarano, Eva Mozes Kor und sieben weitere Zeitzeugen befragt und ihre Erinnerungen für Jugendliche aufgeschrieben. Ein erschütterndes Zeugnis und ergreifendes Mahnmal wider das Vergessen. Und zugleich ein zutiefst bewegendes Plädoyer für das Leben.
Mit schwarz-weiß Fotos und ausführlichem Glossar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Reiner Engelmann
Wir haben das KZ überlebt
Zeitzeugen berichten
»Niemand kann aus der Geschichte seines Volkes austreten.Man soll und darf die Vergangenheit nicht auf sich beruhen lassen, weil sie sonst auferstehen und zu neuer Gegenwärtigkeit werden könnte.«
Jean Amery
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
„Ich habe viel Glück in meinem Leben gehabt.“
Aus dem Leben der Zeitzeugin Esther Bejarano
„Wir sind alle Menschen! Wir wollen leben!“
Aus dem Leben des Zeitzeugen Edward Paczkowski
„Ich wollte noch einmal die Sonne sehen.“
Aus dem Leben der Zeitzeugin Erna de Vries
„Erinnerung ohne Hass“
Aus dem Leben des Zeitzeugen Josef Königsberg
„Wenn wir hassen, verlieren wir. Wenn wir lieben, werden wir reich!“
Aus dem Leben der Zeitzeugin Philomena Franz
„Ich rede, damit ihr wisst, wie es damals war!“
Aus dem Leben des Zeitzeugen Heinz Hesdörffer
„Wir Slawen haben keinen Hass in uns.“
Aus dem Leben des Zeitzeugen Karol Tendera
„Ich habe den Nazis vergeben.“
Aus dem Leben der Zeitzeugin Eva Mozes Kor
„Vergebung, Versöhnung ist wichtig, aber wir dürfen nicht vergessen.“
Aus dem Leben des Zeitzeugen Tadeusz Sobolewicz
Versöhnung als Stärke.
Aus dem Leben des Zeitzeugen Max Mannheimer
Glossar
Literaturhinweise
Bildnachweis
Vorwort
Sie waren in Auschwitz und in Buchenwald, in Bergen-Belsen und in Ravensbrück. Sie waren in Theresienstadt und in Dachau, in Westerbork und in Sachsenhausen-Oranienburg. Sie waren im Warschauer Ghetto und in Schwarzheide, in Flossenbürg, in Mülsen und in Groß-Rosen. Einige wurden, bevor sie in ein Konzentrationslager kamen, in Gefängnisse eingesperrt, andere wurden nach Deutschland verschleppt und mussten als Zwangsarbeiter in der Rüstungsindustrie arbeiten.
Unabhängig von den Lagern, die sie durchlebten und überlebten, haben sie alle gleiche Erfahrungen gemacht: Sie wurden vertrieben, sie wurden gedemütigt, Hunger, Durst und Misshandlungen waren ihre ständigen Begleiter. Dem Tod waren sie oft näher als dem Leben. Manchmal waren es Zufälle, manchmal etwas Glück und manchmal auch Freunde, die sie retteten.
Mit zehn Menschen, die den Holocaust überlebt haben, habe ich gesprochen, mir ihre Geschichten angehört. Ich habe sie reden lassen, ohne viele Fragen zu stellen, denn es war ja ihr Leben, von dem sie erzählten, es waren ihre Erinnerungen, die sie preisgaben. Manchmal fließend, manchmal stockend, oft mit Tränen in den Augen. Geschichten jenseits allen menschlichen Vorstellungsvermögens. Und doch waren es Menschen, die diesen Menschen Unsägliches zugefügt haben. Mit Worten kaum zu beschreiben.
Über Jahre hinweg konnten die Opfer dieser unfassbaren Gräuel über ihre Erfahrungen nicht reden. Nach außen hin versuchten sie, ein normales Leben zu führen. Sie gründeten Familien, sie arbeiteten, sie lebten mitten in einer Gesellschaft, die nichts von ihrem Schicksal wusste oder wissen wollte. Und die Familie, der man das Unbeschreibliche hätte anvertrauen können, wollte man mit der Beschreibung der Erfahrungen in den Konzentrationslagern nicht belasten. Erst spät, manchmal nach dem Tod des Ehepartners oder aber durch andere Ereignisse, waren sie in der Lage, ihre Geschichten nach außen zu tragen.
Andererseits gab es aber auch kein wirkliches öffentliches Interesse an solchen Lebensgeschichten. Der Holocaust wurde verdrängt, aus dem Alltagsbewusstsein ausgeblendet. Die Verantwortlichen waren bei den Nürnberger Prozessen bestraft worden, damit war das Kapitel für viele abgeschlossen. Man wollte nach vorne blicken. Es sollte vorbei sein. Politisch wurde diese Haltung dadurch gestärkt, dass während der Zeit des ersten Bundeskanzlers nach dem Zweiten Weltkrieg Konrad Adenauer (1949–1963) Männer in verantwortlichen Funktionen auftauchten, wie sie sie vergleichbar während des Hitler-Regimes hatten. Und Franz-Josef Strauß forderte, ein Volk, das diese wirtschaftlichen Leistungen vollbracht habe, habe auch ein Recht darauf, von Auschwitz nichts mehr hören zu wollen.
Ein tatsächliches öffentliches Interesse an dem Schicksal dieser Menschen gab es erstmals Ende der Achtziger-, Anfang der Neunzigerjahre. Sensibilisiert u. a. durch die Ausstrahlung des Mehrteilers »Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiß«, begann man öffentlich, sich dieser Zeit anzunähern, in Schulen fand das Thema einen breiteren Raum. Erste Zeitzeugen wurden eingeladen, um vor Schülerinnen und Schülern zu reden.
Heute leben nicht mehr sehr viele Menschen, die das Grauen überlebt haben, um darüber zu reden. Aber wir brauchen ihre Geschichten, jetzt und in Zukunft noch mehr, wenn die Überlebenden nicht mehr unter uns sein werden. Wir brauchen sie nicht, um neu anzuklagen oder zu verurteilen. Wir brauchen sie als Erinnerung für die Zukunft. Für unsere Zukunft. »Nie wieder Konzentrationslager, nie wieder Faschismus, nie wieder Unterdrückung und Erniedrigung!«, mahnen sie gemeinsam und haben über ihre Erfahrungen geredet, sie uns als Botschaften anvertraut. An uns liegt es nun, das zu erkennen und zu handeln.
Reiner Engelmann, März 2015
„Ich habe viel Glück in meinem Leben gehabt.“
Esther Bejarano mochte die Arbeit in ihrer Boutique. Die Kinder waren erwachsen, gingen ihre eigenen Wege. Ihr Mann Nissim hatte, nach einer Umschulung, eine Stelle als Feinmechaniker und sie ihren Laden in Eimsbüttel. 1972 hatte sie die Boutique eröffnet. Sie freute sich über die Kontakte, die sich durch ihre Arbeit ergaben. Es waren viele junge Menschen, die bei ihr einkauften. Über Alltägliches redeten sie miteinander, manchmal aber auch über politische Fragen. Sie mochte die Offenheit der Menschen. Über ihre Vergangenheit hatte sie bis dahin noch nicht gesprochen. Nur so viel eben, wie man von außen wahrnahm: Kinder, Familie, Beruf. Aber auch mit ihren Kindern hatte sie nie über die Vergangenheit gesprochen. Sie wollte die Familie schützen, sie nicht mit ihrer Geschichte belasten. Nicht mal mit ihrem Mann, der zwar über diese Vergangenheit etwas wusste, bei Weitem aber nicht alles, redete sie über dieses Thema. Auch er fragte sie nicht, aus Rücksicht. Er glaubte, seine Fragen würden alte Wunden aufreißen. Sollte sie nun, da die Kinder erwachsen waren und sie mit manchen Kunden einen persönlichen Kontakt über das Geschäftliche hinaus hatte, anfangen zu reden, zu erzählen, was sie erlebt hatte? Wo die Menschen doch sicher vieles über die Zeit zwischen 1933 und 1945 wussten. Diese Frage beschäftigte sie.
Es war schließlich ein konkretes Ereignis, das bei Esther Bejarano die Mauer des Schweigens brach.
An einem Morgen im Jahr 1979 wurde direkt vor ihrer Boutique ein Informationsstand aufgebaut. Sie ging vor die Tür, um nachzusehen, wer da Flugblätter und Informationsbroschüren verteilte. Mit einem Blick stellte sie fest, dass es die NPD war, die hier auf sich aufmerksam machte, Sympathisanten und Mitglieder gewinnen wollte für ihre ausländerfeindlichen und antisemitischen Parolen.
Das kannte Esther zur Genüge. So hatte es schon einmal angefangen. In den Zwanziger und Dreißigerjahren. Und es hatte mit einem furchtbaren Krieg und mit Auschwitz geendet.
Es hatten sich aber nicht nur ein paar NPD-Leute vor ihrem Geschäft versammelt, es gab auch eine Gegendemonstration.
Esther Bejarano schaute zu den überwiegend jungen Menschen hin, die Transparente trugen mit Slogans wie »Nie wieder Krieg« oder »Nie wieder Faschismus«. Sie freute sich über die Sätze und das Engagement der jungen Leute.
Doch zwischen den beiden Gruppen stand ein Aufgebot von Polizisten. Esther Bejarano sah, wie sie Demonstranten festnahmen und in die bereitstehenden »grünen Minnas« abführten.
»Was machen Sie denn da?« Mit dieser Frage ging sie auf einen Polizisten zu. »Sie verhaften die falschen Leute! Wen schützen Sie denn? Etwa die da?« Sie zeigte auf den NPD-Stand. »Das sind doch die, die Deutschland schon einmal Unglück gebracht haben! Und die schützen sie?«
Sie hatte den Polizisten am Revers gepackt und lautstark auf ihn eingeredet.
Der Polizist forderte sie auf: »Gehen Sie wieder in Ihre Boutique oder ich muss Sie verhaften!«
Esther Bejarano schaute dem Polizisten in die Augen.
»Sie können mich ruhig verhaften«, sagte sie mit fester Stimme, »ich bin Schlimmeres gewöhnt. Ich war in Auschwitz!«
Darauf empörte sich einer der NPD-Männer und forderte den Polizisten auf: »Die müssen sie verhaften! Die war in Auschwitz! Alle die, die in Auschwitz waren, sind Verbrecher!«
Das war für Esther Bejarano zu viel!
Jetzt muss ich etwas tun, beschloss sie.
Rache
Ich muss mich rächen, dachte sie schon damals, als sie noch im Konzentrationslager war. Ich muss mich an den Nazis rächen, die so viel Leid über die Menschheit gebracht haben.
Wie diese Rache aussehen konnte, wusste sie damals noch nicht. Es waren auch keine Rachegedanken gegen einzelne Nazis, Rachegedanken hegte sie gegen das System.
Esther Bejarano bei einem Zeitzeugengespräch im April 2015 in der Christuskirche in Fulda
© Picture-Alliance: (dpa/Jens Büttner)
Heute weiß sie, wie diese Rache – ihre Rache gegen die Nazis – aussieht. Sie geht an Schulen, redet mit Schülerinnen und Schülern, erzählt ihnen von der Zeit, die sie durchlebt hat, von den Konzentrationslagern, die sie überlebt hat. Sie redet und singt, zusammen mit der Rapper-Band Microphone Mafia, gegen das Vergessen an, wehrt sich mit ihren Texten, Reden, Interviews und Diskussionen gegen den wieder aufkeimenden Rechtsextremismus und gegen Ausländerfeindlichkeit.
Esther Bejarano hat viel zu erzählen.
Kindheit
Am 15. Dezember 1924 wurde sie in Saarlouis als jüngste Tochter von vier Kindern geboren. Ihre Familie gab ihr den Namen Esther. Schon bald zogen die Loewys nach Saarbrücken, wo der Vater Oberkantor der jüdischen Gemeinde wurde.
Die Familie liebte die Musik. Alle vier Geschwister durften ein Instrument lernen. Esther entschied sich fürs Klavier. Eine Entscheidung, deren Tragweite sie damals noch nicht absehen konnte.
An Feiertagen hatten die Loewys häufig Besuch. Dann gab es Hauskonzerte. Und weil der Vater ein engagierter Kantor war, kamen häufig bekannte Sängerinnen und Sänger ins Haus und probten mit ihm.
Esther mochte das sehr.
Erste Anzeichen einer politischen Veränderung registrierte sie 1934. Nicht nur in Saarbrücken, sondern im ganzen Saarland, das zu dieser Zeit unter der Aufsicht des Völkerbunds stand, gab es immer mehr antisemitische Hetzkampagnen. Jüdische Kinder durften auf einmal nicht mehr zur Volksschule gehen. Stattdessen wurden jüdische Schulen eingerichtet. Auch Esther musste eine solche jüdische Schule besuchen.
Über viele Jahre hinweg hatte die Familie Loewy ein Hausmädchen beschäftigt: Käthchen. Sie organisierte den Haushalt, sie war mit der Vorbereitung der vielen Familienfeste beschäftigt, man konnte sie aber auch immer ansprechen, wenn man Probleme hatte. Sie war einfach da, lebte mit den Loewys, gehörte dazu.
Als 1935 das Saargebiet nach einer Volksbefragung dem Deutschen Reich angegliedert wurde, durfte das Dienstmädchen Käthchen plötzlich nicht mehr in der Familie wohnen. Die ersten Rassengesetze verboten das. Später war es ihr sogar verboten, überhaupt für die Familie zu arbeiten. Arier durften sich nicht in den Dienst von Juden stellen.
Weil die jüdische Gemeinde in Saarbrücken schrumpfte, brauchte der Vater eine neue Anstellung. So wurde er Rektor der jüdischen Schule in Ulm und Kantor der dortigen Gemeinde.
Obwohl sich die Situation immer mehr zuspitzte, der jüdischen Bevölkerung immer mehr Rechte und Freiheiten entzogen wurden, die Familie Loewy sogar so weit ging und die beiden ältesten Kinder ins Ausland schickte – Gerdi zu einer Tante in die USA, Tosca nach Palästina –, damit sie dort sicher waren, glaubte der Vater weiter, die politische Situation werde sich bald wieder ändern, und lehnte es ab, mit dem Rest der Familie auszuwandern.
Als am 9. November 1938 überall in Deutschland die Synagogen brannten, jüdische Geschäfte geplündert wurden und man Juden einfach verhaftete, standen die SA-Schergen auch bei den Loewys vor der Tür. Herr Loewy wollte sich seiner Festnahme widersetzen, erklärte, dass er im Ersten Weltkrieg an der Seite der Deutschen gekämpft und sogar das Eiserne Kreuz 1, die höchste deutsche Kriegsauszeichnung, bekommen habe, doch die SA-Männer brüllten ihn an: »Du Saujud, wir pfeifen auf dein EK 1, halt’s Maul, sonst kannst du was erleben!«
Er wurde mitgenommen und drei Tage ins Gefängnis gesperrt.
Zu Beginn des neuen Jahres wurde der Vater nach Breslau versetzt. Dort sollte er in der jüdischen Gemeinde arbeiten.
Esther kam in die Jugend-Aliah-Schule in Berlin. Diese Schule war ein Vorbereitungslager zur Auswanderung nach Palästina.
Zwangsarbeit
Doch zu einer Auswanderung kam es nie. Alle Vorbereitungslager in Deutschland wurden im Juni 1941 geschlossen, die Jugendlichen von der SS verhaftet und in Zwangsarbeitslager gebracht. Esther kam in das Lager Neuendorf bei Fürstenwalde. Die meisten Insassen arbeiteten außerhalb des Lagers. Morgens um sieben Uhr mussten sie anfangen und der Tag dauerte zwölf Stunden. Auf dem Weg zur Arbeitsstelle und abends wieder zurück ins Lager wurden sie von der SS bewacht.
Esther wurde im Blumengeschäft der Familie Westphal eingesetzt. Es war eines der größten Blumengeschäfte in Fürstenwalde. Mit ihrer Arbeitsstelle hatte sie Glück. Herr Westphal, der Besitzer, war nett zu ihr. Er übertrug ihr verantwortungsvolle Aufgaben. Dazu gehörte auch, dass sie Fleurop-Bestellungen entgegennehmen durfte. Sie band Kränze, richtete Blumengestecke her, musste Besorgungen im Ort erledigen, und manchmal, in den Sommermonaten, wenn das Obst auf den Bäumen reif war, nahm ihr Chef sie mit in seinen Garten, wo sie sich an all den Früchten satt essen durfte.
Im November 1941 erhielt sie eine schriftliche Aufforderung der Polizei aus Breslau, unverzüglich in die Wohnung ihrer Eltern kommen, um diese zu räumen. Die Familie sei nach Riga abtransportiert worden.
Esther erschrak, als sie feststellte, dass die Eltern ganz ohne Gepäck nach Kownow in Litauen aufgebrochen waren. Alle Koffer waren noch da und im Kleiderschrank hing die gesamte Garderobe. Dass die Eltern zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr lebten, erfuhr Esther erst viel später.
Gegen den Widerstand der Polizisten, die sie in die Wohnung der Eltern begleitet hatten, gelang es ihr, zwei Koffer mit Bettwäsche und ihren eigenen Kleidern zu packen. Auch ein paar Bilder von den Eltern konnte sie heimlich im Koffer verschwinden lassen.
Die Situation im Lager Neuendorf verschlimmerte sich. Man drohte den Jugendlichen, wenn sie ihre Arbeit nicht korrekt machten, kämen sie nach Auschwitz. Da hörte sie den Namen das erste Mal. Auschwitz. Was verbarg sich dahinter? Ein noch schlimmeres Arbeitslager?
Wenn Esther im Ort Blumen ausfuhr, traf sie gelegentlich ein älteres Ehepaar. Sie mussten, wie auch Esther zu dieser Zeit, einen Judenstern tragen. Daran erkannten sie sich. Das Ehepaar lud sie zu einem Kaffee ein und erzählte, dass fast keiner im Ort mehr mit ihnen rede, und es nur noch zwei Geschäfte gebe, die ihnen etwas verkauften. Aus allen anderen würden sie rausgejagt.
Manchmal, besonders vor den Festtagen, wenn es viel Kundschaft gab, erlaubte Herr Westphal Esther, im Laden auszuhelfen. Das ging lange Zeit gut, bis sich eines Tages ein Kunde beschwerte, es sei eine Zumutung, von einer Jüdin bedient zu werden. Daraufhin durfte Esther nur noch in den hinteren Räumen des Geschäfts arbeiten.
Und Herrn Westphal wurde gedroht: »Wenn diese Jüdin noch einmal im Geschäft steht, kommt sie nach Auschwitz und Sie werden sie dorthin begleiten!«
Anfang April 1943 wurde das Lager Neuendorf geschlossen. Für Esther war das eine herbe Enttäuschung. Sie hatte sich in dem Blumengeschäft wohlgefühlt. Herrn Westphal fand sie »klasse«, weil er nicht alle Anordnungen der SS befolgte und ihr dadurch einige Freiheiten ermöglichte. Und Frau Westphal steckte ihr gelegentlich heimlich etwas Essen zu. Die Verpflegung im Lager, das wusste die Familie, war nur sehr dürftig.
Eines Tages erfuhren die jüdischen Jugendlichen im Lager, dass sie in ein anderes Arbeitslager umsiedeln würden. Jeder dürfe einen Koffer mitnehmen.
Auf Lastautos wurden sie nach Berlin gebracht.
Auschwitz
Der Waggon war überfüllt. Nicht nur die Jugendlichen aus dem Lager in Neuendorf waren dort eingepfercht, sondern zahllose Männer, Frauen, Kinder, ganze Familien – Menschen jeden Alters. Alle waren Tage zuvor in das Sammellager Große Hamburger Straße in Berlin gebracht worden und nun saßen sie in Viehwaggons. Niemand wusste, wohin die Fahrt ging.
Zwei Tage waren sie unterwegs. Zwei Tage ohne etwas zu essen oder zu trinken. Niemand hatte etwas dabei. Zwei Tage, mit siebzig oder achtzig Menschen in dieser Enge. Zwei Tage, in denen einige ältere Menschen, die krank waren, starben.
Nirgendwo gab es eine Toilette. In einer Ecke stand ein Kübel, auf dem man seine Notdurft verrichten konnte. Jeder versuchte, den Zeitpunkt, um den Kübel aufzusuchen, so lange wie möglich hinauszuzögern. Doch irgendwann musste jeder mal zu diesem Ort, sich vor den Augen aller entleeren. Der mit Menschen überfüllte Waggon und der von Stunde zu Stunde voller werdende Kübel machten die Luft fast unerträglich.
Ab und zu hielt der Zug an. Die Gefangenen riefen den SS-Männern zu, sie sollten wenigstens für kurze Zeit die Tür öffnen, damit etwas frische Luft in den Waggon käme. Doch ihre Rufe wurden ignoriert.
Nach zwei Tagen Fahrt, am 20. April 1943, kamen sie an. Die Waggontüren wurden aufgerissen.
Esther sah einige in Zivil gekleidete Herren, die einen freundlichen Eindruck auf sie machten.
»Sie kommen jetzt in ein Arbeitslager«, erklärten die Herren. »Alte, Kranke, Gehbehinderte, schwangere Frauen und auch Mütter mit Kindern können auf eines der bereitstehenden Lastautos steigen. Sie werden ins Lager gefahren!«
Das klingt ja höflich, dachte Esther, dann wird es wohl doch nicht so schlimm werden.
»Alle anderen stellen sich in Sechserreihen auf, sie werden die Strecke zu Fuß gehen. Eure Freunde und Verwandte seht ihr nachher im Lager wieder«, wurde ihnen erklärt.
Die Gruppe setzte sich in Bewegung. Als sie das Tor des Lagers passierten, änderte sich mit einem Schlag alles. Waren sie eben noch freundlich angesprochen worden, so brüllten ihnen jetzt die SS-Männer entgegen: »Los, los, ihr Saujuden, hier werdet ihr sehen, was ein Arbeitslager ist!«
Sie wurden quer durch das Lager zu einem Gebäude getrieben, von dem sie erfuhren, es sei eine Sauna. Kaum angekommen, sollten sie sich nackt ausziehen.
Esther und auch ihre Freundinnen konnten das nicht glauben. Ausziehen? Vor den SS-Männern? Das wollten sie nicht! Sie schämten sich. Einige Gefangene, die im Raum die SS bei ihrer Arbeit unterstützten, sagten ihnen: »Ihr müsst alles tun, was man euch befiehlt, sonst seid ihr ganz schnell tot.«
Esther und ihren Freundinnen wurde klar: Sie mussten ihre Kleider ablegen. Dann mussten sie ein Stück weitergehen, und – Esther konnte es nicht fassen – ihnen wurden die Haare geschoren. Aus den Duschköpfen, unter die sie sich danach zu stellen hatten, kam nur kaltes Wasser. Mit Heißluft wurden sie getrocknet, denn Handtücher gab es nicht.
Bevor sie ihre Häftlingskleidung bekamen, mussten sie sich alle noch einmal nackt aufstellen. Hinter Tischen saßen Häftlinge, die ihnen Nummern auf den linken Unterarm tätowierten. Esther bekam die Nummer 41948.
Mein Gott, dachte sie, als sie die hohe Zahl sah, wenn das Registrierungsnummern sind, wo sind dann die anderen Menschen? Etwa alle hier in diesem Lager?
Nachdem sie ihre Häftlingskleidung bekommen hatten, wurden sie auf verschiedene Blocks verteilt. Es waren Baracken, die früher als Pferdeställe gedient hatten. Je acht bis zehn Frauen teilten sich eine Koje als Schlafplatz. Die Kojen hatten keine Matratzen, keine Decken, kein Stroh.
Den Pferden hatte man bestimmt wenigstens Stroh gegeben, ging es Esther durch den Kopf.
Esther teilte sich eine solche Koje mit einigen Freundinnen. Sie schliefen auf nackten Brettern. Es war April. Es war kalt. Überall waren Ritzen in den Barackenwänden, durch die es zog. Obwohl sie sich aneinanderkauerten, froren sie.
Im Waschraum, der ein ganzes Stück von ihrem Block entfernt lag, gab es nur kaltes Wasser. An eine richtige Körperpflege war hier nicht zu denken. Vom Waschraum ging es zur Toilette. Die bestand aus einer Stange, unter der ein Auffangbecken entlanglief. Vierzig bis fünfzig Frauen mussten die Toilette gleichzeitig benutzen, immer bewacht von SS-Männern oder -Frauen. Die Frauen waren in ihrer Brutalität oft schlimmer als die Männer, wie Esther im Laufe der Zeit herausfand.
Zum Frühstück aßen sie von dem Brot, das man ihnen am Abend zuvor ausgeteilt hatte. Dazu gab es ein Getränk, das Tee sein sollte. Was es wirklich war, konnte niemand genau erkennen. Es war einfach eine dunkle Brühe.
Nach dem Morgenappell, bei dem die Häftlinge gezählt wurden – auch die, die in der Nacht gestorben waren, mussten mitgebracht werden, der Vollständigkeit halber –, ging es zur Arbeit.
Esthers Arbeitsstelle lag außerhalb des Lagers. Auf einer Seite eines Feldes lagen dicke, schwere Steine. Diese Steine musste sie auf die andere Seite des Feldes schleppen. Den ganzen Tag. Es war mühsam. Sie plagte sich. Sie war eine schmächtige Person. Sie hatte das Gefühl, als würden die Steine immer schwerer. Aber sie schaffte es, sie hielt durch.
Am nächsten Tag musste sie die Steine wieder zurücktragen. Alle Steine, die sie am Vortag von der einen Seite auf die andere geschleppt hatte, sollten nun wieder zurückgebracht werden. Sie verstand das nicht. Hatte man keine sinnvolle Arbeit für sie?
Vernichtung durch Arbeit sei ein Motto des Lagers, erfuhr sie von anderen Mithäftlingen.
Würde sie das lange durchhalten? Sie glaubte es nicht. Tag für Tag merkte sie, wie ihre Kräfte schwanden. Kein Wunder bei dieser Verpflegung!
Hinzu kam die psychische Belastung. Täglich sah sie abgemagerte Menschen, die dem Tod näher waren als dem Leben. Sie sah die vielen Toten, die man auf einem Karren einsammelte und zum Krematorium brachte. Und zu allem Überfluss begegnete ihr auch öfter der Arbeitsführer Moll mit seinem Schäferhund. Sie hatte Angst vor dem Mann. Wie oft hatte sie schon gesehen, dass er seinen Hund auf Frauen hetzte, die er zerfleischte.
Freundinnen – Frauen, die sie kannte – fühlten sich oft diesem täglichen Grauen nicht mehr gewachsen. Sie wollten ihrem Leben lieber selbst ein Ende setzen, bevor die SS es tat, und gingen in den Draht. Esther und auch einige andere Frauen befreiten die Toten aus dem Zaun.
Sosehr Esther den Arbeitsführer Moll fürchtete, weil sie in ihm eine Bestie sah, die zu allem fähig war, so sehr verdankte sie ihm jedoch ihr Leben.
Im Mädchenorchester
Dass Esther musikalisch war, hatten die Blockältesten im Lager schnell erfahren. Für einen Kanten Brot oder ein Stück Wurst sang sie Lieder von Bach, Mozart, Schubert und anderen Komponisten.
Im Frühjahr 1943 sollte ein Orchester aus Gefangenen zusammengestellt werden – ein Mädchenorchester. Die polnische Musiklehrerin und Geigerin Zofia Czaikowska, die ebenfalls in Auschwitz gefangen war, erhielt von der Lagerleitung den Auftrag, entsprechende Musikerinnen zu suchen. Eine der Blockältesten schlug Esther und zwei ihrer Freundinnen vor. Sie meldeten sich zu dritt bei Frau Czaikowska, und auf die Frage, welches Instrument Esther spiele, antwortete sie: »Ich spiele Klavier.«
»Ein Klavier gibt es hier nicht«, war die Antwort, »aber wenn du Akkordeon spielst, kannst du im Mädchenorchester mitmachen.«
Auf einem Akkordeon hatte Esther noch nie gespielt. Sie wusste nur, dass das Instrument auf einer Seite eine Tastatur hatte wie ein Klavier.
»Ja, ich kann Akkordeon spielen«, log sie die Frau an. Sie wusste, dass es ihre Chance sein könnte, aus dem kräftezehrenden Arbeitseinsatz herauszukommen.
»Gut«, sagte Frau Czaikowska, »dann spielst du den Schlager ›Du hast Glück bei den Frau’n Bel Ami‹.«
»Aber ich habe lange nicht mehr geübt«, entgegnete Esther, »ich muss erst wieder reinkommen!«
Sie bekam die Gelegenheit, sich zurückzuziehen und sich mit dem völlig fremden Instrument zu beschäftigen. Das Wenige, was sie darüber wusste – dass nämlich ein Ton erklang, wenn man an dem Akkordeon zog –, reichte nicht, um den Schlager zu spielen. Schritt für Schritt machte sie sich mit dem Instrument vertraut. Sie musste es schaffen. Das war ihre einzige Chance. Sie steckte ihre ganze Energie hinein, und nach einiger Zeit gelang es ihr tatsächlich, das Lied zu spielen. Damit war sie im Mädchenorchester aufgenommen.
Was für eine Veränderung das für sie bedeutete! Sie konnte es kaum fassen. Sie musste nicht mehr in der großen Baracke auf Holzbrettern schlafen. Sie war nun ein Funktionshäftling und wurde zusammen mit anderen Funktionshäftlingen in der sogenannten Funktionsbaracke untergebracht. Dort gab es richtige Betten mit Matratzen und Decken und Kopfkissen und dazu auch noch Bettwäsche. Welch ein Luxus! Die Frauen, die dort untergebracht waren, arbeiteten in verschiedenen Funktionsbereichen. Sie waren Dolmetscherinnen, Schreiberinnen, Läuferinnen und arbeiteten in den Kanada-Baracken.
Für Esther war der Kontakt zu den Frauen, die in »Kanada« arbeiteten, besonders wichtig. Diese Frauen sortierten all die Dinge, die die Menschen auf ihrem Transport von der Heimat hierhin ins Lager mitgebracht hatten. Wenn auch unerlaubt, so konnte man bei ihnen doch Dinge »kaufen«, die man dringend brauchte. Die Währung bestand aus Lebensmitteln.
Esther kaufte sich einmal einen Pullover, weil sie so oft fror. Der kostete sie die Brotration einer ganzen Woche. Aber sie hungerte lieber, als zu frieren.
Als das Orchester zusammengestellt war, mussten sie einige Wochen lang Musikstücke üben.
Dann war es so weit. Sie wurden eingesetzt. Morgens, wenn die Arbeitskommandos aus dem Lager geführt wurden, mussten sie Marschmusik spielen und abends, wenn die Frauen und Männer zurückkehrten, das Gleiche.
Während ihrer Übungsstunden kamen gelegentlich ranghohe SS-Männer vorbei, um sich an der Musik zu erfreuen. Begeisterte Zuhörer waren unter anderem Josef Mengele und der Arbeitsführer Otto Moll.
Auch wenn die Züge mit neuen Häftlingen kamen, musste das Orchester spielen. Was mögen diese Menschen gedacht haben, als sie mit Musik empfangen wurden?, fragte sich Esther.
Sie und auch die anderen Mädchen im Orchester wussten, was mit den Neuankömmlingen geschehen würde. Nur wenige würde man zum Arbeiten selektieren, die meisten von ihnen würden direkt zu den Gaskammern und Krematorien geführt. Die würden noch am gleichen Tag sterben.
Für Esther war das kaum auszuhalten. Sie mussten fröhliche Musikstücke spielen für Menschen, die nicht mehr lange leben würden. Aber es blieb ihnen nichts anderes übrig, es ging auch um ihr eigenes Leben.
Nachdem Esther zwei Monate im Orchester gespielt hatte, wurde sie krank. Sie bekam Fieber, sehr hohes Fieber.
Die SS-Aufseherin, eine Frau aus Saarbrücken, die sich vielleicht auch wegen der gemeinsamen Heimat ein wenig Esther verbunden fühlte, sorgte für sie. Esther erkannte in ihr eine Frau, die anders war als die meisten ihrer Kolleginnen. Sie schrie nicht, sie schlug nicht, ja, Esther empfand ihr Verhalten geradezu als human. Diese Frau brachte Esther ins jüdische Krankenrevier von Birkenau, weil Esther ja Jüdin war. Nun wusste jeder in Birkenau, dass man aus dieser Baracke nicht mehr lebend herauskam.
In dem zweiten Krankenrevier, dem christlichen, wurde man versorgt. Hintergrund war, dass christliche Häftlinge Pakete aus der Heimat empfangen durften. Und mit diesen Schätzen, vorwiegend Lebensmitteln, wurden Häftlingsärzte und Häftlingspfleger bestochen.
Der Arbeitsführer Otto Moll, der bei den Gefangenen im Lager als »Der Henker von Auschwitz« bezeichnet wurde, Frauen und Kinder persönlich erschoss und die Leitung des Sonderkommandos in den Birkenauer Krematorien innehatte, bekam irgendwann mit, dass Esther im jüdischen Krankenrevier lag. Er befahl, Esther ins christliche Revier zu verlegen, weil sie als Akkordeonspielerin dringend gebraucht werde. Das war allerdings noch keine Gewähr dafür, nun besser versorgt zu werden, denn Esther durfte als jüdische Gefangene ja von außen keine Päckchen mit Lebensmitteln bekommen, mit denen sie Ärzte hätte bestechen können. So ging es ihr in der ersten Zeit von Tag zu Tag schlechter, sie bekam erneut hohes Fieber und in einem solchen Zustand im Krankenrevier zu liegen, bedeutete, sich im Vorraum zur Gaskammer zu befinden. Als der Arbeitsführer Otto Moll von Esthers Zustand erfuhr, befahl er der tschechischen Häftlingsärztin unter Androhung der Todesstrafe, Esther alle notwendigen Medikamente und jedwede Pflege zukommen zu lassen, damit sie wieder gesund werde. Er werde die Ärztin persönlich erschießen, sollte sie sich seinen Anweisungen widersetzen.
Nach vier Wochen war Esther gesund. Sie konnte es kaum glauben, als sie hörte, wem sie das zu verdanken hatte. Aber sie konnte wieder spielen.
Durch die Krankheit war sie sehr geschwächt und bekam irgendwann auch noch Keuchhusten und später, bedingt durch den Vitaminmangel, am ganzen Körper Furunkel. Eine Krankenschwester von der Erste-Hilfe-Station kümmerte sich um sie, legte ihr Verbände an.
An einem Morgen wurde beim Appell verkündet, dass alle, die noch arisches Blut in den Adern hätten, sich bei den Blockältesten melden sollten. Sie würden in ein anderes Lager verlegt, das kein Vernichtungslager sei.
Was sollte Esther tun? Ihre Großmutter war christlich, damit war sie ein Viertel arisch.
Doch auch andere Fragen gingen ihr durch den Kopf. Sollte sie hierbleiben, weiter im Orchester mitspielen? Als Funktionshäftling war sie relativ sicher. Oder würde man irgendwann auch sie ins Gas schicken? Sollte, ja, durfte sie ihre Freundinnen in Auschwitz zurücklassen?
Die Freundinnen waren es, die ihr zuredeten, sich auf den Transport einzulassen. Sie solle überleben, sagten sie. Später, wenn alles vorbei sei, solle sie darüber reden, was in Auschwitz geschehen sei.
Sie meldete sich für den Transport an.
Vorher mussten sich alle einer Untersuchung bei Josef Mengele unterziehen. Esther hatte Angst, er könne sie aussondern, ins Gas schicken, weil sie durch die Krankheiten so abgemagert war. Sie hatte Avitaminose, ihr ganzer Körper war übersät mit Furunkeln. Nackt stand sie vor dem Herrn über Leben und Tod und musste sein Urteil abwarten. Doch sie hatte Glück. Mengele hatte nichts zu beanstanden.
Mit siebzig weiteren Frauen ging die Fahrt in einem Zug los. Ihr Ziel war Ravensbrück, das größte Frauenkonzentrationslager auf deutschem Gebiet.
Ravensbrück
Die siebzig Frauen wurden die ersten vier Wochen in Ravensbrück unter Quarantäne gestellt. Das half ihnen, sich von all den Qualen in Auschwitz wenigstens ein wenig zu erholen. Auch Esters Furunkel heilten in dieser Zeit ab, nur einige Narben blieben zurück.
Nach vier Wochen mussten sie arbeiten. Esther wurde wieder eine körperlich extrem anstrengende Arbeit zugeteilt. Sie musste, zusammen mit anderen Häftlingsfrauen, Kohlen in Loren füllen, diese an einen festgelegten Ort schieben und wieder ausladen.
Die Arbeit war schwer. Zu schwer für die junge zierliche Frau. Lange würde sie das nicht durchstehen.
Doch dann hatte sie die Gelegenheit – oder das Glück –, sich bei den Siemens-Werken, die dort im Lager Zwangsarbeiterinnen beschäftigten, zu bewerben, und nach einer Prüfung wurde sie genommen.
Die Arbeit war leicht. Die Firma Siemens war zu jener Zeit ein bedeutendes Unternehmen in der deutschen Rüstungsindustrie. In Ravensbrück mussten die Gefangenen in Halle 4, wo Esther arbeitete, Schalter für U-Boote zusammenbauen.
Auf Vorschlag ihrer Vorarbeiterin, Frau Hintze aus Berlin, mit der sie sich gut verstand und die öfter mal Briefe von ihr mit aus dem Lager nahm, um sie unterwegs in einen Briefkasten zu werfen, lernte sie zumindest die Grundbegriffe ihrer Tätigkeit in russischer Sprache zu erklären. So konnte sie Vorarbeiterin am Arbeitstisch der russischen Zwangsarbeiterinnen werden. Aber auch die Russinnen drängten sie, die Position zu übernehmen. Sie lernte die Sprache mithilfe der russischen Frauen, sie verstand sich mit ihnen gut, und sie wusste von ihnen, dass sie besser Deutsch konnten, als sie an ihrer Arbeitsstelle in Gefangenschaft zugeben wollten.