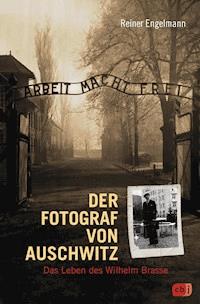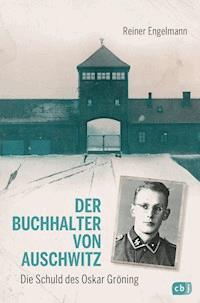6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nach einer wahren Begebenheit – stellvertretend für viele Schicksale jüdischer Jugendlichen
Simon Weiß lebt in Frankfurt, besucht das Gymnasium und ist Mitglied im Fußballverein. Soweit alles ganz normal – außer der Tatsache, dass Simon Jude ist. Für ihn ist das nichts Besonderes, doch in der Schule wird er deswegen gehänselt, drangsaliert und gemobbt. Seine Angst wird immer größer und seine Noten immer schlechter. Als Simon schließlich zur Zielscheibe zweier Mitschüler wird und die Gewalt gegen ihn eskaliert, ist die Schule überfordert. Simon muss selbst einen Weg finden, wie er mit dem Hass gegen Juden umgehen will.
Ein bewegender Coming-of-Age-Roman und gleichzeitig eine beeindruckende Befreiungsgeschichte, die unsere Gesellschaftsstrukturen kritisch hinterfragt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Reiner Engelmann
Ich bin Jude
Euer Antisemitismus ist mein Alltag
Unterrichtsmaterialien zu diesem Buch sind erhältlich unter:
www.schullektuere.de
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten,
so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung,
da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf
deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe Januar 2023
© 2023 cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Uwe-Michael Gutzschhahn
Umschlaggestaltung: Geviert GbR, Grafik & Typografie, München
Umschlagmotive © Shutterstock.com (BAZA Produktion, Juhku)
skn · Herstellung: AJ
Gesamtherstellung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-29314-7V001
www.cbj-verlag.de
Für meine Enkelkinder
Paul, Lior und Leonid,
Henri und Ella,
Milla und Edda
Vorwort
Antisemitismus ist in unserer Gesellschaft weitverbreitet. Er zeigt sich nicht nur in Anschlägen wie dem auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019. Auch wenn dahinter ein Einzeltäter steckte, fand seine Tat in sozialen Netzwerken doch großen Zuspruch. Nach dem Anschlag sagte der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland*, Josef Schuster*: »Wir erleben einen deutlich enthemmteren Antisemitismus, wie ich ihn mir vor einigen Jahren nicht hätte vorstellen können.« (Interview im Deutschlandfunk vom 27. 12. 2020.)
Antisemitismus zeigt sich in offener und versteckter Form überall in unserem Alltag. Er äußert sich verbal in Schulen, Vereinen, an Stammtischen, am Arbeitsplatz, in der U-Bahn genauso wie in der Familie.
Bei meinen Recherchen habe ich alle möglichen antisemitischen Äußerungen gefunden, von denen ich hier nur eine kleine Auswahl zitieren will:
»Was ist das für eine Judenaktion!«
»Juden zahlen keine Steuern!«
»… bis zur Vergasung!«
»Du Jude!«
»Sie sehen ja gar nicht jüdisch aus!«
»Juden reden zu oft über den Holocaust!«
»Juden sind Kindermörder!«
Diese Sätze wurden in der Öffentlichkeit geäußert, ohne dass irgendjemand von denen, die sie mithörten, reagiert hätte. Warum stoppt niemand Menschen, die solche Sätze sagen? Gehen wir der Auseinandersetzung lieber aus dem Weg? Oder erkennen wir in den Sätzen vielleicht gar nichts Antisemitisches?
Wie fühlen sich die Betroffenen, wenn sie diese Sätze hören und merken, dass niemand eingreift?
Die jüdischen Mitmenschen, mit denen ich gesprochen habe, fühlen sich in diesen Momenten schutzlos. Und sie haben Angst, sich verbal zu wehren, weil sie sich alleingelassen sehen.
Worte sind oft Vorläufer von Handlungen. Menschen, die sich in der Öffentlichkeit zu ihrer jüdischen Religion bekennen, indem sie eine Kippa tragen oder eine Kette mit dem Davidstern, werden bespuckt, angerempelt und geschlagen. Nur selten greife jemand helfend ein, erzählen sie. Und wenn, dann seien es meist Freunde oder Bekannte.
Es sind ganz unterschiedliche Gruppierungen, die die Übergriffe verüben. Mal sind es Menschen mit muslimischem Hintergrund, die hier lebende Juden für die Politik in Israel verantwortlich machen, obwohl diese überhaupt keinen Einfluss auf die israelische Politik haben.
Andere kommen eindeutig aus der rechten Szene. Sie bedauern, dass Hitler sein Werk nicht vollenden konnte. Zumindest in ihren verbalen Äußerungen möchten sie noch einmal Gaskammern errichten oder sämtliche Menschen jüdischen Glaubens nach Israel verbannen. Aber die Juden, die unter uns leben, sind Deutsche, sie haben die deutsche Staatsangehörigkeit.
Das Gedankengut des Nationalsozialismus ist leider bis in unsere Gegenwart spürbar. Die Vorurteile gegen Juden, die von den Nazis damals – von 1933 bis 1945 – der Bevölkerung eingeimpft wurden, sind nie wirklich überwunden worden. Lange wurden sie halblaut weitergeraunt, inzwischen werden sie sogar wieder lautstark skandiert.
Wenn aber, wie einschlägige Forschungsergebnisse zeigen, der Antisemitismus bis mitten in unsere Gesellschaft reicht, bedeutet das eine weitverbreitete Unkenntnis über die jüdische Religion. Woran liegt das? Warum wissen wir zu wenig, was hinter den Toren von Synagogen geschieht? Warum wissen wir zu wenig über die Feiertage, die Juden im Laufe des Jahres begehen? Warum lehnen wir ab, uns näher mit ihrem Glauben zu beschäftigen, ihn anzuerkennen?
Aus meiner persönlichen Erfahrung, nicht nur im Zusammenhang mit diesem Buch, kann ich sagen, dass es bereichernd ist, die jüdische Religion näher kennenzulernen. Ich habe immer wieder die Offenheit und Freundlichkeit der Menschen gespürt, wenn sie von ihren Festen und Bräuchen erzählten.
Juden, so habe ich während meiner Recherchen erfahren, möchten hier in Deutschland ein ganz normales Leben leben und nicht auf ihr Jüdischsein reduziert werden. Sie sind Nachbarn, Kollegen, Vereinsmitglieder und vieles mehr. Und sie haben eine Religion, die sie gerne unbeschwert ausüben wollen, so wie Christen oder Muslime auch.
Es muss ein gesamtgesellschaftliches Anliegen sein, polizeiliche Überwachungen an Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen überflüssig zu machen. Eine Utopie? Sicher! Aber nur so werden wir den Antisemitismus in unserem Land überwinden.
Wenn ich mit diesem Buch beitragen kann, dieses Ziel zu erreichen, würde mich das freuen.
Die antisemitischen Übergriffe, die ich im Buch beschrieben habe, sind nicht erdacht, sondern haben sich tatsächlich so ereignet. Die Personen der Handlungen sind frei erfunden, doch es gibt viele lebende Vorbilder für sie.
Shalom Alechem! Frieden für alle!
Reiner Engelmann, März 2022
Unfassbar!
Sein erster Weg führte ins Badezimmer. Er war erleichtert, dass niemand zu Hause war. Die Tür schloss er trotzdem ab. Sein Rücken schmerzte, das Shirt klebte ihm auf der Haut. Vorsichtig zog er es aus, stellte sich vor den Spiegel und betrachtete seinen Rücken. Überall blaue Flecken, an zwei Stellen blutete er. Dort hatte ihn die Kette getroffen. Auch das Shirt war blutig. Außer den Blutflecken entdeckte Simon noch etwas anderes auf dem Stoff: einen Aufkleber. Jetzt wurde ihm klar, was die Ursache für den brutalen Angriff gewesen war. Deshalb war er auch schon auf dem Weg zur Bushaltestelle angepöbelt worden. Wörter und Sätze, die er alle bereits gehört hatte. Einige Male hatten ihn Leute überholt und vor ihm ausgespuckt. Was war los mit diesen Menschen? Warum taten sie das?
Später im Bus hatte sich die Situation weiter zugespitzt.
»Bist du Jude?«, fragte ihn ein älterer Mann.
»Haben Sie ein Problem damit?«, hatte Simon dagegengehalten.
»Willst wohl noch frech werden, du Scheißjude!«
Im Nu hatte der Mann einige Fahrgäste auf seiner Seite, meist Jugendliche, die Simon nicht kannte. An der nächsten Haltestelle drängten sie ihn aus dem Bus, umzingelten, beschimpften und bespuckten ihn, dann folgten die Schläge. Zunächst mit Fäusten, die Simon noch halbwegs abwehren konnte, bis einer eine Kette aus seiner Jackentasche zog und ihm damit auf den Rücken schlug. Simon schrie auf, ließ sich zu Boden fallen und spürte noch ein paar Fußtritte. Plötzlich war alles still. Er hob den Kopf, schaute sich um, Menschen gingen an ihm vorbei. Das Aufstehen fiel ihm schwer, er hatte Schmerzen.
Der Zettel, der auf seinem Shirt klebte, erklärte alles. Ich bin Jude!, stand dort. Wer konnte das gewesen sein? Wann war das passiert? Auf dem Weg zum Bus? Eher nicht. In der Schule? Bei welcher Gelegenheit hatte ihm jemand den Zettel angeklebt? Nach dem Unterricht hatte es auf dem Flur kurz ein Gedränge gegeben. Vielleicht da?
Simon schaute auf seine Uhr. Es war erst früher Nachmittag. Direktor Schneiderjahn war um diese Zeit sicher noch in der Schule. Schnell zog er sich ein frisches T-Shirt an, das blutverschmierte mit dem Aufkleber steckte er in eine Tasche und machte sich auf den Weg.
»Was willst du denn schon wieder?«, herrschte Schneiderjahn ihn an, als Simon unaufgefordert in sein Büro trat.
Simon griff in die Tasche, zog das Shirt heraus und legte es auf den Schreibtisch des Direktors.
»Was soll das? Pack das schmutzige Ding weg!«
»Ich möchte, dass Sie sich das anschauen!«, forderte Simon Schneiderjahn auf.
»Ich sehe nur ein verschmutztes Shirt, das du jetzt sofort wieder in deine Tasche steckst!«
»Sehen Sie nicht den Aufkleber?«
»Und? Was soll das?« Schneiderjahn wirkte verlegen.
»Das hat mir jemand unbemerkt auf meinen Rücken geklebt und so bin ich zur Bushaltestelle gelaufen und verprügelt worden!«
»Was habe ich damit zu tun?« Schneiderjahns Kopf wurde rot vor Wut.
»Diesen Zettel hat mir jemand hier in der Schule auf den Rücken geklebt!«
»Das war sicher nur ein dummer Scherz!« Schneiderjahn versuchte zu lächeln. Sein Gesicht glich eher einer Fratze.
Simon drehte sich um und zog sein T-Shirt hoch.
»War das auch nur ein dummer Scherz?«, fragte er.
»Was soll ich deiner Meinung nach jetzt tun? Wenn du sicher bist, dass das hier in der Schule passiert ist, dann bring mir die Schuldigen, damit ich sie bestrafe.«
»Es gibt hier an der Schule ein Problem mit Antisemitismus! Und Ihnen fällt wieder nichts anderes ein als Strafe, was? Tun Sie endlich was! Es ist höchste Zeit!!«
Bevor Schneiderjahn etwas antworten konnte, hatte Simon das Büro schon verlassen.
Simon
Simon Weiß hat sich in sein Zimmer zurückgezogen. Er will allein sein, braucht Zeit zum Nachdenken.
Ein paar Monate bleiben ihm noch an der Schule, diese Zeit muss er nutzen, um eine Entscheidung zu treffen. Er ist unsicher. Gehen oder bleiben? Fliehen oder standhalten? Doch wohin fliehen? Wo wäre er sicher? Zumindest sicherer als in dieser Stadt? In seiner Heimat Frankfurt.
Wann ist für mich die Grenze erreicht, an der ich sage, es geht nicht mehr? Das ist die zentrale Frage.
Es ist für ihn immer schwerer geworden, ein ganz normales Leben zu leben. Simon Weiß will öffentlich zeigen können, dass er Jude ist. Dazu gehört als äußeres Zeichen, dass er, wann immer er möchte, auch außerhalb seines Zuhauses eine Kippa tragen kann oder die Kette mit dem Davidstern, die er zu seiner Bar Mizwa bekommen hat.
Er weiß, das sind Äußerlichkeiten, nur Symbole seiner Religion. Aber wenn er sie zeigt, wenn er den Davidstern offen trägt, wird er beleidigt, verspottet, bespuckt, ausgegrenzt, sogar geschlagen. Das hat er oft erlebt, zu oft!
Die Kippa setzt er schon lange nicht mehr auf und die Kette mit dem Davidstern versteckt er unter seinem Shirt. Das ist für ihn zu einem Automatismus geworden, bevor er das Haus verlässt.
Trotzdem wird er als Jude erkannt, seit er sich in der Schule geoutet hat. Manche zeigen ihm den Hitlergruß, andere faseln irgendwas von »Vergasung«, und wieder andere, vor allem Muslime, sehen in ihm den Israeli und damit den Feind. Simon kennt Israel, er war schon ein paar Mal dort, doch er ist Deutscher. Er ist in Frankfurt geboren, in Frankfurt aufgewachsen und zur Schule gegangen, er hat hier Freunde gefunden, einen Fußballverein, für den er spielt.
Die Anfeindungen gegen ihn haben vor ein paar Jahren nach seinem Wechsel von der jüdischen an eine staatliche Schule begonnen und nie mehr aufgehört. Manchmal glaubt er, sie haben sich noch verstärkt, vor allem die Beleidigungen hinter seinem Rücken. Sie richten sich nicht nur gegen ihn, sondern gegen die gesamte jüdische Bevölkerung in Deutschland. Deutlich wird ihm das besonders dann, wenn es im Nahen Osten zu Krieg und Gewalt kommt. Dann ziehen muslimische Gruppen demonstrierend durch die Städte und fordern die Vernichtung Israels.
Wird er in diesem Land, das ja sein Land ist, sicher leben können? Ist Frankfurt für ihn ein sicherer Ort?
Die zuständigen staatlichen Stellen sorgen dafür, dass jüdische Einrichtungen von der Polizei bewacht werden. Auf den ersten Blick gibt das Simon tatsächlich ein Gefühl von Sicherheit. Die Polizei steht bereit, damit nichts passiert. Zum Glück, und doch kommen in ihm bei dem Gedanken Zweifel auf. Christliche Kirchen und staatliche Schulen brauchen keine Bewachung. Es gibt also eine Bedrohung, die sich allein und ganz generell gegen Juden und ihre Einrichtungen wendet, nicht nur gegen ihn persönlich.
Wird es, wenn die Entwicklung in Deutschland so weitergeht, ausreichen, nur die Gebäude zu bewachen? Wird irgendwann auch Personenschutz nötig sein? Müsste es den nicht eigentlich jetzt schon geben?
In seiner Heimatstadt Frankfurt gibt es Bezirke, die für ihn und jeden anderen jüdischen Bürger No-go-Areas geworden sind. Auf wie viel Freiheit ist er bereit zu verzichten, um hier leben zu können? Kann er das? Will er das? Sieht er Chancen, dass sich etwas verändert oder sogar verbessert? Nicht nur für ihn, sondern auch für die anderen Mitglieder der jüdischen Gemeinde? Simon Weiß hat Zweifel.
An der Pinnwand über seinem Schreibtisch hängt die Kopie eines Briefes von seinem Urgroßvater, den dieser im Jahr 1938 schrieb. Darin heißt es: »Unsere Koffer standen immer bereit. Jederzeit könnten wir sie packen und ausreisen. Wir hatten aber die Hoffnung, alles würde sich beruhigen, besser werden. Wir lebten doch in einem zivilisierten Land, unter gebildeten und zivilisierten Menschen. Das war unsere Vorstellung. Mit dem, was in der Nacht vom 9. auf den 10. November passiert ist, hatten wir nicht gerechnet. Jetzt ist es zu spät. Wir sitzen in der Falle und haben keine Möglichkeit, uns zu befreien.«
Simon kennt die Geschichte seiner Urgroßeltern.
An einer anderen Stelle des Briefs schrieb der Urgroßvater, dass es am Anfang lediglich Pöbeleien von einzelnen Bewohnern aus der Nachbarschaft und auf der Straße gab, doch im Laufe der Zeit hätten sich immer mehr Menschen beteiligt. Die Stimmung gegen die jüdische Bevölkerung sei von der Partei angeheizt worden. Dann folgten die Einschränkungen. Deutsche sollten nicht mehr in jüdischen Geschäften kaufen, Juden durften nicht mehr während der üblichen Geschäftszeiten ihre Besorgungen machen.
Simon weiß das, er hat in vielen Büchern darüber gelesen und auch mit Menschen gesprochen, die das am eigenen Leibe erlebt hatten.
Sind wir wieder da, wo meine Urgroßeltern in den frühen Dreißigerjahren des letzten Jahrhunderts gestanden haben? Die Vorstellung macht Simon Angst.
Er beruhigt sich damit, in einem demokratischen Staat zu leben. Erschreckend findet er aber, dass sich der Antisemitismus trotzdem wieder ausbreitet, und zwar in allen Bevölkerungsschichten. Bei vielen Deutschen macht sich eine Schlusspunkt-Mentalität breit. Zunehmend hört er, das Thema Holocaust gehöre endgültig der Vergangenheit an. Gleichzeitig werden Juden plötzlich wieder wie damals für alle möglichen Probleme und Missstände verantwortlich gemacht – zum Beispiel für die Ausbreitung der Corona-Pandemie. Bei Wahlen hängt eine rechtsgerichtete Partei ihre Plakate offenbar ganz bewusst in der Nähe von Häusern auf, von denen bekannt ist, dass dort Juden wohnen. »GASGEBEN!«, steht in großen Buchstaben auf den Plakaten.
Simon Weiß kann nicht mehr anders, als sich zu fragen: Wo ziehe ich für mich Grenzen, ab wann sage ich, dass es nicht mehr geht? Wo werde ich leben? In dieser Stadt? In diesem Land? Welche Alternative gibt es für mich? Er braucht Zeit zum Nachdenken, auch über früher, als für ihn noch alles in Ordnung schien. War wirklich alles in Ordnung?
Schabbat
Viele Jahre lang war der Schabbat für Simon Weiß der Höhepunkt der Woche gewesen. Er freute sich darauf, mit den Eltern und seiner jüngeren Schwester Charly zur Synagoge zu gehen, dort zu singen und zu beten. Er freute sich, anschließend mit der Familie und manchmal auch mit Verwandten oder Freunden den Abend und den nächsten Tag zu verbringen. Sobald der Schabbat begann, wurde es ruhiger in der Familie. Sowohl für die Vorbereitungen als auch für den Abend selbst gab es immer einen festen Ablauf. Die Vorbereitungen zum Schabbat waren Familiensache. Er und Charly räumten ihre Zimmer auf, abwechselnd mal mit dem Vater, mal mit der Mutter bereiteten sie dann das Abendessen zu, und danach zogen sie ihre festliche Kleidung an.
Während sein Vater mit den Kindern in der Synagoge war, deckte die Mutter den Tisch. Zwei weiße Kerzen gehörten dazu, Geschirr, Besteck, die Challot*, das besondere Brot für den Schabbat, das sie für diesen Abend gebacken hatte, sowie das Essen und die Getränke für das anschließende Festmahl.
Niemand musste mehr aus dem Haus, um irgendetwas zu erledigen. Fernseher, Radio, Computer und andere elektronische Geräte blieben ausgeschaltet, so wie es für diese Zeit vorgeschrieben war. Simon verschickte, bevor sie sich auf den Weg zur Synagoge machten, schnell noch eine SMS an seine Freunde und wünschte ihnen einen schönen Schabbat. Danach schaltete er das Handy aus.
Simon liebte auch das immer wiederkehrende Ritual des Abends: Sobald alle am festlich gedeckten Tisch versammelt waren, wurden zwei weiße Kerzen angezündet. Über dem Tisch, der mit dem einen Ende an der Wand des Esszimmers stand, hingen in alten wuchtigen Holzrahmen ein Foto der Urgroßeltern und eines der Großeltern väterlicherseits. Auch wenn sie nicht mehr lebten, waren sie so doch immer beim Schabbat dabei.
Von den Eltern der Mutter gab es auch Fotos, doch die klebten in verschiedenen Alben. Selbst als sie noch lebten, hatten Simon und seine Eltern nicht viel Kontakt zu ihnen gehabt. Sie waren dagegen gewesen, dass ihre Tochter zum Judentum übertrat.
Sobald die Familie am Tisch saß, sprach der Vater den Segensspruch, zunächst über die Kerzen, die als Symbol für das Licht stehen:
»Gelobt seist du, Herr unser Gott, König der Welt,
der du uns geheiligt durch deine Gebote und uns befohlen hast, das Schabbat-Licht anzuzünden, …«
Danach folgte die Segnung des Weins:
»… der die Frucht des Weinstocks erschafft …«
und schließlich vor dem Verzehr des Weißbrots:
»… der das Brot aus der Erde hervorbringt.«
Schließlich segnete der Vater seine beiden Kinder, indem er Gott bat, sie immer zu beschützen.
Nach all diesen Segnungen wurde das Lied »Shalom Alechem« gesungen:
»Wir wollen Frieden für alle,
wir wollen Frieden für alle,
wir wollen Frieden für alle,
wir wollen Frieden, Frieden,
Frieden für die ganze Welt.«
Auf Hebräisch:
»Havenu shalom alechem
Havenu shalom alechem
Havenu shalom alechem
Havenu shalom alechem
Shalom alechem.«
Dann brach der Vater das Brot in Stücke, bestreute sie mit Salz und reichte sie reihum. Langsam und bedächtig kauten alle. Die Erwachsenen tranken Wein, die Kinder Traubensaft. Hinterher aßen sie das, was sie tagsüber für den Abend vorbereitet hatten.
Nach dem Abendessen versammelte sich die Familie im Wohnzimmer und sie spielten oder redeten miteinander. Simon genoss es, dass sie eine ungestörte Zeit miteinander verbringen konnten. Kein Telefon klingelte, kein Fernseher lief, und es spielte auch keine Musik.
An einem dieser Schabbat-Abende – Simon war damals schon in der dritten Klasse – hatte er seinen Vater gefragt, wieso es in der Schule oft Terroralarm gebe. Das Wort war an dem Morgen gerade wieder über die Lautsprecheranlage ertönt.
Nach der kurzen Durchsage der Schulleitung hatten sie die Tür und die Fenster des Klassenzimmers abschließen und die Vorhänge zuziehen müssen, dann mussten alle Schülerinnen und Schüler unter ihre Tische kriechen, und niemand durfte in der Nähe des Fensters bleiben.
Simon und die anderen Kinder in der Klasse hatten das schon oft mitgemacht. Für sie war es eher ein spannendes Spiel, ohne dass sie den Sinn des Ganzen begriffen. Aber einige Kinder hatten auch Angst, das spürte Simon. Deshalb fragte er jetzt.
»Weißt du«, begann sein Vater, »niemand möchte, dass euch etwas Schlimmes passiert. Deswegen müsst ihr manchmal Dinge tun, die ihr noch nicht richtig versteht.«
»Was soll uns denn passieren, Papa?«, bohrte Simon nach. »Wieso müssen wir die Türen abschließen, wieso müssen wir unter die Tische kriechen?«
»Manchmal gibt es böse Menschen, die mit Pistolen oder Gewehren einen Überfall auf Schulen machen. Und damit euch in so einem Fall nichts passiert, müsst ihr vorbereitet sein. Deshalb sind die Übungen notwendig.«
»Was sind das für Menschen, die eine Schule überfallen? Passiert das oft?«
»Nein«, antwortete sein Vater. »Es passiert nur ganz selten, eigentlich fast nie.«
»Und dafür müssen wir unter die Tische kriechen?« Simon merkte, dass mehr dahinterstecken musste.
»Es könnte aber etwas passieren … manchmal gibt es eben Menschen, die sich schreckliche Dinge einfallen lassen und in die Tat umsetzen.«
»Gibt es an allen Schulen Terroralarm? Müssen sich alle Kinder verstecken? Manchmal haben Kinder ja auch Angst, wenn so eine Durchsage kommt.«
»Nein, nicht an allen Schulen gibt es diesen Terroralarm«, erklärte der Vater. »Nur an deiner.«
»Wieso nur bei uns?«
»Du gehst eben auf eine besondere Schule. Es ist eine jüdische Schule, wo fast nur jüdische Kinder hingehen. Es gibt Menschen in unserem Land, die haben etwas gegen jüdische Menschen. Die hätten am liebsten, wir wären gar nicht hier.«
»Wieso? Wir wohnen doch hier, das ist doch unser Zuhause!«
»Mach dir keine Sorgen«, versuchte sein Vater ihn zu beruhigen. »Wir werden ganz gut beschützt. Schau, du wirst morgens mit einem Bus vor der Haustür abgeholt und zur Schule gebracht, und mittags bringt er dich wieder nach Hause. Der Bus fährt sogar bis in den Innenhof der Schule, sodass euch niemand sehen kann. Du musst keinen Schritt laufen, der ganze Weg ist sicher.«
»Werden wir deshalb zur Schule gefahren, damit wir sicher ankommen?« Simon hatte das bislang nie so betrachtet. Für ihn war es bloß bequem. »Bedrohen uns diese Leute nur deswegen, weil wir jüdisch sind?«
Sein Vater nickte. »Ja, so kann man das sagen. Aber hab keine Angst, es wird schon nichts passieren. Wir müssen einfach nur vorsichtig sein.«
Das Gespräch mit seinem Vater blieb Simon noch lange im Kopf. Die Antworten, die er bekommen hatte, waren unvollständig, das merkte er. Aber sein Vater wollte nicht länger darüber sprechen.
Was ist so schlimm daran, Jude zu sein? Diese Frage beschäftigte Simon in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder. Er fühlte sich wohl mit seiner Religion, konnte sich gar nicht vorstellen, einer anderen Religion anzugehören. Aber er wusste auch zu wenig von anderen Religionen und ihren Bräuchen.
Er wusste nur, dass es den Sonntag gibt, der für die Christen wichtig ist. Der war ja auch fast vergleichbar mit dem Schabbat.
Doch eine Frage beschäftigte ihn noch mehr: Was war mit seinen Urgroßeltern und Großeltern? Oft betrachtete er die Fotos, die an der Wand hingen. Er wollte herausfinden, wem er ähnlich sah, dem Opa oder der Oma? Oder etwa seinem Urgroßvater? Er konnte sich nicht festlegen. Aber was war mit ihnen? Warum gab es um ihr Leben so ein Geheimnis? Was wusste er über sie? Dass sie verschleppt wurden und in einem Lager leben mussten. Dass sie dort gearbeitet hatten. Dass Opa und Oma damals noch Kinder waren. Aber was war das für ein Lager gewesen? Und warum hatten sie dort hingemusst? In seiner Familie wurde darüber nie gesprochen. Warum nicht? Die Eltern redeten doch auch über andere Menschen?
Viele Wochen vergingen, bis Simon an einem Schabbat-Abend nach der Geschichte seiner Großeltern und Urgroßeltern fragte. Es hatte ihm keine Ruhe gelassen, er musste es einfach wissen.
Die Eltern schauten sich an. Wie sollten sie reagieren? Sollten sie an einem Schabbat-Abend, an dem sie ausruhen und die Seele baumeln lassen wollten, ihrem Sohn die Wahrheit sagen? Die ganze unbequeme Wahrheit, die sie selbst nicht verstanden? Die niemand verstehen konnte, weil sie so unvorstellbar war?
»Lass uns ein andermal drüber reden«, bat die Mutter, »heute Abend sind wir einfach müde, und wenn wir jetzt anfangen, dann wird es sicher sehr, sehr spät.«
»Ich mache dir einen Vorschlag«, lenkte sein Vater ein. »Wir beide gehen demnächst mal zum Main, da hatte dein Opa einen Lieblingsplatz. Schon als Kind habe ich oft dort mit ihm gesessen. Wir haben den Schiffen zugeschaut, er hat mir Geschichten erzählt, manchmal hatte er auch eine Zeitung dabei, ich ein Buch. Viele schöne Stunden haben wir dort zugebracht. Aber dort hat mir mein Vater auch seine Geschichte und die seiner Eltern erzählt. Einverstanden?«
Simon fand es zwar schade, dass sie nicht gleich reden konnten, aber er stimmte dem Vorschlag zu.
Opa
Nach dem Schabbat, an dem sie über den Terroralarm in der Schule gesprochen hatten, vergingen Wochen, ohne dass Herr Weiß sein Versprechen einlöste.
Über die Großeltern wurde in der Familie fast nie gesprochen, auch nicht über die Urgroßeltern. Warum eigentlich? Was gab es zu verbergen? Gab es Geheimnisse, über die man nicht sprechen durfte, auch nicht in der Familie? Simon verstand das nicht.
Das wenige, was er vom Leben seiner Großeltern wusste, hatten seine Eltern irgendwann einmal kurz erzählt. Oma Miriam und Opa Georg hatten sich nach dem Krieg kennengelernt und im Dezember 1959 geheiratet. Opa war Justizangestellter beim Amtsgericht der Stadt gewesen, Oma Lehrerin. Und sie hatten drei Kinder bekommen: Aaron, Simons Vater, Hannah, die jüngere Schwester, und Elias, den Nachzügler, wie er immer genannt worden sei. Während einer Urlaubsfahrt waren die Großeltern beide bei einem Verkehrsunfall gestorben.
Simon hatte aber nie etwas über ihre Kindheit und Jugendzeit gehört und auch nicht darüber, wie und wo sie den Krieg überlebt hatten. Er wusste, dass es jüdischen Menschen in dieser Zeit nicht gut gegangen war. Aber was das hieß, davon hatte er keine Vorstellung. Ihm ging es auch manchmal nicht gut. Konnte man das miteinander vergleichen?
Als er schon glaubte, sein Vater hätte das Versprechen vergessen, kam er an einem sonnigen Sonntagnachmittag auf Simon zu und legte ihm die Hand auf die Schulter.
»Wenn du heute Nachmittag nichts anderes vorhast, könnte ich dir die Geschichte deines Großvaters und deiner Urgroßeltern erzählen.«
Simon schaute aus dem Fenster, sah den strahlend blauen Himmel und wünschte sich einen Regentag für die Erzählung. Bei diesem Wetter den ganzen Nachmittag drinnen zu hocken, darauf hatte er wenig Lust. Andererseits …
Der Vater schien seine Gedanken zu lesen.
»Wir werden an den Main gehen, dort gibt es einen Platz, an dem wir reden können. Davon hatte ich dir ja schon erzählt.«
»Hier, auf dieser Bank habe ich vor vielen Jahren mit deinem Opa, meinem Vater, gesessen«, begann er schließlich, nachdem sie erst mit dem Bus durch die Stadt gefahren und dann das letzte Stück am Main entlanggelaufen waren. »Hier, genau an dieser Stelle, hat mein Vater mir zum ersten Mal alles erzählt, was ihm widerfahren ist, als er noch ein Kind war und Adolf Hitler* in Deutschland die Macht hatte.«
Simons Vater räusperte sich und schaute lange dem Schiff nach, das langsam auf dem Main an ihnen vorbeiglitt.
»Ich weiß nicht so recht, wie ich anfangen soll«, sagte er dann. »Es ist nicht leicht, darüber zu reden, aber das wirst du gleich merken.«
Wieder schaute er lange zum Fluss hinunter.
»Die Familie Weiß wohnt schon seit vielen Generationen hier in der Stadt. Unsere Vorfahren waren Ärzte, Lehrer, es gab sogar mal einen Professor für Mathematik in der Familie, und deine Urgroßeltern hatten ein Textilgeschäft. Sie hießen Clara und Ferdinand. Über dem Eingang ihres Geschäfts hing ein großes Schild: Textilhaus Weiß stand darauf. Deine Urgroßeltern waren sehr stolz auf ihren Laden. Viele reiche Frankfurter kamen dorthin, kauften edle Stoffe und ließen sich von einem Schneider Kleider und Anzüge nähen. Aber auch weniger reiche Menschen gehörten zu den Kunden, Leute, die sich ihre Kleidung selbst nähen mussten, weil sie sich keinen Schneider leisten konnten. Deine Urgroßmutter, meine Oma Clara, war eine gute und hilfsbereite Geschäftsfrau. Sie konnte ihre Kundinnen sehr gut beraten, und wenn sie merkte, dass eine unsicher war, weil sie nicht wusste, wie man aus einem Stück Stoff ein Kleid oder eine Hose näht, bot sie an, mit ihr gemeinsam im Nebenraum, wo auch eine Nähmaschine stand, zunächst den Stoff zuzuschneiden und danach beim Nähen behilflich zu sein.
Das Geschäft florierte und von ihrem Verdienst konnten deine Urgroßeltern gut leben. Sie konnten ins Theater gehen, sie besuchten Restaurants, hatten einen großen Freundeskreis, mit dem sie Feste feierten, sie konnten sich Urlaubsreisen leisten und hatten ein Hausmädchen, das für den Haushalt, aber auch für die Kinder zuständig war. Irene hieß sie. Sie war jung, hübsch und besonders bei den Kindern, also bei meinem Vater und seiner Schwester, sehr beliebt. Ja, mein Vater hatte noch eine Schwester. Margarete hieß sie. Von allen wurde sie immer nur Gretel gerufen. Sie ist auch immer dieses kleine Mädchen geblieben. Warum, das erkläre ich dir später. Jedenfalls hätte das Leben so weitergehen können, wenn nicht …«
Mitten im Satz brach er ab.
»Was ist, Papa«, fragte Simon, als er merkte, dass sein Vater in Gedanken versunken war. »Warum erzählst du nicht weiter?«
Herr Weiß sah seinen Sohn mit traurigen Augen an.
»Das, was dann 1933 passierte, das ist so unfassbar, dass man es kaum beschreiben kann.«
Wieder machte er eine Pause, bevor er weitersprach.
»In dem Jahr kam hier in Deutschland ein Mann an die Macht, der von Anfang an etwas gegen uns Juden hatte: Adolf Hitler. Er hatte eine große Gefolgschaft, die Menschen jubelten ihm zu. Endlich hatte Deutschland wieder einen starken Führer, nachdem es in den Jahren zuvor oft zu Regierungswechseln gekommen war. Für alles, was nicht gut im Land war, machte Hitler die Juden verantwortlich. Davon hat er schließlich viele Menschen überzeugt. Sie glaubten ihm.«
»Ich weiß«, sagte Simon, »seinen Namen habe ich schon gehört. Doch das, was er gemacht haben soll, hab ich nicht verstanden.«
»Wenige Monate nachdem Adolf Hitler an der Macht war, ordnete er an, dass niemand mehr in jüdischen Geschäften einkaufen durfte. Überall vor den Geschäften standen uniformierte SA-Männer* mit Plakaten: ›Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!‹ Am 1. April 1933 trat die Verfügung in Kraft. Seit 1924 hatte die Partei von Adolf Hitler, die NSDAP*, Männer bewaffnet, die die Befehle des Führers in den Städten durchsetzen sollten. Diese Männer gehörten zur Sturmabwehr oder SA*, wie sie genannt wurde. Die stand nun mit ihren Plakaten vor den Läden und hinderte Menschen daran, bei Juden einzukaufen. Das hatte natürlich Folgen für deine Urgroßeltern, meine Großeltern. Sie hatten plötzlich viel weniger Einnahmen. Manchmal kamen trotzdem noch Kunden, die sich über die Anweisungen hinwegsetzten. Ansonsten waren es aber nur noch einige jüdische Familien, die bei ihnen einkauften. Du kannst dir ja vorstellen: Irgendwann hatten aber auch die genügend Kleider und Anzüge in ihren Schränken und brauchten ihr Geld für andere Dinge.«
Simon nickte.
»Auch der Freundeskreis meiner Großeltern wurde kleiner. ›Gute Deutsche‹, wie sie von der Nazi-Partei genannt wurden, durften keinen Kontakt mehr zu Juden haben.«
»Waren deine Großeltern denn keine guten Deutschen?«, unterbrach Simon seinen Vater.
»Doch, das waren sie. Mein Großvater war im 1. Weltkrieg Soldat gewesen und für seine Tapferkeit sogar ausgezeichnet worden! Aber nun waren sie eben bloß noch Juden, die jeder mied. Menschen, mit denen sie wenige Monate zuvor noch gefeiert hatten, grüßten sie plötzlich nicht einmal mehr auf der Straße. Mit erhobenem Haupt stolzierten sie an ihnen vorbei. Das war eine furchtbare Zeit für meine Großeltern.«
»Und was war mit deinem Papa, meinem Opa? Er war ja noch klein damals. Hat er das auch gemerkt?« Simon wollte sich nicht vorstellen, dass sich die Zeit auch für die Kinder geändert hatte.