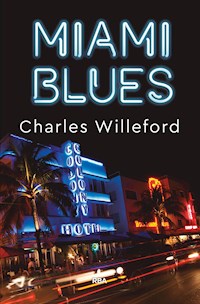Ein Vorwort
von Frank Nowatzki
Ich habe ziemlich lange mit mir gerungen, dieses Buch überhaupt zu machen, denn Anthologien lassen sich, aus welchen Gründen auch immer, relativ schlecht verkaufen. Glücklicherweise ist dieses Kriterium bei uns eher sekundär. Es wäre schlicht schade gewesen, das hierzulande noch unveröffentlichte Material in der Schublade verstauben zu lassen. Schließlich hatte die Old-School-Fraktion der hier versammelten Autoren meinen
Geschmack an Crime- und Pulp Fiction wesentlich geprägt. Die wilde New-School hat letztendlich dafür gesorgt, dass ich nicht mehr davon losgekommen bin. Genau genommen ging es in
den Achtzigern los, als ich begann, ein eigenständiges Sub-Genre inmitten der Masse an Kriminalliteratur für mich zu entdecken und qualitative Unterschiede wahrzunehmen. In San Francisco
bekam ich von einer Freundin die RE/SEARCH-Ausgabe von Charles Willefords Debüt High Priest of California mit folgender Widmung geschenkt:
... the ultimate in cool in California right now ...
Burroughs-Verehrer V. Vale hatte RE/SEARCH mit wenigen hundert Dollar
Startkapital gegründet, die er unter anderem von Allen Ginsberg für das Punkmagazin SEARCH & DESTROY erhalten hatte. Dass ein ehemaliger Pulp-Writer wie Charles Willeford
ausgerechnet im Punk-Umfeld wiederentdeckt wurde, war kein Zufall. Denn
Willeford hatte das schöne Cadillac-Amerika gnadenlos demaskiert und für dieses Unterfangen einen fiesen, selbstgefälligen Antihero geschaffen. Ein obsessives Macho-Arschloch, das seine eigene
Auffassung vom American-Way-of-Life zelebriert und Spaß daran hat, seine Mitmenschen zu manipulieren. Das hier war ein ganz anderes
Kaliber als die Whodunits und Krimis, die ich bisher kannte. Buchstäblich angefixt, stieß ich unweit von San Francisco, in Berkeley, auf die BLACK LIZARD BOOKS und den
Herausgeber Barry Gifford (Wild at heart), der weitere Willefords und andere Pulp-Poeten wie Jim Thompson und Paul Cain
wieder veröffentlichte. Autoren, deren Bücher im Laufe der Jahrzehnte in Antiquariaten verstauben und vergilben. Autoren,
die ihre Bücher entgegen dem damaligen Zeitgeist mit psychopathischen Fieslingen bevölkert hatten und dem Leser eine andere Sicht auf die gesellschaftlichen Verhältnisse darboten: die des Antiheros.
Paul Cain war 1933 der erste, der im legendären US-Pulpmagazin BLACK MASK die Figur des Antihero als Stilmittel einsetzt und
so die Welt der Crime- und Pulp Fiction verändert. In Fast One erzählt Cain die Geschichte des schießwütigen, amoralischen Gangsters Gerry Kells und beeindruckt damit selbst die
beiden Flaggschiffe Dashiell Hammett und Raymond Chandler. Chandler bezeichnet
Cains Stil sogar als ultrahardboiled. Es war ein geschickter Schachzug von Paul
Cain, die vertrackte Lage der Nation durch die Figur des Antihero selbst
formulieren zu lassen. Hatte doch die Prohibition in den zwanziger Jahren die
verbotene Herstellung und den ebenso illegalen Vertrieb von Spirituosen im großen Stil provoziert, wurden gesetzlose Verhaltensweisen bereits nach kurzer Zeit
zur gesellschaftlich akzeptierten Norm. Eine ganze Nation verhielt sich
kriminell und ermöglichte der Unterwelt, sich zu organisieren und so stark zu werden, um ihre Fühler bis in die höchsten Ebenen der Gesellschaft und Politik ausstrecken zu können und den Polizeiapparat zu korrumpieren. Entsprechend skizziert Paul Cain in
Der Ausputzer eine Art Grenzgänger zwischen Gesetz und Illegalität, der alle Fäden in der Hand hält, der manchmal mit der Polizei zusammenarbeitet, um sich Vorteile zu
verschaffen, manchmal aber auch verborgen im Hintergrund agiert. Für das noch junge Hardboiled-Genre, einer Melange verschiedener Stile und Genres,
die auf die Mythen und Heldenfiguren des alten Western setzte, war das ein
Paukenschlag. Paul Cain (1902-1966), der eigentlich George Carrol Sims hieß, verhielt sich völlig anders als seine berühmten Kollegen, legte sich Decknamen zu und verschwand ab und an völlig von der Bildfläche. Er behauptete, selbst Gangster gewesen zu sein, hatte als Maat die halbe
Welt kennen gelernt und tauchte plötzlich in den späten Dreißigern unter dem Namen Peter Ruric als Drehbuchautor in Hollywood auf. Als PULP
MASTER 1995 sieben Paul Cain Stories unter dem Titel Totschlag herausbrachte, schrieb Fritz Göttler in der SZ: » ... näher an Musil und Doderer als Hammett oder James M. Cain. Die einsamen Helden
plagen sich mit dem unentwirrbaren Geflecht aus Eifersucht und Ambition,
Politik und Verbrechen, Intrige und Verrat, werden gepeinigt vom Zweifel an
sich selbst.« Die längst verloren geglaubte Paul-Cain-Story Der Ausputzer entschädigt mich dafür, hier nicht alle Autoren, die für die Thematik von Bedeutung wären, einbeziehen zu können. Bleiben wir also bei meinen persönlichen Favorites.
Der Eintreiber kommt nach dem Zahltag von Fletcher Flora (1914-1969) erschien ursprünglich im MANHUNT-Pulpmagazin, das die BLACK MASK Tradition fortsetzte. Floras
präziser Erzählstil und seine Verliererfigur Frankie, die in einem desolaten Umfeld versucht,
dem Augenblick etwas Kontrolle über das Geschehen abzutrotzen, heben ihn deutlich aus der Masse der
Vielschreiber heraus, die sich oft mit größeren Themen auseinander setzten: Senator McCarthys Kommunistenhatz, nukleare
Bedrohung, Jugendkriminalität und landesweit organisiertes Verbrechen. Die zu letzterem abgehaltenen Anhörungen vor Untersuchungsausschüssen wurden Anfang der Fünfziger in Rundfunk und Fernsehen übertragen und brachten kriminelle Verwicklungen bis hin zum netten
Kommunalpolitiker von nebenan zu Tage.
Während Mickey Spillane der schockierten Öffentlichkeit als Antwort auf die aktuellen Verhältnisse seinen Privatdetektiv Mike Hammer schickte, der mit korrupten und
kriminellen Elementen im wahrsten Sinne des Wortes kurzen Prozess machte, debütierte Charles Willeford (1919-1988) eher unspektakulär, dafür aber mit weitaus überzeugenderen Charakteren. Doch der lesende Durchschnittsbürger war anscheinend weniger an Willefords Exkursionen in die Psyche des fiesen
Gebrauchtwagenhändler Russel interessiert, sondern wollte sich eher an Spillanes geschickter Überdosierung von Sex und Gewalt und Mike Hammers Selbstjustiz ergötzen. Der relativ kurze Willeford-Roman High Priest of California, der 1953 erschien, ging damals sang- und klanglos in der Masse der Pulps unter,
während Spillane die Auflagen in Millionenhöhe trieb, ein paar Feministinnen erschreckte und unzählige Pulp-Kollegen beeinflusste, die sich fortan als Nachahmer versuchten.
Willeford hingegen, der als Waisenkind buchstäblich auf der Straße aufwuchs und später seine Armeezeit als Panzerkommandant überstand, ließ sich dadurch nicht beirren, verfolgte optimistisch sein Konzept Nihilismus
weiter. Trotz internationalen Durchbruchs in den Achtzigern mit den
Hoke-Moseley-Romanen schaffte es High Priest nie in einen deutschen Verlag, obwohl es als erstes Buch von Willefords
sogenannter San-Francisco-Trilogie immer noch Kult ist und mittlerweile bei
RE/SEARCH schon die x-te Neuauflage erlebt hat. Lakonisch beschreibt Willeford
die Wertvorstellungen des Hohepriesters Russel und setzt den amerikanischen
Traum, irgendwo zwischen Selbstgefälligkeit und Machowahn, in ein furchtbar schäbiges Licht. Die vielgepriesene unbegrenzte Freiheit, Selbstbestimmung und
Mobilität, müssen mit gesellschaftlichen Zwängen und der Selbstgerechtigkeit eines anderen Amerika, das intolerant und
gewaltbereit ist, teuer bezahlt werden.
Anfang der Sechziger stellt der Berufszocker Dan J. Marlowe (1914-1987) in The Name of the Game is Death mit dem gewalttätigen Bankräuber Earl Drake einen Vertreter des Antiheros vor, der nun gänzlich auf der anderen Seite des Gesetzes steht. Marlowe beschreibt
Gewaltverbrechen aus der Täterperspektive. Beeinflusst und beraten wurde Marlowe von seinem kriminellen
Freund Al Nussbaum, der es im wahren Leben bis auf die ›Ten Most Wanted List‹ des FBI schaffte, bis er 1962 verhaftet und in ein Bundesgefängnis in Illinois gesteckt wurde. Hinter Gittern nahm Nussbaum mit Marlowe
Briefkontakt auf und versorgte ihn mit Insiderwissen über Alarmanlagen, Geldschränke und Waffen aller Art, sogar eine Dokumentarstory verfasste er mit ihm
gemeinsam. Die Publikation wurde jedoch vom FBI unterbunden, das darin eine Art
›Handbuch für Bankräuber‹ sah und Nachahmung und Legendenbildung verhindern wollte. Marlowe, der
mittlerweile in seinem Heimatort Harbour Beach als stellvertretender Bürgermeister in den City Council gewählt worden war, stand Nussbaum während der Haftzeit mit Rat und Tat zur Seite. So unterstützte er ihn bei seinem Bewährungsantrag und half bei ersten Gehversuchen als Schriftsteller. In Der Spender zeigt Marlowe, dass er sein Handwerk perfekt beherrscht und keine Worte
verschwendet.
Der Brite Derek Raymond (1931-1994) setzt sich mit seiner äußerst unbequemen Prosa intensiv mit dem Phänomen des Serienkillers auseinander. »Bei meinem Interesse an Psychopathen geht es darum, inwieweit ein von diesem
Geisteszustand Betroffener die Gesellschaft widerspiegelt, in der er
aufgewachsen ist. Der tief greifende Schock, der seine Psyche in zwei Teile
gespalten hat, war, wie und wo auch immer es sich ereignete, das Resultat eines
Schadens, der dem Betroffenen von einem Mitglied der Gesellschaft zugefügt wurde, und die Schockwellen breiten sich aus wie die Wellen auf der Oberfläche eines Teiches, in den man einen Stein wirft, bis sie schließlich ein enormes Gebiet abdecken.«
Was für den Leser seines vielleicht wichtigsten Buches Ich war Dora Suarez (Bd. 9) einer Tortur gleichkommt, muss für Raymond beim Schreiben die Hölle gewesen sein. Gerade die an manchen Stellen zu beobachtende Gratwanderung,
der Versuch, Weltschmerz und stringenten Plot miteinander zu vereinen, gibt den
Blick auf das Wesen des Genres frei, den die Perfektion eines James Ellroy oder
Thomas Harris häufig zu verstellen droht, so dass nur pure Unterhaltung und Spannung übrig zu bleiben drohen. Der Serienkiller John Reginald Christie, der Frauen eher
still und sanft ermordete, inspirierte Raymond für Die unvergängliche Susan. Auch hier wieder schimmert die lebenslange Abneigung des Autors gegen das
britische Klassensystem und dessen Verwaltungsapparat durch.
Die Themenpalette des Genres erweiterte sich in den Achtzigern erheblich, die
zunehmende Präsenz von Drogen in allen Gesellschaftsschichten, AIDS, Obdachlosigkeit und
sexueller Missbrauch, insbesondere von Kindern, bekamen immer mehr Gewicht. Joe
R. Lansdale, der in Texas lebt und sich in verschiedenen Genres austobt
(Horror, Western, Comics, Thriller), mischt diesem Albtraumcocktail zumeist
einen Spritzer Rassismus bei. Seine kurze Geschichte über zwei Hitmen auf dem Weg zu ihrem Opfer spielt auf den Shrimpskrieg an der
texanischen Golfküste 1979-81 an, bei dem sich vietnamesische Immigranten und einheimische Fischer
im Kampf um Shrimps-Fanggründe ins Gehege kamen. Lansdales grafische Erzählweise und hautnahe Dialoge stechen wieder unverkennbar heraus. Der Job wurde 1997 von A.W. Feidler verfilmt.
Zuletzt treibt Buddy Giovinazzo mit einem grauenvollen Horrorpärchen die Mutation des Antiheros in sein vorerst letztes Stadium, zumindest was
die letzte Dekade des vorigen Millenniums und diese Anthologie betrifft. Die
Neunziger standen ohne Zweifel unter dem Einfluss von Quentin Tarantino, der
die Plots alter Pulps und Filme plünderte, um sie für Filme und Drehbücher mit effektvoller Designer-Gewalt anzureichern und wieder
Hollywood-kompatibel zusammenzusetzen. Filme wie Natural Born Killers oder Love and a .45 folgten diesem neuen Konzept, versessen darauf zu beweisen, dass cineastische
Gewalt Spaß machen kann und befreiend wirkt, ja sich problemlos immer weiter steigern lässt, sofern man die Charaktere zu Sinnbildern degradiert und entpersonifiziert.
Mit noch weitgehenderer Überschreitung des guten Geschmacks und blankem Sarkasmus versucht Buddy
Giovinazzo in Ich töte nur für Catalaine mit diesem Trend Schluß zu machen. Er behauptet immer noch, es handle sich hier um eine moderne
Love-Story und ordnet in diese Kategorie auch seine Romane Poesie der Hölle und Broken Street (Bd. 5 und Bd. 8) ein. Zudem schwört er Stein und Bein, während er mein einjähriges Söhnchen auf seinem Schoß an seiner Armbanduhr spielen läßt, dass die Catalaine dieser Story wirklich existiere und als Producerin in L.A.
arbeite. Catalaine sei im wirklichen Leben nicht minder durchgedreht, und die
Idee sei aus E-mails entstanden, die sich beide zugeschickt und die sie
gegenseitig ergänzt hätten. Übrigens hat diese Catalaine kürzlich den Hollywood-Regisseur Tony Scott (True Romance, Crimson Tide) überzeugt, die Option von Buddys neuem Roman Potsdamer Platz
Der Ausputzer
Paul Cain
Mae wohnte in den Mara Apartments in Rossmore. Es war ungefähr neun Uhr, als ich dort ankam, und die Party war noch nicht richtig im Gange.
Damit will ich sagen, dass noch niemand umgefallen und keinem eine Flasche über den Schädel geschlagen worden war. Außer Mae und Tony waren sechs oder sieben Leute da — ich kannte keinen, was mir ganz recht war. Tony öffnete die Tür und führte mich herum, um mich vorzustellen. Mae kam aus der Küche und wir fielen uns in die Arme. Sie wurde immer so theatralisch, wenn sie
eine halbe Flasche Gin unter der Haube hatte.
Tony machte mir einen Drink. Ich nahm ihn, denn es hatte keinen Sinn, über so etwas zu streiten. Die meiste Zeit trug ich ihn mit mir herum, und wenn
mich jemand fragte, ob ich noch einen Drink wolle, konnte ich aufs volle Glas
zeigen.
Tony war Italiener — aus Genua, glaube ich. Sehr dunkelhäutig und schlank, mit glänzendem, blauschwarzem Haar, feurigen schwarzen Augen und einem anziehenden Lächeln. Ich kannte ihn seit fünf oder sechs Jahren — aus New York, wo er versucht hatte, um das Grand Hotel herum einen
Schnapsschwarzhandel aufzuziehen. Wir waren nie besonders eng befreundet, aber
wir kamen miteinander aus. Als er in Kalifornien auftauchte, besorgte ich ihm
einen Job als Schmieresteher bei Eddie Garda. Ich stellte Tony Mae Jackman vor,
als sie noch eine drittklassige Statistin war, noch dazu keine besonders
erfolgreiche. Seit ungefähr einem Jahr lebten sie zusammen. Tony hatte inzwischen sein eigenes Geschäft und es lief gut genug, um im Mara wohnen zu können. Mae arbeitete noch gelegentlich beim Film und das half.
Sobald sich eine Gelegenheit bot, schob mich Mae in die Küche. Sie lehnte am Waschbecken, schlürfte eine Mischung aus Gin und Ginger Ale und flüsterte: »Wir müssen Tony loswerden.«
Betrunkene strapazieren meine Geduld. Ich hoffte, dass sie durch ihren Gin-Nebel
meinen angewiderten Blick wahrnahm.
Schnell fügte sie mit theatralischem Flüstern hinzu: »Für den Augenblick, meine ich. Ich habe etwas, das ich dir zeigen möchte, und ich will nicht, dass er hereinplatzt.«
Sie trank ihr Glas aus und sagte dann mit bedeutungsschwangerem Unterton: »Warte«, und hastete zurück ins Wohnzimmer.
Ich goss meinen Gin ins Waschbecken und füllte das Glas mit Ginger Ale und Eis.
Eine Minute später kam sie zurück. »Ich habe ihn zu Cora geschickt, um Eis zu holen«, sagte sie. Cora war Maes Busenfreundin, sie wohnte oben.
Mae steuerte mich durch den kurzen Flur ins Schlafzimmer und schloss die Tür. Sie ging zur Kommode, wühlte eine Weile in der unteren Schublade herum, kam mit einem gelben, gefalteten
Papier zurück und reichte es mir. Ich faltete es auseinander und hielt es unter das Licht
am Kopfende des Bettes; es war ein von Louis L. Steinlen ausgestellter Scheck über zweitausendfünfhundert Dollar. Steinlen war der Geschäftsführer der Astra Motion Picture Company.
Ich sagte: »Nicht schlecht, Mae.«
Ich gab ihr den Scheck zurück und sie hielt ihn ins Licht, schaute erst ihn an, dann mich.
»Ja, nicht schlecht«, meinte sie, »aber es wird noch besser.«
Sie lächelte und für einen Moment verlor ihr Gesicht den betrunkenen Ausdruck. Sie war ein sehr
sehr hübsches Mädchen, und wenn sie lächelte, war sie beinahe schön.
Ich fragte: »Und?« nicht sonderlich begeistert davon, mit ihr in ihrem Schlafzimmer zu bleiben,
denn Tony konnte früher als erwartet zurückkehren, und er war alles andere als nüchtern — ich wollte vermeiden, dass er auf irgendwelche vertrackten Ideen kam.
Mae lächelte immer noch.
Sie sagte: »Das ist die Summe« — sie wies mit dem Kopf auf den Scheck — »dein Anteil, wenn du mir hilfst, mit Steinlen ins Geschäft zu kommen.«
Ich hatte eine blasse Ahnung, worauf sie hinauswollte, aber das half mir nicht
weiter. »Wovon, zum Teufel, redest du?«
Sie setzte sich auf die Bettkante. »Wir werden Steinlen seinen Scheck für fünfundzwanzigtausend verkaufen«, verkündete sie.
Ich erwiderte nichts. Ich wollte lachen, aber ich hielt mich zurück.
»Dieses kleine Stück Papier«, fuhr sie fort, »ist sein Gewicht in Radium wert.« Sie schaute verträumt auf den Scheck, dann sah sie wieder mich an. Nun lächelte sie nicht mehr. »Steinlen ist seit Monaten hinter mir her. Letztes Wochenende war Tony geschäftlich in Frisco — ich fuhr mit Steinlen nach Arrowhead — ebenfalls geschäftlich.« Sie lächelte wieder, hielt den Scheck in einer Hand und rieb mit dem Zeigefinger ihrer
anderen Hand darüber. »Das hier ist ein kleines Honorar für das Geschäft.«
»Das ist allerdings ein Honorar«, stellte ich fest.
In diesem Augenblick mochte ich Mae ungefähr neunzig Prozent weniger, als ich sie je gemocht hatte, und sie war nie die
Art Mädchen gewesen, das ich meiner Familie vorgestellt hätte. Ich eröffnete ihr nicht, dass sie meiner Meinung nach außerordentlich überbezahlt sei — das war ziemlich offensichtlich. Ich wartete darauf, dass sie fortfuhr und mir
erklärte, welche Rolle mir bei all dem zukam.
Sie erzählte mir lang und breit, was für ein Kinderspiel es sei, von Steinlen die fünfundzwanzig Riesen zu kriegen, dass es sich technisch gesehen nicht um
Erpressung handele, weil sie einfach seinen Scheck — einen Scheck, den er seiner Frau verdammt schwer erklären könne — gegen Bargeld eintauschen werde, zehn Mal so viel Bargeld. Sie sagte, sie wolle
mich bei dem Geschäft dabeihaben, weil ich einen Deal besser durchziehen könne als sie und weil der Scheck bis zur Übergabe des Bargeldes bei mir besser aufgehoben wäre.
Als sie fertig war, grinste ich sie kalt an und fragte: »Warum fragst du nicht Tony, ob er mitmacht?«
»Sei nicht so blöd, Red — wenn Tony Wind davon bekäme, würde er mir die Kehle durchschneiden.«
Dann klagte sie mir ihr Leid über Tony und erklärte, dass sie absolut genug von ihm habe, und zwar schon seit längerer Zeit, und dass sie sofort nach Europa abhauen werde, sobald sie den
Zaster habe.
Als sie ordentlich Dampf abgelassen hatte, unterbrach ich sie und machte ihr
klar, dass sie erstens total verrückt sei, aus Steinlen irgendetwas herausschlagen zu wollen, und dass ich mich
zweitens niemals auf eine solche Transaktion einlassen würde, nicht mal für eine Million. Und dass ich auch auf legale Weise sehr gut zurechtkomme — und es drittens eine miese Tour sei, hinter Tonys Rücken herumzumachen. Sie riskierte damit aufzufliegen, bevor sie sich davon
machen konnte. Schließlich erklärte ich ihr, dass es mein Job sei, Ärger von Leuten fern zu halten, statt sie hineinzuziehen.
Sie nahm es ziemlich leicht. Sagte, es tue ihr Leid, dass ich es nicht so sehe
wie sie und dass sie jemand anderen finden müsse oder es selbst tun werde. Sie meinte, wie auch immer sie es mache, es müsse schnell passieren, weil Steinlens Frau, der Astra-Star Sheila Dale, morgen
von einem Dreh zurückkomme — und Steinlen psychologisch reif sei für den Deal in Erwartung der Heimkehr seiner Frau. In mancher Hinsicht war Mae
ein helles Köpfchen. Zu schade nur, dass sie so hinterhältig war — schlechte Gesellschaft, nehme ich an.
Wir gingen hinaus in die Küche. Sie machte sich einen Drink, wollte auch einen für mich in Angriff nehmen, woraufhin ich ihr mein volles Glas zeigte.
Sie sagte: »Ich nehme an, es ist überflüssig zu betonen, dass du alles für dich behältst ...«
Ich lächelte, schüttelte den Kopf und trank einen Schluck Ginger Ale als eine Art stillen Toast
auf ihren Erfolg.
Dann versuchte ich noch einmal, ihr die Sache auszureden, doch es hatte keinen
Sinn — sie war fest entschlossen. Ein paar Betrunkene schwankten in die Küche und Mae mixte ihnen Drinks.
Während sie noch in der Küche standen, erschien Tony. Zur rechten Zeit, denn so sah es nicht danach aus,
als hätten Mae und ich während seiner Abwesenheit etwas ausgeheckt.
Er sagte: »Cora hat mich aufgehalten. Ich musste ein paar Drinks mit ihr nehmen. Sie ist
sehr niedergeschlagen und wird nicht runterkommen.« Er erzählte mir, dass Coras Freund sie verlassen habe und was für ein Penner das sei und was er, Tony, mit ihm täte, würde er ihm begegnen. Tonys Stimme war sehr sanft und er sprach jedes Wort sehr
ruhig aus, sehr genau, mit nur einer Spur von Akzent.
Während Tony mir in allen Details erklärte, was er Coras Freund antun würde, sah ich Mae an; sie genehmigte sich einen weiteren Drink.
Ich verschwand ziemlich früh, ging hinunter, nahm ein Taxi und fuhr ins Derby. Nach einer Weile trudelten ein paar Zuschauer des Boxkampfes ein und Franey,
Broun und ein Buchmacher namens Connie Hartley erschienen auf der Bildfläche. Wir nahmen ein paar Drinks, saßen herum und erzählten uns Lügengeschichten. Seit Wochen hatte ich keinen Alkohol getrunken und verspürte keine Lust mehr auf Enthaltsamkeit — also genehmigte ich mir mehr als einen Drink. Hartley hatte ein paar
Wettscheine für die Rennen dabei und Franey und ich pickten uns ein paar Verlierer für Samstag heraus.
Später suchten Franey, Hartley und ich noch den Colony Club auf. Dort arbeitete ein Freund von mir, ein sehr guter Pianist. Wir lauschten
ihm und tranken noch mehr. Gegen vier kam ich nach Hause.
Ungefähr gegen elf Uhr wurde ich wach, stand aber nicht gleich auf. Ich führte ein paar Telefonate und versuchte danach wieder zu schlafen, aber das war
vorbei. Schließlich rollte ich zur Bettkante hinüber und blickte auf die Extraausgabe, die unter der Tür durchgeschoben worden war. Als ich mich herumdrehte, konnte ich die
Schlagzeile lesen:
Schauspielerin in Hollywood-Apartment erwürgt
Ich stand auf, holte die Zeitung, setzte mich wieder aufs Bett und las die
Story. Mae Jackman war, so weit die Polizei ermitteln konnte, gegen drei Uhr
dreißig in ihrem Apartment im Mara ermordet worden. Ein Zimmermädchen hatte die Leiche um acht Uhr dreißig entdeckt. Die Fahndung nach Tony Aricci lief.
Ich frühstückte in einem kleinen Laden ein paar Häuser vom Hotel entfernt. Als ich wieder nach Hause kam, stand ein Mann im
Halbdunkel des Flurs, direkt vor meiner Tür. Es war Tony. Er trat dicht an mich heran und drückte mir eine Automatik in die Magengrube. Ich schloss auf und wir gingen in
mein Zimmer.
Ich fragte: »Was soll das?«
Tony hatte einen Gesichtsausdruck, der sich mir immer vor die Augen schiebt,
wenn ich zu viel Hummer und Kirschbrandy konsumiere. Seine dunkle Haut war
aschfahl, sein Mund ein dunkelgrauer Schlitz und in seinen Augen stand der
Wahnsinn.
Als er sprach, klang es, als würden die Worte aus einem tiefen Brunnen aufsteigen. Er sagte: »Du hast Mae umgebracht.« Ohne Betonung — die Worte trieben alle auf exakt der gleichen Höhe.
Ich fühlte mich nicht sonderlich wohl. Langsam bewegte ich mich weg von ihm, noch
langsamer setzte ich mich in den Sessel am Fenster. Gleichzeitig rief ich: »Um Himmels Willen — Tony — wie kommst du bloß auf so eine absurde Idee?«
Er sagte: »Wenn du sie nicht umgebracht hast, weißt du zumindest, wer es war. Sie hat dich an drei Tagen angerufen. Du hast letzte
Nacht allein mit ihr gesprochen, während ich bei Cora war — die ganze Zeit meiner Abwesenheit. Es gibt da etwas, was ich nicht weiß. Ich hab schon lange geahnt, dass es etwas gibt, von dem ich keine Ahnung habe — du musst mir sagen, was es ist. Wenn du’s mir nicht sagst, lege ich dich um.«
Wenn ich auch nur im Ansatz die Gabe besitze, zu spüren, ob Leute die Wahrheit sagen — bei Tony spürte ich, er sagte die Wahrheit. Ich versuchte, Zeit zu schinden, zündete mir eine Zigarette an.
Ich sagte: »Setz dich, Tony.«
Er schüttelte heftig den Kopf.
Ich versuchte es nochmals. »Du bist auf der falschen Spur, Tony. Wenn diese Bande Betrunkener dir gesteckt
hat, dass Mae und ich im Schlafzimmer waren, während du oben warst — sie hatte mich dahin gelotst, um mir die Standfotos ihres letzten Films zu
zeigen. Wir haben über alte Zeiten geredet ...« Ich beugte mich vor, schüttelte sacht den Kopf. »Als ich es in der Zeitung gelesen habe, habe ich gedacht, du seiest es gewesen.
Eine eurer Streitigkeiten und du wärst ein bisschen zu weit gegangen.«
Plötzlich sank er zusammen, fiel neben dem Bett auf die Knie. Die Automatik
schepperte zu Boden. Er nahm den Kopf in beide Hände, ließ ihn aufs Bett sinken und wimmerte auf eine schrecklich trockene Weise wie ein
verwundetes Tier. Er sprach abgehackt, seine Stimme, durch das Bett gedämpft, schien von sehr weit herzukommen: »Mein Gott, lieber Gott. Ich sie töten? — Ich soll die getötet haben, die ich mehr geliebt habe als irgendetwas sonst? Warum, lieber Gott,
behaupten sie, ich hätte sie umgebracht? ...«
Es war peinlich anzusehen, wie ein Mann wie Tony derart zusammenbrach. Ich stand
auf, nahm die Automatik, schob sie in die Tasche meines Mantels und klopfte
Tony auf die Schulter. Ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen oder was ich hätte sagen können, also ging ich zurück zum Sessel, setzte mich und sah aus dem Fenster.
Überraschend schnell stand Tony wieder auf. Er sagte: »Letzte Nacht musste ich nach Long Beach. Ich verließ Mae gegen halb zwei, da war die ganze Bande bereits gegangen. Ich bin noch
nicht lange zurück. Weil ich Mae nicht wecken wollte, hielt ich bei Sardis, um zu frühstücken — und da entdeckte ich die Zeitung.« Er räusperte sich. »Ich gehe zu Cora. Cora wird etwas wissen. Sie wird mir sagen, was los ist ... «
Ich sagte: »Nein, das tust du nicht. Du kannst nicht hier bleiben, denn wenn die Bullen
herausfinden, dass ich letzte Nacht bei euch war, werden sie hierher kommen und
mir eine Menge Fragen stellen. Ich bring dich zu einer Freundin, ein Stockwerk
höher, bei der bleibst du, bis ich zurückkomme. Ich will sehen, ob ich die Sache für dich geradebiegen kann, wenn nicht, werden wir versuchen, dich aus der Stadt
zu bringen.«
Er lächelte auf unangenehme Weise.
»Es ist mir egal, ob man mir unrecht tut. Ich hab kein Interesse daran, hier
wegzukommen. Ich will den Kerl finden, der Mae umgebracht hat. Er soll dafür bezahlen.«
Ich nickte, als wollte ich das auch. Dann schob ich ihn aus dem Zimmer, und wir
stiegen über die Hintertreppe in den achten Stock. Ich klopfte an Opal Cranes Tür. Sie lag noch im Bett und rief: »Wer ist da?« ich sagte es ihr, und eine Minute später kam sie zur Tür und öffnete. Sie rieb sich die Augen und gähnte. Als ich ihr Tony vorstellte und sie bat, ihn eine Weile bei sich
aufzunehmen, sah sie nicht sehr begeistert aus.
Sie deutete mit dem Kopf auf Tony, der sich hingesetzt hatte und aus dem Fenster
starrte, und fragte: »Heiß?«
Ich nickte.
Sie sah noch weniger begeistert aus. Ich sagte ihr, dass ich sie niemals um
etwas bitten würde, wenn ich nicht sicher sei, dass es in Ordnung gehe. Sie schüttelte den Kopf, gähnte und verschwand im Bad.
»Ich bin so schnell wie möglich zurück oder rufe dich an«, versprach ich Tony.
Monoton nickte er mit dem Kopf, dann sagte er: »Gib mir meine Waffe.«
Ich sagte: »Nein. Du wirst sie nicht brauchen, ich vielleicht schon.«
Ich ließ ihn am Fenster sitzen, in den grauen Tag starren, ging leise hinaus und schloss
die Tür.
Zurück in meinem Zimmer, rief ich Danny Scheyer an, einen Polizeireporter der Post. Ich bat ihn, so viel wie möglich über den Jackman-Mord herauszufinden, ob die Polizei tatsächlich Tony für den Täter hielt oder ob man noch anderen Spuren nachging. Insbesondere bat ich ihn
herauszufinden, ob bei Mae oder im Apartment ein Scheck gefunden worden war,
der mit dem Fall etwas zu tun haben könnte. Scheyer hatte einen Draht zum Polizeipräsidium, und ich wusste, dass er alle Informationen bekommen würde, die es da zu holen gab. Ich sagte ihm, dass ich ihn bald wieder anriefe.
Es war fast halb eins und ich vermutete Steinlen beim Lunch. Ich rief dennoch
an. Er war tatsächlich zum Lunch und ich sprach mit seiner Sekretärin. Ich sagte ihr, dass ich einen Termin mit Steinlen benötige, so gegen halb zwei, und sie fragte, worum es gehe. Ich bat sie, ihm
auszurichten, Mr. Black aus Arrowhead komme gegen halb zwei vorbei und sein
Anliegen sei persönlicher Natur. Dann ging ich rüber zum Derby und trank einen Kaffee.
Aus dem Derby rief ich wieder Scheyer an. Er sagte, man habe nichts bei Mae oder im Apartment
gefunden, was von Bedeutung sei. Es sehe nicht gut aus für Tony Aricci.
»Vielleicht doch«, widersprach ich.
Ich versicherte Scheyer, ihn als Erstes anzurufen, sollte ich etwas
herausfinden, und dankte ihm.
Steinlen war jünger, als ich gedacht hatte — zwischen fünfunddreißig und vierzig. Ein dünner, nervöser Mann mit tief liegenden braunen Augen in einem langen, knochigen Gesicht.
Seine Hände schienen nie zur Ruhe zu kommen. »Was kann ich für Sie tun, Mister Black?« empfing er mich.
Ich beugte mich vor und drückte meine Zigarette in dem Aschenbecher auf seinem Schreibtisch aus, dann
lehnte ich mich zurück und machte es mir bequem. Ich sagte: »Sie können gar nichts für mich tun, ich aber kann verdammt viel für Sie tun.«
Er lächelte ein wenig und nickte. »Die Leute tun ständig etwas für mich«, meinte er. »Deswegen habe ich bereits so viele graue Haare.« Er kratzte sich die lange Nase, legte dann seine Hand zurück auf die Schreibtischplatte und trommelte mit den Fingern. »Was verkaufen Sie?«
»Ich verkaufe Seelenfrieden«, sagte ich. »Früher, an der Ostküste, nannten sie mich den Ausputzer. Ich bewahrte Leute vor Fettnäpfchen — und saßen sie bereits drin, holte ich sie wieder raus. Das war mein Job — nun ist es eine Art Hobby.«
Er lächelte immer noch. Er sagte: »Fahren Sie fort.«
Seine Eigenheit, die Hände in Bewegung zu halten, machte mich kribbelig. Ich hatte noch den Mantel an
und lag buchstäblich im Stuhl, die Hand auf Tonys Waffe in der Manteltasche.
Ich sagte: »Sie haben Mae Jackman umgebracht.«
Sein Gesichtsausdruck blieb unverändert, aber er hörte auf, mit den Fingern zu trommeln und zeigte für etwa fünfzehn Sekunden keinerlei Regung. Dann sah er mich geradewegs an, und er lächelte immer noch. Mit einem Kopfschütteln sagte er: »Nein.«
Kürzlich hatte ich eine Bemerkung über die Gabe gemacht, spüren zu können, ob Leute die Wahrheit sagen. Fünfzehn Jahre intensives Studium unterschiedlichster Varianten von Draw- und
Studpoker kultivieren diese Gabe. Will sagen, ich werde nicht so schnell ein
Opfer der Täuschung, und — ich glaubte Steinlen.
Ich fragte: »Wer war es?«
Wieder schüttelte Steinlen langsam den Kopf. »Aricci, nehme ich an.«
In diesem Moment flatterten mir die Segel. Ich war so sicher gewesen, dass
Steinlen der Richtige war, und nun war ich überzeugt davon, dass er es nicht war — ich kam mir verarscht vor. Aber ich würde es nicht einfach auf mir sitzen lassen. Ich hatte den Eindruck, dass
Steinlen die Wahrheit sagte, aber meine Intuition allein reichte mir nicht aus.
Ich wollte es wissen.
»Aricci hat es nicht getan.« Ich sagte es so, als wäre ich sicher.
Steinlen lachte kurz. »Sie sind sehr überzeugt.«
Ich erklärte ihm, dass dem tatsächlich so sei und auch, warum. Hätte Aricci Mae umgebracht, dann nur wegen des Schecks. Aber hätte Aricci von dem Scheck gewusst, dann wäre er, Steinlen, ebenfalls nicht mehr am Leben.
Bei der Erwähnung des Schecks kam zum ersten Mal Bewegung in Steinlens Züge. Sein Gesichtsausdruck wurde beinahe eifrig. Er sagte: »Sind Sie sicher, dass die Polizei den Scheck nicht gefunden hat?«
Ich nickte.
Er fragte: »Wer außer Ihnen wusste davon?«
»Nur Sie«, antwortete ich — »und vermutlich derjenige, der ihn jetzt hat.«
Ich zündete eine Zigarette an und beobachtete Steinlens Gesicht. Ich sagte: »Solange dieser Scheck existiert, schwebt ein Damoklesschwert über Ihrem Kopf. Wenn die Polizei ihn in die Hände bekommt, wird man Sie mit dem Mord in Verbindung bringen. Wenn Aricci ihn
bekommt oder etwas von seiner Existenz erfährt, wird er Sie umbringen, so wahr wir hier sitzen.«
Steinlen blickte ausdruckslos aus dem Fenster. Er nickte leicht.
»Am besten erzählen Sie mir alles, was Sie über die Sache wissen«, fuhr ich fort.
»Vielleicht finde ich einen Hinweis.«
Er schwenkte in seinem Drehstuhl herum, um mich anzusehen, er lächelte wieder. Er sagte: »Sind Sie hergekommen, um mich hochzunehmen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nicht unbedingt. Ich stoße niemanden ins Loch, solange es noch andere Möglichkeiten gibt. Ich bin hierhergekommen, weil ich dachte, dass Sie der Täter sind, und ich hatte vor, das zu Papier zu bringen und Ihnen dann ungefähr vierundzwanzig Stunden Vorsprung zu geben. Ich mochte Mae nicht besonders und
ich hielt das mit dem Scheck für eine Schnapsidee, aber ich mag Tony, und ich weiß, dass er unschuldig ist. Ich will nicht, dass er für einen anderen ins Loch geht.«
»Und von meiner Unschuld sind Sie überzeugt?«
Ich lächelte leicht und sagte: »Ziemlich.«
Er fing wieder an, auf der Schreibtischplatte zu trommeln. »Mae rief mich heute Morgen gegen zwei Uhr an. Sie war sehr betrunken und erzählte mir, Tony sei ausgegangen, sie sei allein.«
Ich sagte: »Ja. Tony fuhr nach Long Beach. Um halb zwei verließ er das Apartment.«
Steinlen kratzte sich an der Nase. »Kann er kein Alibi nachweisen?«