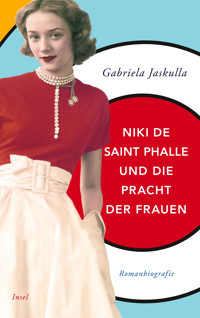14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie war ein Star – und sie war berüchtigt. Artemisia Gentileschi, geboren 1593 in Rom, fiel schon in jungen Jahren als talentierte Malerin auf. Der erste Schicksalsschlag traf sie, als sie, mit siebzehn von ihrem Lehrer vergewaltigt, nach einem aufsehenerregenden Prozess zwangsverheiratet wurde und Rom verlassen musste. Doch sie überstand noch viele weitere: Vulkanausbrüche, Pleiten und die Pest. Sie etablierte sich als Malerin und wurde als erste Frau überhaupt an der Akademie in Florenz aufgenommen – im Triumph kehrte sie nach Rom zurück. Sie erhielt Aufträge vom Papst und vom Hochadel und unterhielt bis zu ihrem Tod eine eigene Werkstatt. Ihre Bilder waren keine braven Stillleben, keine artigen Porträts – sie zeugen von Kraft und von Rache, von Stolz und von Rebellion. Selbstbewusst forderte sie für ihre Kunst denselben Platz und denselben Preis wie ihr Zeitgenosse Velázquez.
Gabriela Jaskulla folgt in dieser Romanbiografie dem Weg der einzigartigen Künstlerin Artemisia Gentileschi von Rom über Florenz und Venedig bis nach London und Neapel und zeichnet das Leben einer mutigen und kraftvollen Frau, für die Aufgeben niemals in Frage kam.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
Gabriela Jaskulla
Artemisia Gentileschi und Der Zorn der Frauen
Romanbiografie
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Insel Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 5049.
© Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2024
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Artemisia Gentileschi, Judith und ihre Dienerin (Detail), 1623-1625, The Detroit Institute of Arts, Foto: akg-images, Berlin
eISBN 978-3-458-77982-7
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Prolog
1
. Rom
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
Nachbemerkung
Fußnoten
Informationen zum Buch
Artemisia Gentileschi und Der Zorn der Frauen
Prolog
Das Kleid riss. Es war ein Geräusch, das zwei Schritte machte: einen kleinen, vorsichtigen und dann einen großen, entschlossen. Ritsch, ratsch! Hell, dunkel! Artemisia hielt einen Augenblick inne, erschrocken über die vermeintliche Missetat. Aber es war ja nicht sie – es war der Mann gewesen, der das Kleid zerfetzt hatte und jetzt wieder, schon wieder, über ihr war. Nein! Artemisia befreite sich, das dritte, das vierte Mal, jedes Mal wurde es schwerer, Widerstand zu leisten, es war, als würde das Gewicht des Mannes auf ihr lasten, auch wenn sie ihn gerade wieder abgeschüttelt hatte, wieder losstürzte, zur Seite auswich, davonjagte, die Treppe hinauf. Aber er hinterher. Kein Auskommen! Nein, nein!
Dabei hatte alles als Spiel angefangen. Sie hatten sich geneckt, weil ihnen das Zeichnen der Zentralperspektive zu langweilig erschien. Das hätte sie stutzig machen sollen, war es doch sein Beruf: Perspektive. Große Räume zeichnen. Das war sein Metier, dafür war Agostino Tassi berühmt, dafür hatte ihn der Vater angeheuert: Tassi sollte seiner Tochter, der 17-jährigen Artemisia Gentileschi, Perspektive beibringen. Das Werkzeug lag noch unten auf dem Tisch in Orazios Atelier, in dem Artemisia dem Vater zur Hand ging. Aber dort war nur noch Chaos, Durcheinander, die teuren Papiere vom Tisch gewischt, die Werkzeuge verstreut. Da hatte das begonnen.
Komm, küss mich, Artemisia!
Sie hatte ihn ausgelacht. So ein alter Mann, mit gezwirbeltem Bart und Bäuchlein. Der sich parfümierte, Postiche trug, ein Haarteil, um sein schütteres Haar zu kaschieren. Ihr angeblicher Lehrer. Ein angeblich großer Künstler, der hinter seinem Rücken Lo smargiasso genannt wurde. Der stadtbekannte Angeber. Sie rief es laut aus, sie verhöhnte ihn:
Smargiasso! Übernimm dich nicht!
Sie hatte gesehen, wie er in ihr Dekolleté gestarrt hatte, mit einem Blick, als wollte er ihre Brüste heraussaugen. Sie hatte seine Hände gesehen, manikürte Hände, die zeigten, dass er, der Künstler, wohlhabend genug war, eine Reihe von Assistenten zu beschäftigen, Meisterhände also, unruhige Hände, die immerfort ihre Hände korrigierten, selbst dann, wenn keine Korrektur nötig war.
Komm, küss mich!
Das allzu vertrauliche Du. Er machte Faxen dazu. Es sollte aussehen wie eine Spielerei. Aber sein Gesicht war angespannt, die Haut gerötet. Das Hemd stand offen.
Artemisia sagte: Das kann man nicht malen, dass einer was sagt – und man sieht, er meint das Gegenteil! Du sagst: Küss mich, und meinst: Ich will dich bezwingen.
Genau!, rief der Mann – und damit begann es. Er griff nach ihr, sie wehrte die Hand ab, unwillkürlich sprang sie auf, so heftig, dass der Hocker umstürzte, und er folgte ihr.
Nicht so schnell!
Wer hatte das gerufen? Warum hielt sie inne? Wie sehr sie zum Gehorchen neigte.
Warte!
Nein!
Auf und davon! Wie hinderlich die langen Röcke waren. Drei Röcke übereinander. Weißes Linnen, dann ein farbiger Rock aus Leinen und noch ein Überrock aus Wolle. Das Oberteil ebenfalls aus Leinen, nachlässig in die Röcke gestopft, denn sie trug eine Schürze, die das Ganze in der Taille zusammenhielt. Am Schürzenband hielt er sie fest. Wie gut, dass sie es nur lose gegürtet hatte!
Sie entkam. Aber nur bis zur Treppe. Erneut hinderten sie die langen Röcke, drohten sich um ihre Beine zu wickeln. Gegriffen, gerafft, hinauf! Die Treppe schien heller als sonst, als fiele von oben ein Licht darauf. Es mussten ihre Augen sein, sie strengte sich so sehr an, zu sehen, jetzt keinen Fehler machen, hinauf, nur hinauf, in ihr Zimmer, das ein Schloss hatte und einen Schlüssel. Zwölf Stufen, das wusste sie, die hatte sie so oft gezählt und gezeichnet, schattiert und schraffiert, zwölf Stufen nur.
Er hinter ihr und vor ihr plötzlich Tuzia, die Freundin, die Frau, die ihrem Vater zur Hand ging, Tuzia, Gott sei Dank! Hoch aufgereckt, aufmerksam, abwartend.
Artemisia rief ihren Namen, sah sie lächeln, sah, dass sie die Situation begriff. Aber was war das? Tuzia trat zur Seite, ließ Artemisia passieren. Ebenso den Mann.
Tuzia, hilf mir!
Gelächter, aus zwei Kehlen.
Wieder diese Stimme, die sie nicht einordnen konnte. Der lange Gang, die von dort abgehenden Zimmer. Das zweite, das ihre. Sie hatte schon die Klinke in der Hand, da hatte er sie eingeholt.
Warte!
Warum um alles in der Welt tat sie es? Warum hielt sie einen Augenblick inne? So sehr erzogen zur Willfährigkeit? So sehr gewöhnt, auf die männliche Stimme zu hören? Artemisia schrie auf vor Wut. Und vor Schmerz. Der Mann packte sie an den Haaren, hinten im Nacken. Und zerrte sie in das Zimmer. In ihr Zimmer. Das einmal eine Zuflucht gewesen war. Jetzt aber eine Falle. Artemisia kämpfte. Sie versuchte, an dem Mann vorbeizukommen. Aber er war zu schwer. Er war zu groß. Auch sein Mund war groß. Riesig. Ein Maul, das nach ihr schnappte. Die fauligen Zähne. Der rot leuchtende, wie brennende Schlund. Das sah man nie auf den Bildern des Vaters, wenn er seine Heiligen malte und seine Herrschenden. Das Bett! Das war ihr Heiligstes. Tuzia hielt es auf ihre Bitte hin penibel reinlich. Man fand das übertrieben, aber gerade heute war frisches Leinen aufgezogen worden. Das Bett war hoch, vier Pfosten reichten bis fast zur Decke. Dagegen prallte sie nun, nicht schlimm, gar nicht schlimm. Sie versuchte, nach dem Mann zu treten, aber die Röcke hinderten sie. Sie lag. Sie rang nach Luft. Die Hände des Mannes auf ihr. Der schwere Schädel. Die schmutzigen Stiefel. Warum waren die Stiefel schmutzig? Sie waren doch nur im Haus gewesen. Sie drehte sich und wand sich, aber er immer ihr nach. Das Bettzeug zur Seite, das Bettzeug über ihr. Er schob es beiseite. Immerhin erstickte er sie nicht.
Artemisia, du machst mich verrückt. Nein, das stimmte nicht, er selbst war es, er selbst machte sich verrückt, er selbst war gewalttätig, er selbst hatte sich dem Bösen überlassen.
Sie hatte jetzt den Kopf schmerzlich überdehnt, in dem Bedürfnis, ihm auszuweichen, seinen Händen, seinen Lippen. Sie sah, über Kopf, die kleine Öffnung des Fensters. Das Licht fiel auf sein Gesicht. Sie im Schatten. Sie entkam ihm nicht, er war schon wieder über ihr. Vor dem Fenster Vögel. Ein Taubenpaar in der Via della Croce? Mitten in Rom, mitten in der Stadt? Das passte nicht, dachte sie noch. Dann dieser Riss, erst einfach, dann doppelt. Und ihr Schrei.
Stopp!
Cut!
Aufhören!
Alle fuhren zusammen. Die Kamerafrau, die außerhalb des Zimmer-Settings auf einem Stuhl saß und gerade den Monitor kontrolliert hatte. Die Assistenten. Das Scriptgirl. Und natürlich Lena, die Regisseurin. Sie war es, die geschrien hatte. Cut. Aber erst, nachdem Joy, die Hauptdarstellerin, geschrien hatte: Stopp! Ein unerhörter Vorgang. Niemand unterbrach, wenn eine Szene gedreht wurde, vor allem keine mit so viel Action. Das war eine Choreografie, da musste jeder Schritt, jeder Handgriff der Crew sitzen.
Okay. Vorbei. Pause, sagte Lena. – Wir machen in einer Stunde weiter.
Jemand brachte Espresso und eine Karaffe mit Wasser. Sie saßen in Lenas Trailer. Die Regisseurin und ihr Assistent, dazu Tim, der Drehbuchautor, Joy, die Darstellerin der Artemisia. Und die Professorin, wie sie sie alle nannten, die Expertin, die Fachberaterin für den großen Spielfilm über Artemisia Gentileschi, über die bedeutendste Malerin des Barock, die Meisterin biblischer Szenen, die ein Vergewaltigungsopfer war.
Was war los? – Die Stimme Lenas streng, aber nicht unfreundlich. – Ich hoffe, du hast einen triftigen Grund, meine Liebe …?
Das geht so nicht. – Joys Stimme ein wenig zitternd, aber entschlossen.
Was geht so nicht?
Das Setting. Die Kamera. Das Licht. Die ganze Szene. Joy suchte nach Worten. Die Regisseurin, kooperativ wie stets, ließ den Monitor bringen.
Wir sehen uns an, was wir gerade gedreht haben.
Die fünf schauten. Lange, konzentriert. Dann entfuhr es Joy:
Genau das ist es. Das meine ich.
Sie wies mit dem Finger auf den Take, den sie gerade betrachteten. Danilo, der Darsteller des Agostino, in Großaufnahme. Sein mächtiges Gesicht von unten, sodass es noch kräftiger wirkte. Die gerötete Haut, die aufgerissenen Augen.
Ganz gut, oder? – Lena wollte ein wenig Leichtigkeit in die angespannte Situation bringen.
Aber Joy war nicht zu bremsen: Um wen geht es hier?
Die Regisseurin war befremdet. Sie hatten tagelang, wochenlang diskutiert, sich schließlich darauf geeinigt, die Vergewaltigungsszene drastisch zu zeigen, aber nicht voyeuristisch. Keine verkrampften weiblichen Hände, kein schmerzverzerrtes Gesicht, keine nackten Brüste. Kamera eins war Danilo gefolgt, subjektive Kamera, viel Bewegung, sie hatten den Gang die Treppe hinauf etliche Male proben müssen, aber so wurde die Verfolgung klar, die Enge. Und dann Umschnitt, in die Kammer, der Fokus beim Täter, erst über die Schulter gedreht, dann Einstellung in der Halbtotalen: Agostino, also Danilo, riesenhaft über dem Bett, und auf dem Bett Artemisia, also Joy, verschwindend in den Laken. Sie ganz klar das Opfer, aber nicht der Kamera preisgegeben.
Wo ist das Problem? – Lena war durchaus genervt, das hörte man nun doch.
Artemisia trug … kein Dekolleté. – Joy wusste, dass sie mit dem Unwichtigsten begann.
Stimmt. – Die Expertin mischte sich ein. – Frauen trugen um 1600 nur zu großen Festlichkeiten ausgeschnittene Gewänder.
Und er war nicht ihr Lehrer. Schon lange nicht mehr. Wenn es überhaupt stimmte. Da arbeiten wir … historisch nicht korrekt, sagte Joy unsicher und schaute zur Expertin, die sich Notizen machte.
Herrgott, ja! – Nun wurde Lena laut. – Aber wir machen keinen Dokumentarfilm. Und es geht darum, den gierigen männlichen Blick zu zeigen. Der auf eine Frau fällt wie ein Urteil. Zack! Jede Frau kennt das. Und die Situation Lehrer-Schülerin ist nun einmal typisch.
Genau, sagte Joy, das ist es wohl, was mich stört. Es ist … der männliche Blick.
Der männliche Blick auf das Opfer. – Lenas Assistent sprang ihr bei.
Joy nickte. Die anderen schwiegen eine Weile.
Die Frage ist doch, sagte der Assistent vorsichtig, ob wir die Szene überhaupt so ausführlich brauchen.
Sie eröffnet immerhin den Film!, zischte jetzt Tim, der Drehbuchautor. – Es ist der Beginn und gleichzeitig die Schlüsselszene. Auch Leute, die Artemisias Werk nicht kennen, haben davon gehört. Sie wird geradezu identifiziert mit der Untat. Wir holen die Leute ab, verstehst du? Und Missbrauch kennt ja jeder.
Joy winkte ab. Sie war plötzlich unglaublich müde. Es kostete Kraft, einer ganzen Crew in den Arm zu fallen. Sie wusste, dass sie alle dafür zahlen würden. Mit noch mehr Hektik, noch mehr Eile. Jede Minute eines Drehtages, in der nicht gearbeitet wurde, galt als Verschwendung. Sie spürten den Druck. Und dennoch. Sie überlegte, wie sie weiter argumentieren könnte, dankbar, dass die anderen sie ließen. Es war eine gute Crew, eine nachdenkliche. Die Regisseurin war keine Tyrannin, sondern eine, die ihr Team ernst nahm. Joy suchte nach Worten, stotterte, unterbrach sich, begann von neuem.
Ich glaube, ich habe verstanden, sagte die Expertin schließlich langsam. – Ich verstehe dein Problem, Joy.
Sie schaute erst die Hauptdarstellerin an, ließ dann den Blick schweifen, zum Autor, zur Regisseurin. Die war gespannt.
Ja?
Die Expertin holte tief Luft: Ist es das, was du meinst, Joy? Die Frage ist doch: Wessen Geschichte erzählen wir hier eigentlich?
1. Rom
Das kleine Mädchen hielt fest die Hand des Vaters. Es versuchte zu sehen, was da vorn geschah. Aber es war zu klein. Es sah nichts als die Manteaux und die Reifröcke der Damen und die sich plusternden Hosen und die Umhänge der Männer, und sie hörte nichts als das betende Gemurmel der Umstehenden. Steife Gewänder, stetes Raunen. Schwarz, Schwarz und Schwarz. Der Vater schwieg. Er sprach die Gebete nicht mit. Er sprach überhaupt so gut wie nichts in den letzten Tagen. Orazio Gentileschi, der Leutselige, der Maler, der stets Freunde um sich scharte, der die Tavernen von Rom ebenso liebte wie die Ateliers, war verstummt. Ein Berg. Finster. Undurchdringlich. Seine Kiefer mahlten. Seinen Blick konnte Artemisia nicht sehen.
Vater? Natürlich sagte sie das nicht. Nicht jetzt in der Kirche. Es fiel ihr schwer, zu gehorchen, aber sie galt als folgsames Kind. Als das liebenswürdigste der vier Kinder. Ihre drei Brüder standen rechts und links, heulten. Artemisia blieb stumm und aufrecht. Verstand sie, was da gerade geschah? Verstand sie, dass dies hier ein Abschied für immer und eine Katastrophe für sie und für ihre Familie war? Die Mutter war gestorben, mit knapp dreißig, im Kindbett. Man hatte sie aufgebahrt, ihr den toten Säugling auf die Brust gelegt, in die wachsweißen Arme. Die Kerzen in Santa Maria del Popolo flackerten, der Weihrauch stank. Die Leute standen und schwankten, so lange dauerte die Totenklage, so sehr fehlte Luft zum Atmen in dieser trauerschwangeren, beißenden Atmosphäre. War der tote Säugling ein Mädchen? Oder ein Junge? Artemisia wusste es nicht mehr. Die letzten Tage waren verschwommen, der Morgen, der Abend. Sie war aufgestanden, hatte zusammen mit der weinenden Magd den Brüdern das Frühstück bereitet, das genauso gut eine Vesper hätte sein können, hatte serviert und abgeräumt, gebürstet und gewaschen. Sie war elf Jahre alt. Sie war jetzt eine Frau. Und verantwortlich für die Brüder.
Der Vater drückte ihre Hand. Artemisia schaute nach oben. Jetzt schaute er sie an, aber er schien sie nicht zu sehen. Er war weit weg. Würde er zurückkommen?
Prudenzia Montone war die Liebe seines Lebens gewesen. Eine gute Partie, gewiss. Aber Liebe? Die Zechkumpane hatten sich gewundert. So etwas gab es doch nicht. Oder man nahm es in Kauf, so wie man einen Gewittersturm in Kauf nahm. Legte sich wieder. Dass aber ein Mannsbild wie Gentileschi, aufgeräumt, trinkfest, ein rechter Kerl, so versessen war auf ein Weibsbild! So redeten sie in der Taverne, wenn sie glaubten, dass die kleine Artemisia nicht zuhörte oder nicht verstand. Vielleicht hatte Orazio sie auch nur bekommen, weil sie einen brauchte, schnell und diskret. Man kannte so was, da war etwas unterwegs. Artemisia hörte und versuchte zu verstehen. Sie wurde geschickt, um den Vater abzuholen, was mal besser, mal weniger gut gelang. Sie hasste das. Sie mochte die Luft in der Taverne nicht, die schwer vom Wein war, sie mochte das Reden der Männer nicht, das ebenso unsicher war wie ihr Gang, wenn sie sich endlich erhoben, um nach Hause, zu Frau und Kindern zu gehen, so wie ihr Vater, meistens jedenfalls, wenn sie nur genug auf ihn eingeredet, ihn am Ärmel gezogen, ein bisschen gebettelt und gegreint hatte. Ihr Vater war oft genug der Mittelpunkt solcher Männerzusammenkünfte, und doch war er anders. Oft saß er mit den Kumpanen beieinander, sie bildeten einen Kreis, aber die Abstände zu seinen Nebenleuten waren bei Orazio Gentileschi größer als bei den anderen. War das Respekt? War das Befremden? Vielleicht eine Mischung aus beidem. Keinen Augenblick vergaß Orazio Gentileschi, wer er war: ein Künstler. Der Künstler. Jedenfalls einer der angesehensten Künstler im Rom seiner Zeit. Das hatte er seiner Tochter immer wieder erklärt, den Zeigefinger erhoben, den Oberkörper zu ihr herabgebeugt, die Miene freundlich.
Vergiss das nie: ein Künstler!
Auf einer Stufe mit dem benedeiten und verfluchten Merisi. Allenfalls diesen ließ der Vater gelten. Michelangelo Merisi aus Caravaggio. Er ließ sich allerdings selten hier blicken – und wenn, dann nur, um Geld zu leihen, weil er schon wieder vor irgendwem irgendwohin fliehen musste. Immer war Merisi in Bewegung, es war ein Rätsel, wie er überhaupt zum Malen kam. Artemisia sah sich um: Merisi war nicht da. Er war wieder einmal zu weit gegangen. Diesmal hatte er den Vater gekränkt oder herausgefordert, was ein und dasselbe war. Er war in ihrem Haus vorstellig geworden, als die Mutter gerade gestorben war. Aber was hieß gestorben: elendiglich eingegangen war sie, nachdem man das Kleine nach drei Tagen endlich aus ihrem wunden Leib hatte holen können, ausgeblutet war sie, niemand hatte das stoppen können, sie hatte erst gejammert und geklagt, sich gewunden und die Tücher, die man ihr gab, mit schweißnasser Hand weggeschoben. Dann hatte sie sich ausgestreckt, war, so schien es, von Minute zu Minute bleicher und stiller geworden, das Laken über ihrem Leib sank ein, in der Mitte über ihrem Körper ein dunkler Fleck, der immer weiter wuchs, bis die Hebamme das Tuch fortriss und ein neues auflegte und wieder ein neues. Artemisia hatte nicht hinschauen können, wenn die Laken erneuert wurden. Das Kleine war ganz blau gewesen, und es atmete nicht. Erschrocken hielt Artemisia es in den Armen, wusste nicht, wohin damit. Es war nicht ihre Aufgabe, ein totes Kind zu halten, nackt und bloß, sie nahm ein paar Tücher, hüllte es rasch und ungeschickt ein, wiegte es automatisch, so wie sie es die Frauen tun sah, aber natürlich regte sich nichts, griffen keine kleinen Finger nach ihr, greinte und schluckte nichts. Alles blieb stumm. Nur die Mutter atmete schwer, jetzt sah Artemisia, dass sie ihre Augen auf sie richtete, auf sie und das Neugeborene, und Artemisia konnte nicht anders, zupfte die Tücher ein wenig beiseite, sodass die Mutter das kleine Gesicht des toten Kindes sehen konnte:
Schau nur!
Aber da waren schon wieder die anderen bei der Mutter, die Hebamme und sogar ein Arzt, den der Vater eilends gerufen hatte, und der Blick der Mutter wurde verstellt, jetzt brachen Geschäftigkeit aus, Rufen und Klagen:
Prudenzia! Atme!
Und nach Tüchern und mehr Wasser wurde gerufen.
Heißes Wasser?
Nein – kaltes!
Aber der endgültige Blutsturz der Mutter war nicht abzuwenden. Alles färbte sich rot. Das Rot überschwemmte die Bettstatt, die Laken, die Tücher, färbte das Weiße glutrot und das Graue dunkel, und Artemisia wurde aus dem Zimmer geschoben, immer noch das tote Kind auf dem Arm.
Am nächsten Tag war Merisi gekommen. Um seine Aufwartung zu machen, so sagte er, und der Vater hatte es merkwürdig gefunden, dass der Malerfreund am Totenbett eine äußerst traurige Miene gezeigt hatte, sogar weinte und schluchzte und dann bat, ihn einen Augenblick allein zu lassen mit der Mutter und dem Kind in ihren Armen. Der Vater hatte schließlich eingewilligt und mit schweren Schritten das Zimmer verlassen, die anderen mit sich ziehend. Dann hatte ihn jedoch ein böser Verdacht befallen, und er hatte sich umgewandt und war die Treppen nach oben gestürzt. Artemisia, die wie immer hinter ihm blieb, sah, wie er in das Totenzimmer trat, erstarrte, mit ein, zwei großen Schritten bei Merisi war und dem etwas aus der Hand schlug: einen Skizzenblock und einen Stift. Und dann holte er aus und gab Merisi eine Ohrfeige.
Raus hier! Verlasse mein Haus!
Eine Ohrfeige war weitaus schlimmer als ein Faustschlag. Demütigend. Etwas für Frauen und Kinder. Nichts für eine Auseinandersetzung unter Männern. Und so schlich Merisi geduckt und mit brennend roter Wange an Artemisia vorbei aus dem Haus. Aber: Täuschte sie sich? Oder hatte er ihr tatsächlich noch zugezwinkert?
Merisi hatte die Tote und ihr Kind zeichnen wollen.
Die Maler von Rom waren versessen auf den Tod.
Hingegossene, in Verzückung erstarrte Nonnen, heilige Märtyrerinnen, die die Augen verdrehten, bleiche, schöne Tote, Ohnmächtige, gebettet auf Rosen oder kostbare Tuche – das waren die Stoffe, das war gefragt. Artemisia mochte diese Mode nicht. Sie mochte die ohnmächtigen Frauen nicht. Sie wollte, dass Frauen klaren Blickes aus den Gemälden schauten, dass sie aufrecht standen, dass sie dort, wo sie darniederlagen, schon im nächsten Augenblick wieder aufstehen würden. Sie wollte, dass die Frauen die Augen offen hielten – und die Arme. So wie die Mutter, bis zuletzt. Oder wie die Cenci. Auch, wenn es der nichts genützt hatte.
Die Cenci! Warum fiel ihr ausgerechnet jetzt die Cenci ein? Weil auch sie eine tote Frau war – und eine, die Merisi zeichnen wollte?
Bei der Hinrichtung der Cenci war Artemisia sechs Jahre alt gewesen. Der Vater hatte sie mitgenommen zum Castel Sant’ Angelo, zur Engelsburg. Links von ihr der Vater, rechts der Kollege Merisi. Beide Männer waren aufgeregt. Sie merkte das, weil der Vater noch mehr redete als sonst und weil Merisi schwitzte, obwohl dieser Septembertag des Jahres 1609 eher kühl war. Sie waren nicht allein. Hunderte, nein Tausende Männer und Frauen machten sich auf den Weg. Sie nahmen eine der Brücken über den Tiber und dann nach links, da, wo sich in der Ferne die gewaltige Baustelle der Papstkirche in den Himmel schraubte. Hier ragte die Hadriansburg als runder, gewaltiger Turm empor, ein Bau, der schaudern machte, abweisend, trotzig und düster. Früher, so hatte es der Vater berichtet, hatten sich die Päpste hierher geflüchtet, wenn ihre Feinde übermächtig geworden waren, aber längst flüchteten sie nicht mehr, sie schlugen vielmehr in die Flucht, sie verbannten, ließen foltern und töten. Aus der Festung war ein Kerker geworden, mit einer Papstwohnung allerdings inklusive. Clemens VIII. legte Wert darauf, kein Erbarmen zu zeigen, auch jetzt nicht, da ihn eine Fülle von Bittschriften, von Protestnoten erreicht hatte, wo selbst bekannte Adelige für die Verurteilte eingetreten waren. Der Papst blieb hart. Die Cenci musste weg. In Artemisias Haus hatten die Eltern darüber gesprochen, fassungslos wie die meisten Römer. So klar schien die Sache, dass ein Kind sie verstehen konnte. Beatrice Cenci stammte aus einer adeligen, eigentlich begüterten Familie. Aber ihr Vater Francesco war ein berüchtigter Mann, ein Trinker und Schläger. Er trieb es mit allem, das sich nicht wehren konnte, mit Frauen, Männern und mit Tieren. Immer wieder war er angeklagt worden, aber sein Geld half ihm stets, sich freizukaufen. Schließlich verschleppte er seine zweite Frau und die Tochter auf eine Burg weitab von Rom, und dort schloss er beide ein. Jahrelang hörte man nichts mehr von ihnen und wenn, nur das Schlimmste. Die Leute in Rom flüsterten darüber, als könnten sie die Untaten des Mannes kleiner machen durch einen gesenkten Tonfall.
Artemisia erspähte zwischen den Rücken und Köpfen der Menschen, die vor ihr gingen, die Engelsburg. Ob Beatrice in solch einem Bau gefangen gewesen war? Vermutlich. Man wusste es nicht. Und ob sie dort ganz allein gewesen war? Man wusste es nicht. Man wusste nur, dass sie eines Tages all die Prügel und Missetaten nicht mehr aushielt und einen Mordplan fasste. Gemeinsam mit ihrer Stiefmutter und ihrem Bruder ließen sie den Vater umbringen. Ein Gutsverwalter half ihnen, den Alten mit Hammerschlägen zu töten. Aber die Sache flog auf. Die Männer und die Stiefmutter gestanden schnell unter der Folter, nur Beatrice, so hieß es, sei bis zuletzt standhaft geblieben. Was mochte das bedeuten? Bedeutete es, dass Beatrice buchstäblich stehengeblieben war, aufrecht? Dass sie schwieg? Oder dass sie der Kommission die Wahrheit entgegenschrie, ihren Zorn, ihren Schmerz? Wie wehrte man sich gegen Gewalt? Mit neuerlicher Gewalt? Mit Anständigkeit?
Die Mitglieder der Familie wurden einzeln herbeigeführt. Die Menge schrie auf, als sie Beatrice zu erkennen glaubte. Aber es war nicht Beatrice, es war Bernardo, der kleine Bruder, den man begnadigt hatte. Allerdings war er verdammt, zuzusehen bei dem, was nun folgen würde, deshalb führte man das Kind auf den Richtplatz. Die Menge begriff die Grausamkeit, die in der vermeintlichen Milde lag, und ein ungeheures Murren setzte ein, grollend und drohend wie ein Unwetter, das sich erst noch sammeln muss. Das Murren der Menge wurde lauter, dann begannen die Leute zu rufen und zu schreien – das war der Moment, als Beatrice Cenci auf den Richtplatz geführt wurde. Der Vater sagte es ihr, sehen konnte die kleine Artemisia nichts.
Vater, bitte!
Er nahm sie auf die Schulter. Und da erst erkannte Artemisia, wie unendlich groß die Menge war. Dicht an dicht standen die Menschen, dahinten war sogar ein Podest für die Zuschauer aufgebaut, als sei hier eine Prozession zu bestaunen oder ein Wettkampf. Auf den Balkonen pressten sich die Leute aneinander, auf den Dächern lagerten sie, aus den Fenstern hingen Menschenklumpen, und die Masse war keineswegs still, sie bewegte sich, auch um Artemisia bewegte es sich, die Menge schob und rückte, und der starke Vater schwankte in dem Bemühen, das Gleichgewicht zu halten, er stand breitbeinig, hielt die Arme vor der Brust verschränkt und schnaufte. Artemisia bekam Angst, aber nun war es zu spät, sie musste hier oben ausharren und alles sehen. Sie bemühte sich, den Blick nach vorn zu richten, auf den Richtplatz, auf diese seltsam nüchterne Bühne, nein, das war keine Bühne, das war der Altarraum einer Kirche, aber einer Kirche ohne Apostel, ohne Madonna, ohne Christus, ohne Heil. Da war nur der Altar, also der wuchtige Holzblock, in den die Delinquenten eingespannt würden. Auf diesem Holzblock mussten sie rittlings Platz nehmen, und der Altar verwandelte sich in eines der Unheil bringenden Pferde aus der Offenbarung des Johannes. Artemisia begann zu schwitzen. Gleich, gleich. Artemisia schaute nun doch nach unten, musste sich augenblicklich am Vater festhalten, denn so unruhig war die Menge, so chaotisch suchte ein jeder das Gleichgewicht zu halten, reckte sich, balancierte auf Zehenspitzen, fuchtelte, zeigte, wandte sich zum Nebenmann, schnäuzte sich, redete, dass einem schwindelig wurde wie bei einer Bootsfahrt auf dem Tiber. Es rumorte im Magen, es brannte im Kopf. Der Vater hielt jetzt ihre Beine fest, er merkte, dass sie unsicher saß. Und dann wurde es für einen Augenblick still. Der Henker mit seinem riesigen Schwert betrat den Richtplatz. Und dann sah Artemisia die Cenci am Rande des Richtplatzes stehen. Wie war sie dorthin gekommen? Wie hatte diese Person die Hand gegen den Vater erheben können, ihn töten lassen können? Es war undenkbar. Aufrecht stand sie, klein und schmal. Sie hatte die Arme ein wenig zur Seite ausgebreitet, wie jemand, der sagen will: Seht nur her, da bin ich. Warum zitterte sie nicht? Oder konnte man das Zittern nur wegen der Entfernung nicht sehen? Artemisia kniff die Augen zusammen. Sie wollte sich alles ganz genau einprägen: das lose, blaue Gewand, das man Beatrice übergeworfen hatte, die Haare, die ihr irgendjemand achtlos abgeschnitten hatte, sodass der weiße Nacken leuchtete. Die bloßen Füße. Die Hände, die aus den weiten Ärmeln ragten. Artemisia schaute und schaute, so angestrengt, dass sie sich die Augen reiben musste. Sie nahm aus den Augenwinkeln Merisi wahr, der neben ihr lächelte, nicht aufmunternd, sondern eher wie ein Komplize.
Kleine Seele, schweifende, zärtliche,
Gast und Gefährtin des Leibs,
Die du nun entschwinden wirst dahin,
Wo es bleich ist, starr und bloß,
Und nicht wie gewohnt mehr scherzen wirst …
Merisi trug die Worte ernst und bedächtig vor, er sprach sie vor sich hin, zu niemand Bestimmtem gewandt. Artemisia wusste, woher sie stammten: aus der Engelsburg. Es war eine Inschrift, die man dem Kaiser aus Vorzeiten zuschrieb und die jedermann kannte. Merisi war nicht gebildet, aber er wusste Gedichte und Lieder. Betete er etwa? Nein, er lächelte wieder sein ironisches Lächeln. Artemisia streckte die rechte Hand nach ihm aus, aber er ignorierte sie.
Die Wärter nahmen nun Beatrice rechts und links bei den Armen und führten sie zur Richtstätte, wo der Henker wartete. Die Menge schrie auf. Fäuste flogen in die Luft, Arme wurden nach oben gereckt. Gnade, Gnade! Die Menge schrie für die Cenci, sie protestierte, sie verfluchte den Papst und die Kirche, die, so wusste man, nichts Eiligeres zu tun habe würde, als sich den Reichtum dieser Familie unter den Nagel zu reißen, sobald ihre Mitglieder beseitigt wären. Die Menge brüllte. Da gab es weit hinter den Gentileschis ein gewaltiges Krachen, etwas barst, etwas polterte, und wieder schrien die Leute, ein Podest, auf dem viele Zuschauer gestanden hatten, war zusammengebrochen. Der Vater fuhr kurz herum, hielt Artemisia an den Beinen, aber dann kam wieder der unheilige Chorraum dieser heidnischen Kirche in den Blick, der Richtplatz, das Opfer, die Zeugen, der Pfaffe, und der Henker ließ sich jetzt nicht mehr aufhalten. Auch Beatrice, so schien es, hatte es nun eilig und schwang sich auf den Holzbock und beugte sich. Plötzlich ertönte ein Kanonenschuss vom Palast des Papstes, das war das Zeichen. Der Henker hob das Schwert hoch über den Kopf der Beatrice, holte noch einmal aus und – schlug zu. Die Menge fuhr zusammen, die Menge stand still. Artemisia zwang sich hinzusehen, die Hände vor dem Mund zu Fäusten geballt. Merisi neben ihr streckte sich. Seine Augen funkelten. Es war klar, dass er auf keinen Fall etwas verpassen wollte. Der Vater atmete schwer und stoßweise. Auf dem Richtplatz lag nun der Kopf der Cenci, ein paar Schritte weiter der blutige Torso. Artemisia brachte das nicht zusammen. Schon nicht mehr. Da der Kopf, dort der Leib. Hier die Augen, der Mund, die gestutzten Haare, dort die Arme, die Beine. Plötzlich wurde ihr übel. Der Vater ließ sie behutsam zu Boden gleiten.
Wer einen Menschen tötet, entzweit die Welt.
Hatte das der Vater gesagt? Oder Merisi, der neben ihnen blieb, als sie sich nun ebenso eilig wie vorsichtig den Weg zurück durch die Menge bahnten. Es war schwierig, Helfer versuchten, sich zum Podium durchzuarbeiten, hinten gab es ein Chaos aus Brettern, Bohlen und schreienden, klagenden Menschen, wütend wurden sie jetzt, fingen mit Nebenstehenden Händel an, weil die Wut irgendwo hinmusste, andere strebten wie sie weg von dem Platz, weg aus dem Wühlen, dem Toben, dem Schimpfen, dem tausendfachen Köpfeschütteln und Jammern.
Fort, nur fort!
Komm!
Artemisia aber ließ sich führen, sie hielt die Augen geschlossen, als wollte sie das grausige Bild, das sie eben gesehen hatte, auf jeden Fall bewahren, es einschließen hinter ihren zuckenden, sich wehrenden Lidern eines Kindes.
Bald haben wir es geschafft, sagte der Vater ungewohnt sanft, als sie in die Via dei Nari einbogen.
Geschafft? So etwas wie heute konnte man nicht schaffen, sagte sich Artemisia. Niemals. Man konnte es nur aufheben, mit sich tragen. Hatte sie genau genug hingeschaut? Hatte sie sich alles in korrekter Weise eingeprägt? Und was konnte man überhaupt sehen und was nicht?
Kleine Seele, schweifende, zärtliche,
Gast und Gefährtin des Leibs …
Wie Merisi die wohl malen würde?
Konnte man die Seele malen?
Der Vater hatte Merisi daran gehindert, bei der toten Mutter zu verweilen; er verbot ihm das Bild. Artemisia verstand es und verstand es doch nicht. Freilich, Merisi hätte fragen müssen. Und ja, vielleicht wollte der Vater diese Tote, seine geliebte Frau, die Mutter, ganz für sich. Warum malte er sie dann aber nicht selbst? Warum stattdessen dieses Spektakel, diese Totenmesse? Das halbe Viertel war gekommen, teils, um Abschied von einer geschätzten Nachbarin zu nehmen, teils, um Orazio die Ehre zu erweisen – aber wohl doch vor allem, um zu sehen, wie aufwendig die Gentileschis diese Beerdigung veranstalteten. Artemisia sah das Abschätzige in den Augen von vielen. Die Trauerfeier der Mutter war auch eine Feier der Möglichkeiten. Orazio Gentileschi zeigte, was er aufzubringen vermochte. Wie gleichgültig ihm die Riesensumme war, die das hier zweifellos kosten würde. Es sollte so aussehen, als spielte es keine Rolle, aber Artemisia hatte ihn rechnen sehen, sie hatte gesehen, wie er Papier um Papier nahm, beschrieb, den Zettel zerknüllte und nach einem neuen griff. Und dann die Wahl des Ortes! Nein, nicht die Kirche San Luigi dei Francesi, die Pfarrkirche, die die Gentileschis normalerweise besuchten. Vielleicht nicht, weil dort zwei Gemälde von Merisi hingen, dem ewigen Rivalenfreund? Und schon gar nicht die bescheidene Santa Maria in Via Lata, die in unmittelbarer Nachbarschaft lag und eher einem schwachbrüstigen Palazzo als einer Kirche glich. Der Vater hatte unwillig den Kopf geschüttelt. Die nicht!
Es musste Santa Maria del Popolo sein. Sie lag direkt am Stadttor, an der Porta Flaminia, und die von außen schlichte, etwas gedrungene Kirche erwies sich von innen als Schatztruhe, die vor Kunstwerken geradezu barst. Ja, auch hier gab es Bilder von Merisi, aber ebenso Werke ehrenwerter Kollegen wie Raffael oder Bregno, die die Verhältnisse zurechtrückten, wie der Vater meinte. Santa Maria del Popolo versammelte die Großen. Orazio Gentileschi zeigte mit der Trauerfeier für seine Frau, dass er genau hierhergehörte. Artemisia hatte es geschaudert, als er ihr von der Wahl der Kirche erzählte, er erzählte immer alles, er war ganz anders als andere Väter, er sprach mit seinen Kindern, als wären es seine Lehrlinge – und nicht mit den Lehrlingen, als seien sie Kinder. Er ließ sich von den Söhnen und dem Töchterchen begleiten, als er die Kirche in Augenschein nahm, genauer, als er es je zuvor getan hatte, er prüfte sie, als wollte er sie kaufen, und der Pfaffe oder Verwalter, der sie führte, wurde schon ungeduldig: Wusste nicht jeder Römer, was er an der Kirche hatte? Wie einzigartig und prachtvoll sie gerade in ihrer Schlichtheit war? Der Vater ließ seine kritischen Blicke schweifen. Nein, nicht eine der acht Seitenkapellen, nicht das Kirchlein des angeschlossenen Klosters, genau hier im Zentrum unter dem achteckigen Tambour vor dem Hauptaltar der Santa Maria del Popolo sollte Prudenzia aufgebahrt sein. Ganz Rom sollte sie sehen, seine tote Frau, seine Liebe – und ihn, den würdigen, untröstlichen Witwer. Er stampfte mit dem Stock auf, den er stets mit sich führte, wenn er wichtige Unterredungen vorhatte.
Artemisia löste die Hand unauffällig aus der des Vaters, entfernte sich und schaute sich um. Sie standen im Hauptschiff, kurz vor der Vierung, da, wo sich Langhaus und Querhaus kreuzen. Die Kirche war wuchtig, schwer, gediegen. Bündelpfeiler gruppierten sich aus hohen, halben Säulen. Die Pfeiler trugen die Rundbögen zu den Seitenschiffen, die meisten jedenfalls, andere reckten sich empor bis zum Gewölbe. Artemisia zuckte zusammen: War das alles Marmor?
Der Vater war ihr mit Blicken gefolgt, lächelte und rief ihr zu:
Was schaust du, Kind?
Artemisia ließ die Hand über einen der Pfeiler gleiten:
Ist das alles – Marmor?
Der Vater lachte, trotz seiner Trauer:
Alles Tand, mein Kind, alles Tand! Das ist Marmorimitat. Weniger Aufwand, mehr Effekt. Weniger Kosten, mehr Effizienz.
Er ließ die Söhne und den Pfaffen, mit dem er gerade verhandelte, stehen und näherte sich Artemisia.
Schau nur!
Er führte ihre Hand noch einmal, behutsamer, über den Stein. – Merkst du es?
Es ist nicht so kühl wie Marmor!
Genau. Wichtig ist auch die Temperatur der Dinge. Und merkst du, dass es rauer ist?
Artemisia nickte. Der Vater tat, als hätte er alle Zeit der Welt. Immer, wenn es um Bilder ging, um Skulpturen oder gar Bauten, war das so. Dann wandte ihr Vater sich wieder seinen Geschäften zu, der Organisation eines Abschieds. Und Artemisia tastete und schaute.
Jetzt war es gut, dass sie sich auskannte. Ihr war elendiglich zumute. Schwindelig. Hörte das denn nie auf mit dem Weihrauch? Mit dem Knien und Aufstehen, dem Murmeln und Beten? Einer der Brüder war eingeschlafen. Sein Kopf war auf das Kinn gesunken, er schnaufte leise im Schlaf. Der Vater ließ ihn, oder er bemerkte es nicht. Er schaute nach vorn, finster, er hatte die Augen zusammengekniffen, als wollte er Maß nehmen, dabei lief alles genau so ab, wie er es wollte, er bekam, was er bezahlt hatte, aber was er eigentlich wollte, das hatte er für immer verloren.
Artemisia sah sich erneut um. Niemand, der ihren Blick erwidert hätte. Niemand, der ihr zulächelte oder aufmunternd nickte. Die Menge hinter ihr starr und stumm, eine schwarzgekleidete Wand. Da war ihr, als würde sie in diese Wand stürzen und die Wand in sie. Da fing sie an zu verstehen, wie das sein würde, eine Welt ohne die Mutter.
Wenige Tage später begriff sie noch mehr. Das war, als der Vater ganz selbstverständlich davon ausging, dass Artemisia nun den Platz der Mutter einnehmen würde. Wer denn sonst? Wer sollte am Morgen die Brüder wecken, das Wasser holen, die Brüder anweisen, das Feuer zu entfachen? Wer, wenn nicht Artemisia, würde das Atelier fegen, den Raum lüften, um den Staub nach draußen zu entlassen und die Anstrengungen des vergangenen Tages, würde aufräumen, die Gesellen empfangen, ihnen erste Anweisungen geben, während der Vater, stumpfhaarig, unrasiert, den warmen Brei lustlos in sich hineinlöffelte, den sie ihm hinstellte, den Wein dazu schlürfte. Er brauchte seine Zeit. Und sie hatte ja genug davon. Die Brüder fügten sich murrend in das neue Regiment, weil es ihnen Vorteile brachte. Nach wie vor mussten sie sich um nichts kümmern, was sie nicht unmittelbar betraf, denn sogar die Wäsche besorgte Artemisia jetzt.
Sie hatte die Mutter oft begleitet. Dann waren sie zu dritt gewesen: Emilia, die Wäscherin und die Mutter redeten pausenlos bei diesen Unternehmungen; kaum dass sie das Haus verlassen hatten, begann das Geplapper und Geplauder. Es war nicht weit von der Via Margutta zur Piazza del Popolo, trotzdem schnaufte Prudenzia, wenn sie die Weite des Platzes betraten: Meist trug sie ja ein Kind unter dem Herzen, Artemisia hatte ihre Mutter eigentlich nie anders als guter Hoffnung erlebt. Deshalb eilten die anderen Frauen herbei, um ihnen zu helfen. Die Waschtage auf der Piazza waren fröhliche, nur halb organisierte Festtage der Frauen. An den Waschtagen gehörte der größte Platz des Campo Marzo allein ihnen, sie schufen eine neue Ordnung mit ihren Zubern, Kesseln und Tragen. Zunächst stellten sie die großen Körbe ab, scheinbar irgendwohin, als wollten sie die Wege markieren. Der Platz gab Pfade vor: von der etwas heruntergekommenen Stadtmauer am oberen Ende, da, wo sich das Stadttor zur Via Flaminia öffnete, bis zum Zentrum des Platzes. Dort stand der riesige Obelisk, einer von der Art, wie sie der Papst etlichen Plätzen spendiert hatte, warum, das begriff keiner so recht; die Fremdkörper mit ihren ägyptischen Hieroglyphen waren jedoch recht schmuck, und es war leicht, sich an ihren Sockeln zu verabreden, Ziegen konnte man hier anbinden, das war praktisch. Weiter südlich mündete der Platz in die drei großen Straßen, die die Stadt wie einen Fächer teilten. Über die Via del Corso waren sie gekommen, in der Via Paolina würde der Vater später einkehren, und über die Via di Ripetta sprachen sie nur hinter vorgehaltener Hand, denn dort gingen liederliche Frauen ihren Geschäften nach. Der Platz bündelte und fasste alles – aber er überließ es den Menschen, wie sie ihn nutzten. Es war ein Platz, der Ruhe ausstrahlte, Gelassenheit. Diese Ruhe strömte in die Lebensadern der Stadt. Wenn die Frauen ihre Körbe abgesetzt und auf diese Weise ihre Plätze markiert hatten, inspizierten sie die Waschtröge, begrüßten einander, hielten einen Schwatz, besprachen die Sorgen der letzten Woche. Und dann begann das Einweichen und Reiben, das Kratzen und Rubbeln, das Herausnehmen, Schwenken und Wiedereintauchen, bis die Leintücher endlich prüfend gegen die Sonne gehalten wurden, die eine oder die andere Frau zufrieden nickte, die nun schweren Tücher mit der Hilfe einer zweiten faltete und wieder in den Korb legte. So ging das bis mittags, bis die Sonne unerbittlich brannte. Dann war aber noch genug Zeit, die reine Last ein paar Meter nach oben zu schleppen, auf den Pincio-Hügel, dahin, wo der Park der Borghese begann. Zwischen den Pappeln ließ sich die Wäsche gut trocknen; die Besitzer des Palazzos duldeten das, schließlich trockneten auch ihre Tafeltücher zwischen den anderen. Jedes Mädchen lernte das Ritual beizeiten; Artemisia war, kaum dass sie laufen konnte, an der Hand der Mutter zum Waschplatz gegangen, und so hatten sie es weiterhin getan, Woche für Woche, und das Tragen des Korbs der Wäscherin Emilia und deren Freundinnen überlassen. Und jetzt? Jetzt war sie allein mit der Wäscherin. Niemand hielt ihre Hand. Und der große Platz, der immer freundlich und fröhlich auf sie gewirkt hatte, war plötzlich gewaltig und leer. Die Menschen schienen sich darauf zu verlieren. Artemisia erinnerte sich daran, dass die Piazza del Popolo ehedem auch als Richtplatz diente, dass hier Missetäter geköpft oder mit dem Schwert hingerichtet wurden, bevor der Papst einen feineren Platz dafür eingerichtet hatte. Wie konnte da Wäsche sauber werden? Und wehte nicht ein garstiger Wind? Der Obelisk ragte in der Mitte empor wie der mahnende Zeigefinger des Vaters: Spute dich, komm schnell zurück, führ keine losen Reden, mach mir keine Schande! Der Vater jagte sie zur Arbeit – und hielt es nicht aus, wenn sie unterwegs war. Er sprach stundenlang mit ihr über die Kunst seiner Kollegen – und brauste plötzlich auf, dass sie ihm die kostbare Zeit stehle. Hinaus! Mach deine Besorgungen! Er witterte, dass sie Zeit vertrödelte. Oder dass sie sich mit den falschen Leuten unterhielte. Dass sie sich überhaupt unterhielte! War Emilia der richtige Umgang? Argwöhnisch bestellte er die Wäscherin ein, redete vorgeblich harmlos mit ihr, um sie zu prüfen, fand nichts, das sich hätte beanstanden lassen, und entschied gleichwohl, sie nicht mehr allein mit Artemisia zu lassen; einer der Brüder musste nun mitgehen zum Waschplatz, das war eine Demütigung für beide: für den Bruder Francesco, der Weiberkram zu erledigen hatte, und für Artemisia, die sich kontrolliert und gegängelt fühlte. Die Mutter fehlte. Sie fehlte überall. Sie hatte den Vater beruhigt und die Söhne zu Fleiß angetrieben. Sie hatte Schönheit in die Räume und Licht in die Wohnung gebracht. Sie hatte gesungen und Artemisias erste Malversuche lächelnd begleitet. Sie war mit ihr gegangen. Sie war überall gewesen.
Der Vater bemerkte wohl, dass seine Tochter immer stiller wurde. Dass sie den Löffel mit der Polenta sinken ließ und an den Brüdern vorbei ins Nichts schaute. Es machte ihn nervös. Es machte ihn hilflos. Es gab keinen Trost, er selbst wälzte sich schlaflos in jeder verfluchten Nacht, seit Prudenzia nicht mehr an seiner Seite war. Was sollte er seiner Tochter sagen? Alles wird wieder gut? Ha! Orazio Gentileschi spürte einen Grimm in sich, eine Wut über den Verlust. Man sah es in seinem finsteren Gesicht, in den zusammengezogenen Augenbrauen, auch, wenn er nur selten in seiner Arbeit innehielt und einen Pinsel zu Boden warf oder von der Leiter stieg, um eigenhändig die Position eines Modells zu verändern, mit ruppigen Händen: Nicht so! Sondern so! Wie stehen denn Engel da? Du jedenfalls gebärdest dich wie ein Bauer!
Und dann liefen die Modelle davon, und die Gesellen mussten neue suchen. Sie blieben für Tage oder Stunden verschwunden, was den Vater noch mehr aufbrachte. Und diese Stimmung ließ er Artemisia spüren.
Komm und beeil dich!
Warum sind die Farben nicht angerührt?
Wann reinigst du die Paletten?
Heute Abend bekomme ich einen Besucher, bereite alles vor.
In letzter Zeit bist du nachlässig mit den Mahlzeiten.
Und so fort. Er trieb sie an, damit sie nicht so viel grübelte, sagte sich die Tochter. Es mochte also eine eigentümliche Form der Sorge dahinterstecken, aber es verletzte sie doch. Und es machte sie gänzlich unfrei. Nie, niemals hatte Artemisia eine ruhige Minute. Also zog sie sich noch mehr in sich selbst zurück, wurde bockig, wie ein Tier im Pferch, das Anlauf nimmt.
Irgendwann jedoch besann sich der Vater, wie es schien.
Komm, Kind!
Er erklärte nichts, obwohl es noch sehr früh am Sonntagmorgen war. Das musste er auch nicht. Er war der Vater. Artemisia aber war es gewöhnt, dass er sprach. Meistens ging es um Kunst, um Malerei, dann war der Vater kein Vater, sondern ein Künstler, einer, der brannte, der leuchtete und dem es gleichgültig war, dass er es mit einer Zwölfjährigen zu tun hatte, Hauptsache, sie war an seiner Seite, Hauptsache, sie stellte sich gelehrig an.
Komm, Kind!
Er winkte ihr, mitzugehen, wie er seine Gesellen angewiesen hätte, herrisch und grob.
Mach schneller!
Warum?
Er warf ihr die Pelerine über.
Wirst schon sehen!
Der Vater wählte den Weg zum Tiber, über die noch menschenleere Brücke, und dann bogen sie ab, in den Rione Borgo, die Leostadt, wo alles im Zeichen des Löwen, also des Papstes stand, und da tauchte schon der riesige, erdbraune Klotz auf, den Artemisia mied, wie alle Römer, die jung waren und ohne Malaisen: Santo Spirito in Sassia, das Hospital, ein Segen für die Kranken, ein Monster für die Gesunden, ein unübersichtlicher Bau auf einem dreieckigen Grundstück, zu jeder Seite abgeschlossen, mit wenigen Fenstern ausgestattet, aus denen man die Kranken und Moribunden stöhnen und die Findelkinder schreien hörte, auch jetzt.
Kommen Sie, Vater! – Artemisia zog Orazio am Arm.
Der Vater war enttäuscht, nicht, weil er Artemisias Zaghaftigkeit töricht fand, sondern weil er auf die Kranken hoffte. Er hoffte auf interessant zerlumpte oder geschädigte Figuren, die an den wenigen Pforten des Krankenhauses um Einlass bettelten. Ein paar Pilger wären auch gut. Aber heute war es noch still. Der Vater schüttelte enttäuscht den Kopf. Sie umrundeten das Hospital, gelangten auf die Piazza della Rovere – und da leuchtete der Prachtbau in überraschender Nähe: Der Petersdom, Sitz des Papstes, war eine ewige Baustelle – aber was für eine! Ob Julius II. den Riesenbau in Auftrag gegeben hätte, wenn er gewusst hätte, wie lange es dauern würde? Freilich sollte San Pietro nicht einfach nur eine Kathedrale werden – nein, Julius II. und seine Nachfolger träumten von der mächtigsten Kirche der Welt. Aber erst Michelangelo, der größte unter allen Künstlern, hatte einen Entwurf gemacht, der alle mitriss.
Mi-chel-an-gelo. – Artemisia sprach den Namen so aus, wie tief Gläubige einen Heiligen anrufen.
Ja, Michelangelo, erwiderte Orazio. – Rom sähe ohne ihn anders aus. Ein fantastischer Mann! Aber Carlo wird es schon richten!
Carlo, das wusste Artemisia, war Carlo Moderno, der berühmte Architekt. Orazio war nicht wenig stolz darauf, mit ihm befreundet zu sein.
Komm näher!
Orazio wollte die Baufortschritte sehen. Über der alten Basilika, die so lange bestand, wie die römische Erinnerung dauerte, hatte Michelangelo eine neue Kirche geplant, so groß und so weit wie Straßenzüge, so hoch wie der Himmel selbst. Das Kirchenschiff war jetzt fertig. Unter den Gerüsten sah man die erhabenen Mauern. Die Baustelle ruhte heute am Feiertag. Aber einige Wachen waren da. Sie näherten sich Vater und Tochter mit angemessen finsteren Gesichtern.
Was wollt ihr?
Ich bin Orazio Gentileschi …
Und?
Der Name schien die Wachleute nicht zu beeindrucken, wohl aber die Silbermünze, die Orazio hervorholte. Er hatte, das war Artemisia nun klar, irgendetwas vor. Die Wachen ließen sie durch. Sie bahnten sich einen Weg durch Sperren und Baumaterialien, fanden eine offene Tür, glitten in das Dämmerlicht des riesigen Baus.
Vater!
Das hier war so groß, dass es größer schien als die Weite des Platzes. Das war keine vertraute Basilika, in der man sich sogleich zwischen Westseite und Chor, zwischen Apsis und Seitenschiff hätte orientieren können. Das hier war – eine Landschaft aus Stein. Artemisia legte den Kopf in den Nacken, blinzelte. Die Luft war noch immer staubig, obwohl die Arbeiten gewiss seit einem Tag eingestellt waren. Die meisten Fenster waren verhangen, sodass sich kaum ein Lüftchen regte. Trotzdem fröstelte Artemisia. Das war zu gewaltig für einen Menschen!
Komm weiter!
Der Vater hatte offenbar etwas Bestimmtes im Sinn. Er suchte. Er schaute sich um. Er schritt schnell aus, nur, um sofort eine neue Richtung einzuschlagen. Und dann hatte er es gefunden. Er wollte Artemisia ungeduldig zu sich winken, aber plötzlich schienen seine Arme schwer zu werden, sie sanken langsam herab.
Artemisia! – Seine Stimme war ungewohnt leise.
Die Tochter ging zu ihm. Orazio stand vor der schönsten Skulptur, die man sich vorstellen konnte.
Artemisia! Orazio sagte es leise, fast flüsternd. Er wies still nach vorn.
Die Mutter hielt den toten Sohn auf dem Schoß gebettet. Der Sohn war nackt und bloß, wie ein Kind, das gerade auf die Welt gekommen ist. Das Gewand der Mutter rahmte sanft die innige Umarmung, in der die beiden ruhten. Unendliche Trauer und unendliche Zärtlichkeit gingen von dieser lebensgroßen Figur aus, obgleich sie doch aus Stein war. Aus blendend weißem Marmor, der selbst hier in der halbdunklen Kapelle leuchtete.
Michelangelo, sagte der Vater leise, als bedürfte es einer Erklärung. – Ich frage mich, wie er das gemacht hat. Er war fünfundzwanzig.
Fünfundzwanzig!
Es war klar, wie er das meinte. Er verglich das Talent Michelangelos mit dem eigenen, dessen Lebensspanne mit der seinen. Üblicherweise beschäftigte sich Orazio nicht mit Bildhauerei, obwohl es in der Via Margutta einige Steinmetze gab. Zu mühselig war ihm deren Geschäft, es hing zu sehr an schwer zu beschaffenden und obendrein teuren Materialien, auch war Orazio natürlich nicht entgangen, dass die schweren Statuen die Palazzi der Reichen nicht in so großer Zahl füllen konnten wie Gemälde. Wer die Welt bewegen wollte, schuf Statuen, wer eine Familie zu ernähren hatte, Gemälde. Manchmal beneidete er die Berserker unter den Künstlern aber doch, wenn sie in Gruppen aufbrachen nach Carrara, um dort den passenden Marmor zu suchen, wenn sie zurückkamen, sonnenverbrannt, ausgepumpt und fröhlich, mit schmerzenden Rücken, weil sie wider besseres Wissen bei den aufwendigen Transporten mit angepackt hatten. Dann ertränkten sie die Pein in der nächstbesten Taverne und hatten Heldengeschichten zu erzählen.
Nicht Michelangelo. Der war ein Einzelgänger gewesen, besessen, so berichtete man, einer, der immer gearbeitet hatte, zeichnete, entwarf, der den Knaben hinterhersah und sich gefährlich wenig um seine Auftraggeber gekümmert hatte – und genau das war seine Strategie gewesen: zur Schau gestellter Gleichmut. Aber dass sie aufgegangen war! Und dass er die besten, die kühnsten Entwürfe gemacht hatte! Immer! Und nun diese Figur. Der Vater atmete schwer.
Du weißt schon, Kind, was das hier ist?
Eine Pietà, antwortete Artemisia gehorsam.
Das meine ich nicht, sagte der Vater ungewohnt milde. – Das ist etwas, was man nur einmal im Leben zu sehen bekommt. Schau hin, schau genau hin! Und sag mir, was du siehst.
Die Trauer, die Umfangenheit. Je länger Artemisia die Figur betrachtete, umso sprachloser machte sie sie. Sie blickte ja nicht auf eine Geschichte, das hier stellte nicht eine bestimmte Mutter mit einem bestimmten Sohn dar – Michelangelo zeigte alle Mütter mit allen verlorenen Söhnen, so kam es ihr vor. Oder war dieser Gedanke gotteslästerlich, weil doch das Opfer der Maria einzigartig gewesen war? Wie verwirrend solche Schönheit sein konnte! Durfte sie das? Durfte Kunst, statt den Menschen zu erheben und ihn zur Andacht zu bringen, auch Zweifel nähren? Artemisia schob die Gedanken zur Seite, die ihr zu kompliziert wurden, sie zu sehr ablenkten von dem, was sie da staunend betrachtete. Sie schaute und schaute – und so sehr blendete das Weiß des Marmors, dass sie die Augen hin und wieder schließen musste; das Bild von der Skulptur aber blieb.
Hier wollte ich eigentlich … deine Mutter…
Artemisia verstand. Hier, zu Füßen von Michelangelos Madonna mit dem toten Jesus, hatte Orazio seine Prudenzia begraben lassen wollen. Aber das hätte selbst seine Möglichkeiten und seinen Mut zur Unmöglichkeit überstiegen – abgesehen davon, dass das Kircheninnere noch nicht fertiggestellt war und in der Kapelle Vergine della Febbre, in der die Pietà einstweilen untergebracht war, keine Trauerfeiern möglich waren. Aber irgendwie … Der Vater haderte. Hier wäre der ideale Platz gewesen, hier und nur hier wäre sie möglich gewesen, die einzig wahre, die angemessene Abschiedszeremonie für seine geliebte Frau. Der Vater schaute abwesend, voller Kummer. Er wischte sich mit dem Ärmel über die Nase.
Artemisia runzelte die Stirn. Der Vater lachte:
Das kriegst du schon wieder sauber!
Gewiss, gewiss!
Es tat gut, das Schweigen für einen Moment zu brechen.
Sie verließen die Kirche, und das Schweigen holte sie wieder ein. So gelangten sie zurück zum Hospiz, zur Tiberbrücke. Den aufkommenden Wind hörte man umso deutlicher, er ließ die Silberpappeln rascheln. Auf dem Wasser zischten Vögel dahin wie filigrane Boote. In der Ferne hörte man Kessel aneinanderschlagen, Fenster, die geöffnet wurden, Rufe über Gassen hinweg, das Rumpeln von Rädern. Allmählich erwachte die Stadt. Sie hörten die Glocken von Santa Maria del Popolo.
Wäre das nichts für dich?, fragte der Vater endlich.
Was – die Bildhauerei? Artemisia lachte, denn dass ein Mädchen sich dem Steinehauen widmete, war unvorstellbar.
Nein, sagte der Vater langsam. – Ich meine, wir waren beim Hospiz, beim Kloster. Wäre das nicht ein Weg für dich? Zu den Nonnen?
Er schaute sie nicht an bei dieser Frage, er schaute auf das Wasser. Artemisia spürte, wie der Boden unter ihr zu weichen schien. Sie klammerte sich an der Brüstung fest.
Vater – wie?!?
Du hast mich schon verstanden.
Seine Stimme war wieder sicher, von ungewohnter Schärfe, leise.
Artemisia schlug die Hände vors Gesicht, hielt sich fest, damit sie nicht vor Furcht und Entsetzen gänzlich aus den Fugen geriet. Deshalb der Spaziergang. Deshalb das vertrauliche Miteinander. Michelangelo war nur ein Vorwand. Oder die Schönheit hatte sie milde und nachgiebig machen sollen. Der Vater wollte sie in ein Kloster stecken!
Artemisia wandte sich um. Sie wäre fortgelaufen, wenn der Vater sie nicht am Arm gepackt hätte.
Artemisia! Schau mich an!
Artemisia schüttelte den Kopf, wehrte sich, warf den schwankenden Körper gegen die Brüstung. Der Stein war kalt. Der Vater hielt sie fest mit eiserner Hand. Der Tiber rauschte. In ihren Ohren brauste es. Sie wollte springen. Der Vater hielt sie. Es gab keinen Trost.
Der Vater sprach weiter. Sie verstand kaum etwas von dem, was er sagte. Sie verstand nur, dass sie fort sollte. Zu den Nonnen, die der Vater sonst verachtete. In ein Kloster, draußen vor der Stadt. Fort, fort. Sie versuchte, die Finger in den Stein zu graben; der Schmerz war wohltuend. Der Vater redete und redete. Seine Stimme klang wie Eisen. Seine Stimme war laut, ganz so, als stünde sie meterweit von ihm entfernt. Es gab nur Härte. Aber Obacht – die würde sie auch aufbringen, ja gewiss!
Artemisia sammelte sich. Sie richtete sich auf. Sie reichte ihrem Vater, wenn sie sich streckte, bis über die Schulter. Sie reckte das Kinn vor. Sie schaute ihrem Vater direkt in die Augen.
Wenn Sie das tun, Vater, wenn Sie mich zu den Nonnen schicken, dann … – sie wies auf den Fluss – dann gehe ich hierhin. Dann schlage ich mich zu den Fischen!
Sie wich der Ohrfeige aus, die der Vater ihr geben wollte.
Gotteslästerlich!, brüllte er.
Und wenn!
Zu ihrer eigenen Überraschung brüllte sie zurück. Sie starrten sich feindselig an wie zwei Bravi, betrunkene, schwankende Räuber, die gleich aufeinander losgehen werden.
Nein! Niemals!
Zu Hause in ihrem Zimmer angekommen, warf sie sich aufs Bett und weinte zwei Tage lang. Als sie endlich aufstehen und hinuntergehen wollte, weil sie der Hunger übermannte, stellte sie fest, dass die Tür abgeschlossen war. Der Vater hatte entschieden. Wenn sie nicht zuließ, dass die Nonnen sie erzogen, dann würde er selbst auf sie achtgeben, auf seine Weise. Sie würde schon sehen!
Die Jahre wurden entsetzlich. Die Jahre wurden dunkel. Die Jahre waren, als wäre es immer November in Rom, als gäbe es keine Sonne und keine Wärme mehr. Das lag daran, dass Artemisia das Haus nicht mehr verlassen durfte. Wozu auch, befand der Vater. Es gab im Inneren genug zu tun. Der Haushalt musste besorgt, die Brüder mussten ernährt, ermahnt und angeleitet werden. Ebenso das Mädchen, die Bedienerin, die Wäscherin. Die Werkstatt wollte tagtäglich vorbereitet sein – und abends wieder aufgeräumt. Für Besucher des Vaters galt es zu sieden, zu backen und zu kochen, damit mögliche Auftraggeber großzügig gestimmt würden. Artemisia wurde dreizehn Jahre alt, vierzehn, fünfzehn. Sie war eine Mutter ohne Kinder, eine Hausfrau ohne Schlüssel, eine Ehefrau ohne die Zuneigung des Gatten. Sie wurde empfänglich für Liebe. Oder für das, was sie dafür halten musste. Sie saß in ihrem Zimmer, stundenlang, tagelang, mit wehen Fingern und Händen. Die Hände waren vom steten Waschen und Putzen geschwollen, die Finger gekrümmt und gerötet vom Arbeiten mit dem Pinsel. An den langen Nachmittagen wollten die Hände nicht mehr, die Hände bedeuteten ihr: Nun ist es genug. Artemisia saß also da, sie bemühte sich, sich nicht zu rühren, sie wollte nicht bemerkt werden, keine neuen Aufträge erhalten, keine Befehle ausführen, keine Bitten erhören. Wie lange würde sie sitzen müssen, um sich in einen Stein zu verwandeln? Kühl und unangreifbar zu werden, schlank und anmutig wie der Tod selbst, den Michelangelo dargestellt hatte. Der hieß bei ihm Christus und ruhte in den Armen Mariens, aber Artemisia hatte den Bildhauer durchschaut. Um den Tod selbst war es ihm gegangen, da war sie ganz sicher, um die endgültige Ruhe, die Stille. Aber wer würde sie halten? Im Haus rumorte es. Türen öffneten sich und wurden geschlossen. Als sich Artemisia endlich erhob, war sie ganz steif und kalt. Ihr war kalt, obwohl es ein schöner Spätsommertag war. Schön und Spätsommer für die anderen, die hinauskonnten. Wenn sie zurückkamen, umarmte sie die Brüder manchmal. Nicht, dass ihr nach Zärtlichkeiten zumute war, dafür waren Giulio, Marco und Francesco nicht geeignet – aber sie rochen so gut. Sie rochen nach frischer Luft und manchmal nach den Pferden, die sie bewegt hatten, und oft genug nach dem Rauch aus den Tavernen, die sie mit dem Vater viel zu früh schon besuchten. Vor allem Francesco. Der ihr eigentlich hätte nahestehen können.
Leise und unendlich mühsam trat Artemisia ans Fenster. Wie schwer die Röcke wogen! Sie atmete aus und ein, aus und ein. Sie hob den Blick. Das war ihr kleiner Ausschnitt der Welt: das Haus gegenüber und seine schmalbrüstigen Nachbarn. Auf das Haus des Silberschmieds fiel noch ein Streifen Sonnenlicht. Der Silberschmied betrieb seinen Laden unten im Haus. Er hatte nicht viele Kunden, das hatte Artemisia längst bemerkt, aber diese waren interessant: gut gekleidete, feine Herrschaften, die Herren in den neuen Anzügen, die jetzt in Mode waren, Hose, Weste und Jacke fein aufeinander abgestimmt. Die Herren hoben den Respondent, wenn sie Artemisia oben am Fenster entdeckten, sie lüfteten den Hut so schwungvoll, dass selbst die Fuchsschwänze schwangen. Manche lüfteten den Hut ein wenig zu lange, dann knufften sie ihre Damen in die Seite oder packten sie am Arm, dass die Capa ins Rutschen kam. Artemisia beneidete die Damen – nicht, weil sie Männer bei sich hatten, sondern, weil sie durch die Gassen gehen konnten, jedenfalls ein paar Schritte, solange es das steife Überkleid zuließ oder bis sie um die nächste Ecke in eine Sänfte steigen oder sogar in eine Kutsche gehoben würden. Bald wurde es kühler, die Herren lösten jetzt die Capa von der Schulter, über die sie den Ausgehmantel lässig geworfen hatten, und trugen sie wieder als Mantel. Fuchsschwänze ersetzten Pfauenfedern bei den Herren, wuchtige Umhänge die Überkleider bei den Damen. Artemisia liebte Mode, sie liebte Kleider – und sie liebte sie umso mehr, je weniger sie davon haben konnte.
Dann wurde es stiller in der Gasse, die Kunden huschten eilig unter Schirmen in die Läden und noch eiliger wieder hinaus. Es wurde dunkler und dunkler, und erst im darauffolgenden Frühjahr bemerkte Artemisia, dass sich ein neues Geräusch unter das alltägliche Scheppern von Rädern und Schleifen von Eimern mischte: Es klirrte allenthalben. Das Klirren kam von den Sporen, die die Herren jetzt an ihren stets blank gewienerten Stiefeln trugen, selbst die Alten, die sich kaum noch auf den Beinen halten konnten, trugen elegante Reitstiefel und daran, zur Zierde, die aufwendig gearbeiteten, oft fein ziselierten Sporen. Die Blicke aber blieben dieselben, nur, dass es jetzt wirkte, als läge Waffengetrommel darunter. Artemisia zuckte zusammen unter diesen fremden Blicken, trotzdem konnte sie es nicht lassen, sie herauszufordern. Der Zorn der Frauen, die Galanterien der Männer, das konnte sie nun schon gut voraussehen und ihren Grad berechnen, Artemisia stand am Fenster und übte Herrschaft aus. Es verlieh ihr Macht, aber keine Freude. Die Kunst der Manipulation war erfolgreich, aber nicht befreiend. Unwillkürlich klopfte sie sich manchmal das einfache Kleid ab, das sie tagaus, tagein trug, wenn die Leute vorbeigegangen waren. Etwas blieb hängen, etwas, das nicht gut war. Es fühlte sich an wie verdorbenes Obst, es machte den Gaumen pelzig, den Bauch sauer, es ließ sie nicht schlafen. Schauten sie der Vater und die Brüder ebenfalls so an? War auch in ihren Blicken so etwas wie …?