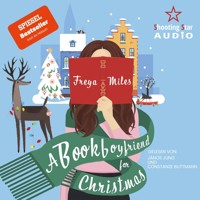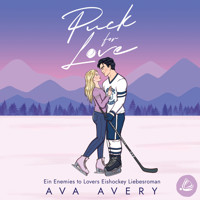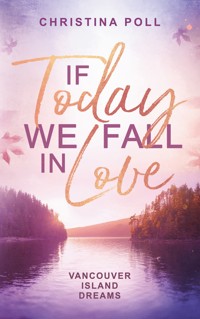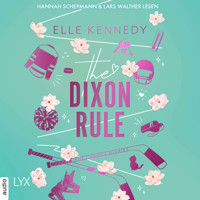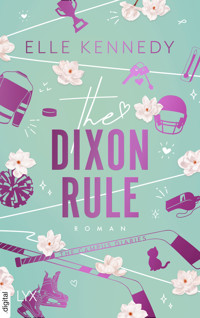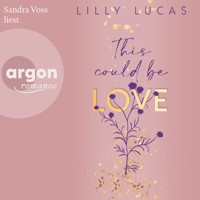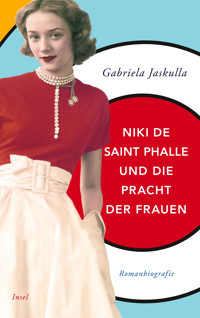
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie wurde geliebt und gehasst, als Femme Fetale bewundert und sexistisch beleidigt – die Künstlerin Niki de Saint Phalle (1930-2002) war eine einzige Herausforderung für ihre Zeit. Berühmt wurde sie für ihre knallbunten Nanas, die Gartenfiguren und Brunnen, ihre selbstbewussten Auftritte und ihre »Schießbilder« – aber dahinter steckt das Schicksal einer sensiblen und oft verletzten Frau.
In der Romanbiografie begibt sich Gabriela Jaskulla auf die Spur der großen Künstlerin und erzählt, wie aus der »adeligen Lady«, dem Missbrauchsopfer und der Femme Fatale die größte Plastikerin des 20. Jahrhunderts wurde – eine Künstlerin, die von einer »Stadt der Frauen« träumte und von einer gerechteren Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cover
Titel
Gabriela Jaskulla
Niki de Saint Phalle und Die Pracht der Frauen
Romanbiografie
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Insel Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 4912.
Erste Auflage 2022insel taschenbuch 4912Originalausgabe© Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2022
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Niki de Saint Phalle, 1949, Foto: Arnold Newman/Getty Images, München
eISBN 978-3-458-77343-6
www.insel-verlag.de
Widmung
Für die unterschätzten Städte
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Gegen Ende
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Danke
Informationen zum Buch
Niki de Saint Phalle und Die Pracht der Frauen
Gegen Ende
Gegen Ende liegt Niki de Saint Phalle erschöpft auf der Seite. Die Atemmaske behindert sie bei jeder Bewegung, aber bald wird es vorbei sein. Vor ihr liegen kleine Steine, Kiesel, glatt poliert die einen, unbearbeitet und rau die anderen. Braun, lapislazuliblau, weiß gesprenkelt. Auf manche haben Künstler mit jüngeren Fingern winzige Muster aufgemalt, blau auf weiß, wie holländische Kacheln im Miniaturformat. Gute Mitarbeiterinnen! Niki denkt voller Zärtlichkeit an sie. Niki hält eine Glasscherbe in der Hand. Sie hat die Form eines langgezogenen Dreiecks und ist sehr scharfkantig. Niki dreht und dreht die Glasscherbe, sie versucht, das Licht einzufangen, das durch das Fenster des Hospitalzimmers eindringt. Warmes Sonnenlicht, kalifornisches. Sie denkt an die Figuren, die sie auf den spiegelnden Wänden einer Grotte angebracht hat. Ein Raum der Grotte ist mit silbernen Spiegeln ausgestaltet. Ein weiterer Raum leuchtet mehrfarbig, der dritte strahlt im tiefen Blau des nächtlichen Himmels. Die Figuren scheinen sich über den Himmel aus Mosaikscherben zu schieben, sie streben nach oben, sie scheinen zu schwimmen. Himmelsschwimmerinnen. Es sind weibliche Figuren, Frauen, Engel – nicht alle sind vollständig, manche lösen sich auf, sind nur noch Hände, Beine, sind Korpus, Kopf und wehende Haare. Keine Bräute mehr, keine Engel. So wird es auch ihr bald gehen. Sie wird sich auflösen im Blau der Nacht.
Niki fasst die Scherbe fester. Sie wendet sie hin und her, ganz langsam. Da erwischt sie endlich einen Sonnenstrahl, der sich ins Tief des Krankenzimmers verirrt hat. Komm her, du! Niki atmet tief. Keine Kämpfe mehr, nur noch Scheinen und Weichen und Leuchten.
1.
Sie altert nicht gut. Das konnte man schon aus der Entfernung erkennen. Und nun aus der Nähe? Ganz so schlimm hatte sie sich den Zustand nicht vorgestellt. Martha Grünhold seufzte – eine unangemessene Äußerung, zu emotional. Schließlich war das hier ein Job, nicht mehr. Ein großer Job, zugegeben, aber dass er so herausfordernd werden würde? Sie sah wieder hin. Ziemlich mitgenommen, die Frau. Vorsichtig strich Martha mit der rechten Hand über die Flanke, über die Seite, dort entlang, wo bei einer schlankeren Statur Rippen zu erkennen gewesen wären. Hier gab es keine Rippen, hier gab es kein Schlüsselbein, ebenso wenig, wie sich auf dem Rücken die Wirbelsäule abgezeichnet hätte. Keine Knochen, nirgends; alles war rund und üppig und geschwungen – und so bunt, dass man schier die Augen abwenden wollte.
Nicht ihr Ding. Aber egal. Jede Figur verdiente Respekt. Auch eine solche Explosion von Weiblichkeit.
Schon wieder unangemessen. Wen interessierte ihr Urteil? Nicht einmal sie selbst. Urteile sind Abschlüsse. Ein Restaurator lebt aber vom Prozess. Grünhold, bleib sachlich, sonst siehst du nichts. Die alte Mahnung ihres Meisters. Schön langsam, schön objektiv bleiben, um der Sache nahezukommen. Einer der vielen Widersprüche im Restauratorenberuf. Fünf Jahre lang hatte sie das gehört; so lange hatte die Ausbildung gedauert. Dabei hatte sie bereits eine Ausbildung und einen Beruf. Aber die Restauratoren stellten alles auf den Prüfstand, hinterfragten jeden Kenntnisstand, checkten das Wissen. Fünf Jahre Konservierung und Technologie in Dresden und beinharte Prüfungen. Zweihundert hatten sich auf den Studienplatz beworben, fünf wurden genommen. Nichts war je genau genug. Ein Beruf für Perfektionisten und für passionierte Zweifler. Gleichzeitig musste man hinlangen können.
Sie versuchte, sich einen Überblick zu verschaffen über die Plastik, die da vor ihr lag, nein, die in acht Metern Höhe vor ihr schwebte: aufgehängt an Stahlseilen, mitten im Zürcher Hauptbahnhof, ein weißgrundiges Wesen mit Stummelflügeln, viel zu kurz für die Riesenfigur, wie eine Riesenhummel, ein Himmelsbrummer. Warum reizte sie die Figur zu Kalauern?
Elf Meter totale Frauenpracht, so hätte man das Desaster freundlicher beschreiben können, wenn, ja wenn man die Figur hier mögen würde, vielleicht sogar eine Beziehung zu ihr aufbauen wollte. Martha Grünhold wollte nicht. Ihr war der Wirbel um diese Stadt- oder Staatskünstlerin, diese Niki de Saint Phalle, vollkommen gleichgültig. Niki de Saint Phalle – unwillkürlich näselte sie den Namen mit einem künstlich übertriebenen Akzent vor sich hin. Eigentlich: Cathérine Marie-Agnès Fal de Saint Phalle, geboren 1930 im französischen Neuilly-sur-Seine, gestorben 2002 in San Diego, Kalifornien. Der Name halb obszön, halb monumental – wie es sich vermutlich für alten, französischen Adel gehörte. Was scherte sie das? Was verstand sie davon? Martha Grünholds Vater war Dreher gewesen – Zentralwerkstatt Zeche Nikolaus, so fügte er immer hinzu; die Mutter half in einem Betrieb nebenan bei der Buchführung. Adel kam nur in Zeitschriften vor, die die Mutter beim Friseur angestrengt nicht las – wenn sie denn mal zum Friseur ging. Zur Sache, Grünhold! Martha Grünhold, obwohl erst fünfunddreißig, redete gelegentlich mit sich selbst, halblaut immer und immer ironisch, und immer nannte sie sich beim Nachnamen. Das Gerede brachte vermutlich ihr Beruf mit sich. Ziemlich einsam war der, und man konnte nicht immerzu Musik hören, die Musik erinnerte einen ja erst recht daran, dass da keiner war. Viel Musik dennoch, laut am liebsten, Rap, Metal oder Punk Jazz. Jaco Pastorius.
Martha Grünhold war eine einigermaßen erfolgreiche Restauratorin, trotz ihres Quereinstiegs in den Beruf, der sie ein wenig zur Außenseiterin machte, trotz der Probleme mit den Fingern. Dieses Plastik-Teil hier würde es nicht besser machen, denn sie würde wahrscheinlich mit Feuchtigkeit arbeiten müssen, wie sonst sollten die Farben gereinigt werden? Wer kam überhaupt auf die Idee, solch eine Figur ausgerechnet in einer zugigen Bahnhofshalle aufzuhängen? Martha Grünhold schnupperte: Der Geruch von Dönern und Bratwürsten machte ihr keinesfalls Appetit, er beunruhigte sie vielmehr. Wo Würste waren, stieg fettiger Dunst auf – Gift für Plastiken aller Art. Martha Grünhold bewegte die kräftigen, ein wenig krummen Finger an den Nähten entlang, die Teile der Riesenfigur beieinanderhielten. Das hier waren die kritischsten Stellen!
Sie konzentrierte sich. Schaute sich die Nähte genauer an, die Übergänge der Farben. Sie sah an die Decke der Halle, folgte den vier stählernen Aufhängungen nach oben und dann wieder nach unten, wo sie in Kardangelenken an der Figur endeten, und runzelte die Stirn. Das war nicht gut, das war gar nicht gut!
Der L’ange protecteur von Niki de Saint Phalle, der Schutzengel der Reisenden, hing an vier Befestigungen, vier Kardangelenken, und da, wo sich die T-Eisen mit dem Plastik der Figur verbanden, gab es ziemlich viele Schadstellen. Noch schlimmer waren die schmalen Wasserläufe, die sich über das Becken, die Oberschenkel, die Kniekehlen der Figur zogen. Kondenswasser! Der Engel hielt zwei Krüge in den Händen, aus denen sich scheinbar Flüssigkeit ergoss, vom einen Krug in den anderen. Die Flüssigkeit wurde hier durch eine Neonröhre simuliert – das elektrische Licht war aus Sicherheitsgründen aber schon lange abgeschaltet worden; hier glitzerte kein elektrifizierter Rotwein mehr.
Martha Grünhold hätte im Schlaf aufsagen können, woraus dieser Engel ansonsten und hauptsächlich bestand: aus Draht und Styropor und einem Überzug aus Lacken. In einem ersten Schritt war die Figur aus Drahtgitter geformt worden. Eine garstige Arbeit, bei der man sich leicht die Hände zerschnitt, mühselig, langsam. Das Ganze war dann in Styropor gebaut und mit Farbe überzogen worden. Zunächst weiß grundiert und dann mit farbenfrohen Schnörkeln und Kreisen, abstrakten Flächen und Ornamenten verziert, allerlei Symbole waren dabei. Die Farben selbst jedoch waren eine Katastrophe! Was hatte sich Saint Phalle dabei gedacht?! Das Grün und Rot mochten noch angehen, aber dieses Königsblau, das von Ferne an Matisse erinnerte, vielleicht an Yves Klein, dieses sanfte, eher stumpfe Blau war eindeutig für Innenräume gedacht und nicht für dieses Drinnendraußen einer Bahnhofshalle. Acrylfarben statt haltbarem Polyesterüberzug. Die Künstlerin wusste doch, wo die Figur platziert werden sollte, es war schließlich eine Auftragsarbeit gewesen. Hatte sie das nicht interessiert? Oder war Saint Phalle zu unbedarft gewesen, war es ihr womöglich egal gewesen, so nach dem Motto: Der Prozess ist alles? Na, vielen Dank auch! Und sie hatte nun den Salat. Martha Grünhold schnaubte. »Niki, die größte Künstlerin des 20. Jahrhunderts«? – Das hatte Jean Tinguely geschrieben, ihr Lebensgefährte, ein, wenn man den Fotos glaubte, recht selbstbewusster, offenbar leicht wahnsinniger Kerl, der Riesenfiguren zusammengeschweißt hatte, die sich drehten und in den Himmel schraubten. So einer stand eigentlich immer in Reihe eins und trat dann noch einen Schritt vor – trotzdem hatte er Niki de Saint Phalle in den Vordergrund gerückt, auf den Fotos jedenfalls, die im Netz herumvagabundierten und die Martha Grünhold studierte wie andere die Instagram-Accounts von Prominenten.
Bei ihren ruhelosen Streifzügen durchs Netz war Martha auf einen Film gestoßen. Study for an End of the World No. 2. Das Ganze spielte in Las Vegas oder in der Wüste bei Las Vegas. Ein amerikanischer Fernsehsender hatte Tinguely auf die Idee gebracht, an einem Ort eine Aktion zu machen, an dem vierzig Jahre zuvor Atombombentests durchgeführt worden waren. Na bitte! Große Geschichte und großer Knall, das war etwas für Tinguely, so viel hatte Martha schon begriffen. Eine dramatische große Bumm-Skulptur sollte entstehen, so nannte Tinguely das selbst, und tatsächlich: Einen Sinn für Drama hatte Tinguely, hatten die beiden, denn schnell war klar, dass Tinguely mit Saint Phalle arbeiten wollte. Die beiden kauften Schrott, schleppten ausrangierte Maschinenteile, Eisen, Draht, Kühlschränke und Koffer herbei und bauten alles zunächst in der Stadt auf: Fünf Meter hoch, sieben Meter breit, wie Tinguely penibel vermerkte. Es ist nicht überliefert, was die Bewohner von Las Vegas darüber dachten. Das Zeug wurde dann in die Wüste verfrachtet und dort erneut aufgebaut. Martha konnte es kaum glauben: Im Film sah man einen Tinguely, der gekleidet war wie ein Pilot – mit Käppi, das schon damals, im Jahr 1962, modisch nach hinten gedreht war, Pilotenbrille, Blouson und weißem Hemd, und dazu Saint Phalle in modisch karierter Hose, feinen Stiefelchen, mit einer Sonnenbrille – und einem Pelzkragen über der Jacke. Martha hielt den Film an, schaute genauer hin. Das war wohl mal ein Fuchs gewesen. Der lange Schwanz der Beute baumelte Saint Phalle über der Schulter. Im Hintergrund sah man die Berge der Wüste Nevada, vorn die Gerätschaften des Künstlerteams, die Steuerungstafeln, die Schaltpläne. Man hantierte mit TNT. Wussten die beiden, was sie taten? Unwillkürlich hielt Martha den Atem an, noch jetzt, fast sechzig Jahre später. Tinguely mit einem Megaphon. Überall wurden jetzt Kabel gezogen, das Fernsehteam war nicht sichtbar, Bonnie und Clyde vertauschten Kappen und Hut mit Sicherheitshelmen. Und dann sah dieses kinderlose Elternpaar zu, wie ihre Brut in die Luft gejagt wurde. Kra-wumm! Martha flüsterte mit, als man auf dem Film sah, wie sich erst eine der beiden Schrott-Skulpturen, dann die zweite in einer gewaltigen schwarzen Wolke in Nichts auflöste. Kra-wumm. Wo Tinguely und Saint Phalle waren, war immer action. Kein Wunder, dass sie in einen halblauten Comic-Sprech fiel. Study for an End of the World. Drunter machten sie es nicht. Wollten auf die Risiken der atomaren Rüstung hinweisen. Wollten mit Feuer und Rauch protestieren gegen den Kalten Krieg, mit hitziger Kunst und großen Worten gegen die Politik der Herrschenden. Im Film verzog sich der Rauch rasch, gab den Blick frei auf das kunstvoll angerichtete Desaster. Allerdings: Auf dem Boden der Wüste lag immer noch genug herum; es sah ganz so aus, als habe sich der Schrott nicht auflösen lassen, als habe sich die Plastik wohl verkleinert und gehörig verformt – weg war sie aber nicht. Im Grunde genommen ein schöner, opernhafter Reinfall.
Martha musste lächeln. Sie lächelte, obwohl ihr solche Aktionen nicht geheuer waren: zu viel Effekt, zu viel große Geste für ihren Geschmack. Ein Paar wie aus einem Spielfilm der Zeit. Die melodramatischen Schwarz-Weiß-Szenen kamen ihr heute schon historisch vor, eine Zeitreise in die 1960er Jahre. Die elegante Italienerin Sophia Loren, die ungebärdige Monica Vitti und natürlich Richard Burton und Liz Taylor und ihre für alle Welt anstrengende On-off-Beziehung – die hätten auch ganz gut in die Wüste gepasst. Vermutlich hätten sie den einen oder anderen Whiskey gekippt, Burton hätte seinen perfekt sitzenden einreihigen Mantel zurechtgezupft, die Taylor hätte sich im kunstvoll gewundenen Kopftuch in ein sündteures Cabriolet geklemmt, und dann wären sie davongebraust. Und Tinguely und Saint Phalle? Wie waren die in die Wüste gekommen? Wie waren sie abgereist? Wo begann die Inszenierung und wo hörte sie auf? Hatten Saint Phalle und Tinguely wirklich politischen Protest inszeniert – oder ihre eigene Beziehung nach außen gekehrt? Und konnte man das, konnten sie das trennen?
Schon von Berufs wegen musste Martha Grünhold gegen Risiken sein, und diese beiden waren immer Risiko gegangen, volles Risiko.
Die Künstlerin konnte von Glück sagen, dass sie ihr nicht mehr unter die Augen treten konnte. Saint Phalle war vor zwanzig Jahren gestorben, mit einundsiebzig, an einem Ort, den sie erst spät entdeckt hatte. Warum war sie zurück in die USA gegangen? Martha Grünhold wusste es nicht. Vielleicht eine der vielen Allüren von Saint Phalle? Denn Allüren musste man das doch nennen, diese actions, diese wechselnden Kostümierungen, immer in Samt und Seide oder gar mit Pelzen. Eine solche Frau brauchte keine Feinde. Moment mal, Grünhold: Wiederholte sie da nicht einen typischen Männerspruch? Und die alte Dichotomie übernehmen – Freunde und Feinde –, war das nicht längst überholt? Warum machte sie diese Saint Phalle so wütend? Wut war schlecht, fand Grünhold, Wut riss zu Handlungen hin, mit denen man vor allem sich selbst verletzte, Wut war abzulehnen. Wut sollte wie andere eruptive Emotionen im Leben einer Restauratorin keinen Platz finden. Ihr Ausbilder. Ausgeglichenheit, Mäßigung. Sie machte eine Handbewegung, als wollte sie etwas wegwischen. Aber: Wo gehörte sie denn nun hin, diese Niki de Saint Phalle? Wie war sie zu fassen? Musste sie zu fassen sein? Grünhold fand: Ja. Grünhold hielt nichts vom Herumgeheimnissen – so nannte sie das. Man hätte nicht sagen können, wo Saint Phalle überhaupt zu Hause gewesen war. Eine Kosmopolitin, so nannte man das wohlwollend. Heimatlos, so hieß das bei ihr zu Hause. Mensch ohne Ruhe.
Martha Grünhold weigerte sich, die Künstlerin »Niki« zu nennen, wie es anbiedernd und abstandslos anscheinend die ganze Welt tat. Ja, zugegeben, ein paar Artikel hatte sie gelesen. Redete denn irgendwer von »Pablo«, wenn er Picasso meinte, oder von »Auguste«, wenn es um Rodin ging? Eben. Eine Frage des Respekts, Gräfin hin oder her. Von edlen Abstammungen ließ sie sich sowieso nicht beeindrucken. War ihr völlig gleichgültig. Wumpe!, hätte ihr Vater gesagt. Kommt drauf an, was du aus deinem Leben machst, hätte er gesagt. Einerseits, hatte seine Tochter gedacht. Andererseits erlebte sie täglich, wie es zählte, woher man kam. Und ob man ein Mann war oder eine Frau. Auch deshalb: Grünhold. Punkt. Und Saint Phalle. Doppelpunkt: Ob das was werden würde?
Nun tätschelte sie die Figur doch ein wenig. Sah ja keiner. Sie war allein hier oben, Gott sei Dank. Schwatzende Kollegen oder schlimmer noch, die Arbeiter von gestern, die ihr mit der Hebebühne geholfen hatten, das hätte gerade noch gefehlt. Trotzdem: Einfach so anfassen, das ging eigentlich nicht. Martha tat nichts Unnötiges, nichts Überflüssiges. Wenn sie Hand anlegte, dann mit Sinn und Verstand, zu einem bestimmten Zweck, mit einer bestimmten, lange geübten Technik. Sie musste sich besser konzentrieren. Der Ort war schon etwas Besonderes.
Der Wannerbau in Zürich hatte hundertfünfzig Jahre auf dem Buckel. Seine eisernen Fachwerkstreben waren in einer Zeit errichtet worden, in der die Eisenbahn gerade erst auf Touren kam. Und dann diese Höhe! Und diese Weite! Den Erbauern war nichts prächtig genug gewesen. Der Bau aus Sandstein war eine riesige Burg der technischen Möglichkeiten – ein schnöder Kopfbahnhof eigentlich, aber mit Triumphbogen über dem Eingang, kolossalen Pilastern an den Seiten und waschechten, nachgebauten korinthischen Kapitellen. Logisch, dass auch noch eine Helvetia, in Zink gegossen, über dem Eingang thronte. Martha Grünhold staunte, dass sie in einem Verkehrspalast der Neorenaissance arbeiten sollte. Und sie staunte, dass die traditionsversessenen Schweizer Behörden ausgerechnet der schrägen Saint Phalle vor über zwanzig Jahren den Auftrag zu einer monumentalen Plastik erteilt hatten.
Vorsichtig! Martha Grünhold balancierte auf der Arbeitsbühne. Immer wackelte und schwankte hier irgendwas. Unangenehm in acht Metern Arbeitshöhe. Nicht nur, dass sie sich den Hals brechen konnte, da hielt es Martha mit dem alten Spruch »Unkraut vergeht nicht!« – aber der Figur konnte etwas passieren. Nicht auszudenken, wenn sie sich abrupt auf ihr hätte abstützen müssen, weil sie das Gleichgewicht verlöre oder, schlimmer noch, auf sie stürzen würde!
Ein Schutzengel als Patient. Nein, als Patientin. Eigentlich ganz nett, dass bei Niki de Saint Phalle die Engel weiblich waren. Und nicht bloß die Mütter. Obwohl diesem Engel einige Kinder zuzutrauen gewesen wären. Geschlechtslos war die Dicke nicht. Sie war eine Verwandte der Nanas, jenen knallbunten Erfolgsfiguren, die bei den meisten Leuten eingebrannt waren wie bestimmte Marken, die sie immer wieder kauften. Nana wie Nivea oder Nutella. – Niki de Saint Phalle und die Nanas. Langweilig, wie alles, was sich wiederholte. Immerhin: An den Frauen kam bei Saint Phalle keiner vorbei. Alles, was Geborgenheit bot, alles Gebende, alles Großzügige bei ihr war weiblich, und so zweifellos auch der Himmel mit diesen etwas aus der Art geschlagenen Boten. Schon ein Statement. War das einer Künstlerin vor oder nach ihr gelungen? Martha fiel keine ein.
Der Vertreter der Schweizerischen Bundesbahn war mächtig nervös gewesen beim Vorgespräch, das Martha Grünhold nur widerwillig mit ihm geführt hatte.
»Lueget Sie«, hatte er in diesem sich ewig dehnenden angestrengten Hochdeutsch der Zürcher gesagt, und dann, eine kleine Variation einbauend: »Verstönnt Sie: Der L’ ange protecteur ist eines der Wahrzeichen der Stadt Zürich. Dem dörf nüt passiere, keinesfalls! Das können wir gar nicht versichern, so wertvoll ist er.«
Er? Der Engel.
Sie. Die Engel, müsste es bei Saint Phalle heißen. Die Engelin.
Gut, dass das bald vorbei sein würde mit den ewigen Geschlechtsbezeichnungen. Hatten das die Engel nicht eigentlich sowieso schon hinter sich? Nicht bei Saint Phalle. Die schrie das Weibliche in die Welt, sie trompetete es. Wird schon ihre Gründe gehabt haben, dachte sich Martha Grünhold. Der Engel oder besser: die Engelin war übrigens Amerikanerin, die Figur war in Kalifornien gefertigt und in Einzelteilen hierhergeliefert worden. Warum Kalifornien? War es schicker, da zu wohnen?
Per Schiff war die Engelin von La Jolla aus über den Panamakanal nach Europa transportiert worden bis Rotterdam. Dann den Rhein hinauf bis nach Basel, und von dort ging es per Tieflader weiter nach Zürich. Und zum Empfang der dann vollständigen, zusammengesetzten und vergoldeten Figur war Franz Liszt gespielt worden, L’album d’un voyageur, wie passend! Das hatte in den Unterlagen der Bahngesellschaft gestanden, die sich das ganze Unternehmen etliche Zehntausend Franken hatten kosten lassen. Ein ziemlich aufwändiger Umzug. Was hatte wohl auf den Containern gestanden? Angel on Tour?
Er lachte mit, als habe es eine entsprechende Dienstanweisung gegeben. Martha ärgerte sich. Solche Beamtentypen machten sie immer albern. Albern-Sein hatte so was Anbiederndes. Lieber gleich voll auf die Zwölf.
»Haben wir sonst noch was zu besprechen?«
»Allerdings.«
Der Mann von der Eisenbahngesellschaft strahlte die Ruhe des Auftraggebers aus. Er rechnete, er rekapitulierte den Prozess. Seine Finger knackten, als er vor Grünhold die einzelnen Stationen beschrieb, die dazu geführt hatten, dass der Zürcher Hauptbahnhof nun neben einem Werk von Mario Merz auch die Riesenplastik des Engels besaß. Den springenden Hirsch von Merz sah allerdings kein Mensch mehr, seit die Engelin hier regierte. Ja, die Engelin war eine Herrscherfigur auf eine seltsam entspannte, selbstironische Art. Saint Phalle hatte die Engel befördert, aus dem Service auf den Thron.
Jahre hatte es gedauert, bis aus dem Auftrag der Schweizerischen Bundesbahn ein leibhaftiger Repräsentant des Himmels wurde, der nun die Haupthalle des Bahnhofs schmückte, zwischen Gleis 13 und dem südlichen Ausgang, wie der Mann korrekt anführte. Martha fand es originell und ein wenig bedenklich, dass eine Eisenbahngesellschaft es für nötig befand, den Reisenden einen Schutzengel zur Seite zu stellen, aber das sagte sie nicht und ebenso wenig, wie passend es war, dass ausgerechnet eine Versicherungsgesellschaft das Ganze finanziert hatte.
Der Herr von der Eisenbahngesellschaft hatte ihr den Vertrag feierlich in einer überdimensionierten Mappe überreicht, sieben Blätter hatte sie unterzeichnen und zurücksenden und zusagen müssen, alle paar Tage Zwischenberichte zu liefern über den Bearbeitungsprozess. Bitte schön!
»Wann treffen denn die Herren Assistenten ein?«
Der Mann wollte munter klingen, hatte aber etwas Lauerndes. Woher wusste er oder wollte er wissen, dass es Assistenten waren und keine Assistentinnen? Martha Grünhold nervte es, dass die Norm für alle immer noch das Männliche war.
»Übernächste Woche«, sagte sie trocken.
Man fand kaum Frauen für den Job, leider. Nicht für die großen Sachen. Eher für Papier, für Keramik, für Stoff. Das lag daran, dass selbst die tüchtigsten Kolleginnen von vorherein nicht die großen Aufträge bekamen, nicht die Panoramen, die Deckengemälde, die Riesenfresken. Also bildeten Frauen keine Frauen aus – und alles blieb, wie es war.
»Ach, Mädels«, hatte ihr Ausbilder in Dresden achselzuckend gemeint, als sie wieder einmal über die schlechten finanziellen Aussichten sprachen, »ihr habt so einen schönen Job und bekommt sogar noch Geld dafür.«
»Denken Sie daran«, sagte der Mann von der Eisenbahngesellschaft, »die Halle soll wieder mit etwas bespielt werden. Dazu braucht es den Engel.«
Ja, es brauchte den Engel, aber verdammt noch mal, warum war diese Hebebühne so kipplig? Hatten die Burschen gestern die Bremsen nicht korrekt festgestellt? Natürlich konnte Martha Grünhold Hebebühne fahren, das heißt: Sie war berechtigt, eine solche zu führen, sie hatte eine 1-A-Bedienerschulung mitgemacht, konnte die Geräte aufbauen, Hubarbeitsbühnen aller vier Kategorien lenken und sichern. Hatte sie eine Stange Geld gekostet, dieser Lehrgang. Aber deutsche Dokumente waren den eidgenössischen Behörden nicht geheuer. Und so war Martha genötigt worden, die Dienste eines einheimischen Unternehmens in Anspruch zu nehmen. Sie hatte schon nichts Gutes geahnt, als die Typen, ihre Vierschrötigkeit im Anschlag wie eine Waffe, mit dem tonnenschweren Spezialgefährt vor dem Bahnhof vorfuhren. Und hinein! Ein Wunder, dass nichts passiert war, selbst die große Halle wurde plötzlich zu klein, als die vier mit ihrem Riesenspielzeug da herumfuhrwerkten. Dann die Figur! Jedes Kind wusste, dass man sich solchen Plastiken mit äußerster Vorsicht nähern musste. Jeden Meter, den man vorankommt, gilt es, mit noch größerer Vorsicht, mit doppelter Vorsicht, zurückzulegen. Aber nein! Schwungvoll drauflosgekurvt, abrupt gebremst – und beim Hin- und Hermanövrieren hatte die Bande den Schutzengel prompt mehrmals touchiert.
»Ja, seid ihr denn völlig meschugge?«
Reisende blieben abrupt stehen, als seien sie gemeint, Rollkoffer zuckten, Kinder zerrten, selbst die Männer von A-Z Hebi fuhren zusammen, als Martha Grünhold durch die Halle brüllte. Sie konnte brüllen. Wie ein Mann, so sagt man wohl. Martha Grünhold brüllte aber eher wie fünf Männer, mit einer Stimme, von der ihre Mutter behauptete, sie sei schon gleich nach der Geburt genau so gewesen: heiser, herrisch, eine Stimme, die immerzu mit dem Fuß aufstampfte, auch wenn sie ausnahmsweise einmal »bitte« sagte.
»Jetzt lasst mich mal machen!«
Martha schob den Maschinenführer von seinem Platz und übernahm das Kommando. Vorwärts, rückwärts, langsam. Und stand. Genau an der vorgesehenen Stelle. Sie half noch, die rot-weißen Absperrbänder zu ziehen, dann trieb sie die Männer davon. Sie brauchte ihren Raum. Für sich und ihre Arbeit. Da störten solche Typen nur.
»Danke ja, ich komme klar.«
Hieß: Haut schon ab.
Das taten sie.
Martha wischte sich die Hände am Overall ab. Dann packte sie aus. Sie stellte zusammen, was sie oben, auf der Hebebühne, brauchen würde. Handwerklich gute Arbeit beginnt damit, dass man so tut, als ob man alle Zeit der Welt hätte. Dabei hatte sie nur sechs Wochen. Verdammt knapp. Aber dann würde man den Engel brauchen. Nicht als Schutz. Sondern als Zierrat für den Bahnhofs-Weihnachtsmarkt. Gleich wieder der erste Härtetest nach der Reha: Bratwurstgestank, Rauch, Dämpfe, die Ausdünstungen von Tausenden von Menschen.
Martha seufzte. Nicht dran denken!
Zug um Zug brachte sie die Sachen nach oben zur Figur. Sie sah sich nicht um, noch nicht. Da war sie abergläubisch. Erst alles parat haben, erst alles bereitstellen.
Sie kletterte wieder hinunter und bat einen bärtigen Polizisten, kurz auf die Baustelle achtzugeben. Lästig, dass sich der Waschraum eine Etage tiefer befand in diesem riesigen, undurchdringlichen Gemäuer. Der Bahnhof, eine Parallelwelt. Man hatte ihr erlaubt, die Aufenthaltsräume der Bahnbediensteten mitzubenutzen, ihre Waschräume, sogar die kleine, rundherum verglaste Kantine. Und dahin eilte Martha nun, ohne auf die vielen Reisenden zu achten, die rollenden Koffer, die geschobenen Paletten, die gewuchteten Kisten. Sie trottete mit ihrem schweren Arbeitsgang die Rolltreppe hinab, ohne einen Blick auf die Imbisse zu werfen, die Fahrkartenschalter, den Chocolatier, die Barbiere, ohne auf die Tür zur Kapelle zu achten, die sich tatsächlich fast unter dem Engel befand. Sie nahm aus dem Augenwinkel für eine Sekunde einen Mann wahr, der gerade die Kapelle betrat, zu hochgewachsen für die niedrigen Decken hier unten, vielleicht fiel er deshalb gleich auf die Knie oder ließ sich jedenfalls irgendwie nieder. Weiter, keine Zeit für den Betrieb, für das Allerlei des Alltags, sie schob eigentlich nur ihren Körper hinunter in die unterirdischen Gänge des Bahnhofs, zielstrebig, noch einmal linksherum, rechtsherum, da war das Restaurant, da lagen die Waschräume der Bahnbediensteten, sie eilte nun, um sich selbst, aber vor allem ihre Hände vom Reisestaub, vom Alltag, von den banalen Beschäftigungen zu reinigen. Im Kopf blieb sie oben beim Engel.
Sie ließ sich viel Zeit. Sie seifte die Hände und die gemarterten Finger erst sanft, dann mit immer kräftigen Kreisen ein, schrubbte und spülte sie ab. Sie begann immer mit einer gründlichen Reinigung. Wie ein Arzt, bevor er den OP betritt. Vorsichtig das Handgel aufgetragen – rückfettend, aber nicht fettig, das Einzige, was möglich war. Heilung hatte es bisher nicht gebracht. Die Finger glänzten rot und an den Rändern leicht entzündet. Noch ein kurzer Blick in den Spiegel.
Dann war es so weit. Sie setzte den Helm auf. Die Ohrenschützer schoben den Lärm der Welt in eine erträgliche Ferne. Sie entriegelte die Sicherung der Hebebühne, der Greifarm fuhr aus, sie stoppte ihn, er nickte noch einmal nach. Sie schwebte nun auf der größten Hebebühne der Schweiz in der größten freitragenden Halle des Landes. Es war schon … irgendwie erhaben. So, wie auf dem Dach eines Berges zu stehen. Vorsicht, Grünhold: Schon wieder so ein emotionaler Ausschlag! Das Gegenüber der Erhabenheit ist die Peinlichkeit! Sie besann sich, nickte und winkte nach unten: Alles klar. Der Polizist, der achtgegeben hatte, verschwand mit einem Gruß. Sie richtete sich auf, griff nach ihrem Klemmbrett, zeichnete. Machte Handyfotos, vergrößerte den Bildausschnitt mit zwei Fingern, runzelte die Stirn. Schaute, wartete. Spürte die Wärme des Oktobertages durch das Hallendach, schwitzte, schob sich den Stirnschweiß unter den Helm. Machte keine Pause, spürte, wie sich das Licht in der Halle veränderte. Schaute zur Decke, ließ den Blick schweifen, noch einmal, wie um Maß zu nehmen. Diktierte schließlich:
»Bericht zum Zustand der Figur Schutzengel der Reisenden in Zürich. Höhe: circa elf Meter. Zurzeit hängt der Engel im vorderen Hallenteil, nahe beim Querdurchgang. Hier herrscht starke Luftzirkulation, insofern muss von einer schnell fortschreitenden Verschmutzung ausgegangen werden, insbesondere durch Staubablagerung. Das Dach der Halle ist nicht vollständig dicht konstruiert, sodass bei starkem Regen und Wind Wasser eindringen kann. Über rostige Eisenträger und die Taubenschutzgitter tropft Kondenswasser auf die Figur und hinterlässt Laufspuren und dunkle Flecken.« Martha Grünhold hielt kurz inne, atmete durch, dann wandte sie den Blick zur Decke: »Trotz der Schutzgitter, die in einiger Höhe, direkt unter den Eisenträgern, über der Figur angebracht sind, können Tauben und andere Vögel die Figur überfliegen und entsprechend Kot hinterlassen.«
Der Engel musste hier weg. Eigentlich gehörte er gar nicht hierher. Vor allem von seiner Fassung her gesehen handelte es sich um ein Objekt, das für einen geschlossenen Innenraum entworfen worden war. Und hier war weder drinnen noch draußen, ein Zwischenbereich, in dem mit der frischen Luft von draußen auch Feuchtigkeit eindrang. Von unten stieg der Dunst von Gebackenem und Gesottenem herauf. Martha Grünhold schloss die Augen. Sie sah den kommenden Weihnachtsmarkt vor sich, roch die gebrannten Mandeln, das Fett der ausgebackenen Pilze, die Pommes frites, die Würstchen, hörte das Schreien der Kinder, das Gerede der Paare, sah aufsteigende Atemwolken, Niesen, Pusten und den Dampf – ein restauratorischer Albtraum. Aber der Engel musste hier ausharren. Ihre Aufgabe war es, ihn zu ertüchtigen, so gut es eben ging. Und dazu musste er zunächst, um an ihm zu arbeiten, in den hinteren Teil der Halle gebracht werden – schwebend, so wie er war. Die Dicke würde lernen zu fliegen. Grünhold, reiß dich zusammen. Es ist ein Objekt.
Alles klar. Für heute war ihr Tagwerk getan. Das Licht in der Halle war jetzt milder. Es fiel durch das Glasdach, das von Eisenstreben durchzogen war. Die Halle wirkte wie ein großer, edler Gartenpavillon, in dem aber leider keine Blumen wuchsen. Die Halle war leer, ein Festsaal, in dem niemand feierte. Doch, da hinten! Im goldenen Licht des späten Nachmittags entdeckte Martha Grünhold eine Figur – es war eine Frau, die mitten in der riesigen Halle ihre Tasche abstellte. Nun zog sie ihren Mantel aus, kramte in der Tasche. Martha konnte nicht sehen, was sie hervorzog. Sie trat ein paar Schritte zur Seite, wartete. Marthas Aufmerksamkeit war geweckt. Sie hielt sich an der Strebe fest, die die Arbeitsbühne begrenzte, um die Situation entspannter zu beobachten. Die Frau begann sich zu drehen – die Frau tanzte, mit fließenden, zögerlichen Bewegungen, als müsste sie sich erst einfinden in ihren einsamen Ball. Da trat eine zweite Person hinzu, begrüßte sie – man kannte sich offenbar. Die beiden berührten sich nicht, tanzten aber miteinander auf eine Weise, die Vertrautheit verriet und Entzücken an der Bewegung. War die zweite Person ein Mann? Eine Frau? Aus der Entfernung war es nicht zu erkennen – wohl aber die Harmonie zwischen den beiden, wie sie improvisierten, manchmal stockten, sich dann aber wieder fanden. Mitunter bewegten sie sich voneinander fort, kehrten ohne Eile zurück, kreiselten, steppten, sprangen bisweilen. Martha Grünhold zwang sich, nicht an den Schweiß der beiden zu denken, an die aufsteigende Hitze der Menschen in der Halle, sie wollte einfach dabei sein, genießen. Sie setzte den Helm ab, nahm den Kopfhörer ab. Sie hörte es seltsam gedämpft: Mozart. Natürlich. Immer, wenn die Leute etwas Festliches brauchten, nahmen sie Mozart zu Hilfe. Trotzdem ganz schön, diese federleichte Musik unter ihrer tonnenschweren Engelin. In diesem Licht sah der Schutzengel nicht aus wie einer, der selbst Schutz benötigte, sondern eher wie einer, der gleich abheben würde, sanft, trotz seines Volumens schwerelos, frei.
Wovon die Künstlerin wohl geträumt hatte? Was hatte ihr Leben leicht gemacht – was schwer?
Martha Grünhold setzte den Helm wieder auf, setzte ihn ab. Zu früh eigentlich, die Arbeitsschutzverordnung sah etwas anderes vor. Aber es war ungewöhnlich heiß für diese Jahreszeit, selbst jetzt noch, um fünf. Sie wischte sich endlich das Gesicht ab, mit dem alten Stofftaschentuch des Vaters. Sie hatte immer seine Taschentücher dabei. »Glück auf!« stand auf dem einen, auf dem anderen war der Doppelbock abgebildet, das Wahrzeichen der Zeche Sankt Nikolaus. Die Kumpels hatten sie nicht unter Tage benutzt; sie hatten sie zum Abschied produzieren lassen, als Pluto und die anderen Zechen geschlossen wurden. »Glück auf!« färbte sich einen Ton dunkler vom Schweiß. Wie hielten es die beiden da unten aus zu tanzen?
Genug geträumt! Sie zog den Hebel, der die ausgefahrene Bühne wieder in die Startposition bringen sollte. Nichts. Sie zog erneut. Der Hebel stieß auf keinerlei Widerstand. Sie wartete. Versuchte es erneut. Nichts. Hier oben gab es einen Notknopf für die Stromversorgung. Aus. An. Nichts. Offenbar hatte es einen Kurzschluss gegeben. Verdammt. Martha überlegte. Noch einmal! Zwecklos. Sie versuchte, sich bemerkbar zu machen, aber die wenigen Menschen, die durch die Halle eilten, ignorierten ihre Rufe oder hörten sie nicht. Und die Tänzer hatten gerade zusammengepackt und schickten sich an zu gehen. Hallo? Niemand reagierte. Sie konnte doch brüllen, das wusste doch jeder! Aber nicht, wenn es um die eigene Sache ging, nicht, wenn sie Hilfe brauchte. Ihre hilferufende Stimme klang anders als ihre Befehlsstimme, sie klang kleinlaut, unsicher, fast zittrig … Das Handy! Verdammt! Es lag unten im Aufenthaltsraum der Bahnleute, gut gesichert im Schließfach.
Sie schaute nach unten. Die Hebebühne war über den langen Greifarm mit dem eigentlichen Fahrwerk verbunden – viel zu schmal, um hinüberzuklettern – und außerdem in der Mitte nach oben geknickt. Daran entlanghangeln? Martha Grünhold sah nach unten. Gut und gern neun Meter über Stein.
So ein Mist! Die Restauratorin betrachtete die Figur unter sich, die Flanke, die sie vorhin eigentlich ganz gelungen fand mit ihrem barocken Schwung, ihren leuchtenden Farben. Das Biest bringt mir kein Glück. Ich hätte es lassen sollen.
Und Martha Grünhold war selbst nicht klar, wen sie damit meinte: die Figur des Schutzengels – oder seine Schöpferin, jene berühmte und gleichzeitig völlig unbekannte Aristokratin aus Frankreich, die der Stadt Zürich einen kalifornischen Engel beschert hatte. Sie war, wie es aussah, seine Gefangene. Oder ihre. Jedenfalls für eine Weile.
2.
»So viel zum Thema Erhabenheit.«
Am nächsten Abend hatte sich Martha Grünhold wieder beruhigt. Drei Stunden hatte es gedauert, bis man sie befreit hatte. Ein Mann von der Security hatte sie endlich entdeckt, ihr etwas zugerufen, das sie nicht verstand, und war eine quälend lange Zeit verschwunden. Zurückgekehrt war er mit zwei Kollegen und einer Schiebeleiter mit zwei Eskalationsstufen. Ewig lang, so schien es hier, war mit der Leiter herumgefuhrwerkt, war das Stecksystem verstellt worden, um die exakte Höhe zu ihr zu überwinden – aber schließlich war es geschafft. Der Typ von der Security verschwand erst unter ihr, dann tauchte sein bärtiges Gesicht vor ihr auf, als er zur Plattform hinaufgestiegen war. Er reichte ihr die Hand. Bloß nicht! Sie kletterte vor ihm die Sprossen hinab, rang sich ein knappes »Danke« ab und sah zu, dass sie die Baustelle gesichert bekam. Und nun saß sie mit Marie in der Barfußbar und schaute auf die träge dahinfließende Limmat.
»So viel zum Thema Erhabenheit.«
Sie musste selbst darüber lachen. Und nach dem zweiten Likörchen erst recht. Likör war ein Laster, das wusste sie selbst. Kein Mensch trank heutzutage noch so ein süßes, klebriges Zeug. Außer Martha Grünhold. Vor allem, wenn sie an Zuhause dachte. An die gemütlichen Sonntage mit den Tanten und ihrem Heidelbeerlikör. Starke Frauen waren das. Sie quetschten sich in das ausladende Sofa, machten nicht viel Federlesens und redeten und tranken. Kaffee angeblich, aber vor allem ging es um den Mirtillo, den Likör aus Beeren und Kräutern. Den gab es hier nicht, aber immerhin ein feines Orangenstöffchen für die Gäste. Nur Frauen. Die Barfußbar gehörte zur Frauenbadi, einem Refugium mitten in der Stadt. Auf den weißen Lamellenstühlen – nur Frauen. Auf den Stegen – nur Frauen. Sie hielten ihre Beine ins Wasser, sie schwatzten, sie lachten, sie waren schön und gewöhnlich, dick und herrlich, heiter und still – je nachdem. Warum fielen ihr jetzt schon wieder die Nanas von Saint Phalle ein? Martha Grünhold musste zugeben, dass sie gut hierhergepasst hätten, in diese Frauenwelt. Dass diese Niki de Saint Phalle also womöglich eine Welt im Sinne gehabt hätte, die eine Welt der Frauen gewesen wäre.
»Hatte sie ja auch«, sagte Marie ungefragt. »Sie hat diese Nanas gemacht, weil sie den Frauen ein Denkmal setzen wollte. Frauen, die normal aussehen oder eben ziemlich rund. Dabei aber vielfarbig und voller Schwung.«
Vielfarbig. Marie war wie Martha Restauratorin, und niemals hätte sie »bunt« gesagt. Bunt war ein Begriff, den man, wenn überhaupt, abfällig benutzte. Bunt im Sinne von zu vielfarbig, von unausgewogen, von aufdringlich oder vulgär. Restauratoren hielten aufs Maß, auf die möglichst optimale Gewichtung von Farbe. Eine ziemlich elitäre Zunft! Und Marie war eine der besten. Eine, die sich zu Martha Grünholds Kummer auf das traditionell weiblichste Teilgebiet konzentriert hatte, die Papierrestaurierung. Und dabei war sie so schnell so gut geworden, dass sie nun in den Wiener Kunstmuseen eine Festanstellung bekommen hatte. Eine Teilzeitstelle zwar, trotzdem sensationell für eine Frau Anfang dreißig. Sonst zogen die wenigen Männer, kaum dass sie ihr Diplom oder ihren Master in der Tasche hatten, seelenruhig an den ehemaligen Kommilitoninnen vorbei. Der Gender Gap lähmte auch ihre Zunft, er machte, dass aus verheißungsvollen Studentinnen binnen weniger Jahre müde, ausgelaugte Assistentinnen wurden. Nicht so Marie. Sie hatte die Konkurrenz locker hinter sich gelassen, sicher nicht zuletzt mit ihrem heiteren, selbstbewussten Auftreten, mit ihrer Weltgewandtheit und ihrem Charme, den sie jederzeit unter ihren brandroten langen Haaren hervorschütteln konnte. Martha musste achtgeben, dass sie nicht missmutig wurde bei so viel offenkundigem Erfolg. Was war schon Erfolg? Wer bemaß ihn, wer bewertete ihn?
»Die Nanas stehen ja gar nicht am Anfang von Nikis Werk«, sagte Marie.
»Saint Phalle.«
»Wie?«
»Nenn sie Saint Phalle. Die Frau hat ein Recht auf ihren Nachnamen.«
Marie lachte. »Wenn du darauf bestehst …«
»Tu ich.«
Marie ließ sich nicht irritieren. Sie erzählte von den Figuren, die seit Ende der siebziger Jahre entstanden waren. Dass sie eine Reaktion auf andere, viel harschere Figuren gewesen waren. Dass Niki – Saint Phalle – erst durch einen langen, schmerzhaften Prozess in die Lage gekommen war, diese Figuren zu erschaffen, die so viel Heiterkeit, so viel Lebensfreude verströmten.
»Lass mich mal überlegen«, sagte Marie. »Ich weiß, dass Saint Phalle in Frankreich geboren wurde. Sie hatte drei oder vier Geschwister. Und mit vier oder fünf Jahren ist sie zu ihren Eltern nach New York gekommen.« Sie zögerte. »Aber wo waren die Eltern vorher? Sind die gleich nach der Geburt von Niki weg?«
»Saint Phalle.«
»Ja, ja … Oder haben sie das nur bei ihr so gemacht? Und warum? Soweit ich weiß, waren sie vermögend, der Vater Banker oder so was.« Marie hielt wieder inne. »Weißt du was, ich suche dir was raus und schicke es dir.«
»Googeln kann ich selbst«, sagte Martha unwirsch. »Und ich weiß auch nicht, inwieweit die Biografie weiterhelfen soll bei der Arbeit. Wäre nur wichtig zu wissen, warum sie mit welchen Mitteln gearbeitet hat.«
»Komm schon!«, sagte Marie. »Du hast doch schon angebissen. Du willst wissen, woher diese Nanas eigentlich kommen. Woher also eine, die erst mal die halbe Welt in die Luft sprengen will, plötzlich diese Heiterkeit nimmt.«
»Der Engel ist aber keine Nana«, sagte Martha schließlich langsam. »Er ist ein Engel. Und er steht für etwas anderes. Das habe ich nachgelesen. Es ist nur dasselbe … dasselbe Prinzip Körperlichkeit. Dasselbe Prinzip Weiblichkeit.«
Sie sagte das fast mit schlechtem Gewissen. Da, wo sie herkam, gab man nicht mit Bücherwissen an. Man las nicht, man machte. Und wenn man schon las, dann nur, um sich zu vergewissern, dass das, was man tat, nicht noch besser zu bewerkstelligen wäre. Bücher wurden nicht einmal geringgeschätzt – sie spielten einfach keine Rolle. Zu viel Arbeit, zu viel Gemache und Getue. Das war im Studium anders geworden. Restauratoren lesen ununterbrochen. Studien, Fachartikel, Bücher, in denen die Jahrhunderte der Kunst ausgebreitet werden wie riesige, kunstvoll gewebte Teppiche. Martha, die Frau, die ganz woandersher kam, die nach der Schule erst einmal eine Lehre gemacht hatte, staunte. Watt all jibt!, hätten ihre Tanten zweifellos gesagt, die es schon großartig fanden, dass Martha Mechanikerin geworden war. Mechanikerin, das war doch was! Verfahrensmechanikerin für Kunststofftechnik, sagte Martha dann rau. Eine Berufsbezeichnung, die so kompliziert war, dass fast jedes Gespräch auf der Stelle versandete. Arbeiten mit polymeren Werkstoffen. Das machte es nicht besser. Martha hatte ein paar Jahre bei Reis Polytechnik gearbeitet, auf der Reis, wie die Leute sagten, dann hatte sie gemerkt, dass sie weitermusste, mehr lernen, anderes, selbständiger sein vor allem. Das ungeliebte Abitur sorgte dafür, dass sie studieren konnte. Restaurierung. Sie bestand die harte Aufnahmeprüfung, sie setzte sich durch. Martha hielt mit den anderen Schritt. Mit denen, die aus wohlhabenderen Elternhäusern kamen, die schon als Kinder die Art Basel oder die documenta kennengelernt hatten, die so geläufig mit Künstlernamen umgingen wie ihre Tanten mit den Liedtiteln aus den Kirchengesangbüchern. Wenn Martha unsicher wurde, erinnerte sie sich an die Tanten. Und der Tag heute hatte sie sehr verunsichert, das musste sie zugeben.
»Wofür steht der Engel?«, fragte Marie neugierig. Sie bestellte einen weiteren Cappuccino.
»Ich weiß nicht genau«, erwiderte Martha. »Er sieht nur einer anderen Figur sehr ähnlich, aus einer Art Kartenspiel.«
»Niki de Saint Phalle hat Karten gespielt?« Marie lachte.
»Keine Ahnung«, erwiderte Martha trocken. »Es gibt Fotos, auf denen man sie und ihre Leute mit Spielkarten in der Hand sieht. Es sind Fotos aus der Schweiz, man könnte also denken, dass sie …«
»… Jass spielen?« Marie lachte wieder. Aus irgendeinem Grund begeisterte sie die Vorstellung einer kartendreschenden Künstlerin.
»Warum nicht!«, sagte Martha missmutig. »Es müssen ja nicht alle spitzenklöppeln, nur weil sie eine Frau und Künstlerin sind.«
Sie schlug mit der Hand auf den Tisch. Die anderen Frauen drehten sich um. Aus den Augenwinkeln sah Martha, dass sich von der Straße her ein Mann näherte, der eingelassen wurde: Abends ab einer bestimmten Uhrzeit öffnete die Frauenbadi anscheinend für alle, denn jetzt bummelten auch einige Paare herbei. Der hochgewachsene, düstere Flaneur mit seinem Bart kam Martha irgendwie bekannt vor.
»Schon gut … der Engel?«
Martha besann sich. »Okay. Der Engel sieht einer Figur ähnlich, die nicht zu einem normalen Kartensatz gehört, sondern zum Tarot. Saint Phalle hat mal eines entworfen.«
»Tarot? War sie denn so esoterisch?«
»Weiß ich nicht«, sagte Martha und ärgerte sich sofort. Wenn sie mit dem Schutzengel arbeitete, sollte sie schon wissen, in welcher Beziehung dieses Objekt zu anderen stand. Das konnte helfen, etwa bei der Frage, ob das tiefe Blau, das Saint Phalle verwendete, absichtlich stumpfer war als das sakrale Blau von Madonnen auf älteren Skulpturen – oder ob die Farbe schlicht falsch ausgewählt worden war. Viel hielt Martha Grünhold darauf, dass sie eine Macherin war – aber um zu machen, musste man wissen. Sie hatte etwas versäumt. Auch das mit dem Tarot hatte sie eher zufällig entdeckt. Sie hatte abends gedaddelt, hatte im Netz herumgestöbert, um zu sehen, was von Saint Phalle im Handel war. Zu ihrem Ärger hatte sie Plunder entdeckt – Parfumflakons etwa und sündteure Seidenschals – und dann irgendwann das Tarotspiel.
»If life is a game of cards, we are born without knowing the rules«, hatte Saint Phalle ihrem Kartensatz vorangestellt. »Wenn das Leben ein Kartenspiel ist, dann sind wir geboren worden, ohne die Regeln zu kennen.« Das hatte Marthas Aufmerksamkeit erregt. Warum beschäftigte sie sich mit dem Tarot, dieser uralten Kartentechnik unklaren Ursprungs, die manche Leute als ein Gesellschaftsspiel, manche zum Wahrsagen benutzten und andere für eine philosophische Gedankenspielerei hielten, eine kreative Technik? Für Martha war das nur Kram.
»Ich glaube eigentlich nicht, dass Niki eine religiöse Träumerin war«, sagte Marie jetzt. »Sie hat ja keine Kirchen gebaut oder so was. Sie hat nur Elemente aus dem sakralen Raum benutzt, wenn es ihr gerade gefiel. War sie nicht so eine radikale Macherin? Eine, die immer gleich alles ausprobierte und dabei ihre ganze Umgebung in Atem hielt? Ich kann sie mir, ehrlich gesagt, nicht meditierend auf einem Kissen vorstellen! Wusstest du, dass sie …« Sie plauderte weiter.
Saint Phalle – eine Macherin? Wie sie selbst, wie Martha Grünhold? Es kam Martha gänzlich unwahrscheinlich vor. Und doch, so musste sie zugeben, freute sie der Gedanke.
Abends in ihrem schmalen Hotelbett aus falschem Nussbaum dachte sie über Niki de Saint Phalle nach, die französische Aristokratin mit ihren gewichtigen Engeln, die eine Macherin gewesen sein sollte, eine, die unverblümt herausfordernde, riesige Werke schuf – und über sich selbst, die versuchte, ihnen auf die Schliche zu kommen. Vorbeifahrende Autos ließen ihr Scheinwerferlicht durch die Vorhänge hindurch über die Decke des billigen Zimmers huschen. Das ergab schöne, bewegliche Muster: Blumen, Ranken, Herzen, seltsam verformte Hände, Fragezeichen und etwas, das man mit viel Fantasie für kleine Krebse halten konnte; das alles wanderte über die Zimmerdecke – und drumherum Ornamente, die züngelten wie Flammen. Ein anmutiges Schattenmobile.
Wer weiß: Vielleicht hatte auch die junge Niki de Saint Phalle so wachgelegen und den wandernden Schatten an der Zimmerdecke zugesehen? Wo hatten sich deren Träume entwickelt?
Nach einem kurzen Intermezzo zu Hause war Martha Grünhold wenig später schon wieder in Zürich, wieder im Hotel in der Nähe des Schutzengels, in Bahnhofsnähe, wie sie lieber sagte. Die Schweizer Eisenbahngesellschaft und der Versicherer hatten ihrem Plan zur Restaurierung des Schutzengels zugestimmt. Sechs Wochen. Nur sechs Wochen würde sie Zeit haben, die Figur zu reinigen. Wasser kam dabei nicht in Frage. Damit hatte das Clean-Team schon Unheil angerichtet: Die Bahnhofsleute sollten den Engel eigentlich nur zweimal im Jahr absaugen, er war ihnen aber so schmutzig vorgekommen, dass sie es doch einmal mit einem feuchten Lappen versucht hatten. Prompt war die berühmte blaue Farbe an einigen Stellen verwischt. Erschrocken hatte das Clean-Team innegehalten – und nun war es an Martha Grünhold, Alternativen zu finden. Elf Meter schiere, weißgrundige Fläche. Mit Flecken, Wasserläufen, Kotspuren.
Martha hatte, zurückgekehrt nach Deutschland, gegrübelt und gegrübelt. Sie hatte hier und dort eine Probe genommen. Mit Lupe und Skalpell rückte Martha dem Engel zu Leibe. Gelb und weiß – das mochte noch feucht angehen. Das Blattgold auf den Stummelflügelchen ließ sich vorsichtig abtupfen, ohne dass etwas abfärbte oder gar abblätterte, Gott sei Dank. Das Gold war schweizerisch. Der Engel war in Teilen aus den USA geliefert worden. Ein Mordsaufwand. Martha stellte sich den zerlegten Engel vor wie einen Käfer, der auf dem Rücken liegt. Aber in Einzelteilen. Also eher ein Huhn, ein Himmelshuhn, tranchiert für den Transport. Vergoldet worden war er erst hier, im Lager einer Möbeltransportfirma. Immerhin, das hielt. Gute Arbeit! Das Gold war nicht das Problem.
Martha zwackte noch etwas von der Substanz ab, die sie in Zürich als Probe abgenommen hatte. Untersuchte sie nass-chemisch – wie reagierte die Farbe auf Wasser und Lösungsmittel? Dann bettete sie die Probe in Kunstharz und betrachtete den Querschliff unter dem Mikroskop. Sie stellte eine Reagenz her. War das wirklich Acryl? Sie fertigte eine Art Probenjournal an, ein Schachbrett, auf dem die Reaktionen von Farbe A auf Reagenz A, dann B und so weiter festgehalten wurden. Tatsächlich verbanden sich Feuchtigkeit und Fett mit der Oberfläche.
Wischte man darüber, gab die Korpusoberfläche Farbe ab. Schwierig! Alles trockenreinigen würde nicht ausreichen. Und dann erst die Verätzungen durch den Kot der Tauben! Martha ging noch einen Schritt weiter. Ein Freund in Köln besaß ein größeres Labor. Er war der Einzige ihrer Bekannten, der ein echtes FTIR besaß, ein Fourier-Transformations-Infrarotspektrometer. Gold wert! Dahin wandte sie sich. Er wunderte sich über ihr extremes Interesse, aber so war sie, die Martha, der keine Technik zu ausgefallen, kein Spezialwissen zu abseitig war – so lange es um Konkretes, um Handhabbares ging. Sie begrüßte den Freund flüchtig, besuchte das Labor, schloss sich zwei Tage ein. Es wunderte den Freund nicht, dass sie nur ein paar Sätze für ihn übrig hatte – und noch weniger wunderte es ihn, dass sie mit einem Interferometer umgehen konnte. Das war ihre Technikerinnenvergangenheit. Martha Grünhold war einfach ein verflixt guter Profi! So hatten sie schon während des Studiums über sie gesprochen. Ganz schön grober Klotz – aber nur, solange es um die Kommilitonen ging. Mit den Kunstwerken hingegen feinfühlig, präzise –und eben technisch absolut top. Wenn sie nur ein bisschen verbindlicher wäre …
Martha im Labor schoss mit Infrarot auf die Probe. Sie nutzte Referenzmaterialien. Sie operierte wie ein Chemiker, den man mit einem Verfahrenstechniker gekreuzt hatte. Und dann hatte sie es. Dann wusste sie, wie sie den Engel reinigen könnte.
Eigentlich hatte Marie sie darauf gebracht, Marie mit ihren filigranen Zeichnungen, den zarten Aquarellen, Marie, denen die harten Bleistifte nie spitz genug, die Radiergummis nie sauber genug waren … das war es!
Martha Grünhold fiel die Kollegin in Dresden ein, Quereinsteigerin wie sie, Kunststoff-Fachfrau wie sie. Die hatte sich auf Gummi und Kautschuk spezialisiert, sie benutzte spezielle, professionelle Radiergummis. Das war es! Sie würde den Engel abradieren, die ganze riesige, weißgrundige Fläche. Und nur dort mit Feuchtigkeit operieren, wo es sich nicht vermeiden ließ.
Zurück in Zürich bezog Martha wieder das Hotel Garni am Bahnhof, räumte ihre Siebensachen ein, den Arbeitsoverall, den es gleich in zweifacher Ausfertigung gab, die schweren Sicherheitsschuhe, ein bisschen Wäsche, die Salbe für die malträtierten Hände. Schnell erledigt. Sie machte wieder den Toblerone-Test: Wenn sie in der Minibar eines Hotels einen Riegel der Schokolade vorfände, würde der Auftrag gutgehen. Sie riss die Tür des eingebauten Schränkchens auf – und hätte fast den ganzen Schrank mitgerissen. Wasser, Bier, sogar eine beruhigende Menge kleiner Fläschchen mit Spirituosen, Wein, Limonaden und da oben … Erdnusskerne, Salzstangen – und die begehrte Schokolade. Sie richtete sich ein.
Abends las sie eine Mail von Marie. Die hatte sich Mühe gegeben, ihr die Biografie von Saint Phalle so aufzubereiten, dass sie erträglich wurde für eine wie Martha Grünhold.
»1930 wird sie geboren. Catherine Marie-Agnès de Saint Phalle. In Neuilly-sur-Seine. Sie ist das zweite von fünf Kindern.« Hier hielt Martha schon mit Lesen inne. Fünf Kinder! 1930? In Frankreich?
Sie kramte ihr Handy heraus, suchte »1930«, suchte »Frankreich«. Das Land war, anders als Deutschland, nicht so sehr von der Weltwirtschaftskrise betroffen gewesen, so viel stand fest. Im Ersten Weltkrieg war jeder siebte französische Soldat gefallen, aber wechselnde Regierungen hatten sich darin übertroffen, Zuwanderer ins Land zu holen. Dass die Zeiten unsicherer würden, war gewiss schon vor 1930 spürbar gewesen – aber wo in Europa war das nicht der Fall gewesen?
Martha las die Mail weiter, die Marie ihr geschickt hatte, legte das Handy beiseite. Die Mutter: Jeanne Jacqueline, geborene Harper. Aha, daher der Bezug zu den USA. Der Vater: André Marie Fal de Saint Phalle. Ein Mann mit sieben Brüdern, ein Banker. Die Börsenkrise machte seinem Geschäft den Garaus. Er war 1929 pleitegegangen. Nun ja, nicht ganz: Die Brüder, die die Geschäfte gemeinsam betrieben, hatten sich wieder berappeln können – und dann war noch Yvar Kruger eingestiegen, ein Investor, dessen Engagement hochwillkommen war. Naiv allerdings, nicht damit zu rechnen, dass der Streichholzkönig von New York die Geschäfte lieber selbst übernehmen würde. Er drängte die Brüder aus der Firma, nur zwei ließ er weiterhin für sich arbeiten. André Saint Phalle stand endgültig auf der Straße. Eine Familie im Absturz. Alles im Jahr von Niki de Saint Phalles Geburt. Sie ist ein Kind der Depression, der Wirtschaftskrise, der Unsicherheit. Als Niki geboren wird, liegt die Pleite ein Jahr zurück. Oder ist ein Jahr alt, denn so etwas ist ja eine Krise, die andauert. Trotzdem störte es Martha, dass Marie schrieb: »Also wurde Niki aufs Land geschickt, zu den Großeltern väterlicherseits.« Wieso also, wieso diese Zwangsläufigkeit? Hätte sie denn bei den Eltern Hunger leiden müssen? Und wieso das kleine Mädchen und nicht das erstgeborene Kind? Martha setzte sich in ihrem schmalen Hotelbett auf, schob die Kissen zurecht. Kinder wegschicken, weil man gerade selbst in einer Krise war? Und was waren das für Großeltern, diese alten Adeligen? War das Kind mit offenen Armen aufgenommen worden – oder war es eher lästig? Was war mit dem älteren Kind? Aha, da stand es: ein Bruder, ein Bruder mit dem amerikanischen Namen John, dadurch gleich näher an die Mutter gerückt, und tatsächlich: Der durfte bleiben. Nur die Tochter, die Zweitgeborene, wurde weggeschickt. Martha spürte, wie mühsam es sein würde, die Geschichte von Niki de Saint Phalle zu erfahren, die wirklichen Zusammenhänge hinter der großen action und den knallbunten Nanas, Leitfiguren vielleicht, die den Weg aber eher verstellten, als dass sie ihn gewiesen hätten. Was hatte Niki de Saint Phalle wirklich bewegt, was hatte ihren Weg bestimmt – außer dem offensichtlichen künstlerischen Talent und einem offenbar festen, entschiedenen Willen?
1933, schon drei Jahre später, war die Familie erneut umgezogen – halt, nein – nur die kleine Cathérine Marie-Agnès, damals noch nicht Niki. Sie war, so hieß es in den Quellen, endlich bei der Familie in Greenwich, Connecticut, gelandet, verbrachte als Schulkind aber ihre Ferien immer wieder in Frankreich auf dem Château der Großeltern. Inzwischen gab es einen weiteren Bruder, Richard. Ritschard oder französisch Risch-ar? Und dann zwei Schwestern, Claire und Elizabeth. Knappes Bedauern in dem Text, den die Künstlerin selbst geschrieben hat: Sie seien jung gestorben. Wie?
Entschlossen schwang Martha die Füße aus dem Bett. Jetzt musste die Schokolade daran glauben. Und ein Bier dazu. Die Mischung aus Bier und Süßem war absonderlich, aber für Martha Grünhold unwiderstehlich.
Was für eine Familie – reich und doch arm. Verheißungsvoll – und voller Enttäuschungen. Kinderreich – aber nichts von alledem hatte Bestand, war verlässlich oder blieb. Der Vater hatte wohl sein Teil dazu beigetragen, auf und ab, Erfolg und Pleite, hochfahrende Pläne und Katzenjammer. Dazu die Zeiten. Martha schüttelte sich. Das alles war ihr so fremd. Fremd wie ein Château, ein Wehrhaus in Gottes Namen – und nach dem Wehrhaus in der französischen Provinz auch noch Greenwich, der New Yorker Vorort der Banker! Es gehörte wohl schon einiges an Selbstvertrauen dazu, ausgerechnet dorthin zu ziehen, wenn man gerade pleitegegangen war. Greenwich zog solche Leute an, bis heute. Amüsiert las Martha, dass die Stadt um 2010 den Spitznamen Upper Hedgistan bekommen hatte wegen der vielen Hedgefond-Manager, die sich dort niederließen. Bis heute eine Gegend für Hasardeure. Und 1933 mittendrin die französisch-amerikanische Familie aus Neuilly-sur-Seine. Aber nur für vier Jahre. Dann ein erneuter Umzug, nach New York City. Da war die kleine Cathérine sieben. Also wurde sie vermutlich in New York eingeschult.
Martha erinnerte sich an ihre eigene Schulzeit. An die kleine Grundschule, deren Klassenzimmer-Geruch sie sofort wieder in der Nase hatte, an die kostenlose Schulmilch, an die Tische, in die sie, kaum dass sie schreiben konnten, ihre Namen ritzten. Sie schrieb »Marta«, noch ohne H, das H musste sie sich erst erobern, sie wusste nicht sofort, wohin damit, und setzte es mal hier und mal dort ein, je nachdem, wo sie es schöner fand. Sie konnte aber nur das große H, das ging ziemlich lange so. Der Tisch mit den vielen Versuchs-Hs aber war ihrer, wenn man sie im Klassenraum umgesetzt hätte, hätte der Tisch mit umziehen müssen, das war ihr Terrain, ihre Sicherheit, genau wie Jacqueline ihre Sicherheit war und Randa, Amran und Said. Eine kunterbunte Klasse, chaotisch, laut, lernbegierig: ihr Zuhause. Auch wenn sie sich über die Mitschüler oder die Lehrer ärgerte und zu Hause beklagte – doch sobald die Mutter ernsthaft alarmiert war und deutlicher nachfragte, offenkundig in der Absicht, bald einzugreifen, verteidigte sie die Schule wieder, sagte, alles sei nicht so schlimm, keine Ahnung, warum sie sich gerade so aufgeregt hatte, nein, nein, Mama, es wird schon wieder. Später lernte sie, sich auf die Zunge zu beißen, nicht zu erklären, warum der Riemen ihrer Tasche abgerissen war, die Hose ein Loch hatte. Schulsachen, ihre Sache, nicht Elternsache.
Und bei Cathérine in den USA? Lapidar vermerkte Maries Kurzbiografie, dass Niki de Saint Phalle mit elf der Schule verwiesen wird und wieder umzieht, diesmal allein: Sie wird nach Princeton, New Jersey geschickt, wo die Eltern der Mutter leben. Sie sind wegen des Zweiten Weltkriegs aus Frankreich in die USA gekommen. Niki besucht dort die örtliche Schule, aber wieder nur für ein Jahr. Es geht zurück nach New York, an die Brearley School, in einem Alter, in dem man die Literatur entdecken kann oder die Kunst, in dem Kinder, die vorher ans Klavier gezwungen wurden, plötzlich die eigene Leidenschaft dafür entdecken oder für immer aufhören. Cathérine entdeckt das Theater. Das Mädchen macht aus seiner pompösen adeligen Vornamensgirlande ein knappes Niki. Niki ist schick, ist modern – und obendrein unisex, obwohl es den Begriff damals noch nicht gibt. So wie Robin, Cameron, Blake. Der Trend ist amerikanisch, wer hat Cathérine-Niki wohl dazu gebracht? Niki jedenfalls könnte ein Junge sein, bei Niki weiß man nicht, woran man ist, man soll sich ihrer nicht sicher sein können, niemals.
Sie begeistert sich, liest Martha weiter, für Shakespeare, für die gruseligen Geschichten von Edgar Allan Poe und für die griechische Tragödie.
Wie bitte?!? Sophokles und Co. mit zwölf? Martha erinnert sich an ihre eigene Schulzeit, grübelt: Hat man ihnen Theater beigebracht? Sie kann sich nicht erinnern. Wohl aber an Bücher. An Bücher, die sie gut fand, weil man etwas in der Hand hatte, etwas, das wog und schwer war, das man unters Bett legen konnte, und am nächsten Morgen war es immer noch da, und dieselben Geschichten standen an derselben Stelle.
Die Stadtbibliothek von Herne, vormals Wanne-Eickel, ein schmuckloser Bau, der eher einem Tresor glich als einer Bücherherberge, war ziemlich weit entfernt von zu Hause, aber es gab einen Bücherbus, der sich nach undurchschaubaren Regeln durchs Quartier quälte. Er fuhr an der Siedlung Teutoburgia vorbei und hielt am Nordfriedhof (wer brauchte da Bücher?), parkte länger an der Gesamtschule, schlug einen Riesenbogen vorbei an der Chemopur und dem Abholmarkt, und gelegentlich geschah es, dass er in ihrer Straße hielt. Eine Aufregung! Was für die Erwachsenen der Bäckerbus war oder für die Frauen die fliegende Kosmetikhändlerin, das war für die Kinder der Bücherbus. Später hatte Martha ein Antiquariat entdeckt, in dem man Bücher nach Gewicht kaufen konnte. Der Inhaber hatte ein kompliziertes Bezahlsystem entwickelt, sodass die dicken, schweren Bücher, die Atlanten und historischen Schinken am Ende doch, relativ gesehen, preisgünstiger waren. Noch immer liebte Martha dicke Bücher. Sie erschienen ihr solider, irgendwie überzeugender – in ihrer Ausbildung hatte sie alles darangesetzt, den Wehrle und den Krist möglichst bald zu kaufen, obgleich ihr eine gut bestückte Bibliothek zur Verfügung gestanden hatte. Aber Bücher, das waren sozusagen die Aktien für ihre Zukunft gewesen, die musste man besitzen, darauf ließ sich bauen. Warum dachte sie eigentlich »der« Krist? Der Herausgeber war schließlich eine Frau, Gabi Krist? Die Krist! Es hatte sich so eingebürgert, wie so oft. Ihre Gedanken schweiften ab – noch ein Stück Schokolade, ein Schokoladen-Gipfelchen nur! Das half, sich zu konzentrieren.
Saint Phalle mit zwölf und die griechische Tragödie? War das nicht etwas, das man später in sein Leben hineinerfand, weil es gut klang? Vielleicht hatte man irgendwann einen biografischen Fragebogen ausfüllen müssen, für irgendein Publikumsmagazin – und da machte sich so was besser als ein paar Comics?
Martha nahm sich vor, die Angaben genauer anzuschauen. Die Künstlerin hatte viel geschrieben – so viel, dass es Martha eigentlich die Lust genommen hatte, sich damit zu beschäftigen. Die meisten Künstler schrieben nicht. Es waren allenfalls Briefe von ihnen überliefert, selbst Tagebücher waren nicht die Regel. Und die, die dann doch schrieben, hätten es meistens besser bleiben lassen sollen: zu geschwätzig, zu bemüht, zu defensiv. Was war ein bildender Künstler, der sich erklären musste? Der hatte es doch offenkundig in seinen Werken nicht geschafft, das zu sagen, was zu sagen war.
Niki de Saint Phalle aber legte offenbar großen Wert darauf, mit ihrem Publikum in Kontakt zu kommen. Das rührte Martha auf eine unbestimmte Art und Weise. Und: Die Sache mit den toten Schwestern nagte an ihr. Das Weggeschicktwerden. Das Überflüssigsein, bestenfalls. Ein Kind der Unruhe. So viel Wechsel in dem noch jungen Leben. Das Unsichere bei so viel Geschichte im Rücken. Martha spürte, dass sie selbst dagegen geradezu breitbeinig im Leben stand. Niki de Saint Phalles Kindheit machte sie ganz nervös. Oder lag das am Biografischen an sich? War Biografie nicht überhaupt ein unsicheres Terrain? Sie wollte lieber zu den Werken zurückkehren, zu den handfesten Ausweisen der Tat!
Ihre Werkzeugkoffer wogen diesmal deutlich schwerer als beim letzten Mal. Das lag gewiss nicht am Tarotspiel, das sie dabei hatte. Irgendwie musste sie ja der Bedeutung ihrer seltsamen Engelsfrau auf den Grund kommen. Also hatte sie widerwillig für viel Geld bei eBay einen Siebdruck ersteigert, der die Tarot-Motive von Saint Phalle darstellte. Sie hatte die Motive ausgeschnitten und einzeln kaschiert. Das Motiv mit dem Engel, die Nummer XIV, trug sie mit sich. Sah ja niemand, dass sie sich jetzt mit solchem Zeug beschäftigte.
Weitaus mehr aber wogen die Dosen mit dem gereinigten Wasser, das sie brauchen würde, die weichen, gerundeten Seile, um die Figur zu halten, die Pinsel und Bürsten, die Berge von Tüchern und Lappen, die Maßbänder, Schrauben, die Papierrollen und das viele Werkzeug obendrein.