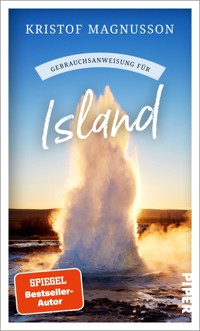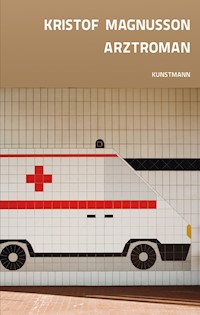
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anita Cornelius ist Notärztin an einem großen Berliner Krankenhaus und liebt ihren Beruf. Sich auf unerwartete Situationen einzustellen, entspricht ihrem Temperament. Auch wenn es bei ihren Einsätzen nicht immer so aufregend zugeht, wie man sich das vorstellt. Anita ist das recht. Sie kann helfen. Und ab und zu sogar jemandem etwas Gutes tun. Adrian, ihr Exmann, ist Arzt am selben Krankenhaus. Sie haben sich erst vor kurzem in bestem Einvernehmen getrennt, und Lukas, ihr vierzehnjähriger Sohn, lebt bei seinem Vater und dessen neuer Freundin Heidi. Hätte Anita Adrian nicht zufällig bewusstlos auf der Krankenhaustoilette gefunden, zugedröhnt mit einem Narkosemittel, und hätte Heidi nicht dauernd diese flotten Sprüche losgelassen, dass jeder seines Glückes Schmied ist, dass Arme und Kranke oft genug selbst an ihrem Zustand schuld sind, dann könnte sich Anita weiter vormachen: alles ist in bester Ordnung. Ist es aber nicht. Weder privat noch beruflich. Kristof Magnusson erzählt mit großer Kenntnis aus dem Alltag einer Notärztin und gleichzeitig aus dem Alltag ihrer Patienten. Vor allem aber erzählt er witzig und unterhaltend aus dem Leben einer Frau Anfang vierzig, die mehr will als Routine und 'schöner Wohnen'.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
KRISTOF MAGNUSSON
ARZTROMAN
Verlag Antje Kunstmann
Für meine Schwester Nicola
»Das Mitfühlen mit allen Geschöpfen ist es,was den Menschen erst wirklich zum Menschen macht.«ALBERT SCHWEITZER
»Nein!«HEIDI KLUM
ZEIT
DER WETTERBERICHT nach den Spätnachrichten kündigte einen weiteren heißen Tag in einer Reihe von heißen Tagen an, die Anita Cornelius bereits jetzt wie unendlich erschienen. Seit Wochen konnte sie kaum einschlafen vor Hitze, auch jetzt hatte sie es wieder versucht, dann jedoch lieber den Fernseher eingeschaltet, die Nachrichten gesehen und dabei die letzten Salzcracker gegessen, die der Kollege von der Tagesschicht übrig gelassen hatte.
Es war eine ziemlich normale Nacht am Notarzt-Stützpunkt des Krankenhauses am Urban in Berlin-Kreuzberg. Anita und ihr Assistent Maik hatten bisher drei Alarme gehabt, einmal Brustschmerzen, einmal Blutzucker und einen akuten Bauch, alle bei alten Menschen. So war es eigentlich immer, selbst in dieser Gegend der Stadt, aus der das Fernsehen gern von Messerstechereien und Drogenkriminalität berichtete. Häufiges ist häufig und Seltenes ist selten, das hatte Anita bereits im Studium gelernt, und Altwerden war eben häufig in diesem Land.
Anita stand auf, um sich aus dem Automaten am Eingang der Rettungsstelle einen Snack zu ziehen. Nachdem sie eine Münze eingeworfen und gewählt hatte, warf sie einen Blick auf das Fach mit den Mars-Riegeln und beobachtete die Metallspirale, die das Mars an das Ende des Regals schob, bis der Riegel in Schieflage geriet, mit der Oberseite nach vorne fiel und gegen die Spirale stieß, die in diesem Moment aufhörte sich zu drehen. Anita sah auf ihren Schokoriegel, zwischen Spirale und Regal über dem Abgrund verkeilt. Super Vertrauensbeweis für ein Krankenhaus, wenn nicht einmal der Snack-Automat funktioniert, dachte Anita und hätte es wohl für ein schlechtes Omen gehalten, wenn sie an solche Dinge glauben würde, doch das tat sie nicht.
Anita dachte an ihren Sohn. Wie oft hatte sie mit Lukas hier gestanden und gehofft, der Automat würde nicht ihr letztes Kleingeld fressen und den gewünschten Riegel dann doch behalten? Als Lukas klein gewesen war, hatte er dem Automaten sogar gut zugeredet, um seine Chancen zu erhöhen. Inzwischen, mit vierzehn Jahren, tat er das natürlich nicht mehr, er kam sie ohnehin nur noch selten auf der Arbeit besuchen, obwohl er jetzt noch näher an der Klinik wohnte als Anita selbst, kaum einhundert Meter entfernt, bei Anitas Ex-Mann und dessen neuer Freundin.
Anita schlug gegen den Automaten. Sie wusste, dass das nichts brachte, tat es aber trotzdem. Sie konnte es doch nicht einfach hinnehmen, dass der Automat ihren Snack nicht hergab, rüttelte an ihm, immer heftiger, da hörte sie ein schrilles Kreischen aus ihrer Hosentasche. Der Funkmeldeempfänger. Sie sah auf die Leuchtanzeige: Alarm: 1600: RTW 1505: NEF E: 46 VU Skalitzer Straße 72 0:32. Anita schaltete ihn aus und eilte zurück, zog ihre orangefarbene Funktionsjacke an und fuhr sich durch die Haare, bis sie einigermaßen locker auf den Rücken mit der Aufschrift Notärztin fielen. Maik kam aus seinem Zimmer, war auch schon komplett angezogen und tastete seine Frisur nach eventuellen Deformationen durch das Kopfkissen ab, auf dem er vor einer Minute noch gelegen hatte. So schritten sie, beide ihre Haare richtend, auf die Auffahrt der Rettungsstelle, so sagte Maik es zumindest immer: Ein Berliner Feuerwehrmann rennt nicht zum Einsatz, er geht auch nicht, er schreitet.
Sie stiegen in ihr Notarzt-Einsatzfahrzeug und fuhren vom Klinikgelände. Als das NEF auf dem Carl-Herz-Ufer beschleunigte, klapperte ihre Ausrüstung immer lauter in den säuberlich beschrifteten Schubladen. Anita sah in die schwarzen Erdgeschossfenster, in denen es blau aufflackerte, während sie vorbeifuhren, still und schnell. Die Leitstelle hatte inzwischen die Einsatzdaten auf ihr Navi übertragen, ein Verkehrsunfall war also ihr nächster Einsatz, die nächste Fahrt durch diese Nacht.
»Hallo, Sonnenschein, hast du gut geschlafen?«, fragte Maik, als sie auf der Baerwaldstraße waren.
»Der Snack-Automat funktioniert nicht.«
»Dann hoffen wir doch mal, dass das heute Nacht unser schwierigster Patient bleibt.«
»Da hast du auch wieder recht«, sagte Anita. Sie war immer froh, wenn Maik ihr Rettungsassistent war. Nach all den Einsätzen, den unzähligen Fahrten über rote Ampeln zu nachtschlafener Zeit, den vielen Stunden des gemeinsamen Wachens und Wartens, waren Anita Cornelius und dieser große Mann mit dem dichten schwarzen Haar und den tätowierten Unterarmen längst Freunde geworden und gingen manchmal nach der Arbeit ein Bier trinken. Maik hatte Anita sogar erzählt, dass er einmal ein paar Semester Medizin studiert hatte, von seinen Feuerwehr-Kollegen wusste das niemand.
»Ich konnte eh nicht schlafen bei der Hitze«, sagte Anita.
»Ich schon«, sagte Maik, dann gähnte er, wie zum Beweis, hob den Arm und legte den Kippschalter um, kurz bevor sie auf die Gitschiner Straße abbogen. Das Martinshorn. Nachts schien es immer besonders laut, sodass Maik es erst in letzter Sekunde ein- und so schnell wie möglich wieder ausschaltete, was Anita gefiel, denn sie wollte nicht allzu wach werden, um nach diesem Alarm endlich etwas Schlaf zu finden. Wenn jemand in Berlin die Eins-Eins-Zwei rief, fuhr normalerweise ein Rettungswagen los. Nur wenn die Leitstelle schwere Fälle erwarte, rief sie Anita und Maik mit ihrem Notarzt-Einsatzfahrzeug hinzu, und es passierte nicht selten, dass die beiden noch auf der Anfahrt erfuhren, dass sie wieder umkehren konnten, weil es doch nicht so schlimm war wie erwartet. Wenn Anita Glück hatte, wäre sie rechtzeitig in der Klinik zurück, um noch einen Versuch zu machen, ihren Schokoriegel zu befreien.
Sie erreichten im Nu das Kottbusser Tor, dann wurde der Verkehr dichter. Auf dem Bürgersteig vor dem Südblock standen zwei angesäuselte Gestalten, die offenbar nicht wussten, wo sie hinsollten und einander erst in Richtung Schlesisches, dann Richtung Hallesches Tor zogen. Wenig später passierten Anita und Maik eine nach Junggesellenabschied aussehende Gruppe von jungen Männern in einheitlichen T-Shirts.
Anita sah ihnen hinterher und rief sich ins Gedächtnis, was bei einem schwer verletzten Unfallopfer zu tun sein könnte, dachte an die wichtigsten Medikamente und machte im Geiste eine Entlastungspunktion nach Monaldi, um gefangene Luft oder Blut herauszuholen, das auf die Lunge drückte – der optimale Ansatzpunkt lag zwischen der zweiten und dritten Rippe, medioklavikulär. Natürlich wusste sie das, doch es beruhigte sie, sich solche Dinge immer wieder ins Gedächtnis zu rufen.
Vor ihnen fuhren die Autos inzwischen so langsam, dass Anita sich überhaupt nicht mehr vorstellen konnte, es wäre etwas Schlimmes passiert. Wahrscheinlich gab es nur einen Betrunkenen zu versorgen, der vor eines dieser Schritttempo fahrenden Autos gelaufen war.
Der Verkehr war vollkommen zum Stillstand gekommen. Die Unfallstelle war noch nicht in Sicht, doch Anita sah bereits den zitternden Widerschein der blauen Lichter an den Häuserwänden, während sie sich langsam und laut durch die Autos schoben, die ihnen Platz machten, so gut es ging. Bald kamen die ersten Einsatzfahrzeuge in Sicht, ein Rettungswagen der Johanniter, ein Lösch-Hilfeleistungsfahrzeug, bald darauf ein Wagen der Einsatzleitung. Zwei Polizisten in neongelben Westen leiteten den Verkehr in eine heillos verstopfte Seitenstraße. Anita begrub die Hoffnung, ihren Stützpunkt bald wiederzusehen.
»Ganz schöne Blaulicht-Disko«, sagte Maik.
»Das kannst du wohl sagen. Ich habe jetzt eher mit einem kleinen Blechschaden gerechnet.«
»Da war wohl eher ein verhinderter Sebastian Vettel am Start«, sagte Maik und zeigte durch die Windschutzscheibe auf ein Auto, das frontal gegen einen der Eisenpfeiler der Hochbahntrasse der U1 geprallt war.
Nun war Anita hellwach. Sie nahm Einweghandschuhe aus der Schachtel auf dem Armaturenbrett, stieg aus und griff den Defibrillator, Maik warf den Notfall-Rucksack über die Schulter und nahm den Koffer, auf dem das Wort trauma stand.
Sie gingen auf den Pfeiler der Hochbahntrasse zu, um den Feuerwehrmänner, Polizisten und Rettungskräfte herumstanden. Die Reflektorstreifen an ihren Uniformen warfen das Licht der Feuerwehrscheinwerfer grell zurück, und über allen Köpfen, Mützen und Helmen ragte eine Hand empor, die einen Infusionsbeutel mit einer glitzernden Flüssigkeit hielt.
Unter Anitas Füßen knirschte Pulver, das die Feuerwehr zum Binden des auslaufenden Benzins gestreut hatte, es fühlte sich an, als gingen sie über eine Kiesauffahrt. Sie näherten sich einem dunkelblauen BMW, der derart deformiert war, als wollte er sich jeden Moment in etwas anderes verwandeln. Die Motorhaube war geradezu um den eisernen Pfeiler herum geflossen. Dass es sich überhaupt um eine Motorhaube handelte, musste man wissen, sehen konnte man es nicht. Der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite war nicht mehr da, Schläuche, Metall und Plastik waren zu einer Masse verformt, die Kühlergrill und Nummernschild eingesogen hatte, die Stoßstange wies fast senkrecht in die Luft, über ihrer Spitze steckte ein Verkehrshütchen, damit sich niemand an den scharfen Kanten schnitt.
»Schickes Auto. Was neueres und teureres hat BMW derzeit nicht zu bieten«, sagte Maik.
»Und wohl auch ziemlich schnell«, sagte Anita. »Das waren doch mindestens achzig Sachen, oder?«
»Am besten, wir fragen mal den Kollegen, der da den Infusionsständer macht«, sagte Maik und ging auf den Rettungsassistenten zu, der die Infusion hoch hielt. Anita kannte ihn vom Sehen, ein Kollege von den Johannitern, die in der Wiener Straße stationiert waren.
»Guten Morgen. Und? Was habt ihr für uns?«, sagte sie.
»Eine eingeklemmte Person. Ansprechbar, Blutdruck 120 zu 80, Herzfrequenz 90«, sagte der Rettungsassistent und zeigte mit der freien Hand auf die Fahrertür. »Zum Glück war das Fenster offen, da haben wir schon mal einen Stiffneck angelegt und gleich einen Zugang gelegt, wo wir schon dabei waren. Aber man kommt echt schlecht am Lenkrad vorbei.«
Er klang erleichtert, dass nun jemand anderes für die medizinischen Entscheidungen zuständig war.
Ein solcher Unfall war in der Großstadt für alle eine Seltenheit. Sogar Maik, den kaum etwas schockierte, fehlten für einen Moment die Worte, wo er nun so nah an dem eingeklemmten Unfallopfer stand.
Anita zählte still für sich bis drei, wie sie es inzwischen automatisch tat, um sich in einer schwierigen Situation zu beruhigen. Sie hatte sofort Mitgefühl für das Unfallopfer, hatte Angst, einen Fehler zu machen, vielleicht vermischt mit Euphorie darüber, dass nun alle auf ihre Anweisungen warteten. Natürlich musste sie diese Emotionen unterdrücken, um vernünftig entscheiden zu können, das war eigentlich kein Problem, sie hatte das gelernt, und doch bemerkte sie, dass es in diesem Fall nicht so einfach war wie sonst. Sie zählte bis fünf, sechs, sieben, dann atmete sie tief durch und sagte zu dem Rettungsassistenten:
»Na, dann machen wir uns mal an die Arbeit.« Sie blickte auf das Wrack und fragte sich, was man bei diesen neuen Autos eigentlich alles tun musste, um sofort tot zu sein. Dann sah sie in das Wageninnere, und die eben unterdrückten Emotionen waren wieder da. Ein Junge. Sie hatte einen Erwachsenen erwartet, einen Mann, davon war sie fest ausgegangen, doch der Fahrer war nur wenig älter als ihr Sohn, siebzehn, vielleicht achtzehn. Junge Menschen auf diese Art schwach und hilflos zu sehen, schockierte Anita immer, sie musste sich zwingen, genau hinzusehen.
Der Junge war schlank und erinnerte in der unnatürlich steifen Haltung, in die ihn der Stiffneck gebracht hatte, eher an eine Puppe aus einem Crashtest als an einen Menschen. Sein linker Arm hing schlaff aus dem offenen Autofenster heraus, wie von dem kleinen weißen Gerät nach unten gezogen, das an seinem Zeigefinger hing und anzeigte, wie viel Sauerstoff sein Blut transportierte – ein erfreulich normaler Wert.
Anita rupfte die noch halb an der Fahrzeugdecke hängende Sonnenblende ab, zog einen schlaffen Airbag hinaus so weit es ging und sagte:
»Ich bin die Notärztin. Können Sie mich hören?«
Sie fragte das eher aus Gewohnheit, denn in dieser Situation konnte sie sich selbst kaum hören: Unweit von ihr hatten einige Feuerwehrleute kurz zuvor einen Generator angeworfen, und eines der Lösch-Hilfeleistungsfahrzeuge fuhr mit lautem Piepen rückwärts.
»Bekommen Sie einigermaßen Luft?«, rief Anita dem Jungen ins Ohr.
Der Junge formte die Lippen zu so etwas wie einem »Ja« und versuchte sie anzusehen, soweit das mit der Halskrause möglich war. Anita bemerkte, dass beide Augen sich synchron bewegten, das war gut.
»Ich leuchte Ihnen kurz in die Augen, okay?«
Anita zog erst das eine Augenlid nach oben, dann das andere. Die Pupillen waren isokor und klar umrandet. Falls es eine Hirnblutung gab, hatte sie zumindest noch nichts Schlimmes angerichtet, doch ein Schädel-Hirn-Trauma hielt Anita ohnehin für unwahrscheinlich, weil sie weder auf dem Armaturenbrett noch auf der Windschutzscheibe oder dem Lenkrad eine Delle in Form einer Stirn entdecken konnte.
»Tut dir was weh?«, fragte Anita. Nachdem sie ihm in die Augen geleuchtet und dabei die glatte Haut in seinem Gesicht gespürt hatte, war sie automatisch zum »Du« übergegangen.
»Mein Rücken.«
Anita ließ sich eine größere Lampe geben und leuchtete in den Fußraum. Kupplung, Gaspedal und Bremspedal hatten sich durch den Aufprall um die Beine des Jungen herum gebogen. Anita zwängte ihren Arm zwischen Lenkrad und Tür hindurch, kniff dem Jungen in den Oberschenkel und rief:
»Spürst du das?«
Sie kniff ihn noch einmal, so fest, dass es ihr in den Fingern weh tat.
»Kannst du mir sagen, was ich gerade mache?«
»Nein«, sagte er, und Anita sah in seinen Augen Tränen. Normalerweise verhinderte der Schock eine solche Reaktion, doch der Junge schien zu begreifen, was das alles bedeutete. Und bei der Angst, die Anita in seinen Augen sah, blieb sie nun selbst ganz ruhig und tat fast automatisch das, was sie in solchen Situationen immer tat, sie strich ihm über den Kopf, senkte die Tonlage und sagte mit einer beruhigenden Alt-Stimme:
»Ich pass auf dich auf.«
Und nach dem, was ich dir jetzt gebe, wirst du dich an das hier ohnehin nicht erinnern, dachte Anita dann und sagte zu Maik:
»Zieh mir mal eine Ketamin auf.«
»Was?«
»Ketamin!« Anita musste fast schreien, so laut war es um sie herum, jetzt ratterte auch noch eine U 1 direkt über ihren Köpfen hinweg in Richtung Spree. Ketamin. Anita und Maik verwendeten es in solchen Situationen gern, denn es wirkte schnell und nahm ihren Patienten alle Schmerzen, ohne die Atmung zu lähmen. Es gab ihnen lediglich das Gefühl, sie könnten ihren eigenen Körper verlassen, und das hätte sich in dieser Situation so ziemlich jeder gewünscht.
Maik reichte ihr die Spritze und rief:
»Willst du auch gleich Dormicum dazu?«
»Ja.«
Anita legte die Spritze an den Venenzugang und gab ihm hintereinander das Schmerz- und das Beruhigungsmittel. Es beeindruckte sie immer wieder, wie gut diese Medikamente wirkten, wie die Atmung mit jedem Luftholen ruhiger wurde und innerhalb von Sekunden die Angst aus den Augen des Jungen wich. Da hörte sie, wie ein Mann neben ihr laut in ein Funkgerät sprach. Er hatte ihr den Rücken zugedreht, auf seiner Uniform las sie das Wort Staffelführer. Sie tippte ihm auf die Schulter und sagte:
»Ich bin Dr. Cornelius. Hallo.«
»Kruschewsky. Morgen. Und? So etwas hat man nicht alle Tage.«
»Da haben Sie Recht. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie wir am besten vorgehen«, sagte Anita.
»Wirbelsäulenverletzung?«
»Er sagt zumindest, er spürt seine Beine nicht mehr.«
»Dann einmal Cabrio, oder?«, sagte der Staffelführer und zeigte mit der Antenne seines Funkgeräts auf das Autodach. Die Lesebrille auf seiner Nase wollte nur auf den ersten Blick nicht zu der Uniform und dem Feuerwehrhelm passen, auf den zweiten Blick passte sie genau zu der Art, wie er mit ihr sprach: Wie ein in Würde gealterter Handwerksmeister, der einer ahnungslosen Bauherrin eine ebenso teure wie alternativlose Maßnahme ankündigte, bei der alles andere als sofortige Zustimmung eine grobe Dummheit wäre. Er senkte den Kopf und sah sie über die Ränder seiner Lesebrille hinweg an. Um sie herum hatten die Feuerwehrleute bereits ihr hydraulisches Rettungsgerät ausgepackt und angeschlossen. Sie machten sich bereit, das Auto aufzuschneiden, das Dach abzureißen und den Jungen aus dem Sitz zu heben, ohne die Wirbelsäule zu verdrehen. Das wäre die schonendste Art, würde aber auch am längsten dauern. Ob er so lange durchhalten würde, war Anitas Entscheidung. Jemand gab ihr einen Feuerwehrhelm.
»Und?«, fragte Staffelführer Kruschewksy. Anita wischte sich den Schweiß von der Stirn, bevor sie den Helm aufsetzte. Es war immer noch unglaublich heiß. Sie überlegte einen Moment, da sagte der Staffelführer schon:
»Dann machen wir doch mal los.«
Für Anitas Geschmack klang er etwas zu enthusiastisch, was ihre Skepsis weiter wachsen ließ. Auch für ihn konnte das keine alltägliche Situation sein, und doch tat er so, als sei alles ganz eindeutig, wahrscheinlich, weil es ihm und seinen Männern langsam unangenehm wurde, bei diesem eingeklemmten Jungen zu stehen und nichts zu tun. Doch Anita hatte ihn noch nicht genau genug untersucht. Sie wusste nur, dass der Junge genug Sauerstoff im Blut hatte und hören konnte. Und, überraschender Weise, weinen. Was sie hingegen nicht wusste, war, was genau passiert war, als der Junge so abrupt von ungefähr achtzig Stundenkilometern auf Null heruntergebremst worden war. Der Körper war gegen den Sicherheitsgurt geworfen worden, so viel war klar. Die Organe waren auf Gewebe geprallt, Blut gegen Blutgefäße, das Gehirn gegen den Schädel. Doch welcher Teil des Körpers hatte den schwersten Schaden genommen? Medizinisch gesehen waren solche Unfälle immer Ratespiele, das war es, was Anita nicht gefiel.
Anita hatte den Eindruck, dass es den Feuerwehrleuten etwas zu viel Spaß machte, ihr schweres Gerät zum Einsatz zu bringen, um ein Auto zu zersägen, je teurer das Auto, desto besser. Doch eine andere Möglichkeit fiel ihr auch nicht ein. Sie musste den Jungen untersuchen und dazu in das Auto hinein.
»Gut. Los geht’s. Aber macht erst die Beifahrertür auf, damit ich rein kann«, sagte Anita und spürte die Erleichterung, die sich um sie herum breitmachte. Endlich gab es einen Plan. Die Feuerwehrleute schoben Holzbalken unter den Wagen, damit er keine unkontrollierten Bewegungen machte, während sie ihn zerschnitten. Ein Feuerwehrmann kam mit einem Werkzeug, das aussah wie eine riesige Hummerschere, und stellte sich an den Kotflügel der Beifahrerseite. Das Rattern des Generators schwoll an und die Rettungsschere knüllte knarrend den Kotflügel zusammen. Das Auto wackelte, der Junge kniff die Augen zusammen. Unter dem Kotflügel erschienen die unlackierten, fast weißen Scharniere der Tür, an denen der Feuerwehrmann als nächstes ansetzte. Es knallte einmal, zweimal, dann öffnete er die Beifahrertür so leicht wie die Tür eines Adventskalenders.
»Bitte sehr, Frau Doktor«, sagte Staffelführer Kruschewsky, deutete eine Verbeugung an und tippte sich an den Helm, als wäre er eine Chauffeursmütze. Anita bekam ohne Probleme ihre Beine in den auf der Beifahrerseite weniger deformierten Fußraum und ließ sich auf den Sitz fallen.
Es roch scharf, nach heißem Plastik, nach Scheibenwaschwasser. Als der Generator für einen Moment leiser wurde, hörte Anita Musik. Es war Blurred Lines von Robin Thicke, ein hibbeliger, gut gelaunter R’n’B-Sommerhit. Sie sah das Autoradio an, in der Hoffnung, sein Telefon zu finden, das wäre später gut gewesen, um Angehörige zu erreichen, doch die Musik kam aus einem billigen MP3-Spieler. Anita stöpselte ihn aus.
Jemand reichte ihr einen zweiten Helm, den sie dem Jungen aufsetzte, dann löste sie den Gurt, schob die Verbandsschere unter sein T-Shirt und schnitt es auf, mitten durch die Aufschrift ABI 2014. Als sie das T-Shirt zur Seite schob, entdeckte sie auf dem Brustkrob eine Prellmarke, die den schrägen Verlauf des Anschnallgurtes nachzeichnete. Sie klebte ihm vier Elektroden auf die Brust, um ihren Defibrillator mit dem integrierten Vitaldaten-Monitor anzuschließen. Der Junge blickte starr geradeaus.
Der Monitor auf ihrem Defi zeigte, dass sein Herz in einem regelmäßigen Sinusrhythmus schlug. Sie tastete den Bauch ab, der unbehaart war und weich, keinerlei Abwehrspannung; wollte die Lunge abhören, hörte jedoch nichts vor lauter Lärm, drückte das Stethoskop fester auf die Brust, die Ohrbügel tiefer in ihre Gehörgänge, und irgendwann, als das Rattern des Generators für einen Moment leiser wurde, hörte sie auf der einen, dann auch auf der anderen Seite ein langsames, tiefes Rauschen. Im nächsten Moment sah sie das Gesicht des Staffelführers, der im Fenster erschien und offenbar etwas sagte. Anita nahm die Stethoskopbügel aus den Ohren und rief:
»Was?«
»Wir wären dann so weit«, rief er und gab Anita eine Decke, die sie über sich und den Jungen breitete. Es wurde still und dunkel um sie herum, die Hektik der Umgebung, der Rest ihrer Welt waren weg. Der Junge gab ein leises Stöhnen von sich, da sagte Anita:
»Die Decke schützt uns vor den Glassplittern.«
»Wenn ich hier raus bin, lasse ich auch das Auto stehen. Ich bin noch verabredet. Wir gehen feiern«, sagte der Junge, der wieder schneller atmete, die Wirkung des Ketamins ließ bereits nach. Anita machte die Lampe an und sah abermals auf den Monitor ihres Defi. Sein Herz schlug schneller, der Blutdruck war gesunken, sie hoffte, dass das nicht so weiter ging.
»Wie lange muss ich denn noch hier sitzen?«
»Wir holen dich hier raus. Wir müssen nur erst das Dach abnehmen.«
»Warum?«
»Weil deine Beine eingeklemmt sind.«
»Was ist mit meinen Beinen?«
Der Junge versuchte, sich aufzurichten, sodass Anita bereute, das gesagt zu haben. Es knallte ein weiteres Mal, direkt über ihren Köpfen. Der Junge zuckte erneut zusammen, diesmal klang es, als würde eine riesige Flasche zerbersten, das musste die Spitze der Feuerwehraxt gewesen sein, die die Windschutzscheibe durchschlug. Es folgte ein ewig langes Sägegeräusch, die Axt arbeitete sich um die Scheibe herum.
»Und nach dem Feiern, da gehe ich zu Fuß nach Hause. Versprochen«, sagte der Junge. Anita nickte. So lange Atmung und Blutdruck einigermaßen stabil blieben, gab es nichts zu tun, außer der sogenannten psychologischen Betreuung: Händchenhalten auf hohem Niveau. So saßen sie da, der Vitaldaten-Monitor piepte, piepte, in schneller, aber regelmäßiger Folge. Die Hitze der Spätsommernacht verfing sich unter der Decke. Anita leuchtete ihrem Patienten noch einmal ins Gesicht. Mit dem Feuerwehrhelm und einer kleinen Schnittwunde auf der Wange sah er jetzt wirklich aus wie ein Junge, der Feuerwehr spielte. Was machte er in so einem Auto? Hatte er es gestohlen? Von seinem Vater ausgeliehen und wenn ja, wusste der davon? Oder gab es in Berlin Kinder, die solche Autos zum Führerschein geschenkt bekamen?
»Erinnerst du dich, was passiert ist?«
»Nein.«
»Unglaublich, wie schnell das heiß wird, unter so einer Decke, oder? Mein Sohn und ich, wir haben oft unter der Decke Spiele gespielt, Höhlenforscher, mit Taschenlampe und Funkgerät, ich habe einen Sohn. Der ist vierzehn«, sagte Anita. Sie wollte ihn ohnehin nur ablenken, es war egal, was sie sagte. Sie hätte auch über das Wetter reden können, wie sie es sonst oft tat, doch aus irgendeinem Grund sprach sie über Lukas.
»Jetzt ist er zu alt für so etwas. Verrückt, wie schnell Kinder groß werden, es kommt mir noch wie gestern vor, da durfte er am Strand nur zwischen der Langnese-Fahne und der Pommesbude herumlaufen, und jetzt sagen wir ihm: zwischen Hermannstraße und Alex.«
Wenig später fing das ganze Auto an zu knarren, immer lauter, immer höher, das Auto erbebte, das Dröhnen der Dieselmotoren wurde immer lauter, dann gab es einen Ruck, als wäre jemand damit zu schnell über einen Bordstein gefahren. Die A-Säule zwischen Windschutzscheibe und Fahrertür war durchtrennt, doch der Junge schien das gar nicht mitbekommen zu haben. Er war nicht einmal zusammengezuckt.
»Jetzt hast du es bald geschafft«, sagte Anita. Der Junge antwortete erst nicht, dann sagte er:
»Ich will jetzt endlich mal los«, und fügte wenig später hinzu: »Es ist mir zu eng hier und …« Es folgte eine erneute Pause. »Und…« Dann hörte er auf. Mitten im Satz. Das Piepen des Vitaldaten-Monitors wurde tiefer, dunkler – das tat es nur, wenn im Blut zu wenig Sauerstoff war. Anita maß den Blutdruck. Nicht gut.
»Weißt du, wo du hier bist?«
Nichts.
»Du musst mir antworten«, rief sie. Erst sah es so aus, als wollte er trotz Stiffneck versuchen zu nicken, doch sein Kopf sank einfach nur nach vorn. Das Piepen wurde noch dunkler. Und schneller. Sie tastete erneut seinen Bauch ab – nun war er ganz hart. Und Anita folgte einem ganz anderen Plan: Behandle zuerst, was zuerst tötet.
Der menschliche Körper konnte meisterhaft auf Sparflamme schalten. Verlor er Blut, wurden unwichtige Stellen weniger versorgt, Organe heruntergefahren, Gefäße zusammengezogen, es wurde schneller gepumpt. Besonders junge Leute konnten so über lange Zeit eine innere Blutung ausgleichen. Der Nachteil dieser Qualität war, dass es, wenn alles das nichts mehr half, sehr schnell vorbei ging. Anita sprang auf, warf die Decke fort und schrie:
»Stop!« Geblendet von dem Scheinwerferlicht, das den Unfallort unter der U-Bahn-Strecke erhellte wie einen Fußballplatz, stieß sie mit dem Helm gegen das Dach, stolperte aus dem Wagen und rempelte die Feuerwehrleute zur Seite, die gerade an der A-Säule auf der Beifahrerseite ansetzten. Der Staffelführer sah Anita an, als habe sie einen Scherz gemacht.
»Er schmiert ab. Wir müssen ihn herausholen. Sofort.«
»Wir brauchen nur noch ein paar Minuten.«
»Wir haben keine paar Minuten. Er verblutet.«
Sowohl die Feuerwehrleute, als auch der Staffelführer sahen nun auf den Jungen. Blut war nirgendwo zu sehen. Und doch war Anita sich sicher. Irgendwo in ihm musste etwas geplatzt sein, ein Blutgefäß wahrscheinlich. Da war die Energie des Aufpralls geblieben.
»Aber er hat gesagt, er spürt seine Beine nicht mehr«, sagte der Staffelführer. »Der hat doch etwas an der Wirbelsäule.«
»Es ist mir egal, was der an der Wirbelsäule hat. Besser im Rollstuhl als tot«, sagte Anita. »Er muss da sofort raus.«
»Wenn Sie meinen. Sie haben studiert.«
Für einen kurzen Moment passierte nichts. Doch Anita war sich sicher, dieser Junge verlor mit jeder Sekunde, jedem Herzschlag Blut. Als die Feuerwehrleute schon wieder die Hydraulikschere anlegen wollten, kletterte Anita zurück in den Wagen. Sie kniete sich auf den Beifahrersitz und legte einen Arm um den Jungen. Sie musste alle Kraft aufwenden, um überhaupt zwischen seinem Rücken und dem Sitz durchzukommen, doch schließlich schaffte sie es, ertastete auf der anderen Seite einen Hebel, zog daran und die Lehne des Fahrersitzes schoss nach hinten. Obwohl Anita den Jungen hielt so gut sie konnte, sackte sein Oberkörper in sich zusammen. Sie drehte ihn zur Seite, bis er ihr in die Arme fiel und sie seinen Bauch umfassen konnte. Anita ergriff seinen rechten Arm, hielt ihn als Schutz vor seine Leber, rutschte auf dem Beifahrersitz zurück, schob ihn, zog an ihm, vor, zurück, wieder vor, doch er kam nicht frei. Sie griff mit der anderen Hand nach einem seiner Füße, riss einmal daran, zweimal, dann packte sie das Bremspedal und bog es aus dem Weg, was ewig zu dauern schien. Jetzt war er frei. Sie zerrte den fast weißen Körper über Handbremse und Schalthebel hinweg, stellte einen Fuß auf die Straße, stemmte sich mit dem anderen gegen den Wagen und riss so lange weiter an dem Jungen mit der Halskrause, bis sie, ihn im Arm, auf der Straße stand. Voller Schreck sahen die Feuerwehrleute ihr zu, hatten sie doch bisher alles getan, um auch die kleinste Verdrehung seines Körpers um jeden Preis zu vermeiden. Selbst in der Menge der Schaulustigen, die sich inzwischen auf der anderen Seite der Skalitzer Straße angesammelt hatte, kam Unruhe auf. Doch Anita war sich sicher, dass jetzt nur noch eins zählte: Zeit.
Wenigstens wussten nun alle, dass sie es ernst meinte.
»Einladen. Losfahren«, rief Anita. Der Staffelführer kam ihr zu Hilfe, fasste dem Jungen unter einen Arm und zog ihn zusammen mit Anita aus dem Wagen. Zwei weitere Feuerwehrleute kamen und halfen, ihn auf die Trage zu legen, in Schocklage, Beine hoch, im nächsten Moment war er bereits im Rettungswagen und sie fuhren los.
Während einer der Rettungsassistenten den RTW zurücksetze, fiel Anitas Blick ein letztes Mal auf den Unfallwagen. Mit den groben Holzbalken, auf die er nun gestützt war und dem halb entfernten Dach, erinnerte der BMW an altmodische, konsumkritische Objektkunst, die die Symbole der Wohlstandsgesellschaft als Schrott darstellte; Anita hatte so etwas in den Hinterhöfen besetzter Häuser von Berlin-Mitte gesehen.
Das Martinshorn ging an und nicht mehr aus, während sie am Schlesischen Tor vorbei, über die Warschauer Brücke zum Frankfurter Tor fuhren und dann abbogen in Richtung Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn.
Anita gab ihm so viel NaCl wie möglich. Wenn schon immer weniger Blut durch seine Adern floss, sollte zumindest Kochsalzlösung an dessen Stelle treten. Als sie das Portemonnaie des Jungen durchsuchte, um seinen Namen herauszufinden, fiel ihr Blick auf das Bild von einem Paar, das nicht wesentlich älter aussah als ihr Ex-Mann Adrian und sie. Sie sah es nicht lange an.
Da Anita den Jungen telefonisch als Polytrauma angekündigt hatte, stand bei ihrer Ankunft im UKB alles bereit, was die Nachtschicht eines Trauma-Zentrums zu bieten hatte, Anästhesie, Radiologie, Unfallchirurgie, Neurochirurgie, Pflegepersonal, eine MTA; ein Dutzend Menschen, die mit ihren bunt gemusterten Röntgenschutz-Schürzen aussahen, als wollten sie gleich an einer Kunst-Performance teilnehmen.
Sobald sie den Jungen in den Schockraum geschoben hatten, rief der Unfallchirurg:
»Alles Ruhe! Übergabe durch den Notarzt«, und Anita berichtete. Dann lief eine Choreographie ab, die Anita schon oft erlebt hatte, aber doch immer aufs Neue faszinierend fand. Der Patient wurde von der Trage auf den Untersuchungstisch gehoben, ein Radiologe hatte das Ultraschallsystem schon in der Hand, mit Gel eingeschmiert und drückte es sofort auf den Bauch, um nach der Blutung zu suchen, eine Krankenschwester schnitt die Kleider auf, während ein Pfleger einen Blasenkathether legte, eine Narkose eingeleitet und Röntgenbilder gemacht wurden. Alle stürzten sich gleichzeitig auf den Jungen wie ein Schwarm Piranhas. Und so schnell es eben noch gehen musste, war für Anita nun alles vorbei.
Sie stellte sich abseits an einen Tisch, schrieb ihr Einsatz-Protokoll und hörte währenddessen mit einem Ohr, dass die Ultraschalluntersuchung ihren Verdacht bestätigt hatte. Die Aorta des Jungen war eingerissen. Ein ursprünglich kleiner Riss hatte sich durch den hohen Druck ausgedeht, und die Blutung war im Nu so stark geworden, dass sie auf die Wirbelsäule drückte. Wenn alles gut lief, hatte er deswegen seine Beine nicht mehr gespürt.
»Ihr schickt uns dann ein Fax mit der Diagnose?«, fragte Anita, schon auf dem Weg zur Tür.
»Aber klar. Wie immer«, sagte der Unfallchirurg. »Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. »
Als Anita das Unfallkrankenhaus verließ, wartete Maik bereits mit dem NEF auf sie. So konnten sie bereits auf der Rückfahrt zum Stützpunkt auf dem Funkmeldesystem die Eins drücken und waren wieder einsatzbereit über Funk, doch den Rest der Nacht blieb es ruhig. Kein Alarm mehr, sodass Anita nun wirklich einschlafen konnte, erst kurz vor Schichtwechsel wieder aufwachte und das Fax vom Unfallkrankenhaus Marzahn vorfand: Der Junge war notoperiert worden und nun stabil, die Wirbelsäule unverletzt. So verließ Anita um kurz nach acht das Urban-Krankenhaus in bester Laune.
Die Nacht hatte kaum Abkühlung gebracht. Jetzt schien es sogar schon wieder heißer zu werden, die Sonne war längst aufgegangen, der Morgen voll da. Anita Cornelius ging auf ihrem Heimweg an der Suffmanufaktur vorbei, einer Kneipe, die nie schloss. Im Laufe der Jahre waren immer mehr Fensterscheiben durch Sperrholzplatten ersetzt worden, dennoch konnte Anita erkennen, dass die Kneipe rappelvoll war, da flog die Tür auf, zwei junge Männer in engen Jeans, Baseball-Caps und Feinripp-Unterhemden wankten heraus, und der eine sagte zu dem anderen:
»And now, let’s get drunk.«
Anita ging weiter. So wie jede Nachtschicht mit der Tagesschau begann, ging sie jeden Morgen nach ihrer Ablösung hier vorbei, denn sie fühlte sich auf merkwürdige Art mit diesen Menschen verbunden, die ebenso die Nacht durchwacht hatten wie sie. Erst wenn sie die Suffmanufaktur passierte hatte, war die Nacht für sie vorbei; sie sah das Licht, spürte die Sonne, hörte die Mauersegler, die sirrend an den Hauswänden hinabstürzten und dann wieder in einen Himmel hinaufstiegen, der sich weiß in Richtung Sonne streckte.
Sie schlief noch einige Stunden und stand gegen Mittag wieder auf, um aufzuräumen. Ihr Sohn kam heute zu ihr, und Anita wollte nicht, dass ihre Wohnung einen unordentlichen Eindruck machte. Also ging sie in ihr Wohnzimmer, hob zwei Eispackungen, eine Weinflasche und eine fast leere Tüte Erdnuss-Flips vom Boden auf und tat sie in die Plastiktüte des China-Imbisses Glück, in der sie gestern eine Siebenundvierzig-mit-Reis nach Hause getragen hatte.
Auch ein Jahr nach der Trennung glich Anitas Wohnzimmer einem Möbellager. Als sie die gemeinsame Wohnung auflösten, hatte Adrian kaum etwas mitnehmen wollen – seine neue Lebensgefährtin Heidi besaß eine so perfekt eingerichtete Wohnung, dass neue Einrichtungsgegenstände ohnehin nur gestört hätten. Adrian hatte nur die Kaffeemaschine und ein gerahmtes Miles-Davis-Poster behalten, alle anderen Möbel waren bei Anita gelandet, doch deren neues Wohnzimmer war ziemlich klein, sodass man nun kaum auftreten konnte zwischen den zwei Sofas, drei Sesseln und den ganzen Bildern, die in ihrer alten Wohnung gehangen hatten und nun hier auf dem Boden standen, an die Wände gelehnt.
Anita war klar, dass sie irgendwann einmal ausmisten musste, doch sie hatte erst Möbel für Lukas gekauft, das hatte Vorrang, schließlich hatte er alles mit in sein neues Zimmer bei Heidi genommen; dann hatte ihr Elan nur noch für ein paar neue Küchenmöbel und einen Kaffeevollautomaten gereicht.
Im Schlafzimmer zog sie die Schublade ihres Nachttisches auf, in der sie vor ungefähr einem Jahr, kurz nach ihrer Trennung von Adrian, drei Kondome bereitgelegt hatte, die dort noch immer lagen. Sie nahm die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Der Notarzt und bedeckte die Kondome damit, dann schob sie die Schublade mit einer energischen Bewegung wieder zu. Erledigt.
Im Zimmer ihres Sohnes gab es, im Gegensatz zu ihrem Wohnzimmer, überhaupt nichts aufzuräumen. Lukas hatte seinen Drehstuhl unter den Schreibtisch geschoben, die Maus lag genau in der Mitte des Mousepads mit dem Bild von Bart Simpson, das wiederum bündig mit der Tastatur abschloss. Sogar das Bett war gemacht, auf dem Nachttisch lag ein Stapel Karteikarten mit Englisch-Vokabeln. Anita schüttelte den Kopf. Lukas’ Zimmer war derart ordentlich, dass sie sich regelrecht über die halb volle Flasche Apfelschorle freute, die unter das Bett gerollt war, sonst hätte dieser Raum gar nicht mehr wie ein Kinderzimmer gewirkt, sondern nur noch wie ein Büro, das ihr vierzehnjähriger Sohn drei Tage in der Woche nutzte, bevor er einige Termine bei seinem Vater und dessen neuer Freundin wahrnahm.
Auch bei Trennungen ohne Schlammschlacht traten zwangsläufig zwei Wohnungen in einen Wettbewerb um die Gunst des Kindes. Die Frage, wie Lukas dieses von Anita neu eingerichtete Zimmer gefiel, war zu einem Symbol dafür geworden, wie es mit der Trennung klappte. Sicher, der PC hatte mehr Arbeitsspeicher als sein alter, und der Monitor war zwei Zoll größer, doch die Gemütlichkeit eines Kinderzimmers mit all den im Laufe der Jahre angesammelten Dingen, vom ersten Teddy bis zum Harry-Potter-Poster, konnte sie nicht erzeugen. Und dennoch hatte es geklappt. Lukas war gern in seinem Zimmer. Anita und Adrian hatten die Trennung gut gemanagt, ein besseres Wort gab es dafür nicht.
Als Lukas eine Viertelstunde nach Schulschluss noch nicht geklingelt hatte, sah sie aus dem Fenster, rückte ein Kissen zurecht, sah wieder aus dem Fenster und dann auf die Uhr. Sie freute sich auf ihren Sohn und fast ebenso sehr freute sie sich auf das, was er mitbrachte: Ein paar Tage ihres früheren Lebens, des Lebens als Frau mit Familie, in dem sie sich um einiges besser auskannte als in dem, was jetzt war.
Wenig später öffnete Anita ihrem Sohn die Tür. Lukas hatte eine neue Frisur. Er trug sein Haar jetzt an den Seiten kurz und oben so lang, dass er es mit einem Seitenscheitel einmal quer über den Kopf kämmen konnte, genauso wie der Junge in dem Unfallwagen letzte Nacht. Dies war die erste Frisur, die sie nicht für ihren Sohn ausgesucht hatte, sein erster selbstbestimmter Haarschnitt, dachte sie und drückte Lukas derart fest an sich, dass seine Stimme ganz gedämpft klang, als er sagte:
»Hallo, Mama.«
Anita trat einen Schritt zurück.
»Schicke Frisur.«
»Es müsste nur oben noch ein bisschen länger sein. Eigentlich soll das bis hier rübergehen.« Lukas stellte den Rucksack im Flur ab und fuhr sich durch die Haare. Dann ging er in die Knie, wie sonst, um sich die Schuhe auszuziehen, doch heute hatte er nur einen kleinen Fleck auf dem leuchtenden Weiß der Turnschuhe entdeckt und wischte daran herum.
»Die Schuhe sind auch neu, oder?«
»Am Samstag gekauft. Ich wollte unbedingt die in weiß mit dem Swoosh in orange, da mussten Heidi und ich ganz schön nach suchen.«
»Lass uns auch mal wieder was einkaufen gehen«, sagte Anita.
»Ja, klar«, meinte Lukas. »Aber ich dachte, du gehst nicht so gern shoppen.«
»Doch, natürlich. Wie kommst du denn darauf? Ich habe nur nicht immer Zeit. Aber jetzt habe ich eh ein paar Tage frei.«
»Wie lief eigentlich dein Nachtdienst?«
»Das war echt wild. Wir mussten einen jungen Typen aus einem BMW schneiden, der ist voll gegen einen dieser Pfeiler von der U-Bahn am Schlesischen Tor geknallt.«
»Schneiden?«
»Das Auto aufschneiden.«
»Krass«, sagte Lukas und folgte ihr in die Küche. Er setzte sich ihr gegenüber an den Küchentisch und lächelte sie an, als sie ihm eine Flasche Apfelschorle zuschob.
»Erst haben wir die Beifahrertür abgeschnitten. Dann wollten wir eigentlich das Dach abmachen und ihn ganz vorsichtig rausheben, doch da haben wir gemerkt, er hat eine riesige intraabdominelle Blutung! Da haben wir ihn einfach über die Beifahrerseite rausgezerrt und sind wie die Blöden ab in’s Unfallkrankenhaus nach Marzahn.«
Anita wusste, dass ihr Sohn sie trotz dieser Fachworte verstand. Seit er klein war, hatten sie zu fast jedem Tischgespräch zwischen Anita und ihrem Ex-Mann gehört, Worte wie intraabdominell waren quasi Familienmitglieder. Sie wusste, wie spannend Lukas diese Geschichten fand und freute sich, in seinem Blick auch jetzt diese kindliche Begeisterung für alles Medizinische zu sehen, die sie seit Jahren mit ihren Geschichten in ihm auslöste:
»Nun mach es nicht so spannend, Mama. Hat es geklappt? Hat er überlebt?«
»Ja«, sagte Anita und hielt ihrem Sohn die offene rechte Hand hin. Lukas zögerte einen kurzen Moment, dann klatschte er mit seiner Hand in ihre, wie es Sportler derselben Mannschaft bei einem Erfolg taten und sagte:
»Genial.«
»Was wollen wir denn essen?«, fragte Anita. Sie wollte nicht von ihrer normalen Routine abweichen. Alles sollte laufen wie immer in den letzten Monaten: Sie würde Lukas das Telefon geben. Die besten Lieferdienste waren gespeichert, die Bestellnummern seiner Lieblingsgerichte kannte Lukas inzwischen auswendig. Sie würde den Tisch decken, und wenn der Lieferservice klingelte, würde sie Lukas mit ihrem Portemonnaie zur Tür schicken, ihm einschärfen, zehn Prozent Trinkgeld zu geben und währenddessen die Soja-Sauce oder den Pizzaschneider holen, je nachdem. Nach dem Essen würde Lukas Klavier üben, den Computer anschalten, Hausaufgaben machen und dabei mit seinen Freunden chatten. Irgendwann würde sie mit einem Stück Kuchen in sein Zimmer kommen, sie würden ein bisschen reden. So sollte es weitergehen. Wie geplant.
»Pizza? Vietnamesisch? Steak?«
»Kann ich gleich zu Matthäus?«, fragte Lukas. Anita sah auf das Telefon in ihrer Hand. »Weil, das haben wir uns so gedacht, er hat einen neuen Computer, gerade erst gekauft. Da wollen wir ein paar Sachen installieren.«
»Willst du nicht erst was essen?«
»Wir holen uns einen Döner.«
Anita steckte das Telefon wieder ein. Natürlich konnte Lukas zu Matthäus. Anita kannte die Eltern, die Mutter arbeitete im Finanzministerium, der Mann im Entwicklungshilfeministerium. Langweilige Leute, aber Langweiligsein war nun wirklich der letzte Grund, aus dem man seinem Sohn den Umgang mit einer Familie verbieten konnte.
»Ich könnte dann auch bei Matthäus schlafen, er hat schon gefragt, wäre echt toll, wenn das ginge. Außerdem ist seine Mutter gut in Mathe, die kann uns für die Klausur am Freitag helfen.«
Anita wollte erst antworten, dass auch sie gut in Mathe sei, hielt sich jedoch zurück und sagte stattdessen:
»Und seine Eltern haben wirklich nichts dagegen?«
»Nein«, antwortete Lukas, zwar nicht so gehetzt, dass es unhöflich klang, aber doch eilig genug, damit seine Mutter mitbekam, dass er ihr genau das eben bereits gesagt hatte.
»Natürlich kannst du das. Spricht absolut nichts dagegen«, sagte Anita und brachte Lukas mit einem merkwürdigen Gefühl der Enttäuschung zur Tür. Doch dann sah er sich auf dem Treppenabsatz noch einmal nach ihr um, rief ihr über das Geländer hinweg ein »Danke« zu, lächelte sie an, und wie immer, wenn er das tat, verflog ihr Ärger. Dieses Lächeln war eine seiner ersten Reaktionen in diesem Leben gewesen, sie war der erste Mensch, der es je gesehen hatte; mit diesem Lächeln hatte er ihr zum ersten Mal gesagt: Ich bin dein Sohn.
Anita blieb noch einen Moment im Türrahmen stehen, Lukas’ Schritte im Treppenhaus wurden langsam leiser.
»Viel Spaß«, rief Anita ihm hinterher, als wäre das die normalste Sache der Welt. Und eigentlich war es das ja auch.
Anita drehte eine ratlose Runde durch die eigens für Lukas aufgeräumte Wohnung. Was nun? Seit ihre beiden besten Freundinnen aus dem Studium sich in Speckgürtel-Praxen in Hamburg und Düsseldorf eingekauft hatten, kannte sie hier eigentlich fast nur noch Leute, die sie durch Lukas kennengelernt hatte, Familienfreunde. Sie kam sich vor, als hätte sie auf ein Date gewartet und sei versetzt worden. Normalerweise war sie nicht so. Oder wollte zumindest nicht so sein. Natürlich wurde ihr Sohn erwachsen, im Allgemeinen konnte sie das gut hinnehmen. Doch mit der Erinnerung an die vergangene Nacht hätte sie an diesem Tag die Zeit gern etwas festgehalten, die Zeit der Kindheit, die Zeit, die Zeit.
Sie beschloss, sich wieder hinzulegen. Doch als sie in ihrem Schlafzimmer stand, in dem sie auch tagsüber Licht machen musste, weil sie die Fenster mit Alufolie zugeklebt hatte, und dann auch noch ihre zwei Wecker und die maßgefertigten, rosafarbenen Ohrstöpsel sah, war ihr jede Lust vergangen, sich hier aufzuhalten – viel zu sehr fühlte sie sich durch all das an ihren Alltag erinnert, der ihr nach Lukas’ Abgang wie eine aus der Kurve geflogene Seifenkiste vorkam, die sich nicht mehr fortbewegte, auch wenn die Räder sich in der Luft noch etwas drehten. Sie öffnete die Nachttischschublade, nahm die Ausgabe der Zeitschrift Der Notarzt heraus, mit der sie ihren Kondomvorrat vor ihrem Sohn hatte verbergen wollen und verließ das Haus.
Es war nicht einmal fünfzehn Uhr. Auf ihrem Weg die Graefestraße hinunter zum Landwehrkanal gingen vor ihr zwei Männer mit abgeschnittenen schwarzen Cargo-Hosen. Einer trug ein ausgewaschenes Band-T-Shirt, New Model Army Impurity Tour 1990, sein grau melierter Pferdeschwanz verdeckte die ersten Tourdaten. Ihr Blick wanderte hinab bis zu den blassen Kniekehlen und weiter, sie registrierte kurz eine für sein Alter schon recht ausgeprägte Varikose, Krampfadern, rechts femoral, dann zog sie an ihnen vorbei und ging Richtung Norden.
Auf der Skalitzer Straße floss der Verkehr wieder. Das BMW-Wrack war entfernt, nichts erinnerte die Autofahrer auf dem Weg zum Schlesischen Tor daran, was letzte Nacht hier passiert war. Anita ging weiter, schlug einen Bogen zum Landwehrkanal und setzte sich am Ufer in ein Café, in dem sie schon einige Male gewesen war, ohne sich jemals den Namen merken zu können. Nun, wo ihr Tag nicht so verlief wie geplant, konnte sie wenigstens etwas trinken. Schon auf dem Weg hatte sie das Bild eines Glases mit kaltem Weißwein im Kopf gehabt, da stand die Kellnerin auch schon vor ihr und fragte:
»Und?«
»Ich hätte gern ein Glas Pfefferminztee«, sagte Anita.
Die teilnahmslos wirkenden Augen in ihrem blass geschminkten Gesicht, die dunkelroten Lippen und die Frisur, der wie mit dem Rasiermesser präzis gezogene Pony, ließen die Kellnerin derart streng aussehen, dass Anita sich nicht getraut hatte, mitten am Tag ein Glas Wein zu bestellen, wenngleich sie wusste, dass es der Kellnerin herzlich egal gewesen wäre. Die Kellnerin hatte eine Windrose auf die linke Schulter tätowiert, die bei allen Bewegungen ihre kreisrunde Form behielt, sogar als sie sich wenig später nach vorn beugte, um den Tee vor Anita hinzustellen. Er kam in einem Latte-Macchiato-Glas, sodass Anita eine gefühlte Ewigkeit warten musste, bis sie, das Glas vorsichtig am obersten Rand anhebend, den ersten Schluck nehmen konnte. Als sie sich auch dann noch die Zunge verbrannte, winkte sie die strenge Kellnerin wieder heran und sagte:
»Und vielleicht noch einen Weißwein dazu.«
»Chardonnay? Veltliner? Riesling?«
»Eigentlich egal.«
»Dann Chardonnay«, sagte die Kellnerin, verschwand ohne eine Antwort abzuwarten und kehrte wenig später mit einem Glas zurück. Anita nahm einen ersten, für ihre Verhältnisse ziemlich großen Schluck. Sie wohnte jetzt seit einem Jahr wieder allein und war sich bei den Freiheiten, die sie sich in dieser Zeit genommen hatte, oft zehn Jahre jünger vorgekommen. Doch nun, nach dem ersten Schluck Wein am helllichten Tag, fühlte sie sich plötzlich zehn Jahre älter. Wie eine Frau mittleren Alters, deren Kinder gerade ausgezogen waren und sie mit dem Familienhund zurückgelassen hatten.
Kaum eine Viertelstunde später winkte Anita schon viel weniger zögerlich erneut nach der Kellnerin, und als sie das zweite Glas Wein trank, verschwanden diese Gedanken wie die Klumpen einer Tütensuppe in heißem Wasser. Manche schwammen länger an der Oberfläche als andere, doch schließlich waren sie alle weg.
Gegenüber stand ein Miet-Transporter, auf dessen Plane ein Seehund aufgedruckt war. Der Seehund hob den Kopf, sah Anita direkt in die Augen und wirkte dabei so aufgekratzt heiter, dass Anita sich nicht nur beobachtet, sondern dazu noch verhöhnt vorkam. Offensichtlich zog jemand im Haus gegenüber ein. Wie jedes Jahr brachte das Ende des Sommers nicht nur eine neue Herbstkollektion in die Modeläden, sondern auch mit dem beginnenden Wintersemester eine neue Kollektion von jungen Männern in ihre Nachbarschaft – ein Phänomen, das sie mit einer Mischung aus Amüsement und Melancholie betrachtete, wobei der Melancholie-Anteil in den letzten Jahren deutlich zugenommen hatte.
Anita schlug ihre Ausgabe von Der Notarzt auf, überflog die Zusammenfassungen der Artikel und begann ein Quiz, bei dem man verschiedene EKGs den passenden Diagnosen zuordnen sollte, vertiefte sich in die verschiedenen Ableitungen, die Feinheiten von Erregung und Erregungsrückbildung, Wellen, Flattern und Flimmern.
»Hey, wir kennen uns doch«, sagte jemand hinter ihr. Ein Mann, der sich an einem der anderen freien Tische niedergelassen haben musste. Anita legte eine Pause in ihrem EKG-Rätsel ein. Sie hatte diese Stimme schon einmal gehört, eine Stimme, die weder besonders hoch noch besonders tief klang, und doch in ihrem Gedächtnis geblieben war durch die Weise, wie sie in einem Moment verlebt und kratzig geklungen hatte, in nächsten jungenhaft klar. Sie drehte sich um.
»Hallo Rio. Das ist ja eine Überraschung.«
»Wirklich, so ein Zufall. Geht’s dir gut?«
»Bestens«, sagte Anita. »Wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen.«
»Stimmt. Das muss irgendwann im letzten Sommer gewesen sein, oder? Auf irgendeiner Party. Fragt sich nur, auf welcher.«
»Das war im Mai, glaube ich. Oder Juni?«, sagte Anita und sah ihn an. Sah das kräftige Kinn, die große, aber ebenmäßige Nase, die an den Seiten kurz rasierten Haare und die etwas längeren Locken, die oben auf seinem Kopf saßen wie eine Schaumkrone auf einem Bier.
»Ich komme noch drauf. Ganz bestimmt«, fügte Anita hinzu. Und als Rio sie anlächelte, bemerkte sie den Ansatz erster Falten um seine Augen. Überhaupt, diese Augen. Sie waren blau, und in der Iris seines linken Auges entdeckte Anita einen kleinen braunen Fleck, eine Farbanomalie.
»Ich hab’s«, sagte Anita. »Das war im Juni. Auf der Geburtstagsparty von Maik.«
»Aber klar, jetzt wo du es sagst … Du bist eine Kollegin von Maik.«
»Und du bist ein Freund von ihm.«
»Ja. Auch«, sagte Rio und holte eine Packung Tabak hervor. »Um ehrlich zu sein, bin ich damals über Theo da hingekommen. Maiks Freund.«
»Ex-Freund, inzwischen«, sagte Anita.
»Ach ja, stimmt. Schade«, sagte Rio, während er ein Blättchen aus einem Heft pfriemelte und sich eine Zigarette drehte.
»Das finde ich auch«, sagte Anita.
»Und du warst mit deinem Sohn da. Lukas, oder? Und deinem Mann.«
»Ex-Mann, inzwischen.«
»Oh. Ich wollte nicht …«
»Kein Problem. Ich wollte auch nicht …«
Es folgte eine winzige Stille, in die sie beide fast gleichzeitig hineingrätschten, Anita setzte gerade an, da hatte Rio schon begonnen:
»Erwartest du noch jemanden?«
»Warum?«
»Ich dachte nur, wegen dem Tee«, sagte er und warf einen Blick auf das Glas mit dem inzwischen erkalteten Wasser, in dem die Minzeblätter schwammen, was zugegebenermaßen schön aussah, das satte Grün in der klaren Flüssigkeit.
»Ach das, das war ein Fehler.«
»Du trinkst Wein?«
»Kann man das nicht machen? Doch, oder? Also, am Nachmittag Wein trinken?«
»Natürlich. Klar. Wein am Nachmittag ist vollkommen okay.«
»Dann kannst du ja auch einen trinken. Also, natürlich nur, wenn du Lust hast«, sagte Anita.
»Gern. Ich müsste nur einmal kurz telefonieren und einen Kunden abwimmeln.«
Rio nahm sein Telefon. Während er wählte und auf Antwort wartete, versuchte Anita, sein Alter zu schätzen. Er hatte einen rötlichen Bart mit hellen Flecken, die ebenso blond sein konnten wie grau. Wie generell bei bärtigen Männern, fand Anita es schwer zu sagen, ob er Mitte zwanzig oder Mitte vierzig war.
»Hallo. Ich wollte nur sagen, dass ich Ihnen das Angebot erst morgen schicken kann. Tut mir echt leid, mir ist etwas Wichtiges dazwischen gekommen, hier, auf der Arbeit, ein anderer Auftrag, das müssen wir jetzt erst einmal abarbeiten.«
Das Telefon noch am Ohr, legte er ein Feuerzeug mit der Aufschrift I love Berlin und die fertiggedrehte Zigarette auf den Tisch. Anita hatte noch nie so eine schöne selbstgedrehte Zigarette gesehen.
»Na, im Laufe des Tages«, sagte Rio dann und als er erneut der anderen Stimme zuhörte, schob er Feuerzeug und Zigarette auf dem Tisch hin und her.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: