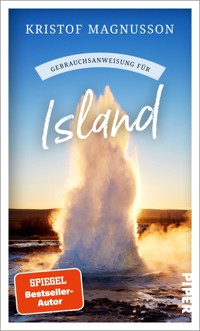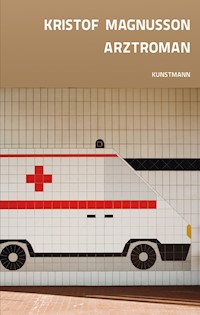16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein berühmter Maler, der zurückgezogen auf einer Burg am Rhein lebt, Kunstfreunde, die ihn verehren und ihm ein Museum bauen wollen: eine Begegnung, die die Höhen und Tiefen des Kulturbetriebs ausleuchtet, so heiter, komisch und wahr, wie es selten zu lesen ist. KD Pratz ist ein Künstler der alten Schule, der sich jeglicher Vereinnahmung durch den Kunstbetrieb verweigert hat. Seine Bilder werden hoch gehandelt, er ist weltberühmt, hat sich aber aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mit der Welt, verlogen wie sie ist, will er nichts zu tun haben, der eigene Nachruhm aber liegt ihm am Herzen, und so sagt er zu, den Förderverein eines Museums zu empfangen, der den geplanten Neubau ausschließlich seinen Werken widmen will. Die Mitglieder des Museums-Fördervereins sind nicht alle einer Meinung über die Bedeutung von KD Pratz, fühlen sich aber hoch geehrt, als ihnen ein exklusives Treffen mit dem Maler und ein Besuch auf seiner fast schon legendären Burg am Rhein in Aussicht gestellt wird – und tatsächlich stattfindet. Wie die Kunstfreunde bei dieser Begegnung mit ihrem Idol nach und nach die Contenance verlieren, als der Meister ihnen die Unvollkommenheit der Welt und ihre eigene um die Ohren haut, dabei subtil die eigene Größe inszeniert, den Kunstbetrieb niedermacht und gleichzeitig behauptet – davon erzählt Kristof Magnusson mit großer Meisterschaft und leuchtet die Untiefen unseres Kulturbetriebs aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Buch
KD Pratz ist ein Künstler der alten Schule, der sich jeglicher Vereinnahmung durch den Kunstbetrieb verweigert hat. Seine Bilder werden hoch gehandelt, er ist weltberühmt, hat sich aber aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mit der Welt, verlogen wie sie ist, will er nichts zu tun haben, der eigene Nachruhm aber liegt ihm am Herzen, und so sagt er zu, den Förderverein eines Museums zu empfangen, der den geplanten Neubau ausschließlich seinen Werken widmen will. Die Mitglieder des Museums-Fördervereins sind nicht alle einer Meinung über die Bedeutung von KD Pratz, fühlen sich aber hoch geehrt, als ihnen ein exklusives Treffen mit dem Maler und ein Besuch auf seiner fast schon legendären Burg am Rhein in Aussicht gestellt wird – und tatsächlich stattfindet. Wie die Kunstfreunde bei dieser Begegnung mit ihrem Idol nach und nach die Contenance verlieren, als der Meister ihnen die Unvollkommenheit der Welt und ihre eigene um die Ohren haut, dabei subtil die eigene Größe inszeniert, den Kunstbetrieb niedermacht und gleichzeitig behauptet – davon erzählt Kristof Magnusson mit großer Meisterschaft und leuchtet die Untiefen unseres Kulturbetriebs aus.
Über den Autor
Kristof Magnusson, geboren 1976 in Hamburg, machte eine Ausbildung zum Kirchenmusiker, arbeitete in der Obdachlosenhilfe in New York, studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Er schreibt Romane, Theaterstücke und übersetzt aus dem Isländischen. Er lebt in Berlin. Bei Kunstmann sind von Kristof Magnusson erschienen Das war ich nicht und Arztroman.
KRISTOF MAGNUSSON
EIN MANN DER KUNST
Roman
Verlag Antje Kunstmann
Für Gunnar
1
ICH WILL MICH NICHT BEKLAGEN. Ich werde gut bezahlt, nicht gemobbt, auch Überstunden gibt es kaum. Dafür, dass ich in einer Branche arbeite, in der es von Platzhirschen, Zampanos und Cholerikern nur so wimmelt, habe ich es ganz gut getroffen.
Doch als ich an diesem Montagmorgen aus unserem Firmen-Passat stieg, fiel es mir schwerer als sonst, so zu denken. Ich wünschte mir, ich wäre Tierpfleger geworden oder Werbezeppelinpilot, doch ich war nun einmal hier, auf unserer Baustelle in Preungesheim bei Frankfurt, und verspürte eine deutliche Unzufriedenheit mit meiner beruflichen Situation.
Ich war mit der Überwachung der Leistungsphasen sechs bis acht bei dem Bau des Firmensitzes eines zu Geld gekommenen Start-up-Unternehmens betraut, das in nur drei Jahren von einer Hinterhofklitsche zu einem führenden Anbieter von E-Zigaretten unter dem Namen Dampferando geworden war und unter autoora Carsharing-Lösungen anbot.
Als Architekt arbeitete ich in einer Branche, in der Dinge aus Prinzip nicht klappten. Im Moment war das Problem das Dach. Es hatte vor einigen Wochen damit angefangen, dass der Gerüstbauer das Gerüst nicht aufbauen konnte, weil es zu viel regnete, und solange das Gerüst nicht stand, konnte kein Dachdecker arbeiten. Als der Gerüstbauer das Wetter für gut genug befunden hatte, um das Gerüst aufzubauen, fiel der Baufirma auf, dass sie vergessen hatten, einen Müllcontainer zu bestellen. Und ohne einen solchen durfte laut Grünflächenamt wiederum kein Dachdecker arbeiten, weil die sonst dazu neigten, Teerpappe einfach so auf den Rasen zu werfen.
Letzte Woche wurde endlich der Container geliefert und alles schien zu laufen. Es regnete nicht mehr, sodass die Dachdecker endlich alles für einen Event vorbereiten konnten, auf den die Marketingabteilung unseres Bauherrn schon lange hinarbeitete: Unser Entwurf für den Neubau dieses Firmensitzes beinhaltete zwei Pavillons, die wie kleine Penthäuser oben auf der Dachplatte stehen und einen Zugang zu einer begrünten Terrasse haben sollten. Und nun, wo mit sämtlichen ausführenden Firmen, Meistern und Polieren verbindliche Termine für die Fertigstellung und Montage der Stahlteile für die Dachpavillons festgelegt waren, hatte unser Bauherr unter dem Motto friends and family seine wichtigsten Geschäftskontakte eingeladen und eine weltweit gefragte Architekturfotografin gebucht, die social-media-wirksame Fotos davon machen sollte, wie ein Kran die vorgefertigten Stahlteile auf das Dach bringen würde und die Stahlbauer sie dort montierten. Der Termin war nächste Woche.
Doch als ich heute Morgen um halb neun in unser Büro gekommen war, mir gerade einen Kaffee gemacht und eine super Idee für einen neuen Wettbewerb bekommen hatte, an dem wir uns beteiligen wollten, rief mich der Metallbauer an, der die Stahlbauteile für die Dachkonstruktion liefern sollte, und sagte, es gebe ein Problem. Aufgrund der Verzögerungen habe er die Aufmaß-Zeichnungen von dem Dachdecker eben erst bekommen, und nun habe die Verzinkungswerkstatt keine Termine mehr frei.
Ich in unseren Firmen-Passat und zur Baustelle. Die Erfahrung hatte gezeigt, dass sich solche Sachen am Telefon nie verbindlich klären ließen – wenn man den Leuten gegenüberstand, hatte man zumindest eine gewisse Chance.
Ich ging über die Baustelle zu dem Rohbau, wo der Metallbauer bereits an dem auf Böcke gelegten Türblatt stand, das wir seit einigen Wochen während unserer Baubesprechungen als Tisch benutzten, um die Pläne auszulegen. Jetzt lag das Türblatt leer da, wie ein Symbol dafür, dass alle Pläne hinfällig geworden waren.
Der Metallbauer nutzte unsere Besprechungen eher als Rauchpausen. Auch jetzt stand er mit einer Kippe da und begrüßte mich mit einem »Guten Morgen«, das für meinen Geschmack etwas schuldbewusster hätte klingen können.
»Ich kann da auch nichts für, wenn die mir das Aufmaß so spät geben«, sagte er.
»Gibt es gar keine Chance?«, fragte ich.
»Schwierig«, sagte er.
»Wann können die von der Verzinkungswerkstatt denn dann fertig sein?«, fragte ich, woraufhin er lange auf sein Telefon sah und dann antwortete:
»In vier Wochen.«
Ich wusste, dass ich ruhig bleiben musste. Sauer zu werden half nichts, wenngleich ich jetzt schon ahnte, dass ich in den nächsten Tagen viele Anrufe von Menschen bekommen würde, die ebenfalls wussten, dass es nichts brachte, sauer zu werden, mich aber trotzdem anschreien würden. Der Bauherr würde an die Decke gehen, weil er auf Facebook und Instagram bereits den Termin für seinen Event angekündigt hatte und für die eingeladenen Geschäftskontakte, eine nicht besonders flexible Slow-Food-Cateringfirma und eine schweineteure, international gebuchte Fotografin einen neuen Termin finden musste.
»Es geht auch in einer Woche«, sagte da der Metallbauer. »Aber dann müssen die eine Sonderschicht machen, das kostet mehr.«
»Wie viel mehr?«
»Das Doppelte.«
Ich unterdrückte ein Seufzen und dachte an die Bauherren, die von der ersten Besprechung an verdächtig oft die Formulierung »klein aber fein« benutzt hatten, was nach meiner Erfahrung meist bedeutete, dass unsere Leistung fein sein sollte, der Preis hingegen klein. So hatte es sich auch dieses Mal bewahrheitet. Wenn im Laufe des Bauprozesses Unvorhersehbarkeiten aufgetreten waren, mauerten die Bauherren sofort. Bereitschaft, noch etwas Geld draufzulegen, gab es nie. Man sei schließlich nicht der Berliner Flughafen, sagten sie dann gern.
Ich sah mich in dem Rohbau um. Die Wände aus Kalksandstein standen genau da, wo wir sie hingezeichnet hatten. Überall Löcher für Kabel und Rohre. Werkzeug lag herum, ein Zementmischer, Pappbecher, Thermoskannen. Ich versuchte mir bewusst zu machen, was das für ein tolles Gebäude sein würde, wenn es einmal fertig war. Noch sah es aus wie ein Schrotthaufen.
Ich dachte an meine Studienzeit. Ich hatte mich bewusst dafür entschieden, an einer Kunsthochschule Architektur zu studieren, nicht an einer technischen Universität. Wie viele Nächte hatten wir uns mit Entwürfen und Modellen um die Ohren geschlagen, wie oft hatten wir uns über Materialien, Raumkonzepte und die gesellschaftliche Verantwortung der Baukunst die Köpfe heißgeredet? Baukunst! Darum war es mir einmal gegangen. Jetzt bettelte ich um Verzinkungs-Termine.
Ich verabschiedete mich von dem Metallbauer mit den Worten:
»Na gut. Aber dann wirklich in vier Wochen.«
Ich suchte mir eine ruhige Stelle in dem Rohbau, um den Bauherrn anzurufen. Es half ja nichts, sagte ich mir, nahm mein Telefon, um in den Kontakten seine Nummer zu suchen, doch als ich ihn gerade gefunden hatte, vibrierte es, blinkte, ein grüner Hörer erschien auf dem Display und darunter das Wort »Mama«.
Mein erstes Gefühl, als ich ihren Namen auf dem Display sah, war Sorge. Normalerweise rief meine Mutter mich nicht an. Meine Mutter schrieb mir auf WhatsApp. Doch auch wenn sie noch in dem Alter war, in dem man WhatsApp benutzte, war sie eben auch bereits in dem Alter, in dem immer etwas sein konnte – zumal sie sich sonst eher selten bei mir meldete und schon gar nicht während meiner Arbeitszeit. Ich tippte auf den grünen Hörer und sagte:
»Alles okay?«
»Consti«, sagte sie, »du musst mir einen riesigen Gefallen tun.«
»Was ist denn los?«
»Du musst mich bei der Sitzung vertreten.«
»Welcher Sitzung?«
»Na, die Sitzung!«, sagte sie laut.
Eigentlich war meine Mutter eine eher coole Person. Sie umgab sich mit einer unaufgeregten Freundlichkeit, die ich selbst während der schlimmsten Momente meiner Pubertät kaum je durchbrochen hatte. Doch jetzt wiederholte sie schnell und laut:
»Die Sitzung!«
»DIE Sitzung?«
Nun wusste ich, was sie meinte. Ingeborg, so nannte ich meine Mutter, neigte wirklich nicht zu Gefühlsausbrüchen, doch es gab eine Ausnahme, eine Sache, die in ihr eine geradezu anfallartige Begeisterung auslöste: Kunst.
Für Kunst ließ meine Mutter alles stehen. Sie liebte Bilder, Gemälde, Arbeiten, Installationen, Skulpturen, Farben und Materialien, Ausstellungen, Kataloge, Museumscafés.
Andere Kinder wurden von ihren Vätern mit zum Fußball genommen, handwerkten oder sahen sich Gebrauchtwagenausstellungen an, doch dafür hätte ich einen Vater gebraucht. Ich war in Galerien und Museen aufgewachsen, mit dem Kinder-Audioguide als ständigem Begleiter. Schon damals war ich fasziniert davon gewesen, was im Gesicht meiner Mutter passierte, sobald sie ein Museum betrat. Alles, was sie im Alltag beschäftigte, war weg. Ihre Gesichtszüge entspannten sich, und wenn sie das erste Bild sah, das sie bewegte, ihr Blick über eine farbige Fläche glitt und hier und da verweilte, sah ich einen ganz anderen Menschen als meine Alltags-Ingeborg, die ihr Leben zwischen ihrem Vollzeitjob als Psychotherapeutin und dem anderen Vollzeitjob als meine Mutter organisieren musste. Es ist wohl ein wichtiger Moment im Leben eines jeden Kindes, zum ersten Mal zu erleben, wie die Eltern – die man ja in der ersten Zeit als allmächtig ansieht – völlig aus dem Häuschen geraten, ohne etwas dagegen tun zu können, gewissermaßen selbst wieder zu Kindern werden. So war es mit meiner Mutter und der Kunst, von der sie eigentlich alle Formen liebte, vornehmlich aber das Schwierige. Ingeborg wollte nichts Leichtverdauliches, sie wollte herausgefordert werden. Je rätselhafter, verschwurbelter, sperriger, provokanter ein Werk war, desto mehr beschäftigte sie sich damit, ging immer wieder hin, hörte bei Führungen zu, las, was sie finden konnte. »Die Kunst, Consti«, hatte sie mir schon gesagt, als ich noch sehr klein war, »zwingt uns, anders zu denken. Anders zu sein!«
Das Lieblingsmuseum meiner Mutter war das Museum Wendevogel in Frankfurt, das in einer direkt am Main gelegenen, überkandidelten Fabrikantenvilla aus dem 19. Jahrhundert Werke moderner und zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler zeigte und in den letzten Jahren so beliebt geworden war, dass es inzwischen vor den Ausstellungseröffnungen Vorpremieren geben musste und vor den Vorpremieren auch noch ein Preview.
Als im Museum Wendevogel vor fünfundzwanzig Jahren ein Förderverein gegründet worden war, wurde Ingeborg sofort Mitglied. In diesem Kreis kamen Freunde der Kunst zusammen, um das Museum zu unterstützen, die einen spendeten viel Geld und ließen sich dafür hofieren, die anderen halfen bei den Eröffnungen ehrenamtlich beim Getränkeausschank. Als meine Mutter dann vor einigen Jahren, wie sie es ausdrückte, »quasi« in Rente ging und nur noch wenige Patienten behandelte, kandidierte sie zur Wahl der Vorsitzenden des Fördervereins und wurde, wenn auch knapp, gewählt.
In ihren ersten Jahren als Vorsitzende des Fördervereins ging alles seinen normalen Gang, doch dann geschah etwas, das Ingeborgs Ehrenamt aufregender machte, als sie es jemals hätte ahnen können: Margarete Wendevogel starb, die letzte lebende Erbin der Fabrikantenfamilie, und das Museum erbte ein Grundstück, eine große freie Fläche, die direkt neben dem Museum lag. Auf einmal war da eine Chance, mit der niemand gerechnet hatte. Das Museum Wendevogel platzte schon seit Jahren aus allen Nähten. Museumsdirektor Michael Neuhuber und sein Kuratorenteam konnten längst nicht so viel aus der Sammlung zeigen, wie sie wollten; in den letzten Wochen vor dem Ende einer Ausstellung musste das Museum inzwischen bis Mitternacht geöffnet haben, um der Besucherflut Herr zu werden.
Insofern war es geradezu logisch, dass sie nun auf dem Nachbargrundstück anbauen wollten. Ingeborg sah die große Stunde des Engagements gekommen, das nun endgültig zu ihrem Lebensmittelpunkt geworden war. »Stell dir das vor, Consti. Ein neues Gebäude. Wir bauen da was ganz Modernes hin – als Kontrast zu dieser ollen Patriarchenvilla. Was wir da alles zeigen könnten!«
Und Ingeborg hatte auch sofort eine Idee gehabt, was das sein sollte. Der Neubau sollte dem Werk eines einzigen Künstlers gewidmet sein.
KD Pratz.
KD Pratz war der erste Künstler, dessen Namen ich als Kind gekannt hatte. Ingeborg war seit vierzig Jahren Fan, sie hatte seinen Aufstieg mitverfolgt, vom Meisterschüler an der Düsseldorfer Kunstakademie zum Weltstar, der in den Top Ten aller Listen der teuersten und bedeutendsten Künstlerinnen und Künstler unserer Zeit stand.
Das Museum Wendevogel hatte das große Glück, eine umfangreiche Sammlung von seinen Arbeiten zu besitzen. Ein früherer Direktor hatte KD Pratz von Anfang an gefördert, sodass KD Pratz dem Museum bis heute für viele seiner Arbeiten ein Vorkaufsrecht zum Vorzugspreis einräumte. Dass KD Pratz dem Museum Wendevogel fast freundschaftlich verbunden war, war außergewöhnlich, galt er doch gemeinhin als schwieriger Mensch. Inzwischen Ende sechzig, war er einer der letzten verbliebenen Old-School-Künstler, der sich von Anfang an jeglicher Vereinnahmung durch den Kunstbetrieb verweigert hatte und allgemein als sperrig galt und zu keiner Gefälligkeit bereit, kurz: er war offenbar ein ziemliches Ekel. Seit über zwanzig Jahren lebte er vollkommen zurückgezogen auf einer Burg im Rheingau. Wenn er einmal auf Presseanfragen antwortete – per Rückruf über Festnetz-Telefon oder handschriftlich per Postkarte –, waren das Schimpftiraden gegen alles, was der heutigen Zeit lieb oder zumindest teuer war: gegen E-Mails, Handys, E-Zigaretten, E-Autos, vegane Ernährung und, am liebsten: gegen das Internet an sich.
Erst vor einigen Monaten hatte ich in der Rubrik Vermischtes in der Zeitung gelesen, dass KD Pratz eine Drohne abgeschossen hatte, die, wie er wahrscheinlich glaubte, von Paparazzi in der Nähe seiner Burg in die Luft geschickt worden war. Später stellte sich heraus, dass es sich bei der Drohne um das Geburtstagsgeschenk eines elfjährigen Mädchens aus Lorchhausen gehandelt hatte, das an dem Abend mit sehr beleidigtem Gesicht in den Abendnachrichten zu sehen gewesen war. Von KD Pratz war zu der Sache keine Stellungnahme zu bekommen gewesen.
Obwohl es Ingeborgs Idee gewesen war, den Museumsbau einem einzigen Künstler zu widmen, gab Museumsdirektor Neuhuber die Idee sofort als seine eigene aus. Es war ja auch geradezu logisch. KD Pratz war weltberühmt und produzierte dennoch hier, in der Region Rhein-Main. Und er war nicht nur ein Künstler, sondern ein Symbol, und zwar für alles: für die Kunst, die Intellektualität, den Typ des Künstlers, der vom Feuilleton bis zum Boulevard, von den Museen über die öffentlichen Plätze bis ins Fernsehen und in Kneipengesprächen überall präsent war. KD Pratz war, was die Menschen an der Kunst liebten. Und hassten.
So machten Ingeborg und Michael Neuhuber sich mit Feuereifer daran, ihren Plan in die Tat umzusetzen, was allerdings nicht einfach war, denn KD Pratz war im Förderverein durchaus umstritten. Von seinem schwierigen Charakter ganz abgesehen galten auch viele seiner früheren Werke – gerade die großformatigen hoch ambitionierten Collagen aus den Achtzigerjahren, auf denen KD Pratz Fußballberichte aus der Bild-Zeitung mit Habermas-Texten, Bauanleitungen für Atombomben und Werbesprüchen mischte und das Ganze dann teilweise mit wilden Farbexplosionen überdeckte – heute bei vielen als Paradebeispiel für verschmockte Politkunst. Ingeborg hingegen liebte auch diese Werke, las jedes einzelne Wort, wollte alles verstehen. In den letzten Jahren hatte KD Pratz nur noch großformatige Bilder von Tieren, Blumen und Landschaften gemalt, doch auch diese ästhetische Wende machte Ingeborg begeistert mit.
Ich erinnerte mich noch genau daran, wie ich als Kind einmal mit ihr vor einem Gemälde von KD Pratz gestanden hatte. Es hieß Der Malerfürst, vom Universum aus betrachtet. Ein winziger schwarzer Punkt auf einer riesigen weißen Leinwand. Sie sah das Bild so lange an, bis ich den Eindruck bekam, sie müsste Tränen zurückhalten. Dann ging ich so nah heran, bis ich entdeckte, dass es sich bei dem winzigen Punkt gar nicht um einen Punkt handelte, sondern um ein Fragezeichen; ich erzählte es ihr und sie lachte.
Seit ich denken konnte, begleitete und prägte KD Pratz ihr Leben, kennengelernt jedoch hatten Ingeborg und er sich nie, was auch nicht überraschend war, da er seine Burg kaum verließ und dort nicht einmal seinen Galeristen empfing, wenn man den Medienberichten glauben konnte.
Dennoch tat Ingeborg alles dafür, ihrem Lieblingskünstler ein Denkmal zu setzen. Die letzten Jahre hatte Michael Neuhuber, unterstützt von Ingeborg, unermüdlich daran gearbeitet, eine Finanzierung für den Neubau auf die Beine zu stellen, und nun war es ihnen endlich gelungen, alle potenziellen Geldgeber an einen Tisch zu bringen. Ingeborg hatte mir das vor zwei Wochen erzählt und auch da diese aufgekratzte Begeisterung gezeigt, die ich bisher kaum von ihr gekannt hatte. Das war die Sitzung. Der große Schritt nach vorn.
»Ich kann nicht zu der Sitzung hin.«
»Kein Problem, ich mache das für dich. Ich rufe dich später zurück, ja?«, sagte ich und dachte wieder an das Telefonat mit unserem Bauherrn.
»Das geht nicht, die Sitzung ist jetzt.«
»Jetzt?«
»Deswegen rufe ich ja an. Die Sitzung beginnt in einer Dreiviertelstunde, und ich habe hier einen Patienten, den ich ins Krankenhaus bringen muss, ich bin im Auto.«
»Im Auto?«
»Ja.«
»Und fährst einen Patienten ins Krankenhaus?«
»Es geht nicht anders.«
»Hast du nicht immer gesagt, man muss eine gewisse Distanz …«
»Du musst mich auf dieser Sitzung vertreten.«
»Können die das nicht ohne uns machen?«
»Ohne einen Vertreter vom Förderverein geht da nichts. Alle potenziellen Geldgeber müssen da sein. Die Referentin vom Kulturministerium in Berlin ist extra angereist, die Leute vom Finanzministerium aus Hessen sind auch da. Das darf nicht platzen!«
»Aber ich habe gar keine Ahnung davon, worum es geht.«
»Du brauchst keine Ahnung zu haben. Du musst nur da sein.«
»Nichts sagen?«
»Sag einfach, dass du das gut findest, was Michael Neuhuber vorschlägt, alles andere wird sich finden. Bitte mach das, du weißt doch, wie lange es gedauert hat, die aus Berlin dazu zu bewegen, hierherzukommen.«
»Aber ich muss …« Ich zögerte. Natürlich musste ich irgendwie.
»Das ist im Stadtplanungsamt. Direkt um die Ecke von deinem Büro.«
»Aber ich bin auf einer Baustelle in Preungesheim.«
»Oh, dann musst du jetzt aber sofort los«, sagte Ingeborg, die nun sogar ihre normale Psychologinnenhöflichkeit vergaß – ich hatte mich ja noch gar nicht entschieden. »Neunter Stock, Martin-Elsaesser-Saal. Du machst das schon«, hatte Ingeborg noch gesagt, dann war sie weg.
Wenngleich ich nicht dieselbe Begeisterung aufbrachte wie Ingeborg – auch ich mochte Kunst. Zu meinem dreißigsten Geburtstag hatte sie mir eine Mitgliedschaft im Förderverein des Museums Wendevogel geschenkt, doch mein Engagement beschränkte sich darauf, Ingeborg auf die Reisen des Fördervereins zu begleiten. Das mag jetzt etwas anstrengend klingen, mit seiner Mutter und einer Menge anderer kunstbeflissener und, ehrlich gesagt, auch ziemlich anspruchsvoller Leute durch Museen zu ziehen. Aber mir gefiel das.
Ich ging durch den Rohbau in Richtung Auto. Vielleicht war es sogar gut, dass sie mich aus dieser Situation herausholte. Und als ich, anstatt mich von dem Bauherrn anschnauzen zu lassen, wieder in unseren Firmen-Passat stieg, ging mir ein Satz durch den Kopf, von dem ich im ersten Moment nicht wusste, worauf er sich beziehen sollte. Ich dachte: Es ist Zeit. Keine Ahnung woher, der Satz war einfach da. Dann stellte ich mein Telefon in den Flugmodus.
Es war viel Verkehr, sodass die Sitzung bereits begonnen hatte, als ich am Börneplatz aus dem Auto stieg. Ich ging eilig auf das Stadtplanungsamt der Stadt Frankfurt zu und sah nur einmal kurz an dem Gebäude hinauf, das ich schon oft verwundert betrachtet hatte. Dieser riesige Kasten mit der glatten Fassade aus braungelbem Backstein und quadratischen Lochfenstern, und dann diese merkwürdigen Pop-Art-Elemente, mit denen die Architekten das Gebäude versehen hatten, Stellen in der Fassade, an denen große Stücke fehlten, als wären sie herausgebissen worden, darüber eine Stahlkante, die wie eine gigantische Donauwelle auf das Dach onduliert war. Durch die gerasterte Backsteinfassade und die gleichzeitig komische Form erschien mir das Stadtplanungsamt immer wie eine seltsame Mischung aus Verwaltungsgebäude und Kulturinstitution – und so war es ja auch: In dem Gebäude befand sich das Museum Judengasse, aber auch das Kundenzentrum der Stadtwerke.
Ich eilte an der Pförtnerloge vorbei zu den Aufzügen, fuhr in das oberste Stockwerk und öffnete wenig später die Tür zum Martin-Elsaesser-Saal. Der Saal wurde fast gänzlich ausgefüllt von einem langen Tisch in der Form eines extrem in die Länge gezogenen Ovals, das an den Enden so spitz zulief, dass der Tisch mich an Saurons Auge aus Der Herr der Ringe erinnerte.
An dem Tisch hätten über dreißig Personen Platz gefunden, es waren jedoch nur sieben. Sie saßen an der breitesten Stelle vor ein paar Thermoskannen, Wasser und diesen kleinen Saftflaschen der Marke Granini, die ich sonst nirgendwo sah, bei solchen Besprechungen allerdings immer. Auf zwei auf einem Pappteller zu einem Stern arrangierten Papierservietten lagen Kekse. Ich sah Michael Neuhuber, den Direktor des Museums Wendevogel. Neben ihm saß eine Frau in einem Kostüm mit einem langen Hals, die sich mit einer erdmännchenhaft hektischen Kopfbewegung nach der Tür umgewandt hatte, als ich eintrat. Neben ihr ein junger Mann und eine junge Frau mit Laptops, während die erdmännchenhafte Frau nur ein Notizbuch und einen sehr schwer aussehenden Kugelschreiber vor sich hatte.
Ihnen gegenüber saß ein großer schwerer Mann, der etwas von einem Trinkhallenbetreiber hatte und als Einziger nicht auf einem der staksigen Eames-Stühle saß, die in diesen Saal gehörten, sondern auf einem Schreibtischstuhl auf Rollen mit verstellbaren Armlehnen und Nackenstützen und einer unermesslichen Zahl von weiteren ergonomischen Features. Auch er war von zwei Leuten begleitet, in diesem Fall zwei Männern. Der eine, neben ihm, wischte auf seinem Telefon herum, der andere auf einem iPad. Sie hatten ebenfalls kurz aufgeblickt, als ich den Saal betrat, sich dann aber wieder ihren Geräten zugewandt.
An der Kopfseite des Saals war eine Leinwand heruntergelassen, die leicht in der Klimaanlagenluft zitterte. Ein Beamer projizierte Fakten zum Museum Wendevogel darauf.
Die erdmännchenhafte Frau fixierte mich. Mit dem Karohemd, den hellen Timberland-Schuhen und der Jeans, die ich zu dem Baustellentermin getragen hatte, musste ich aussehen wie jemand, der eine Schanklizenz für seinen Craft-Bier-Shop beantragen wollte und sich in der Tür geirrt hatte. Da erkannte Michael Neuhuber mich endlich.
»Ich vertrete Ingeborg, sie ist verhindert«, sagte ich.
Er nickte hektisch.
»Dann halten wir für das Protokoll fest, dass gemäß der Förderrichtlinie nun alle maßgeblichen Institutionen vertreten sind. Der Förderverein des Museums Wendevogel wird vertreten von Constantin Marx«, sagte er, woraufhin der neben der erdmännchenhaften Frau sitzende Mann eifrig mit der Tastatur seines Laptops klapperte.
Die Frau hingegen hatte in dem Moment, wo das Wort Förderverein gefallen war, jegliches Interesse an mir verloren. Sie nickte mir kaum mehr zu, als Michael sie als Dr. Sibylle Höllinger vorstellte, die von der Staatsministerin für Kultur und Medien aus Berlin nach Frankfurt geschickt worden war. Die Namen ihrer zwei Referenten wusste Michael offenbar nicht, auch Frau Dr. Höllinger stellte sie nicht vor.
Der Mann auf der anderen Seite des Tisches stand auf, schüttelte lange meine Hand und stellte sich als Nikolai Gurdulic vor, Referatsleiter in der Abteilung IV im Hessischen Finanzministerium:
»Und meine Referenten Knettenbrech und Henning.«
»Dann können wir ja jetzt richtig anfangen«, sagte Michael. »Ich habe den Damen und Herren schon unser Museum präsentiert, da hast du ja nichts verpasst, Constantin.« Ich wollte eine Entschuldigung vorbringen, Stau, sorry, doch das schien niemanden zu interessieren. Keiner nahm mehr Notiz von mir.
»Erst einmal freut es mich sehr, dass Frau Dr. Höllinger extra den weiten Weg aus Berlin nach Frankfurt auf sich genommen hat«, sagte Michael Neuhuber.
»Das muss ich natürlich auch an mein Team weitergeben, die sind ja auch mitgekommen«, sagte Dr. Höllinger und schickte ein schmales Lächeln in Richtung ihrer Referenten, die sofort versuchten, die Mimik ihrer Chefin zu lesen, um zu wissen, wie sie reagieren sollten. Sobald sie sahen, dass ihre Chefin lächelte, taten sie es auch. Frau Dr. Höllinger trug das Haar mädchenhaft nach hinten zu einem Zopf gebunden und einen gerade geschnittenen Pony, der sich nun, wo sie lächelte, kaum merklich hob.
»Das nächste Treffen machen wir in Berlin, dann können Sie sich revanchieren, Herr Dr. Neuhuber«, sagte sie dann, woraufhin Michael freundlich nickte und Herr Gurdulic sagte:
»Dann fahren wir da mal hin und sehen sie uns an – die dunkle Seite der Macht.«
Überrascht von diesem scharfen Satz sah ich in die Runde, doch weder Michael noch Sibylle Höllinger gingen darauf ein, und ihre Referenten blieben nach einem kurzen Seitenblick auf die unbewegte Miene ihrer Chefin erst recht stumm.
»Herr Marx kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe Ihnen ja eben einen Überblick darüber gegeben, was das Museum Wendevogel heute ist, wo wir stehen, nun kommen wir zu dem eigentlichen Grund unseres Treffens. Dem geplanten Neubau.«
»Sie haben ein Grundstück geerbt«, sagte Herr Gurdulic.
»Das Museum Wendevogel hat endlich die Möglichkeit, seine Ausstellungsfläche zu vergrößern und mit den stetig steigenden Besucherzahlen organisch mitzuwachsen. Allerdings sieht es das Vermächtnis der Erblasserin vor, dass das Grundstück innerhalb von fünf Jahren zu bebauen ist, sonst erlischt das Vermächtnis und das Grundstück geht an die anderen Erben. Es besteht also ein gewisser Grund zur Eile.«
»Wir in Frankfurt bauen in der Zeit ganze Flughäfen«, sagte Herr Gurdulic und lehnte sich leise knarrend in seinem Drehstuhl zurück. Auch auf diese Worte des offenbar auf Krawall gebürsteten Herrn Gurdulic gab es von der anderen Seite des Tisches keine Reaktion, nicht einmal der protokollführende Referent schrieb etwas. Wollte sich hier jemand vom Land Hessen gegenüber der großen Berliner Bundespolitik beweisen? Der kleinere Fisch musste offenbar seine Unabhängigkeit beweisen, der größere so tun, als wäre ihm das egal.
Eine der Kaffeekannen entließ mit einem knarzenden Geräusch etwas heiße Luft in den Raum. Da sich eh niemand für mich interessierte, sah ich mich um. Der Saal war gänzlich mit Materialien in gedeckten Farbtönen gestaltet: braun das Fußbodenparkett, grau lackiert die Tür- und Fensterrahmen aus Metall. Das Licht der in die Decke eingelassenen Halogenspots verlieh dem Ganzen eine fast festliche Atmosphäre – auf jeden Fall war es meilenweit von der Stimmung entfernt, die Neonröhren in Amtsstuben verbreiteten. Von der Piefigkeit einer Behörde war hier nichts zu spüren.
Auch Michael Neuhuber ignorierte die spitzen Bemerkungen: »Ein solcher Anbau ist eine einmalige Chance für das kulturelle Gepräge der Stadt Frankfurt und ihr Profil als internationaler Kulturstandort.«
»Und da gibt es ja einigen Nachholbedarf«, sagte Frau Höllinger.
»Wir haben das mal ausrechnen lassen«, sagte Michael. »Das Bauvolumen würde ungefähr 20 Millionen umfassen. Da haben wir natürlich sofort an das Leuchtturm-Projekt-Programm von Staatsministerin Grütters zur Verbesserung der kulturellen Infrastruktur gedacht.«
Herr Gurdulic blätterte in seinen Unterlagen. Seine Referenten waren mit Telefon beziehungsweise iPad beschäftigt, an ihren Mienen war nicht abzulesen, ob sie konzentriert mitdachten oder Candy Crush spielten. Auch der Gesichtsausdruck von Dr. Höllinger war schwer zu lesen, zumindest sah ich keinen Anhaltspunkt dafür, ob sie Michaels Idee gut fand oder schlecht, ich ahnte nur, dass sie es genoss, dass jemand ihr Geld wollte.
»Die Details haben Sie ja dem Antrag entnommen, den ich Ihnen geschickt habe. Ich möchte nur noch einmal besonders darauf hinweisen, dass wir vorhaben, diesen Anbau einem einzigen Künstler zu widmen, der die internationale Kunst der letzten Jahrzehnte geprägt hat wie kein anderer vor ihm und nach ihm.«
»Und jetzt«, fuhr Michael Neuhuber nach einer kleinen Pause fort, »kann ich Ihnen auch endlich mitteilen, für welchen Künstler wir uns entschieden haben. Das musste lange Zeit geheim bleiben, weil wir im Hintergrund die Vorbereitungen treffen mussten, die so etwas natürlich erfordert. Es handelt sich um KD Pratz.«
Da hellte Frau Höllingers Miene sich schlagartig auf.
»Das ist der mit dem Gewehr, oder?«, sagte Herr Gurdulic. »Der die Drohnen abschießt.«
»Ja«, sagte ich und merkte, dass es das erste Mal war, dass ich überhaupt etwas sagte.
»Ein Museum für einen einzigen, noch lebenden Künstler wäre in dieser Form in Deutschland einmalig!«, sagte Michael. »Das hat nicht einmal Beuys gehabt.«
»Der ist ja auch recht flott gestorben«, meinte Frau Höllinger, woraufhin Herr Gurdulic sagte:
»1986, im Alter von 65 Jahren.«
»Ich weiß aus sicherer Quelle, dass KD Pratz seit Jahren nichts tut als arbeiten, ohne jemandem etwas gezeigt zu haben. Es wäre also Kunst von Weltrang, die gar nicht weit von hier auf seiner Burg im Rheingau entsteht. Weltkunst aus der Region.«
»Handkäs, aber global«, sagte Herr Gurdulic.
»Die Burg muss voll sein von Werken, und nachdem es mir endlich gelungen ist, den Künstler zu erreichen, kann ich Ihnen heute sagen: Er hat Interesse.«
»Ich finde das eine sehr gute Idee. Das gibt Ihnen ein ganz besonderes Profil, ohne das Image des Museums Wendevogel als besonders sorgfältig kuratiertes Museum zu verwässern«, sagte Frau Höllinger, begleitet von hektischem Tastaturklappern ihres protokollführenden Referenten. »Sie sehen, Ihre Arbeit wird in Berlin durchaus wahrgenommen, und zwar sehr wohlwollend, sowohl von mir als auch von der Staatsministerin für Kultur und Medien.«
»Also, das Bundesland Hessen ist mit fünf Millionen dabei«, sagte Herr Gurdulic.
»Das BKM auch.«
»Dann geben wir sieben.«
»Acht«, sagte Dr. Höllinger.
»Acht«, sagte Herr Gurdulic.
Michael Neuhuber war ebenso erfreut wie verwundert. Dass die beiden Hauptfinanzierer sich nach oben überboten, hatte er nicht erwartet. Ich kannte das. Wir hatten bereits einige Projekte für öffentliche Auftraggeber geplant: Wer am Schluss am meisten zahlte, hatte die Projektsteuerung, konnte also alles entscheiden. Und das wollten offenbar sowohl die Leute von der Landesregierung als auch die aus Berlin. Manchmal war mehr einfach mehr.
»Dann zahlt das BKM zehn Millionen. Das tun wir aber nur, wenn Sie mir garantieren, dass das Land Hessen das auch tut«, sagte Frau Höllinger und sah Herrn Gurdulic an.
»Das tun wir nur, wenn Sie mir garantieren, dass aus Ihren Bundesmitteln …«
»Und die Projektsteuerung wollen Sie bestimmt auch«, sagte Frau Höllinger.
»Ebenso wie Sie.«
»Dann müssen wir uns später noch mal kurzschließen.«
»Nein, Sie müssen mir versprechen, dass Sie die Projektsteuerung an uns abgeben«, sagte Herr Gurdulic.
»Da muss ich erst mit der Ministerin sprechen«, sagte Frau Höllinger und fixierte Herrn Gurdulic. Herr Gurdulic starrte zurück und versuchte mit seiner nach hinten gelehnten Körperhaltung lässig zu wirken, wie ein Mann, der bis zu seiner – sicherlich von ihm bereits hinter sich gelassenen – Fünfzig wunderbar damit durchgekommen war, Frauen wie Dr. Höllinger als Zicken und Stress-Elsen darzustellen, die in dem gemütlichen, von Männern wie ihm eiergeschaukelten Betrieb eigentlich nur störten.
»Ja, wir schließen uns kurz«, sagte er. Dann sahen sie sich eine Weile an, und ich hatte plötzlich das Gefühl, dass die beiden miteinander flirteten. Dass dieses ganze gegenseitige Gefrotzel ein Balzritual war, wie zwischen Paradiesvögeln, nur ohne schöne Federn und tollen Tanz, dafür mit provokantem Verwaltungsbohei.
»Das wäre genau, was wir uns vorstellen«, sagte Michael Neuhuber, der immer noch überrascht wirkte.
»Das ist eine einmalige Chance. Für Ihre Stadt und das ganze Bundesland«, sagte Dr. Höllinger.
»Für Sie in Berlin offenbar auch«, sagte Herr Gurdulic, und Dr. Höllinger verstummte, als fühlte sie sich in ihrem Enthusiasmus ertappt. Ich fragte mich, ob sie auch KD-Pratz-Fan war oder einfach eine Karrierechance witterte, sich auf die Fahnen schreiben wollte, einen solchen Museumsneubau eingefädelt zu haben.
»Wobei«, fügte Frau Höllinger etwas ruhiger hinzu, »das Leuchtturm-Projekt-Programm natürlich eine Form von Förderung ist, die private Spenden matcht. Wir fördern damit ja das zivilgesellschaftliche Engagement.«
»Ja, natürlich, sehr wichtig«, sagte Michael.
»Deswegen wird das nur etwas, wenn die Grundlagenermittlung des Bauvorhabens zusammen mit einem Vorentwurf mit 500.000 Euro aus den Mitteln Ihres Fördervereins vorfinanziert werden.«
»Das ist natürlich auch sehr verständlich. Und sicherlich kein Problem«, sagte er mit einem leichten Zögern, das wahrscheinlich nur mir auffiel, weil ich wusste, dass KD Pratz im Förderverein nicht nur Fans hatte. »Aber für den Fall, also nur für den hypothetischen Fall, dass das nicht sofort in vollem Umfang möglich sein wird, finden wir doch sicherlich einen Plan B.«
»Ohne das Geld des Fördervereins wird das nichts«, sagte Dr. Höllinger.
»Ist so«, sagte Herr Gurdulic.
»Na, ist ja auch egal. Ich bin mir sicher, dass wir den Förderverein überzeugen können«, sagte Neuhuber. »Ich habe nur gefragt, weil es ja immer ein kleines, theoretisches Restrisiko …«
»Was meinen Sie damit?«