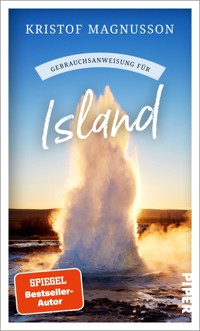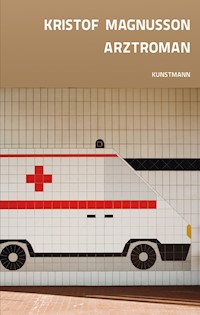8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Bestimmt gibt es auch eine Zeit für das Privatleben. Frau. Kind. Später. Ich war erst 31. Zwischen dreißig und vierzig muss man brennen.« Ein junger Banker, auf dem Sprung zur großen Karriere. Eine Literaturübersetzerin, auf der Flucht vor dem schön eingerichteten Leben mit Weinklimaschrank und Salzmühle mit Peugeotmahlwerk. Ein international gefeierter Schriftsteller mit Schreibblockade und Altersangst. Drei Menschen, die sich unversehens in abenteuerlicher Abhängigkeit befinden. Wie konnte es dazu kommen? Eine Bank, ein Leben ist schnell ruiniert. Das ist das Erschreckende, aber auch das Komische an diesem Roman, der mit großer Leichtigkeit von unheimlichen Zeiten erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Kristof Magnusson
DAS WAR ICH NICHT
Roman
Verlag Antje Kunstmann
Für meine Großmutter
Maria Katharina Schwark, geb. Dreiser (1915–2008)
»It was greatness in a way, small as it was.«
Theodore Dreiser, Sister Carrie
Jasper
»Guten Morgen, Sir. Wie geht es Ihnen?«
»Gut«, sagte ich. Was sogar der Wahrheit entsprach. Es ging mir gut, obwohl ich die ganze Nacht mit den Kollegen durch irgendwelche Londoner Bars gezogen war. Das erzählte ich der Stewardess natürlich nicht. So genau wollte sie es nicht wissen. Dabei hätte ich eigentlich gern jemandem erzählt, was in den letzten Tagen passiert war. Hätte gern erzählt, dass ich erfolgreich eine Software-Schulung absolviert hatte und nun unser Order-Management-System Equinox komplett beherrschte. Die Schlüsselqualifikation, um bei uns im Händlersaal aufzusteigen. Hätte gern erzählt, dass nun für mich die Zeit gekommen war, um karrieretechnisch die Handbremse zu lösen.
Die Equinox-Schulung war bis gestern Abend gegangen. Mein Teamleiter hatte mir einen Tag Urlaub gegeben, damit ich noch mit den Londoner Kollegen einen trinken konnte oder, wie er sich ausdrückte, »mit den Jungs ein paar Guinness kippen«. Wahrscheinlich, weil ich in den knapp zwei Jahren in seiner Unit nicht ein einziges Mal Urlaub genommen hatte. Misstraue jedem Händler, der seine Bücher nie allein lässt, sagt man. Dabei hätte ich kaum etwas Verbotenes tun können. Stand als Junior Trader viel zu weit unten in der Hierarchie. Ich nahm keinen Urlaub, weil auf der Arbeit die Zeit so schnell verging. Weil ich vergaß, daran zu denken, was mich abends erwarten würde. Oder eben nicht.
Also ›kippte‹ ich mit den Jungs ein paar Guinness. Sie redeten über Handys, Heimkinos und Sportwagen, denen sie das Recht auf einen komplizierten Charakter zubilligten. Im Gegensatz zu Frauen. Ich interessierte mich zwar auch für Handys und Frauen, wusste aber nicht, was ich dazu sagen sollte. Hörte eh kaum zu. Konnte an nichts anderes denken als an Equinox, wäre am liebsten jetzt schon im Händlersaal gewesen und hätte mein Wissen angewendet.
Stattdessen saß ich in dieser Londoner Kneipe und trank viel zu kaltes Bier. Und musste mir auch noch Gerede über englischen Fußball anhören. Ich fragte die anderen, was sie davon hielten, dass Felix Magath jetzt Trainer von Schalke wurde. Alle kannten nur Bayern. Natürlich wusste ich, dass es sinnvoll war, wenn man mit den Kollegen einen trinken ging, Networking und so. War auch Arbeit, aber nicht so produktiv, dass man damit eine ganze Nacht verdaddeln sollte. Warum trank man nicht zwei Bier, hakte dabei diese Tottenhams und Arsenals, Audi TTs, Range Rovers und Kolleginnen ab, und dann gute Nacht?
Endlich machte die Kneipe zu. Ich ging ins Hotel und hatte den Fahrstuhlknopf schon gedrückt, da fasste Vikram, der in Bombay geborene Arsenal-Fan, mich am Ärmel und zog mich in die Hotelbar, wo sie alle saßen. »Wir trinken Jägermeister, Mann«, hatte er gesagt, als könnte ich als Deutscher da nicht Nein sagen. Also trank ich. Sorgte für betretenes Schweigen, als ich sagte, dass ich kein Auto hatte. Um drei tat ich so, als müsste ich aufs Klo, ging auf mein Zimmer, kotzte, duschte, trank zwei Liter Wasser, nahm zwei Magnesiumtabletten, drei Paracetamol, eine Pantozol, packte, nahm ein Taxi nach Heathrow und stieg um 5:03 in dieses Flugzeug zurück nach Chicago.
Die Stewardess nahm mir die Jacke ab und hängte sie auf einen Bügel, an dem sie meine Bordkarte festmachte wie eine Garderobennummer. Dann kam sie mit einem Glas Champagner. Ich musste mich zusammenreißen, damit niemand merkte, wie sehr ich mich darüber freute, in der Business-Class zu sitzen. Schließlich war dieser Flug kein Geschenk von Rutherford & Gold, sondern eine notwendige Ausgabe. Sie hielten mich jetzt für einen Leistungsträger und mussten mich gut behandeln. Schließlich konnte ich jederzeit zu Dresdner Kleinwort gehen oder zur UBS. So musste ich es sehen. Dieser breite Sessel war der Lohn für meine Fünfzehn-Stunden-Tage. Dieses Kissen aus Memory-Schaumstoff, das sich meine Kopfform merkte, das war offenbar mein Marktwert. Ich hatte gar keine Lust auf Champagner. Schon von dem Geruch wurde mir schlecht. Ich stellte das Glas ab und sah aus dem Fenster. Es war noch dunkel. Blinkende Lichter, Menschen mit Ohrenschützern, die durch Schneeregen liefen. Mein Gesicht spiegelte sich in der Fensterscheibe. Ich. In der Business-Class. Dann nahm ich doch einen Schluck.
Ab jetzt würden sie mich in der Bank in Chicago ernst nehmen. Ich war nicht mehr der Anfänger, den die Kollegen Kaffee holen schickten, auch wenn sie gar keinen Kaffee wollten. Diese Schulung bewies, dass Rutherford & Gold an mich glaubte. Nun wurde alles besser. Beruflich. Gab bestimmt auch eine Zeit für das Privatleben. Frau. Kind. Später. Ich war erst 31. Zwischen 30 und 40 muss man brennen.
Ich schlief ziemlich lange, dann ließ ich mir eine Spielkonsole bringen und schloss sie an den Bildschirm vor mir an. Obwohl das Unterhaltungsprogramm alle möglichen neuen Spiele anbot, entschied ich mich für Tetris. Wie damals, mit fünfzehn, in der computertechnischen Steinzeit. In unserem Hobbykeller in Bochum, wo ich mit meinen Freunden so lange spielte, bis ich beim Einschlafen rotierende Blöcke sah. Damals hatte ich Freunde. Jetzt ist die Karriere dran. Man kann nicht ewig jung sein. Und wenn ich nun bald Erfolg habe, gehe ich bestimmt auch mal mit den Kollegen in Chicago nach Feierabend ein Bier trinken. Dann gehöre ich dazu.
Plötzlich Druck auf meinen Ohren. War das schon der Sinkflug? Ich hatte doch gerade Level 15 erreicht. Musste es bis Level 18 schaffen. Steine prasselten auf mich ein, ich ließ sie zur Seite gleiten, rotieren. Alle erreichten den Platz, den ich für sie vorgesehen hatte. Level 16. Meine Daumen schossen auf dem Joypad hin und her, rechts, drehen, drehen, rechts, drehen, links, ich musste schneller sein, noch schneller, da wurde der Monitor plötzlich blau. Himmel mit ein paar Wolken. Das Logo von American Airlines erschien, dann machte eine Stewardess die üblichen Ansagen vor der Landung. Ich hämmerte auf sämtliche Knöpfe des Joypads, um das Spiel wieder in Gang zu bringen, doch auf dem Monitor stand nur: Bitte achten Sie auf die Ansage.
Unter mir die Vorortsiedlungen von Chicago. Große Häuser, Grundstücke, die immer kleiner wurden, je näher wir der Stadt kamen. Vor einem Einkaufszentrum zeichnete ein Fischgrätmuster Parkplätze vor. Alle Konsumenten schliefen noch. Europa war wieder sechs Zeitzonen weit weg, dort, wo es hingehörte, in der Vergangenheit.
Auf dem Bildschirm vor mir blinkte ein Flugzeug über der Karte von Nordamerika, verbleibende Flugzeit: 0:11 Minuten. Nach meiner Uhr hätten es 14 sein sollen. Die nächsten drei Minuten zeigte der Bildschirm an, dass elf Minuten verblieben. Doch was soll’s, ich war eh einen Tag zu früh zurück in Chicago. Eigentlich sollte ich erst morgen wieder zur Arbeit gehen, in die Zentrale von Rutherford & Gold an der LaSalle Street, Händlersaal, Desk 3, Futures und Optionen, an meinen Platz in der 29. Reihe mit den vier Monitoren, zwei unten, zwei oben und darüber ein weißes Schild: Jasper Ludemann; das mit dem ü hatten sie nicht hingekriegt, auf ganz normalem Papier. In eine Plastikhalterung geschoben und jederzeit austauschbar.
In Chicago machte ich meinen BlackBerry wieder an, und eine Erinnerungsnachricht poppte auf: Heute: Todestag Papi. Ich klickte sie weg. Sentimentalitäten konnte ich mir jetzt nicht leisten. Mein Gepäck schickte ich per Kurier in meine Wohnung und nahm die blaue Linie der Hochbahn Richtung Loop, wie sie hier das Zentrum nannten. Die werden Augen machen: Gestern noch Schulung in London, Networking-Trinken die ganze Nacht, in der Business-Class geschlafen und am nächsten Morgen wieder am Start. Damit bewies ich ein für alle Mal: Es war kein Fehler, dass sie mich vor zwei Jahren aus dem Back-Office in den Händlersaal geholt hatten. Nach vorne. An die Front.
Für meinen Mitarbeiterausweis hatte ich eine Plastikhülle gekauft. Es war 9:33, als ich ihn an den Sensor legte und sich die Speed-Gates öffneten. Im Fahrstuhl behielt ich ihn gleich in der Hand. Hielt ihn oben an den zweiten Sensor am Eingang zur Drehtür. Das grüne Signal blinkte, ich stellte mich auf die vorgezeichneten Fußumrisse am Boden und wartete auf die halbe Rotation, mit der die Drehtür mich in den Händlersaal brachte. 40 Reihen, ein Organismus aus 600 Menschen, 1.200 Telefonen und Tausenden von Bildschirmen. Bald kam Fixed Income in Sicht, dahinter lag unser Desk, den ich so fest im Blick hatte, dass ich fast mit einer Frau zusammenstieß. Wollte ihr eine Entschuldigung hinterherrufen, da war sie schon bei den japanischen Staatsanleihen verschwunden. Ich war zu langsam! Ich dachte doch, ich hätte ihn endlich abgestellt, diesen schlendernden Back-Office-Gang.
Mein Teamleiter Alex stand neben unserem Trainee, dem schüchternen Jeff, und rückte mit einer seiner riesigen Hände die randlose Brille zurecht. Er sprach sehr schnell, wobei sich nur sein Mund zu bewegen schien, der Rest seines Gesichts wirkte wie immer seltsam gelähmt. Meinen Platz erkannte ich an der Schalke-Fahne, die ich zwischen die beiden oberen Monitore gesteckt hatte, zwischen den Reuters-Monitor und den Bloomberg-Monitor. Dann merkte ich, dass Alex nicht bei Jeff stand, sondern direkt an meinem Platz. Er sah jemandem über die Schulter. Der an meinem Computer saß. War das etwa nicht mein Platz? Hatte ich mich in der Reihe geirrt? Nein, die königsblaue Schalke-Fahne war ja da. Ich hielt auf sie zu, nahm mir vor, ruhig, aber doch überrascht Guten Morgen zu sagen. Da drehte der Typ an meinem Computer sich um. Ganz langsam, als hätte er auf einem meiner Monitore etwas entdeckt. Erst hatte ich nur seinen Hinterkopf gesehen, nun sah ich seine Nase, seine Brille, sein Kinn, das er hob, um Alex anzusehen, meinen Teamleiter, der darauf bestanden hatte, dass ich mir diesen Tag freinahm. Als ich sah, dass der Typ eine Krawatte trug, krampfte mein Magen sich zusammen, und ich dachte nur ein einziges Wort: gefeuert. Niemand im Händlersaal trug eine Krawatte. Das war jemand von der Verwaltung. Einer von denen, die uns kontrollierten. Ich war gefeuert. Wusste zwar nicht warum, doch es war eindeutig. Der Krawattenmann richtete meinen Computer für den Neuen ein. Er zeigte auf einen der Monitore. Schüttelte den Kopf.
Nun war ich es, der schneller ging als alle anderen. Richtung Drehtür, Richtung raus.
Meike
Jetzt musste ich mich nur noch daran gewöhnen, dass es hier richtig schön war. Ich musste mich daran gewöhnen, dass diese Haustür meine Haustür war, und dahinter kein nach Putzmittel riechender Hausflur, keine Kinderwagen, kein von weggeschmissener Werbepost überquellender Plastikeimer, sondern nur meine blauen Schuhe auf den braunen Natursteinfliesen im Vorflur. Dies war ich in meinem neuen Leben.
Ich hängte meine Jacke zum Trocknen an die Türklinke und betrat mein neues Wohnzimmer, durch dessen Fenster sich mir ein Blick auf das bot, was das örtliche Fremdenverkehrsamt euphorisch Reizklima nannte: ein von heftigem Wind getriebener Regen, der auf eine grüne Wiese fiel. Vorgestern waren darauf noch Schafe gewesen.
Ich ging an der Stereoanlage vorbei und drückte ohne hinzusehen auf den Knopf, von dem ich wusste, dass Power darauf stand; in der Küche schaltete ich den Wasserkocher an, ohne ihn vorher anzuheben. Ich wusste, dass sich darin von heute Morgen noch genug Wasser für eine Tasse Kaffee befand – so war das, wenn man plötzlich alleine wohnte. Ich öffnete die Dose, an der ich mir schon manchen Fingernagel abgebrochen hatte und tat zwei gehäufte Löffel löslichen Kaffee in die Tasse. Die Anlage klapperte mit den CDs in ihrem Dreifachwechsler, der Wasserkocher machte bing, ich goss das heiße Wasser in die Tasse, rührte um, nahm die Milchpackung aus dem Kühlschrank und schüttelte sie heftig, bis der darin verbliebene Rest zu Schaum geworden war, Milchschaum, den ich in die Kaffeetasse schüttete. Das sah fast aus wie in einem Café. In Hamburg, in meinem früheren Leben. Doch ich hatte mich nun hierfür entschieden.
Ich stellte Tasse und Aschenbecher auf die mit Büchern gefüllte Umzugskiste, die mir als Wohnzimmertisch diente, lief zur Anlage, drückte die Wiedergabetaste und setzte mich genau in dem Moment auf das Sofa, in dem Wagners Tannhäuser mit verschnupft klingenden Blechbläsern begann. Dann sah ich hinaus und dachte darüber nach, wie mechanisch dieser Ablauf geworden war, obwohl ich erst seit vier Tagen hier wohnte.
Langsam drangen die Farben des Sonnenuntergangs durch das Wolkengrau. Orange, Dunkelblau und Rot. Das war nun wirklich schön. Sofa, Kaffee und Abendlicht – so sollten meine Freunde aus Hamburg mich sehen, während sie in stickigen, überfüllten U-Bahnen auf dem Weg in ihre Wohnungen waren, mit ihren kleinen Küchen, wo die einzige Abendröte aus dem Toaster kam. So sollte Arthur mich sehen.
Als ich mir gerade eine Zigarette anzünden wollte, fiel mir der Kachelofen ein. Ich hatte seit Stunden kein Holz nachgelegt, musste aber auf jeden Fall vermeiden, dass er ausging, da ich nicht richtig zugehört hatte, als der Vorbesitzer mir erklärte, wie man ihn anfeuert. Ich ging hin, öffnete die gusseiserne Klappe und kniff die Augen zusammen, als mir eine Rauchwolke entgegenschlug. Dann griff ich in den Korb neben dem Ofen und stellte fest, dass das klein gehackte Brennholz, das ich zusammen mit dem Haus übernommen hatte, endgültig aufgebraucht war. Es gab noch jede Menge Holz, doch das lagerte in großen Scheiten hinter dem Haus, unter einer LKW-Plane, auf die der Regen pladderte.
Natürlich gab es in meinem Haus auch eine richtige Heizung, eine ganz fortschrittliche sogar: eine mit Erdwärme aus eigenem Bohrloch betriebene Fußbodenheizung, die der Vorbesitzer selbst eingebaut hatte. Dann war er plötzlich ausgezogen und ließ neben der Heizung, die aus irgendeinem Grund nie funktioniert hatte, drei neu eingebaute Isolierfenster mit Löchern in den Fugen und ein zu drei Vierteln mit Schwammwischtechnik ockerfarben bemaltes Wohnzimmer zurück. Warum er ausgezogen war, hatte er mir nicht gesagt, obwohl er sonst eher viel redete. Ich nahm an, dass seine Frau ihn verlassen hatte, enerviert von dieser dilettantischen Hobbyheimwerkerei.
Also blieb mir nur der Kachelofen, der eigentlich nur aus Stylinggründen die letzte Renovierung überlebt hatte, aber das Haus leidlich warm hielt. »So ein Kachelofen macht natürlich eine viel schönere Wärme«, hatte mein Vorbesitzer gesagt, was einer seiner blöderen Sprüche gewesen war, denn Wärme war eine Strahlung mit einer gewissen Energie, und es war völlig egal, ob in diesem Kachelofen nun eine Heizspirale steckte oder dort Holz verbrannte oder eben, wie im Moment, nicht mehr verbrannte.
Ich griff die Axt, die im Flur an der Wand lehnte, zog die nasse Jacke wieder an, verließ das Haus, sah kurz, und nicht zum ersten Mal an diesem Tag, in den Briefkasten und ging dann um das Haus herum. Als ich die Lkw-Plane anfasste, um eines der großen Buchenholzscheite hervorzuholen, fiel mir ein, dass fast alle meiner Hamburger Freunde eine Umhängetasche aus diesem Material hatten, Arthur hatte sogar zwei. Ich hob die Plane vorsichtig an, damit das Wasser zur Seite abfloss, und fasste den verspäteten Neujahrsvorsatz, ab jetzt rechtzeitig und bei trockenem Wetter Holz zu hacken. Denn so viel erinnerte ich von den Ratschlägen meines Vorbesitzers: Bei Regen Holz zu hacken, war nicht gut. Was hatte er noch gesagt? Ich wusste es nicht mehr, legte eines der Scheite auf den Hauklotz und holte aus.
Das Gewicht der Axt überraschte mich und zog meine Arme weiter nach hinten als geplant, woraufhin meine Kapuze vom Kopf rutschte und Regen in meinen Nacken fiel. Durch diesen Kälteschauer zur Eile getrieben, ließ ich die Axt nach vorne fallen, als mir einfiel, zu spät einfiel, was mein Vorbesitzer noch gesagt hatte: Ich müsste mich breitbeinig hinstellen, damit die Axt, sollte sie den Hauklotz verfehlen, nicht mein Bein spaltete. Ich rutschte mit den Beinen auf dem matschigen Boden auseinander und versuchte gleichzeitig, die Axt in ihrem Fall zu bremsen. Zu spät. Die Axt sauste hinab, ich versuchte eine hilflose Drehung zur Seite, die Axt verfehlte das Scheit, meine Beine rutschten, rutschten, ich fiel, schloss die Augen und wartete auf irgendeinen Schmerz. Als ich die Augen wieder öffnete, lag ich im Matsch, und die Axt steckte in dem Hauklotz fest. Instinktiv sah ich mich um – hatte mich jemand bei dieser peinlichen Aktion beobachtet? Doch da war natürlich niemand. Noch nicht einmal das Haus eines Nachbarn. Nur Wiesen und Reizklima.
Zumindest das Badezimmer war gemütlich warm zu bekommen, man musste nur eine Viertelstunde heiß duschen, möglichst noch länger. Am Morgen nach meinem missglückten Holzhackversuch war das umso wichtiger, denn in der Nacht war der Ofen endgültig ausgegangen.
Der Briefkasten war leer. Wer hätte auch etwas einwerfen sollen, seit ich gestern vor dem Schlafengehen das letzte Mal nachgesehen hatte? Ich überprüfte, ob meine Visitenkarte noch über dem Briefkasten klebte, wo ich sie in Ermangelung eines Türschildes befestigt hatte: Meike Urbanski lit. Übersetzerin und darunter meine alte Hamburger Adresse, die ich durchgestrichen hatte.
Der Briefkasten war eines von diesen amerikanischen Modellen, die aussahen wie übergroße Weißbrotlaibe. Das passte zu dem Vorbesitzer meines Hauses, seinem Traum vom autarken Siedlerleben in der nordfriesischen Prärie, mit eigener Erdwärme. Bestimmt hatte seine Frau das lächerlich gefunden, jede Frau musste das lächerlich finden, diesen Briefkasten aus dem nächstbesten Baumarkt, der doch so etwas sagen sollte wie: Hier ist Amerika, das Land der Selbstverwirklichung, land of the free, verkörpert durch eine schmutzigweiße Röhre mit einer roten Blechfahne, die der Postbote hochstellen konnte, nachdem er etwas hineingetan hatte; die nach unten zeigte, seit ich eingezogen war.
Ich musste Holz hacken. Holz bedeutete Wärme, und ohne Wärme konnte ich das alles gleich vergessen mit meinem neuen Leben. Ich sah mich im Wohnzimmer um. Die von meinem Vorbesitzer mit dem Schwamm aufgetragene Ockerfarbe gab dem Raum etwas von einer uterusartigen Wohlfühlhöhle, was schlecht dazu passte, dass ich vor lauter Kälte inzwischen meinen Atem sehen konnte.
Da ich nicht noch einmal Tannhäuser hören wollte, suchte ich nach der Umzugskiste mit den CDs, und nachdem ich sie nicht auf Anhieb fand, wurde mir bald klar, wo sie war: im Flur unserer Hamburger Wohnung, unter der Gastherme, rechts von Arthurs Schuhen, dort, wo meine Schuhe gestanden hatten. Was für ein Umzugsklassiker! Alles war gut gelaufen, nur das Wichtigste hatte ich vergessen, sodass meine Musikauswahl nun auf das beschränkt war, was sich im Dreifach-CD-Wechsler meiner Anlage befand: Zweimal Tannhäuser und einmal Rufus Wainwright, der die Worte alcoholic homosexual so singen konnte, dass ich gerne beides gewesen wäre.
Arthur und ich hatten als Paar immer gut funktioniert. Wir lebten jene Art Leben, das Stoff für Fernsehserien war, hatten genug Geld, interessante Freunde, eine interessante Arbeit. Zehn Jahre war es her, dass wir uns in der Haushaltswarenabteilung von Karstadt kennengelernt hatten. Arthur hatte mich gefragt, ob ich eher eine Waschmaschine kaufen würde, die man von oben befüllte, oder eine, die die Luke ganz normal vorne hatte, einen »klassischen Frontloader«, wie es der Verkäufer ausdrückte, der sich in unser Gespräch einklinkte und uns natürlich für ein Paar hielt. Na gut, hatte ich gedacht, wenn es den Karstadtverkäufer überzeugt … Damit war Schritt eins gemacht. Es folgte Schritt zwei: gemeinsame Pärchenfreunde, Schritt drei: zusammenziehen und Schritt vier: über Kinder nachdenken. Dann tat ich Schritt fünf und zog aus.
Da ich unsere gemeinsamen Pärchenfreunde nicht um Hilfe fragen wollte, erledigte ich den Umzug allein, heimlich und morgens um vier. Das war die Zeit, zu der ich bestimmt niemanden auf der Straße traf, denn die Jahre der langen Kneipennächte waren vorbei für Gösta und Regine, Sabine und Lars. Es war, als hätte ich schon bei der Auswahl meiner Möbel darauf geachtet, dass sie weder besonders sperrig noch schwer waren: Das Bett gehörte Arthur, doch ich besaß ein Schlafsofa, ein Designerstück aus gepresstem Styropor, das weniger als 25 Kilo wog und sich mühelos die Treppen hinuntertragen ließ. Die Beine meines Schreibtisches hatte ich bereits am Vorabend abgeschraubt, und der Rest kam in Umzugskisten. Nach kaum einer Stunde war alles in dem Renault-Rapid-Transporter verstaut, den ich mir vor einigen Wochen gekauft hatte. Ich nahm mir sogar die Zeit, Arthurs Möbel zu verrücken und die Bücher in den Regalen umzustellen, sodass ihm meine Abwesenheit vielleicht nicht sofort auffallen würde, wenn er von seiner Ausstellungseröffnung in München zurückkam.
Es war noch nicht sechs Uhr, als ich die Türen zur Ladefläche meines Transporters endgültig schloss. Beim Abbiegen von der Bellealliancestraße auf die ausgestorbene Fruchtallee blinkte ich nicht und bremste kaum. Als ich wenig später auf die A 23 fuhr und in Richtung Husum/Heide Gas gab, war ich mir sicher, dass ich diese Stadt nie wiedersehen würde.
Zehn Jahre hatte ich hier gewohnt, im Schanzenviertel, war ganz klassisch zum Studieren hierhergezogen und hatte dann miterlebt, wie alles langsam sauberer wurde, ruhebedürftiger, kurz: bürgerlicher; wenngleich sich in den ersten Jahren niemand traute, das so zu nennen, bis dann alle plötzlich dauernd dieses Wort benutzten, wie um sich zu beweisen, dass das nichts Schlimmes sei.
Auf die Rehabilitierung des Wortes bürgerlich folgte Nachwuchs. Eines der mit uns befreundeten Paare, Gösta und Regine, hatte vor einigen Jahren mit einem Hund angefangen, den sie Leander nannten, woraufhin Lars und Sabine mit einem Kind konterten, das sie Friedrich nannten. Als Lars und Sabine dann ein zweites Kind bekamen, von dem ich mir nie merken konnte, ob es Sophia-Marie oder Maria-Sophie hieß, blieb Gösta und Regine nichts anderes übrig, als mit dem kleinen Maximilian, wenn schon nicht gleichzuziehen, so doch einen Anschlusstreffer zu erzielen.
Mit den Kindern, dem Hund und den mit ihnen unternommenen Landausflügen griff eine Begeisterung für Produkte aus der Region um sich. Das Alte Land zum Beispiel, aus dem man mit Äpfeln oder Kirschen wiederkehrte, die allein deswegen besser schmeckten, weil man das Alte Land fast sehen konnte, wenn man an der Elbe flussabwärts blickte und sich vorstellte, dass da hinter der Airbuswerft Dinge auf Bäumen wuchsen. Einen Hund wollten wir trotzdem nie. Ich hatte Angst vor Hunden, Arthur Angst um seine Gemälde, die er »Arbeiten« nannte. Seit einigen Jahren malte Arthur nur noch monochrom.
Warum ich zehn Jahre hier gelebt und mich dann heimlich aus dem Staub gemacht hatte, mag schwer zu erklären sein – unüblich ist es hingegen nicht. Menschen tun so was. Viele. Jeden Tag. Worüber ich mir Gedanken machte, war vielmehr die Frage, warum es ausgerechnet jetzt passiert war, und einer der Gründe war sicherlich der Heilige Abend, den wir im letzten Jahr bei Regine und Gösta verbracht hatten, zusammen mit Sabine und Lars. Seit Regine und Gösta den kleinen Maximilian hatten, waren sie sehr traditionsbewusst geworden. Sie hatten uns aus dem Wohnzimmer ausgesperrt, in das wir erst hineindurften, nachdem Gösta die echten Kerzen an dem Baum entzündet und eine Glocke geläutet hatte. Dabei war ihre Wohnung für solche Zugangsbeschränkungen eigentlich zu klein, sodass wir uns mit den immer unruhiger werdenden Friedrich, Maximilian und Maria-Sophie in der Küche drängelten und Gebäck aßen, das schmeckte wie anderes Gebäck auch, aber nach irgendwelchen speziellen Oma-Rezepten gebacken war. Hund Leander lag so apathisch unter dem Küchentisch, dass ich mir vorstellte, sie hätten ihm etwas Beruhigendes ins Futter getan – und mir dasselbe wünschte. Noch enger wurde es dadurch, dass Gösta sich einen Weinkühlschrank mit stoßgedämpften Regalen und fünf individuell regelbaren Klimazonen gekauft hatte. Gerade als ich fragen wollte, ob wenigstens ich in das Weihnachtszimmer hinein- oder eigentlich nur hindurchdürfte, um auf dem Balkon eine Zigarette zu rauchen, bimmelte es. Gösta las die Weihnachtsgeschichte, schien nicht zu wissen, wo er aufhören sollte und las viel zu lang, bis er verwirrt an der Stelle abbrach, wo der alte Simeon das Jesuskind im Tempel von Jerusalem auf die Arme nimmt, während ich auf die Balkontür starrte. Dann wurden die Geschenke verteilt, und Gösta bekam etwas von Regine.
»Oh, eine Salzmühle, ist die etwa mit …«
»… mit Peugeot-Mahlwerk, Edelstahl. Alle anderen taugen ja nichts«, sagte Regine. Das Wort Peugeot-Mahlwerk löste bei Sabine und Lars emphatisches Nicken aus, ich hingegen wunderte mich darüber, wie klein die Salzmühle war, wo Gösta doch in den letzten Jahren, wenn er für uns gekocht hatte, nach dem Servieren für jeden aus einer Mühle von der Größe und dem Aussehen einer Gartenschach-Figur Pfeffer auf den Teller geknarzt hatte. Ich überlegte, ob er ab jetzt zwei Mal die abendliche Tischgesellschaft umrunden würde, ein Mal mit Pfeffer, ein Mal mit Salz, und musste dabei so abwesend ausgesehen haben, dass Regine einen Versuch unternahm, mich in das Gespräch einzubinden, indem sie sagte:
»Da kann Gösta sein Himalaja-Salz reinfüllen.«
»Himalaja-Salz?«
»Salz ist nicht gleich Salz, da gibt es große Unterschiede. Unser normales Salz ist doch total industriell verunreinigt.«
»Und Himalaja-Salz?«
»Das ist Ur-Salz. Das kommt direkt aus der Natur.«
»Und in der Natur ist alles immer so sauber?«
»Im Himalaja gibt es keine Umweltgifte. Deswegen löst das keine Allergien aus. Bei den Kindern. Und außerdem schmeckt es besser, deswegen braucht man weniger davon.«
»Salz besteht zu 98% aus Natriumchlorid, egal, ob es aus dem Himalaja oder aus Bad Reichenhall kommt. Und das schmeckt immer gleich«, sagte ich, denn ich wusste das, ich hatte das recherchiert für eine meiner letzten Übersetzungen.
»Dann ist das halt mein subjektiver Geschmack«, sagte Regine in einer Weise lächelnd, als wüsste sie, dass ich darauf nichts antworten konnte. Gegen Geschmack, hier sogar subjektiven Geschmack, gefühlten Geschmack sozusagen, kam niemand an.
»Was ist Himalaja?«, fragte Friedrich und konnte nicht ahnen, wie dankbar ich ihm dafür war, dass er dieses Gespräch auf den gedanklichen Horizont eines Dreijährigen zurückholte. Regine erklärte ihm engagiert nickend, dass das Berge seien, Hi-ma-la-ja, gaanz weit weg und soooo hoch, hmhmm!, während ich auf den Balkon ging und gleich zwei Zigaretten rauchte.
Es überraschte mich, dass Lars, als er zu mir herauskam, um noch eine Flasche Sekt zu holen, von meiner Zigarette ziehen wollte.
»Warum hat Gösta den Sekt nicht in seinem Weinkühlschrank kalt gestellt?«, fragte ich.
»Ich glaub, der ist voll«, sagte Lars.
»Alle fünf Klimazonen?«
»Alle fünf individuell regelbaren Klimazonen«, sagte er und zog noch einmal. »Wein-Klima-Schrank übrigens, nicht Wein-Kühl-Schrank, schließlich muss nicht jeder Wein gekühlt werden.« Dann zog er ein drittes Mal und ging wieder hinein, bevor ich in der Halbdunkelheit erkennen konnte, ob er bei dem letzten Satz gegrinst hatte oder nicht.
Als ich wieder hineingegangen war, hatte Regine gerade ihre »Ich mag den Winter, weil man im Sommer wegen der ganzen Straßencafés nirgendwo durchkommt«-Suada begonnen. Ich erinnerte mich daran, dass ich im letzten Sommer im Café unter den Linden beobachtet hatte, wie Regine mit ihrem dreirädrigen Rennkinderwagen die Reihen der Cafétische und Stühle sprengte wie ein Streitwagen des Pharao eine Kompanie feindlicher Soldaten. Ich sagte, dass ich den Winter mochte, weil ich bis neun schlafen könne, ohne vom Licht geweckt zu werden, und Regine sagte: »Das würde ich auch gern mal wieder, aber das ist mit dem kleinen Süßen halt nicht drin.«
»Ich kann mir eben selbst einteilen, wann ich arbeite, was ist daran so schlimm?«, sagte ich, denn mich ärgerte der mitleidige Ton in ihrer Stimme.
»So hab ich das doch gar nicht gemeint. Im Gegenteil, ich wünschte mir manchmal, ich wäre so literaturverrückt wie du.«
»So verrückt bin ich nun auch wieder nicht.«
»Ich hab das ja auch nicht so gemeint, habe ich doch gerade schon gesagt«, sagte Regine dann. »Ich bewundere das.«
An diesem Weihnachtsabend hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich von diesen Menschen nicht einfach nur genervt war. Ich hatte Heimweh, obwohl ich seit zehn Jahren hier zu Hause war, Heimweh nach einem Ort, von dem ich nicht wusste, wo er war.
Natürlich hatten unsere Pärchenfreunde schon lange mit dem Gedanken gespielt, aufs Land zu ziehen. Besonders seit der Geburt von Sophia-Marie redete Sabine dauernd davon, einen alten Bauernhof zu kaufen, und so kam es auch heute wieder. Während sich die dritte Flasche Rotwein in der Dekantierkaraffe auf Zimmertemperatur schwappte, stimmten ihr alle wortreich zu, sogar Arthur: »Ja, ein Haus auf dem Land.«
Genau dort befand ich mich jetzt: auf dem Land, in der Region, aus der die Produkte aus der Region kamen. Dabei hätte es für mich gar nicht so ländlich sein müssen. Ein Supermarkt und ein Bahnhof in Laufweite wären schön gewesen – eine etwas exklusivere Einsamkeit, ruhig und trotzdem nicht am Arsch der Welt. Aber das konnte ich mir nicht leisten; ich schreibe die Bestseller schließlich nicht, ich übersetze sie nur. Und zurzeit nicht einmal das, da ich auf das neue Manuskript meines Autors wartete: Henry LaMarck. Eigentlich hätte es schon vor Wochen kommen müssen, doch nun wäre es wirklich jeden Tag so weit, wie mir sein deutscher Lektor Thorsten Fricke versichert hatte.
Ich ging abermals zum Briefkasten, die Fahne war unten, aber ich sah trotzdem hinein und überlegte, was Arthur und die anderen wohl denken würden, wenn sie das hier sehen könnten: die Straße, von der ich nicht wusste, wohin sie führte, jenseits der Straße den alten Deich, diesseits mein Haus, das in den Vierzigerjahren errichtete Nebengebäude eines alten Bauernhofs, der dann abgebrannt war. Den Briefkasten, die Tür, das Schlafzimmerfenster und das Gitter an der Hauswand, das der Vorbesitzer angebracht hatte, damit Efeu daran emporwachsen möge, wahrscheinlich in der Hoffnung, das Erscheinungsbild des Hauses von verwahrlost in Richtung verwunschen zu wandeln.
Ich ging um das Haus herum, an dem ungehackten Holz vorbei und dem Reisebus mit der Aufschrift modern reisen … bus reisen, den der Vorbesitzer für Gäste hatte ausbauen wollen, ihn aber letztendlich nur mit fast leeren Farbeimern, leeren Blumentöpfen, Dämmpapperesten und Dachziegeln vollgerümpelt hatte.
Vielleicht sollten meine Freunde das erst sehen, nachdem ich mich hier an alles gewöhnt hatte, nachdem ich mich eingerichtet und mit der Übersetzung von Henry LaMarcks neuem Roman angefangen hatte. Arthur. Gösta und Regine, Sabine und Lars. Aber dann würden sie überrascht feststellen, dass ausgerechnet ich ihren Traum wahr gemacht hatte, den Traum vom Wohnen auf dem Land, hinterm Deich. Der Deich lag zwar aufgrund von Landgewinnungsmaßnahmen seit Jahrhunderten nicht mehr am Meer, die Küste war zwei Kilometer weit weg, hinter einem richtigen Deich, aber trotzdem: Es war gut, dass ich hier war. Schön war es auch. Irgendwie.
Henry
Ich sollte mich wirklich schämen. Schämen solltest du dich, Henry LaMarck! Auf jeder anderen Party wäre es im Rahmen des gesellschaftlich Akzeptierten gewesen, sich sang- und klanglos davonzustehlen, doch auf der Party zu meinem eigenen sechzigsten Geburtstag war es das sicher nicht.
Meine Verlegerin Gracy Welsh hatte mich zu Parker Publishing gebeten, angeblich um mir die Umschlagentwürfe für die Taschenbuchausgabe meines letzten Romans, Windeseile, zu zeigen. Als ich jedoch das Großraumbüro im 24. Stock betrat, standen plötzlich jede Menge Leute um mich herum und riefen: »Überraschung!« Viele hatten sich mit Hütchen dekoriert, mit ganz ironisch hässlichen Hütchen natürlich, da ich bei Parker Publishing für meinen Humor bekannt war. Humor – Schmumor, ich war sechzig geworden, was war daran witzig?
Als sich der Überraschungslärm nicht legen wollte, schnippte Gracy mit dem Zeigefinger an ihren mit Sekt gefüllten Plastikbecher, begrüßte und beglückwünschte mich und sagte dann das, von dem sie dachte, das ich es ohnehin längst wusste:
»Henrys Geburtstag wäre ja an sich schon eine tolle Sache, aber das ist erst der Anfang: Henry ist nämlich mit Windeseile einer der Finalisten um den diesjährigen Pulitzerpreis. Ist das nicht fantastisch?«
Alle schienen zu jubeln, das sah ich ihren Gesichtern an, denn ich hörte nichts, und spürte auch nichts, außer diesem Herzrasen, das mich seit einiger Zeit immer wieder befiel und in meinem ganzen Körper wiederzuhallen schien, aufdringlich und schnell. Oh Gott. Ich war für den Pulitzerpreis nominiert, den ich vor etlichen Jahren schon einmal für meinen Roman Unterm Ahorn bekommen hatte. Damals war das eine echte Auszeichnung gewesen, doch jetzt schoss mir nur ein Gedanke durch den Kopf: Sie wollen dir schnell noch mal den Pulitzerpreis geben, bevor sie dich aufs literarische Abstellgleis schieben. Ein zweiter Pulitzerpreis, das war, als bekäme ich den Ehrenoscar für mein Lebenswerk. Danach konnte man nur noch eine künstlerisch relevante Sache tun: sterben.
Ich schüttelte Hände und hangelte mich von einer Umarmung in die nächste wie ein ertrinkender Orang-Utan. Viele sagten, sie freuten sich auf mein neues Buch, meinen Roman über die Terroranschläge des 11. September. So hatte ich es nämlich angekündigt oder besser, so war es mir rausgerutscht, als ich vor ungefähr einem Jahr anlässlich des Erscheinens von Windeseile bei Stephen Fry in der BBC zu Gast gewesen war, zusammen mit Elton John, der fast so witzig und geistreich reden konnte wie Stephen Fry selbst, was dazu geführt hatte, dass ich mich immer kleiner und langweiliger fühlte. Dann hatte ich es irgendwann gesagt: » Roman. 11. September.« Ich fand das witzig in dem Moment, und Elton John beeindrucken wollte ich auch, sodass ich sogar noch einen draufsetzte und behauptete, es sei ein groß angelegtes Projekt, an dem ich praktisch seit dem 12. September 2001 heimlich arbeiten würde. Nun hatte ich den Salat, alle erwarteten keinen Roman von mir, sondern einen Jahrhundertroman. Geschrieben hatte ich seitdem keine Zeile, doch Parker Publishing hatte bereits ein Marketingkonzept und eine Absatzprognose, in der das Wort »Million« vorkam.
Meine Verlegerin Gracy Welsh schien extra für diese Überraschungsparty zum Friseur gegangen zu sein – ihre blonden Haare, die wie immer die Form eines einbetonierten Baisers hatten, wirkten heute besonders unverwüstlich. Ich stellte mir vor, wie sie in ihrem schwarzen Mercedes-Cabriolet den Lake Shore Drive entlangbrauste und kein einziges Haar auch nur ins Zittern kam.
Sie trug ein schlichtes rotes Kleid, vor dessen Hintergrund ihre Comme-des-GarÁons-Handtasche mit nicht weniger als acht Tragriemen besonders hervorstach. Sie würde mich fragen, wann das Manuskript käme. Alle anderen würden sich zurückhalten, schließlich war es normal, dass ich meine Manuskripte erst in letzter Minute in praktisch druckreifem Zustand abgab. Doch Gracy sah ich an, dass sie wissen wollte, was los war. Sie wartete nur auf den richtigen Moment, um mich zu fragen.
Wäre ich bloß nicht hergekommen, ich Hirsch! Doch dann hätte sie erst recht geahnt, dass es ein Problem gab.
»Geburtstag haben und einen zweiten Pulitzerpreis bekommen, da weiß man ja gar nicht, was schöner ist«, sagte einer der Ironische-Hütchen-Träger. Alle erwarteten eine humorvolle Antwort von mir, doch mir fiel nichts Besseres ein als:
»Ich habe nichts gegen einen Alterspreis.«
»Aber Mr. LaMarck, Sie sind doch noch nicht alt«, sagte da eine Frau.
»Ich habe ihr gesagt, sie soll das sagen«, sagte der Hütchenträger und lachte laut, schien dann jedoch etwas unsicher zu werden, weil ich nicht einmal lächelte, und fügte hinzu. »Wie sechzig sehen Sie wirklich nicht aus.«
So war es, alle schätzten alle jünger als sie waren, dachte ich und sagte zu ihm, der höchstens vierzig sein konnte:
»Sie auch nicht.«
Nun lachten alle. Da bemerkte ich, dass Gracy auf mich zukam. Quer durch den Raum, Schreibtische und Gäste umschiffend, direkt auf mich zu. Das war’s. Aber sie blieb stehen, öffnete ihre Comme-des-GarÁons-Handtasche, nahm ein sehr flaches Handy heraus und sah erst auf die Anzeige, bevor sie den Anruf annahm. War es Hugh Hansen, der Verlagsleiter, der sie fragte, ob sie schon mit mir gesprochen hatte. Ich sah den Hütchenträger an und sagte: »Ich muss mal für kleine Pulitzerpreisträger.«
Wieder Gelächter. Ich verschwand in Richtung Toilette, machte aber vor dem Aufzug halt und drückte auf den Pfeil, der nach unten zeigte.
Nach wenigen Sekunden kam ein Fahrstuhl, ich betrat ihn und konnte nicht anders, als mein Spiegelbild in der Rückwand der Kabine zu betrachten. Der Mantel mit dem grauen Pelzkragen, der senfgelbe Helmut-Lang-Anzug, die grauen Ledermokassins, die sorgfältig durcheinandergebrachten schwarzen Haare: Hier stand ein berühmter Mann, der nicht alt sein wollte. Oder ein alter Mann, der nicht mehr berühmt sein wollte?
Eine knappe Stunde später stand ich in der Bar des Estana Hotel & Spa und hoffte, dass hier niemand nach mir suchen würde. Zwei japanische Geschäftsleute saßen an einem der Tische, über einen Laptop und eine Schale mit Wasabinüsschen gebeugt. Von denen ging keine Gefahr aus. Ansonsten waren keine Gäste hier, nur der Barmann machte mir Sorgen. Ich spürte, dass er mich beobachtete, obwohl er sich alle Mühe gab, mich das nicht spüren zu lassen. Ich sah ihm an, dass er schon lange in einem Luxushotel arbeitete und die Art von persönlichkeitsspaltender Schulung durchlaufen hatte, in der ihm zwei widersprüchliche Dinge antrainiert worden waren: Diskretion und Aufmerksamkeit. Er hatte gelernt, so zu tun, als höre er nicht, was die Menschen an seiner Bar miteinander sprachen, und war doch zur Stelle, wenn jemand den Satz »Ich glaub, ich trink noch was« fallen ließ. Er gab vor, mit der Reinigung der Kaffeemaschine beschäftigt zu sein, und doch war ich mir sicher, dass er sich fragte, was der elegant gekleidete Herr dort hinten machte. Dieser elegant gekleidete Herr, ich, schlurfte in Ledermokassins über einen Veloursteppich quer durch den Raum, schlurfte vom Eingang bis zur Bar, dann wieder zum Eingang und wieder zur Bar zurück, ohne die Füße auch nur ein Mal anzuheben.
Ich hielt meine Kreditkarte in der Hand, meine blöde Platinkarte und drückte die Finger auf den Magnetstreifen. Dann stellte ich mich an die Bar und legte die Hand mit der Kreditkarte auf den Tresen. Der Schlag der elektrischen Entladung ließ meinen Körper zusammenzucken. Ich gab ein klitzekleines Stöhnen von mir.
»Kann ich Ihnen helfen, Sir?«, fragte der Barkeeper, doch ich schüttelte nur den Kopf und verließ die Bar.
In einem meiner Romane gab es so eine Szene. Die Kreditkarte eines korrupten Staatsanwalts wird dadurch unbrauchbar, dass der Schlag, den er nach dem Beschreiten eines Veloursteppichs bekommt, seinen Magnetstreifen entlädt. Ich hatte das einfach so geschrieben, ohne es ausprobiert zu haben. Gütiger Gott, es musste einfach funktioniert haben – Kreditkartenlesegeräte funkten dauernd irgendwelche Daten an ihre Zentrale; wer Kreditkarten benutzte, konnte gefunden werden. Doch ich würde mich nicht finden lassen. Auf dem Weg vom Verlag hierher war ich bei der Bank gewesen und hatte 10.000 Dollar abgehoben.
Ich durchquerte die Hotelhalle in Richtung Rezeption. Auf dem Tresen stand eine Obstschale, in der nur grüne Äpfel lagen, was zum minimalistischen Einrichtungskonzept passte, dem Sichtbeton, den Holzpaneelen, den eckigen Vasen mit blattlosen Stöckern und dem anderen Zen-Schrott, der in der Hotelhalle herumstand.
»Willkommen im Estana Hotel & Spa, was kann ich für Sie tun?«
»Ein Zimmer, bitte.«
»Haben Sie reserviert?«
»Haben Sie eine Suite?«
»Wir haben noch eine Juniorsuite. Für wie viele Nächte?«
»Zwei, nein, acht.«
»Da wäre unsere aktuelle Rate 590 Dollar pro Nacht, plus 45 für das Frühstück.« Ich nickte. »Tragen Sie bitte Ihren Namen hier ein. Und dann bräuchte ich noch Ihre …«
»… Kreditkarte, ja natürlich«, sagte ich und schnippte sie beiläufig auf den Tresen. Der Rezeptionist hatte ein sehr schönes Gesicht, war wahrscheinlich halb Chinese, halb Europäer, eine Mischung, die ich schon immer charmant gefunden hatte. Ich sah ihn gerade lang genug an, um mich der Richtigkeit meines Geschmacksurteils zu vergewissern, und sah dann wieder auf das Anmeldeformular. Während er die Kreditkarte durch das Lesegerät schob, trug ich mich ein und machte mich bei dem Geburtsdatum um elf Jahre jünger.
»Haben Sie eine andere Kreditkarte?«
»Leider nicht. Ich muss sie zerkratzt haben, immer dieser blöde Sand in der Brieftasche«, sagte ich und ärgerte mich über diese sowohl unnötige als auch unbeholfene Erklärung.
»Ich würde im Voraus zahlen. Bar«, sagte ich, woraufhin die Unsicherheit, die für einen Moment im Lächeln des Rezeptionisten aufgetaucht war, wieder verschwand.
»Soll Ihnen jemand mit dem Gepäck helfen, Mr. Santos?«
Graham Santos. Unter diesem Namen hatte ich mich angemeldet. Dass auf meiner Kreditkarte ein anderer Name stand, hatte er entweder nicht mitbekommen oder er ignorierte es ebenso diskret, wie der Barkeeper mich ignoriert hatte.
»Danke. Geben Sie mir einfach eine Zahnbürste.«
Nachdem ich die Suite betreten und das Bitte-nicht-stören- Schild hinausgehängt hatte, ging es mir besser. Aus dem Fenster des Wohnzimmers sah ich den See, auf den sich der Abend gelegt hatte, die Luft so dunstig und schwer, dass ich kaum glauben konnte, man könne sie atmen. Auch die beiden Türme der Marina City konnte ich sehen. Im höheren lag meine Wohnung, doch dort würden sie mich finden. Der Verlag würde nach meinem neuen Roman fragen. Journalisten würden fragen, wie es für mich sei, zum zweiten Mal für den Pulitzerpreis nominiert zu sein, wie es für mich sei, sechzig Jahre alt zu sein – alt zu sein. Bei CNN stand ich auf der Liste der Prominenten, für die es einen vorproduzierten Nachruf gab. Wenn ich jetzt noch einmal den Pulitzerpreis bekäme, rückte ich bestimmt in die Liste der Prominenten auf, bei deren Tod das Programm unterbrochen wurde. Die breaking-news-Liste. So berühmt war ich geworden.
Ich ließ mich auf das Bett meiner Juniorsuite fallen, und das Herzrasen ließ endlich nach.
Jasper
Einmal pro Woche schickte die Personalabteilung eine Mail mit den neuen Mitarbeitern rum: Fotos, Mailadresse, Ausbildung, Funktion und Durchwahl. Hieß sie willkommen, ich glaube sogar, herzlich. Wenn jemand nicht mehr da war, erfuhr ich das erst, wenn ich eine Durchwahl wählte und jemand anders am Apparat war.
In wenigen Tagen würde wahrscheinlich auch an meiner Durchwahl jemand anders sitzen. Doch wenigstens musste ich mir nicht die Demütigung geben, ahnungslos da aufzutauchen und gefeuert zu werden. Ich war gewarnt. Es gab schlimmere Arten, von seiner Kündigung zu erfahren: Ich hatte mal von einem Kollegen gehört, der am Wochenende von seinem BlackBerry eine Mail von seiner privaten an seine Arbeitsadresse schickte und von einer automatischen Rückantwort mitgeteilt bekam, dass er nicht mehr für Rutherford & Gold arbeitete.
Zugegeben, so was war selten. Vielleicht sogar ein Gerücht. Aber auch der Normalfall war schlimm genug. Zum Beispiel bei meinem ehemaligen Chef aus dem Back-Office. Er wurde versetzt zu Fusionen und Übernahmen, es sah aus wie eine Beförderung, aber sicher war er sich nicht. Dafür, dass hier alles angeblich so rational war, gab es erstaunlich viel, wo man im Kaffeesatz lesen musste wie eine Wahrsagerin. Als ich einige Tage später mit meinem Ex-Chef im Fahrstuhl stand, sah er so schlecht aus, dass ich mich kaum traute, Hallo zu sagen. Schließlich erfuhr ich, was passiert war: Er hatte sein neues Büro vermessen, und es war zwei Quadratfuß kleiner als sein altes. Das waren ungefähr drei Seiten Papier. Und doch konnte er sich nicht damit abfinden, wurde schließlich sogar um 6:30 bei dem Versuch erwischt, sein altes Büro noch einmal nachzumessen. Einige Wochen später wurde er krank. Nie mehr gesehen. Obwohl sein neues Büro viel heller und zwei Etagen höher war, konnte ihm niemand den Glauben nehmen, degradiert worden zu sein.
Nun stand ich mitten am Vormittag im Caribou Café