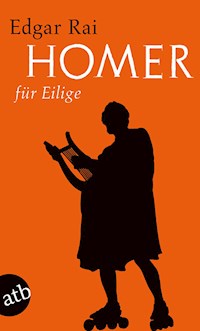10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Nacht vor Hitlers Ernennung zum Reichskanzler flieht Erich-Maria Remarque von Berlin ins Schweizer Exil am Lago Maggiore. Wenig später brennen seine Romane auf dem Scheiterhaufen der Nazis. Remarque stoßen die politischen Vorgänge in tiefe Ratlosigkeit, künstlerisch quält er sich seit Jahren mit einem neuen Roman herum. Seine Depression betäubt er mit Zigaretten und Alkohol, Ausschweifungen und erotischen Eskapaden, in die er sich mit seiner Exfrau Jutta stürzt. Auch sie auf der Flucht vor den Nazis, deren Hetze die Exilgemeinde in Ascona von Tag zu Tag vergrößert. Und noch immer tritt der Roman auf der Stelle, Hoffnung auf Erlösung liegt für ihn allein in der Begegnung mit der Frau seines Lebens, die sein schweizer Exil für immer beendet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de/literatur
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Gertrude Fehr, Am Lago Maggiore, 1940er Jahre (c) VG Bild-Kunst, Bonn 2021.
Sammlung Fotostiftung Schweiz, Winterthur
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Prolog
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
III
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Prolog
Ruth stand vor dem Fenster und blickte hinab auf die Straße. Das trübe Licht der Laterne schimmerte zu ihr herauf. Draußen zehn Grad unter null. Seit Tagen war die Stadt erstarrt, es brachen die Rohre. Allein gestern war die Feuerwehr mehr als fünfzigmal ausgerückt. Die Heizung gab Geräusche von sich, als knacke jemand mit den Fingerknöcheln.
Erich tastete nach ihrer Bettseite. »Komm weg da.«
Als drohe ihr nackter Körper aus dem Fenster zu kippen und auf der Straße in tausend Scherben zu zerspringen.
Sie wandte ihm den Kopf zu, suchte nach seinem Umriss. »Du musst das Land verlassen, heute noch.«
Erich stützte sich auf die Ellbogen, die Matratze gab nach. Er wollte etwas erwidern, aber Ruth hatte diesen Ton, den sie manchmal hatte.
»Ich soll die Stadt verlassen?«
»Nicht die Stadt. Berlin zu verlassen reicht nicht. Du musst raus aus Deutschland.«
Erich schwieg.
»Seit Stunden schleicht die SA durch die Straßen.«
»Bei minus zehn Grad? Die müssen einem ja direkt leidtun.«
»Komm her und sieh es dir an, wenn du mir nicht glaubst.«
»Seit wann stehst du denn schon da?«
»Lange genug.«
Dieser Ton. Erich langte nach dem Morgenmantel.
Er spürte die Kälte durch das Glas dringen, ohne es zu berühren. Es hatte nicht geschneit, doch der Asphalt war mit einer glitzernden Schicht überzogen, in der die Autoreifen matte Spuren hinterließen.
Gegenüber dem Hotel hielt ein Wagen, zwei Männer traten aus dem Hauseingang, Atemwolken vor den Gesichtern, SA-Mützen auf den Köpfen. Da wurden Befehle erteilt, Order entgegengenommen. Die beiden Männer rissen ihre Arme empor, Heil Hitler, der Wagen setzte seinen Weg fort, die Männer verschwanden im Dunkel des Hauseingangs. Kurz darauf glühende Zigarettenspitzen und Rauchwolken, die in den Kegel der Straßenlaterne aufstiegen.
Der Wagen war inzwischen an der Duisburger angekommen, gleiches Spiel. Erich spürte die Bedrohung so deutlich, wie er Ruths Körper neben sich spürte. Er öffnete seinen Morgenmantel, legte ihr den Arm um die Schulter, wickelte sie mit ein.
»Was haben die vor? Einen Putsch?«
»Was immer es ist, Boni, du darfst nicht hier sein, wenn es passiert, nicht in Deutschland. Hitler hat die Macht vor Augen, jeden Tag, er muss nur auf seinen Balkon treten, dann blickt er hinüber auf die Reichskanzlei, in die er hineinwill, und zwar um jeden Preis. Und wenn er einmal drin ist, bist du der Erste, den sie sich vornehmen.«
Erich hätte sie gerne beschwichtigt, ihr versichert, dass ihre Sorgen übertrieben waren. Doch es gab nichts zu beschwichtigen.
Die Erinnerung an die Uraufführung von Im Westen nichts Neues versetzte ihm noch heute, zwei Jahre später, einen Stich. Kaum war der Film angelaufen, hatten Goebbels und sein Gefolge im Mozartsaal einen Tumult entfacht, der sich zu einer Saalschlacht auswuchs und von einem Sonderkommando der Polizei beendet werden musste.
Der eigentliche Skandal war, dass Goebbels es fertigbrachte, den Film eine Woche später wegen angeblicher »Schädigung des deutschen Ansehens im Ausland« von der Oberprüfstelle verbieten zu lassen.
»Hitler soll sich gestern spät noch im Wilden Eber mit Oskar von Hindenburg getroffen haben«, sagte Ruth.
An der Kreuzung Ecke Xantener tauchte eine Brigade auf, sammelte zwei SA-Männer ein, zog weiter.
»Wie die Ameisen«, sagte Erich.
Ruth wand sich aus dem Morgenmantel, ging hinüber zum Bett, schaltete die Nachttischlampe ein, zog den großen Koffer vom Schrank und wuchtete ihn aufs Bett. Erichs Hosen legte sie zuunterst.
»Aber wo soll ich denn hin?«
»Irgendwohin, wo du erst einmal bleiben kannst. Porto Ronco.«
»Ich soll jetzt nach Ascona aufbrechen?«
Ruth stützte sich mit beiden Händen auf dem Koffer ab, blickte Erich an. »Du musst raus hier, Boni. Sofort.«
Er sog den Geruch ein, den ihr Körper in seinen Morgenmantel geatmet hatte. »Aber es ist halb zwei, und da draußen sind minus zehn Grad.«
Nachdenklich nahm Ruth den dicken Kaschmirpullover, den sie eben erst in den Koffer gelegt hatte, wieder heraus.
»Der ist für die Fahrt«, entschied sie. »Und der Mantel mit dem hohen Kragen. Und dicke Wollsocken wirst du brauchen. Und bitte, Boni, steh nicht herum und sieh mich so an, sonst breche ich gleich in Tränen aus. Ja, das ist ein Abschied.«
»Dann komm mit.«
Ein romantischer Impuls.
»Tu das nicht, Boni. Bitte.«
»Du bist die Jüdin von uns beiden. Wer sagt dir, dass du nicht genauso in Gefahr bist wie ich?«
»Unsinn! Ich bin viel zu unbedeutend. Du bist der erfolgreichste deutsche Schriftsteller. Und Pazifist. Du hast zwei Romane geschrieben, die in mehr Sprachen übersetzt worden sind als Hitler aufzählen könnte. Goebbels wird dir genau eine Chance geben, die Seiten zu wechseln. Außerdem« – Ruth hielt einen Moment inne – »außerdem willst du nicht, dass ich mitkomme. Ich weiß, du möchtest es gerne wollen, und das … ehrt dich. Glaube ich. Aber im Grunde weißt du, dass ich dir spätestens nach einer Woche auf die Nerven fallen würde.«
»Ich bin nicht sicher, ob du recht hast«, Erich zögerte, »aber da du ja meistens besser über mich Bescheid weißt als ich, glaube ich dir mal.« Er blickte zum Tisch hinüber. Pat, sein neuer Roman, war frisch abgetippt. »Den wollte ich morgen in den Verlag bringen.«
»Gib ihn mir, und ich bringe ihn hin.«
Es gab niemanden, dem Erich blinder vertraute als Ruth. Aber Pat aus der Hand geben? Zwei Jahre tägliches Ringen, zwei Jahre Hoffen und Bangen, Trauer und Wiederauferstehen?
»Ich nehme ihn mit«, entschied er.
Ruth tat so, als mache es ihr nichts aus. Wenn sie eins gelernt hatte aus ihrer Zeit mit Erich, dann, dass sie nicht ermessen konnte, was seine Romane ihm bedeuteten, dieses In-die-Welt-Müssen.
»Tu das. Und vergiss die Schreibmaschine nicht.«
Die Hände am Lenkrad schlich Erich die Brandenburger hinunter. Der Koffer war verstaut, das fertige Manuskript lag auf dem Beifahrersitz, beschwert von der tragbaren Remington Modell 5. Er hatte den Mantelkragen aufgestellt und sein Gesicht bis auf die Augenpartie mit dem Schal umwickelt, den Jutta ihm zu Weihnachten geschenkt und den Erich für zu lang befunden hatte. Jetzt war er dankbar für jeden Zentimeter.
Er hätte den Kurfürstendamm nehmen können, doch ein warnendes Gefühl ließ ihn in die Gegenrichtung abbiegen. Albern, kindisch geradezu. Wie überhaupt diese – was war das hier, eine Flucht? Hysterisch. Was sollte ihm schon passieren? Und doch saß er hinter dem Steuer und stahl sich den vereisten Hohenzollerndamm hinunter aus der Stadt hinaus.
Auf der Kronprinzenallee kam ihm ein Verband aus drei Autos entgegen, in der Mitte eine schwere schwarze Limousine, ein Mercedes W07. Was hatte Ruth gesagt? Hitler habe sich am Abend noch nach Grunewald hinausfahren lassen? War er das, der da gerade an ihm vorbeifuhr?
Erich steuerte seinen Lancia an den Straßenrand, ließ den Motor laufen, streifte einen Handschuh ab und suchte in den Taschen seines Mantels nach dem Zigarettenetui. Er fand es, zündete sich eine an, inhalierte. Was konnte Hitler von Oskar von Hindenburg wollen, wo doch allgemein bekannt war, dass der Reichspräsident seinen Sohn für einen Taugenichts hielt? Erich rief sich Ruths Worte ins Gedächtnis: Wenn er einmal drin ist, bist du der Erste, den sie sich vornehmen. Ja, das ist ein Abschied. Nicht zu glauben.
Erich klemmte sich die Zigarette in den Mundwinkel, zog seinen Handschuh über und ließ die Kupplung kommen. Vor ihm lagen 1000 Kilometer.
Als er von Locarno kommend auf der schmalen Brücke die Maggia überquerte und seinen Wagen an den schneebedeckten Feldern vorbei zum vertrauten Campanile von San Pietro e Paolo hinabrollen ließ, lagen vierzehn Stunden Fahrt hinter ihm. Noch immer fühlte sich seine Flucht unwirklich an. Als wäre die Welt um ihn herum in Auflösung begriffen. Er brauchte dringend Menschen um sich, Stimmen. Sonst würde er sich noch selbst auflösen. Er kannte diesen Zustand, die Unfähigkeit, etwas anderes zu tun, als einen Punkt an der Wand anzustarren.
Erich passierte die Kirche, tauchte in die Gasse ein, die zur Piazza hinunterführte, stellte seinen Lancia an der Promenade ab und stieg aus dem Wagen. Seine Finger waren klamm, die Füße eisig. Vom See stieg Nebel auf, das Wasser wie Stein. Zwei Männer tippten im Vorbeigehen an ihre Fischermützen. Viele Dorfbewohner wussten nicht, wer er war, sein Auto aber kannten alle.
Er überquerte die Straße und steuerte die Via Borgo an, in der das Caffè Verbano lag. Ein doppelter Espresso, etwas zu essen, ein Glas Wein, einen Grappa. Im Verbano war man nie allein.
Mit aufgestelltem Kragen stapfte Erich die Straße hinauf. Über ihm hingen schwertlange Eiszapfen von den Dachvorsprüngen. Dann der vertraute Anblick der Bogenfenster, erleuchtet, warm.
Als er das Caffè betrat, kehrten ihm sämtliche Anwesenden den Rücken zu. Nicht einmal Fede, die für gewöhnlich jeden Gast wie einen alten Freund begrüßte, nahm Notiz von ihm. Alle lauschten dem Radioapparat, der auf der Theke stand und den Erich hier noch nie gesehen hatte. Eine blecherne Stimme war zu hören, Langwelle.
»Oh, mein Gott«, sagte jemand.
»Maria ci aiuti.«
Einen Moment lang nur Knistern im Radio. Als Fede, die noch nie etwas anderes ausgestrahlt hatte als Freude und Lebenslust, sich umdrehte, sah sie um Jahre gealtert aus.
Sie blickte auf ihre Hände. »Hitler ist Reichskanzler!«
I
1
Bis Erich die Tür der Casa Monte Tabor aufschloss, war es weit nach Mitternacht. In Berlin hatte es unterdessen den ersten Toten gegeben. Keine zwölf Stunden nach Hitlers Machtergreifung war der Mördersturm 33 durch die Wallstraße gezogen, auch minus zehn Grad hatten den berüchtigten SA-Trupp nicht abhalten können. Ein Polizist, der telefonisch Hilfe anfordern wollte, wurde von einer Kugel in der Brust getroffen und starb kurz darauf im Hildegard-Krankenhaus.
Erich war vom Verbano in die Nelly-Bar unten am See gewechselt, wo er ein riesiges Stück Fleisch verzehrt und sich von den Fettaugen der Soße hatte anstarren lassen, hatte sich die Wärme und die Stimmen im Lokal wie einen Mantel umgelegt und sein verschwommenes Spiegelbild in der Scheibe betrachtet. Jetzt stand er im Flur seiner Villa, das Manuskript von Pat unter dem Arm.
Stille. Abgestandene Luft. Ein Geschmack von Keller auf der Zunge, von schlecht gelagerten Kartoffeln, von Feuchtigkeit, die ins Mauerwerk dringt. Der Geruch war ihm vertraut. Es war der Geruch von Räumen, in denen man sich nicht zurechtfand, wenn man nachts erwachte, von Türen, die ins Ungewisse führten, einer Kindheit ohne festen Ort. Es würde Tage dauern, ehe er dem Haus die Kälte ausgetrieben hätte. Er musste den Kamin in Gang bringen. Feuer im Kamin hieß ja auch immer, sich niederlassen dürfen. Das steckte im Menschen seit Jahrtausenden.
Die in einer Weinkiste gestapelten Zeitungen waren feucht, das Papier wellig. Erst beim zweiten Versuch griffen die Flammen auf das Stückholz über und leckten lange genug an den Scheiten, um sie in Brand zu setzen. Erich fühlte sich wie ein Eindringling in den eigenen vier Wänden.
In der Linken eine Zigarette, in der Rechten den Glasaschenbecher, blickte er auf den See hinaus. Vereinzelte Lichter auf der anderen Seite, die Scheinwerfer eines Autos, das die Uferstraße entlangkroch.
Er spürte etwas von sich abfallen, ein Nachlassen. Sollte er am Ende froh darüber sein, Ruths Drängen nachgegeben und so überhastet seine Stadt und sein Land verlassen zu haben?
»Ich werde nie wieder jemanden so lieben wie dich.«
Zwei Jahre war es her, dass sie diese Worte zu ihm gesagt hatte. Eine Feststellung. Mit zweiundzwanzig. Wie konnte man so jung so gut über sich und seine Gefühle Bescheid wissen?
Und dann: »Ich werde mich scheiden lassen.«
Was sollte er dazu sagen? Die Affäre mit Ruth war aufregend und intensiv, zum einen, weil Ruth Ruth war, zum anderen, weil es eine Affäre war. Auch wollte Erich nicht die Schuld an einer zerstörten Ehe tragen. Andererseits hatte er selbst gerade die Scheidung von Jutta hinter sich. Viel verändert hatte sich dadurch nicht. Vielleicht waren Ehen generell überschätzt. Und Scheidungen eben auch.
»Ich kann nicht mit einem Mann verheiratet sein, den ich nicht so liebe wie dich«, hatte Ruth erklärt. »Und da ich keinen Mann so lieben kann wie dich, kann ich nur mit dir oder gar nicht verheiratet sein.«
Der Beginn ihrer Beziehung markierte zugleich den Beginn ihres Endes. Ruth war so leidenschaftlich wie fordernd, und je stärker sie auf Erich einzuwirken versuchte, je mehr sie einforderte, umso mehr entfernte er sich von ihr.
Vergangenen Sommer hatte er ihr einen ausufernden Brief geschrieben, hatte lange über dem Papier verharrt, eine ganze Flasche Wein getrunken, ein Opfer dargebracht, hatte den Brief erst mit Bleistift vor- und dann mit Füller abgeschrieben:
… vielleicht kann ich nicht lieben, ja, geh weg von mir, mach Dich los, ich tauge nicht für einen Menschen, der ungestüm und unbedenklich sich einsetzt und sich hineinwirft, ich bin halb, ich bin nie ganz da, ich bin zu wenig, ich nehme nur und gebe nichts …
Viel verändert hatte sich auch dadurch nicht.
Wo sie jetzt war? Erich versuchte sich zu erinnern. War sie am Abend in einer von Holländers Revuen aufgetreten, saß in diesem Moment mit ihren Kolleginnen bei Schwannecke zusammen und redete über Hitler, und dass er jetzt in der Reichskanzlei saß? Dachte sie an ihn, und spürte sie, dass er an sie dachte? Allmählich, wie ein Verdacht, breitete sich die Wärme im Kaminzimmer aus. Die Scheite zischten. Eine letzte Zigarette, dann würde er sich hinlegen.
Ruth war es auch gewesen, die ihm zum Kauf der Casa Monte Tabor geraten hatte. Genaugenommen hatte sie die Villa für ihn ausgesucht. Und natürlich war er ihrem Rat gefolgt. Bei der Frage nach der Einrichtung hatte er ihr gar nicht mehr hineinzureden gewagt, hatte dankbar alles ihr überlassen, die Möbel, die Teppiche, die Lampen. Sie war so viel sicherer in Geschmacksfragen. Er bewunderte ihre Weltläufigkeit, die Selbstverständlichkeit, mit der sie durch ihr Leben schritt.
Er selbst würde immer ein Hineingeworfener bleiben, trotz seines Erfolgs, seiner Villa, des Autos und der Kaschmirschals. So teuer konnten die Zigarren und der Wein nicht sein, dass die Thomas Manns und Bertolt Brechts dieser Welt ihn nicht dahinter erkannt hätten. Alles Staffage. Sie würden niemals aufhören, die Nase über ihn zu rümpfen, würden ihren Hochmut stets nur mit so viel Jovialität bemänteln, dass er dem genauen Beobachter nicht entging.
Die Schriftstellerei hätten sie ihm verziehen, den Erfolg niemals. Dreieinhalb Millionen Exemplare in 18 Monaten. Selbst sein zweiter Roman, Der Weg zurück, hatte alle anderen Veröffentlichungen des Jahres mühelos in den Schatten gestellt. Kästner, Feuchtwanger, Zweig, Werfel, Tucholsky, alle hatten vorletztes Jahr neue Romane ins Rennen geschickt. Mit Der Weg zurück konnte keiner von ihnen auch nur über die halbe Distanz mitgehen. Sechs Monate nach Erscheinen bereits in 25 Länder verkauft. Sie mussten ihn hassen.
Er öffnete die Tür, trat in die Nacht hinaus, auf die Terrasse über dem See. Kein Wind, kein Nebel, Atemwolken vor dem Gesicht. Die Berührung seiner Hand mit dem Geländer zog ihm die Wärme aus den Fingern. Bis nach Italien ging der Blick, die Grenze irgendwo im See, unsichtbar, eine Behauptung.
Der Erfolg war ihm nicht bekommen. Und ein besserer Mensch war er durch ihn auch nicht geworden. Luxus, mehr nicht. Ein schönes Haus, glänzende Jetons im Casino von Monte Carlo.
Das Manuskript von Pat lag neben der Remington auf dem Tisch. Damals, als Erich den Roman in Angriff genommen hatte, hatte er diese Sehnsucht schon einmal formuliert, in einem Brief an Emil Ludwig.
Ich möchte etwas Geschlossenes, Klares, Positives werden, aber es ist schwer, und manchmal glaube ich, es sei zu spät.
Vielleicht war es noch nicht zu spät, jetzt, da er alles abgestreift hatte, womit er sich sonst so erfolgreich von sich und seiner Arbeit ablenkte. Er liebte seine Künstlereinsamkeit, doch sobald er sich in sie hineinbegab, krochen die Dämonen aus den Ecken. Aber nur dann war er gut. Er musste in Gefahr schweben, wenn er verstehen wollte, worum es ihm beim Schreiben wirklich ging. Vielleicht konnte ihm jetzt etwas Großes gelingen. Der See, die Schönheit. Während man in Deutschland den Verstand verlor.
Er drückte die Zigarette aus. Das Manuskript würde er ruhen lassen, ein paar Tage, eine Woche, sich in sich selbst einfinden, hoffentlich.
Mit der Wärme kam die Müdigkeit, schwer, dehnte sich aus. Erich legte genug Holz nach, um sicher zu sein, am Morgen noch Glut vorzufinden, zog die Schuhe aus. Den Mantel behielt er an. Den Koffer könnte er später aus dem Wagen holen, keine Eile jetzt. Danke, Ruth. Mach’s gut. Und gib auf dich acht.
2
Emil Ludwig stand draußen auf der Terrasse, die Arme ausgebreitet, ehrlich empfundene Freude im Gesicht.
»Da sind Sie also!«, rief er. Als sei er seit Stunden auf der Suche nach ihm.
Erich kniff die Augen zusammen. Dem Stand der Sonne nach musste es gegen Mittag sein. Was war mit dem Vormittag geschehen? Auf dem Sofa liegend hatte er beobachtet, wie die Sonne dem Monte Gambarogno erst einen Heiligenschein aufgesetzt hatte, um kurz darauf über ihm aufzusteigen, doch die Stunden seither? Erich erinnerte sich, den Koffer aus dem Lancia geholt und am Fuß der Treppe abgestellt zu haben. Wo er noch stand, unangetastet, und den Weg ins Obergeschoss versperrte.
Die Freude über Emils Besuch überraschte Erich. Unangekündigt. Wo es doch neuerdings überall Telefon gab. Hier, in Ascona, waren sie Nachbarn. Vergewisserung, darum ging es. Für sich sein, immer gerne. Allein sein, immer schwierig.
Emil hatte zugelegt. Das Sakko spannte über dem Bauch. Es stand ihm überraschend gut, verlieh ihm Gravität.
»Lassen Sie mich raten«, sagte Erich, »Engler hat es Ihnen gesteckt.«
Engler war der Bäcker im Dorf, jeden Morgen um halb fünf auf den Beinen. Und über alles unterrichtet, was in Ascona vor sich ging.
»Es hätten ebenso gut der Fleischer oder der Friseur sein können«, erwiderte Emil. »Das halbe Dorf weiß, dass Sie wieder da sind. Aber so elend, wie mir berichtet wurde, sehen Sie gar nicht aus.«
»Tröstlich … Kommen Sie herein.«
Emil spannte den Brustkorb: »Kommen Sie lieber heraus, das Wetter ist ein Geschenk!«
Erich setzte einen Fuß auf die Terrasse, blickte in den Himmel. Makellos, wie ein perfekter Gedanke.
»Ein Spaziergang«, überlegte er. Körperliche Bewegung an frischer Luft. Vielleicht würde es helfen, wogegen auch immer. »Kommen Sie wenigstens kurz herein. Ich ziehe mir schnell ein frisches Hemd an.«
Emil trat an ihm vorbei ins Kaminzimmer. Umständlich öffnete Erich den Koffer, zog ein Hemd und frische Unterwäsche heraus.
»Haben Sie es mit dem Rücken?«, fragte Emil.
Ludwig spielte auf den Koffer an. Warum sonst hätte Erich ihn hier unten stehen lassen sollen? Das Hemd in der Hand stieg Erich über ihn hinweg und die Treppe ins Obergeschoss hinauf.
»Irgendetwas in mir scheint noch nicht akzeptiert zu haben, dass ich jetzt hier sein soll«, rief er.
Als er kurz darauf wieder herunterkam, fand er Emil über sein Manuskript gebeugt, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Die Deckenbalken knackten, das Haus erwachte langsam.
Emil warf ihm einen fragenden Blick zu.
»Abgeschlossen.« Den Krawattenknoten zur Hälfte gebunden, hielt Erich inne. »Dachte ich jedenfalls bis gestern.«
»Und was ist in der Zwischenzeit passiert?«
»In der Zwischenzeit …« Gute Frage. »Es scheint, als seien meine Gewissheiten irgendwo in den Bergen aus dem Wagen geweht worden.«
Sie gingen entlang der Via Moscia, Ascona im Blick, Schneezungen auf den Uferwiesen. Die Dächer leuchteten ihnen entgegen. Als hätte sich das Dorf ihretwegen den Sonntagsstaat angelegt.
Ludwigs Gang ruckelte ein wenig. Oft machten seine angriffslustige Art, sein wacher Geist und seine Schlagfertigkeit den Altersunterschied zwischen ihnen vergessen. Jetzt jedoch, da sie nebeneinanderher gingen, Emil mit diesem punktierten Rhythmus und den professoral auf dem Rücken verschränkten Händen, spürte Erich die siebzehn Jahre, die sie trennten, die vergangene Jugend.
»Sorgen Sie sich nicht zu sehr.« Emil missdeutete Erichs Schweigen als Besorgnis. »Der Spuk wird bald ein Ende haben.«
Ludwig meinte Hitler. Erich war in Gedanken bei Ruth und Jutta gewesen.
»Es ist gar nicht so sehr die Sorge«, erwiderte Erich. »Es ist … Man kommt sich wie ein Betrogener vor.«
»Hitler wird nicht lange im Amt bleiben. Selbst die Verführungswilligsten werden bald einsehen, dass sie sich einen Kretin zum Führer erwählt haben.«
So hatte es Emil bereits vor Jahren in einem Artikel für die Sunday Times prophezeit. Darin hatte er den Wunsch formuliert, Hitler möge an die Macht kommen, damit seine Unfähigkeit endgültig und für jedermann sichtbar zutage treten müsse. Seither war Emil den Nazis verhasst wie nur wenige. Etwas, das die beiden miteinander gemein hatten.
Erich hatte Zweifel an Emils Einschätzung, behielt sie aber für sich. Für einen Streit mit seinem Kollegen fühlte er sich so früh am Tage noch nicht gewappnet. Emil glaubte an das Gute im Menschen, stoisch.
»Verzagtheit, mein Guter«, sagte er, »wird der Welt nicht von Nutzen sein. Sie sollten nicht zu überrascht sein über das, was in Berlin passiert. Bereits Goethe bekam Bauchschmerzen beim Gedanken an das deutsche Volk.«
Erich wusste, auf welches Zitat Emil anspielte: »›So achtbar im Einzelnen, so miserabel im Ganzen‹.«
»Es liegt in der Natur des Nationalsozialismus, dass er die Humanisten mit der größten Leidenschaft verachtet. Ich fürchte, unser Kampf beginnt gerade erst.«
Emil sah alles andere als besorgt aus angesichts der bevorstehenden Aufgabe.
»Ich soll ein Kämpfer sein«, erwiderte Erich, »gegen die Nazis?«
»Ich sehe nicht, dass Sie eine Wahl hätten. Ihre Romane sind zum Politikum geworden. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, wird Pat ebenfalls zum Politikum werden, vermutlich noch vor seinem Erscheinen. Damit sind auch Sie zum Politikum geworden. Manchmal kann man sich seine Rolle nicht aussuchen.«
»Dann hätte ich vielleicht besser in Berlin bleiben sollen.«
»Das wird die Zukunft erweisen. Ich für meinen Teil bin froh, dass die Umstände Sie fürs Erste hierher verschlagen haben, an einen Ort relativer Sicherheit.«
»Sicherheit«, murrte Erich.
»Ich gebe zu«, erwiderte Ludwig, »sie wirkt sich nicht notwendig positiv auf den künstlerischen Schaffensprozess aus, aber ganz zu verachten ist sie auch nicht. Wir haben beide den Krieg erlebt. Morgens aufzustehen in der sicheren Annahme, dass man auch am Abend noch leben und über zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf verfügen wird, ist ein beruhigender Komfort. Wenn man ununterbrochen nur mit Überleben beschäftigt ist, bleibt für anderes kein Platz.
Sie sind ein kreativer Geist, Erich, es arbeitet in Ihnen. Auch das sucht man sich nicht aus. Irgendetwas wird sich in Gang setzen, ich bin sicher. Und sollten Sie – so Gott will – in diesem Leben noch etwas Disziplin lernen, dann wird es seinen Ausdruck finden.«
Emil hatte leicht reden, um mangelnde Disziplin musste der sich nicht sorgen. Arbeiten, Schreiben … Das war sein natürlicher Zustand. Planvoll, zielgerichtet, ökonomisch, Kapitän seines eigenen Schiffes, mit festem Kurs und unbeirrbarem Kompass.
Es hatte Abende gegeben, da hätte Erich ihn deswegen anschreien mögen: Wie können Sie sich so sicher sein! Das ist unverschämt! Und es hatte Abende gegeben, da hatte er es getan. Und sich tags darauf entschuldigt, kleinmütig. Hier, ich habe mir erlaubt, Ihnen einige meiner besten Zigarren mitzubringen. Es war einfältig, Emil ausgerechnet das vorzuwerfen, worum Erich ihn am meisten beneidete.
Sie hatten die ersten Häuser passiert, Ascona breitete sich vor ihnen aus: die Piazza, der Pier, die Baumreihe entlang der Promenade, der bescheidene Campanile mit seiner zarten Glocke. Das Dorf hatte mit einem Bildnis von Montagné mehr gemein als mit der Realität.
»Immer heraus damit.« Emil hatte längst gemerkt, dass Erich etwas beschäftigte.
»Ich frage mich«, überlegte Erich, »ob Sie mir auch so wohlgesinnt wären, wenn wir uns unter anderen Umständen kennengelernt hätten. Oder ob unsere – ich nenne es mal Freundschaft – vor allem der Situation geschuldet ist.«
»Aber natürlich wären wir auch unter anderen Umständen Freunde geworden!«
Erich schwieg. Die nächste Frage ergab sich von selbst.
»Wie ich da so sicher sein kann«, fuhr Emil fort, »wo wir doch so verschieden sind? Nun, die Antwort ist ganz einfach: Was einen Menschen ausmacht, sind nicht seine Prinzipien – die sind einfach nur quälend banal –, sondern seine Absichten. Seine Reinheit, wenn Sie so wollen.«
Erich verschluckte sich am Rauch seiner Zigarette. Reinheit? Er dachte an Ruth, an Jutta, seine Unfähigkeit, Liebe und Begehren auseinanderzuhalten – gut, das vermochten die wenigsten –, an sein Manuskript, die Selbstzweifel, bei allem, bei jedem dritten Wort, die fehlende Disziplin, die nie erreichten Ansprüche.
»Aber bei mir ist überhaupt nichts im Reinen!«
»Es geht doch nicht um den Istzustand.« Emil sprach mit ihm wie mit einem Kind. »Denken Sie an Homer, die Ilias. Hektor weiß, der Kampf, den er zu kämpfen hat, ist nicht zu gewinnen. Er kann Achilles nicht bezwingen. Und doch nimmt er ihn an.«
»Falsch verstandenes Ehrgefühl.«
»Manchmal sucht man sich seine Rolle nicht aus. Der Mensch ist nicht klug, Erich, war es nie. Die größten Geister haben den größten Unsinn verzapft. Und doch fühlen wir mit Hektor. Denn was uns wahren Respekt einflößt, was uns wirklich für einen Menschen einnimmt, ist sein Streben. Seit Geschichten in unsere Welt gekommen sind, werden Helden zu Helden durch das, was sie zu sein versuchen, nicht durch das, was sie bereits sind.«
Erich blieb stehen, drehte seine Handflächen gen Himmel. »Ich bin ein Held!«
Emil zupfte sich einen Tabakkrümel von der Lippe: »Ich war zuversichtlich, Sie würden von selbst darauf kommen.«
3
Rosenmontag in Ascona. Eine Handvoll junger Männer war nach Locarno hinübergefahren, das als Kurort etwas mehr Zerstreuung bot, und hatte dort Ausgelassenheit demonstriert. Im Dorf jedoch war es wie immer ruhig geblieben.
In München und Köln waren derweil wilde Feste im Gange, Kehrausstimmung, ehe am Aschermittwoch der Alltag wieder Einzug hielt. Menschen in aufwendigen Kostümen drehten sich auf den Tanzflächen, Champagner, Bier, Frauen, Männer. In Berlin hatte die Feuerwehr unterdessen fünfzehn Löschzüge im Einsatz, um den Brand im Reichstag unter Kontrolle zu bringen.
Brandstiftung. Wer immer dafür die Verantwortung trug, musste sehr genau gewusst haben, was er tat. Das Feuer war an mehreren Stellen zugleich ausgebrochen, und bis der erste Löschzug in Stellung gebracht war, schlugen die Flammen bereits aus der Kuppel. Den Brand zu löschen, nahm Stunden in Anspruch. Genügend Zeit für Tausende von Schaulustigen, das Spektakel persönlich in Augenschein zu nehmen. Selbst in Steglitz und Pankow war der Widerschein des Feuers am Berliner Nachthimmel zu sehen.
Als die Flammen am höchsten schlugen, erschienen Goebbels und Göring am Unglücksort, um sich effektvoll vor der einmaligen Kulisse in Szene zu setzen. Informationen über den oder die Brandstifter lagen noch nicht vor, Göring allerdings wollte bereits von einem kommunistischen Aufstand erfahren haben.
Ein junger Maurer aus Holland wurde festgenommen – Marinus van der Lubbe –, der einen ziemlich verwirrten Eindruck machte und bei der Vernehmung nicht nur behauptete, den Brand gelegt zu haben, sondern darauf bestand, es allein getan zu haben. Hitler, Goebbels und Göring waren sich sofort einig: unmöglich. Einer allein konnte den Brand nicht zu verantworten haben. Van der Lubbe musste Unterstützung von den Kommunisten gehabt haben, die Kommunisten, wer sonst?
Es gab noch eine andere Theorie, die offen auszusprechen allerdings kaum jemand wagte. Von Görings Amtspalais führte ein unterirdischer Rohrleitungsgang in die Heizungszentrale des Reichstags, groß genug, um aufrecht hindurchzugehen. Sollten die Nazis selbst den Reichstag in Brand gesteckt haben, um sich einen Vorwand zu liefern? Aber wofür?
Wer sich diese Frage stellte, musste nicht lange auf Antwort warten. Bereits am Aschermittwoch war sie auf den Titelseiten sämtlicher Zeitungen abgedruckt: Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat.
Die nach nur einem Tag erlassene Notverordnung umfasste sechs Paragrafen, aber weiter als bis zum ersten musste man nicht lesen. Dieser erklärte, dass die Artikel 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 der Verfassung des Deutschen Reiches bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt waren. Mit anderen Worten:
Es sind Beschränkungen der persönlichen Freiheit, des Rechts der freien Meinungsäußerung, einschließlich der Pressefreiheit, Eingriffe in das Brief-, Post-, Telegrafen- und Fernsprechgeheimnis, Unordnungen von Haussuchungen und von Beschlagnahmen sowie Beschränkungen des Eigentums auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten gesetzlichen Grenzen zulässig.
Nur vier Wochen nach Hitlers Machtübernahme hatten sich die Nazis sämtlicher gesetzlicher Fesseln entledigt.
Erich saß hinter einem der halbrunden Fenster des Verbano, als die ersten Wellen dieser Erschütterungen Ascona erreichten. Er blickte auf die Via Borgo hinaus und ließ sich von den Gesprächen der anderen forttragen. Es dunkelte bereits. Sein Italienisch bestand aus briciole – Krümeln –, die andere im Vorbeigehen fallen ließen. Meist war ihm das unangenehm, doch es konnte auch von Vorteil sein, eine Sprache nicht zu verstehen, nur Fetzen aufzuschnappen, eine vorbeiziehende Landschaft aus As und Os und Us.
Fede sprach von allem ein bisschen, sogar Ungarisch. Dabei hatte sie Ascona niemals verlassen, war über dem Gastraum des Verbano zur Welt gekommen. Wenn sie mit Gästen kommunizierte, die nicht aus Ascona stammten, konnten sich in nur einem Satz Worte aus drei oder gar vier Sprachen wiederfinden, gelegentlich erfand sie auch welche hinzu. So wie jetzt, da sie auf den Herrn am Ecktisch einredete, der offenbar nicht aus der Gegend stammte und etwas überfordert wirkte angesichts der auf ihn einprasselnden Worte.
Erich richtete seinen Blick wieder aus dem Fenster. Fede war wirklich ein spezielles Geschöpf. Seit Jahren fragte sich das Dorf, wen sie sich wohl zum Mann nehmen würde. Die Verehrer waren zahlreich. Wer immer es war, durfte sich glücklich schätzen. Und würde starke Nerven brauchen.
Vom Straßenpflaster spritzte der Regen hoch. Zwei Frauen, die Kopftücher eng gebunden, teilten sich einen Schirm und überquerten im Laufschritt den schmalen Platz vor der Poststation.
Erich fragte sich, ob Emil dem Wetter trotzen würde. Sie fanden sich regelmäßig zur selben Zeit im Verbano ein. Nicht täglich, aber seit seiner Ankunft zwei-, dreimal die Woche. Einer Verabredung bedurfte es nicht. Emil ließ einen arbeitsreichen Tag für gewöhnlich mit einem Spaziergang ins Dorf, einer herzlichen Begrüßung von Fede, einem Espresso und einer Zigarette ausklingen. Bei Erich verhielt es sich umgekehrt: Der stand gegen Mittag auf, brachte den Nachmittag mit Korrespondenzen, Telefonaten und dem Versuch herum, nicht zu früh mit dem Trinken anzufangen, und ging anschließend ins Verbano, um sich dort auf die Überarbeitung seines Romans einzustimmen, auf eine Nacht bei elektrischem Licht, Kaminfeuer, seinen Bleistiften, Papier, einem Aschenbecher, einer Flasche Wein, dem Blick auf den See. Herrgott, mehr brauchte es doch nicht. Und doch kam er selten über den guten Vorsatz hinaus, aus einem Espresso wurden zwei, Emil spazierte zurück zu Frau und Heim, und Erich ging hinunter zur Piazza, in die Nelly-Bar, und blieb bis in die Morgenstunden.
Der Roman, Pat, etwas stimmte nicht mehr mit ihm. Zwei Jahre lang hatte er Erich so viel abverlangt. Ihn niederzuschreiben war eine Mühsal gewesen. Nein, es war anders: Die Welt um den Roman herum stimmte nicht mehr. Die Geschichte der drei Kriegskameraden, die trotz allem Bemühen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, ihr Leben nicht wieder in den Griff bekamen. Sie sollte die Leser betreffen, etwas angehen, unmittelbar. Doch wen kümmerte noch, was der Krieg aus den Menschen gemacht hatte? Pat spielte in den Jahren 28/29, und da gehörte die Geschichte auch hin, doch lag das vergangene Jahrzehnt nicht längst in Schutt und Asche? Drängte der Roman noch nach vorne? Oder hatten die vergangenen Monate ihn überflüssig gemacht, bevor er in Druck gehen konnte?
Erich sah Emil die Via heraufkommen, erkannte den ungleichen Gang. Als er näher kam, erkannte Erich auch das Lächeln in dessen Gesicht. Der Regen schien ihm Spaß zu machen.
Erich hatte die Treffen mit seinem Kollegen schätzen gelernt. Erschien Emil einmal nicht, fehlte etwas. Kaum zwei Monate in Ascona, und schon die ersten Rituale.
»Ludovico!« Lachend nahm Fede Emil Schirm und Mantel ab.
Der nickte ihr zu. »Ciao, mia cara.«
Sie tanzte davon, hinter die Theke, wo die neue, chromglänzende Mailänder Kaffeemaschine stand, eine Sensation. Und ein Monstrum. Manche Gäste hatten anfangs Angst vor ihr gehabt. Da sollte Espresso herauskommen? Marianne von Werefkin, la Nonna, wie sie im Dorf genannt wurde, hatte bei der ersten Begegnung mit »la macchina« die Fäuste in die Hüfte gestemmt und ausgerufen: »Vielleicht wird es doch noch was mit unserem Bahnhof – eine eigene Dampflok haben wir schon!«
»Sauwetter«, bemerkte Erich, nachdem Emil sich zu ihm gesetzt hatte.
»Allerdings! Da spürt man, dass man lebt!«
Wenn er in dieser Stimmung war, das hatte Erich inzwischen gelernt, dann hatte Emil einen erfolgreichen Arbeitstag hinter sich. Und er war nur selten nicht in dieser Stimmung.
Seit er mit Goethe – Geschichte eines Menschen seinen nationalen und internationalen Durchbruch gefeiert hatte, waren seiner Schreibwerkstatt mit angsteinflößender Regelmäßigkeit Romanbiografien entsprungen. Rembrandt, Napoleon, Wilhelm II., Bismarck, Jesus, Michelangelo, Lincoln, Schliemann. Jede von ihnen ein Bestseller. Über ein mögliches Scheitern dachte Emil gar nicht nach. Und gerade, weil er nicht darüber nachdachte, schien es ausgeschlossen zu sein.
Das war die andere Seite der Medaille. Erich freute sich über die Treffen mit seinem Kollegen, zugleich fielen sie ihm auf die Nerven. In Emils Gegenwart kam er sich wie ein Stümper vor, ein Maulwurf, blind in der Erde wühlend.
»Wie ist es Ihnen heute ergangen?«, fragte Erich. Besser, sie brachten diesen Teil gleich hinter sich.
»Acht Seiten, mein Lieber«, sagte Emil. »Und acht gute Seiten!«
Fede materialisierte sich neben ihm, setzte Emil einen Caffè Corretto nebst einem Biscotto di Prato vor, klopfte ihm auf die Schulter, zwinkerte Erich zu und ging weiter zu dem Mann am Ecktisch.
Acht Seiten. Seit Erich in vierwöchiger Trance Im Westen nichts Neues zu Papier gebracht hatte, hatte er nie wieder acht Seiten an einem Tag geschrieben, schon gar nicht acht gute.
Ende der Leseprobe