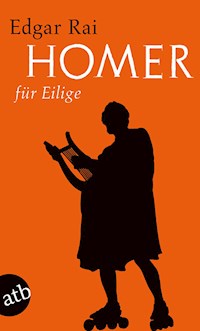11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Amerika hat der Tonfilm längst die Kinos erobert, Deutschland verliert mit seinem Stummfilm den Anschluss. Nun soll die mächtige Ufa das Land wieder an die Spitze führen, koste es, was es wolle. Ein halbes Jahr später hat der geniale Karl Vollmöller fast alles beisammen: eines der modernsten Tonfilmateliers, den gefeierten Oscarpreisträger Emil Jannings, den besten Stoff und den perfekten Regisseur. Sein Film, "Der blaue Engel", wird nicht einfach einer mehr sein, er wird ein neues Zeitalter einläuten, da ist sich Vollmöller sicher. Nur die Hauptdarstellerin fehlt. Die Dietrich könnte passen, als Revuegirl ist sie eine Klasse für sich. Aber sie besitzt doch keinerlei schauspielerisches Talent! Vollmöller würde ihr trotzdem ein Vorsprechen verschaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de/literatur
© Piper Verlag GmbH, München 2019
Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: akg-images / Sammlung Berliner Verlag / Archiv; FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
1
2
3
4
5
6
I
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
II
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
III
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
IV
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1
Berliner Volkszeitung
2. Februar 1917
Der K. u. K. Heeresbericht
Amtlich wird verlautbart:
Außergewöhnlich strenges Winterwetter unterbindet auf der gesamten Ostfront jedwede stärkere Kampftätigkeit. Auch vom italienischen Kriegsschauplatz und aus Albanien ist nichts Wesentliches zu melden.
Der mannshohe Spiegel aus besseren Tagen lehnte an der Wand und schien sie von unten herauf anzublicken. So wirkten ihre Beine noch länger, als sie es ohnehin waren. Marlene legte eine Hand in den Nacken, die andere in die Taille, schob kokett ihr Becken vor. Kindchen, hatte Tante Vally letzten Sommer zu ihr gesagt, diese Beine werden es noch mal weit bringen. Marlene liebte ihren Spiegel, und der Spiegel liebte ihre Beine.
Marlene liebte auch Tante Vally, die immer so fesch gekleidet war und sich so damenhaft zu bewegen wusste. Allein die Art, wie sie ihre Handschuhe auszog, hatte etwas kolossal Mondänes. Eigentlich war sie auch noch nicht alt, gerade einmal dreißig. Selbst Mutter war noch nicht alt, nur zehn Jahre älter als Vally, aber im Gegensatz zur Tante wirkte Josephine verbissen, wie eine alte Hündin, die ihren Knochen verteidigte, obwohl der längst abgenagt war. Dabei war auch Tante Vally bereits verwitwet. Bis auf die ganz alten waren bald alle verwitwet. Man fragte sich, wer an den vielen Fronten überhaupt noch kämpfte.
Marlene versuchte es sitzend, auf der Bettkante, ein Bein ausgestreckt, den Kopf zur Seite gedreht. Nein. Ihre Beine, ja, die waren über jeden Zweifel erhaben, auch an den Schultern gab es wenig auszusetzen. Doch wenn das Licht sie von der Seite traf, so wie jetzt, warf ihre Nase einen grotesken Schatten auf die Wange. Unmöglich sah das aus.
Als Tante Vally ihr sagte, dass ihre Beine es noch weit bringen würden, hatte sie einen ähnlichen Blick auf Marlenes Beine gehabt wie jetzt der Spiegel. Allerdings war Marlene nicht gänzlich nackt gewesen. So weit hatte Tante Vally sich nicht gehen lassen. Immerhin hatte sie erlaubt, dass Marlene sie küsste, während Elisabeth und Mutter unten in der Schlange vor dem Bäcker standen und darauf warteten, ihre Brotkarten gegen etwas Essbares einzutauschen. Das dauerte für gewöhnlich.
Tante Vally zu küssen hatte Marlene heißkalte Schauer über den Rücken laufen lassen, mehr noch als das Küssen selbst aber erregte sie, dass Tante Vally so sehr versuchte, es nicht zu wollen. Dass diese weltgewandte und selbstsichere Frau so hilflos und zugleich berauscht war angesichts von Marlenes leidenschaftlichem Drängen. Bei Vallys nächstem Besuch, das hatte Marlene sich fest vorgenommen, würde sie es nicht bei Küssen belassen. Sie erhob sich und stellte ihr linkes Bein aus. Wohlwollend betrachtete sie die sanfte Erhebung ihres Venushügels. Ihrer Figur hatte der Krieg nicht geschadet. Noch dünner allerdings durfte sie nicht werden. Magere Frauen waren ein Graus.
Die Tür schwang auf. »Um Himmels willen!« Auf halber Höhe – Marlenes Kammer war der Hängeboden über dem Badezimmer, und Josephine stand auf der Treppe – erschien Mutters Kopf. »Was ist das bloß mit dir?«
Marlene sah sie von oben herab an, von Scham keine Spur. Nicht einmal die Knie nahm sie zusammen. Das war es, was Josephine am meisten Sorgen bereitete: diese Schamlosigkeit. Jeder hatte von Zeit zu Zeit unzüchtige Gedanken, Begierden und Sehnsüchte. Aber wenn die sich schon nicht unterdrücken ließen, dann doch bitte im Geheimen!
»Wieso hast du nicht geklopft?«, fragte Marlene.
»Ich habe sehr wohl geklopft, zweimal!«
Endlich lupfte Marlene ihren Büstenhalter vom Spiegel und begann sich anzukleiden. »Und warum hast du geklopft? Geübt hab ich schon – zwei Stunden.«
»Becce ist da. Er möchte dich sprechen.«
Marlene fuhr herum. »Becce? Hier, bei uns?«
»Er steht im Flur wie ein begossener Pudel, offenbar ist er sehr in Eile.« Josephine konnte nicht verhindern, dass ihr Blick auf Marlenes unverhüllte Scham fiel. »Aber einerlei, wie eilig er es haben mag, er wird warten müssen, bis du dir etwas angezogen hast, und zwar etwas mehr als diese neumodische Topflappenkonstruktion.«
Giuseppe Becce stand im Flur mit gewienerten Schuhen, glänzendem Haar, eingefallenen Wangen und sorgenzerfurchter Stirn. Sein Hut klopfte einen unhörbaren Takt gegen den Oberschenkel. Er trug bereits Frack und Fliege für den Abend, fehlte nur der Taktstock. Elisabeth, neugierig wie immer, war aus ihrem Zimmer gekommen, Josephine, in ihrem vergeblichen Bemühen, die Zügel nicht aus der Hand zu geben, wich Marlene nicht von der Seite. Manchmal konnte sie einem direkt leidtun. Ihr Bestreben, den Werdegang ihrer Töchter in vorgezeichnete Bahnen zu lenken, war schon immer ausgeprägt gewesen, aber seit Eduard gestorben war, hatte dieses Bestreben obsessive Züge angenommen.
»Sie müssen sich ein schwarzes Kleid anziehen, Fräulein Dietrich«, sagte Becce unumwunden. »Ich brauche Sie.«
Natürlich witterte Josephine sofort das nächste Liebesdrama im Hause von Losch. Bei Marlene köchelte immer etwas. Dieses Kind war wie ein Wildpferd mit Federboa, das steckte in ihr drin. Vorletztes Jahr, als sie den Sommer in Bad Harzburg verbracht hatten, war es Josephine gelungen, heimlich einen Blick in Marlenes Tagebuch zu werfen. Die Zeilen standen ihr noch immer vor Augen: Ich hab solche Sehnsucht! HH ist 14, aber wie 17. Abküssen im Hausflur. Danach enttäuscht. Nicht einmal die 14-jährigen Buben in Bad Harzburg waren vor Josephines jüngster Tochter sicher. Und woher bitte wusste Marlene, wie die mit siebzehn waren? Und jetzt Becce. Dabei hätte der Dirigent, der ihre Tochter im Geigenspiel unterrichtete, Marlenes Vater sein können! Unwillkürlich strafften sich Josephines Schultern.
»Die zweite Geige ist ausgefallen«, erklärte Becce. »Lörsch und Rosenberg haben beide Fleckfieber.«
Beinahe schien Josephine enttäuscht, dass es keinen Anlass geben sollte, sich zu echauffieren. Seit die Polonaisen vor den Geschäften länger und länger wurden, ging die Kriegspest um. Lörsch und Rosenberg waren nicht die Einzigen aus Becces Orchester, die es getroffen hatte.
Marlene spürte den Boden unter den Füßen nachgeben. »Ich soll in Ihrem Orchester spielen – bei der Premiere?«
»Die zweite Geige können Sie mühelos vom Blatt spielen«, versicherte Becce.
Elisabeth von links, Becce von vorn, Josephine von rechts. Alle sahen Marlene an. Als gebe es da eine Entscheidung zu treffen. Ihre Hand schloss sich um das Medaillon mit der Fotografie des einen, einzigen Menschen, für den sich Marlene ohne zu zögern in jede Gewehrkugel gestürzt hätte, dem sie Autogrammkarten geschickt, Blumen vor die Garderobe gelegt und vor dessen Haus sie heimlich gewartet hatte, ohne zu wissen worauf.
Lange Zeit hatte Josephine versucht, Marlenes Verehrung für die Schauspielerin als vorübergehende Schwärmerei abzutun, doch von Elisabeth wusste sie, dass Marlene sich jeden Film mit der Diva mindestens ein halbes Dutzend Mal ansah, dass sie ihretwegen seit Jahren Woche für Woche ins Marmorhaus am Ku’damm pilgerte und dass ihr Tagebuch vor Liebesschwüren überquoll.
Marlene glühte vor Aufregung.
»Wird sie da sein?«
»Die Porten?«, erwiderte Becce. »Natürlich wird sie da sein. Ist schließlich die Premiere. Jannings ebenfalls, Trautmann, Biebrach ... Alle werden da sein!«
Selbst Josephine wurde ganz ehrfürchtig, als sie die Namen hörte. Da konnte Marlenes Leidenschaft für das Kino ihr noch so sehr ein Dorn im Auge sein. Andererseits: Wer wollte dem Proletariat vorwerfen, sich in Zeiten wie diesen nach Zerstreuung zu sehnen, nach Herzeleid und Liebesglück? Es gab kaum noch etwas zu essen oder zu heizen, die Menschen erfroren und verhungerten in den eigenen vier Wänden, in den Straßen, verbluteten an der Front, und doch eröffnete jede Woche ein neues Kino.
»Dein Kleid!«, rief Marlene.
Elisabeth, die direkt neben ihr stand, wurde von einem Peitschenhieb getroffen. »Was?«
»Dein schwarzes Kleid – das du bei Vatels Beerdigung getragen hast. Schnell!«
Im nächsten Augenblick waren Marlene und ihre Schwester in Elisabeths Zimmer verschwunden. Josephine von Losch stand vor Giuseppe Becce und fühlte sich übergangen.
»Seit wann spielen Frauen in Filmorchestern?«, wollte sie wissen. Vielleicht ließ sich wenigstens ein kleiner Anlass für Protest finden.
»Seit heute«, erwiderte Becce.
»Heißt das, meine Tochter wird als einzige Frau zwischen lauter Männern im Orchestergraben sitzen?«
»Sofern mir nicht noch die Klarinette ausfällt ...«
Josephines Hände rangen miteinander. Einerseits war das Kino ein für gebildete Menschen unwürdiger Zeitvertreib und konnte der Karriere einer klassischen Geigerin kaum zuträglich sein. Andererseits hatte Josephine inzwischen so viel Zeit, Geld und Nerven in die Ausbildung ihrer Tochter investiert – ein halbes Dutzend Lehrer hatte Marlene bereits verschlissen –, da hatte man für eine Gelegenheit wie diese wahrscheinlich dankbar zu sein.
Josephine erhob einen letzten Einspruch, und auch den nur pro forma.
»Ist sie nicht viel zu jung?«
Giuseppe Becce gab die Antwort aller Fragen. »Es ist Krieg, Madame.«
Schwungvoll kehrten die Töchter in den Flur zurück, Marlene präsentierte sich mit einer eleganten Drehung in Elisabeths schwarzem, knöchellangem Kleid.
Josephine hätte sich gerne großmütig gezeigt und mit einem Lächeln ihr Einverständnis signalisiert, wurde aber beim Anblick des Kleides von einer lähmenden Erinnerung an Eduards Beerdigung überrascht. Trotz des kalten Luftzugs im Flur spürte sie plötzlich wieder die Hitze, die im Abteil geherrscht hatte, als sie vergangenen Sommer nach Galizien aufgebrochen war, um ein letztes Mal bei ihrem Mann zu sein – was um alles in der Welt hatten die Deutschen in Kowel zu suchen! –, der sterben würde, sofern er nicht schon gestorben war und dessen einziger Wunsch, seine Frau noch einmal zu sehen, sie in Form eines Telegramms erreicht hatte. Im Lazarett drangen von allen Seiten die Schmerzenslaute der Verletzten auf sie ein, die gesamte Baracke ein einziger, riesiger, qualvoll sterbender Organismus. Sie roch die Fäulnis, das Blut, den Eiter, die todbringenden Infektionen. Eduard war kaum noch bei Bewusstsein. Ob er begriff, dass Josephine in seinen letzten Stunden bei ihm war, würde immer eine Hoffnung bleiben müssen. Die Amputation seines zerfetzten Arms hatte er verweigert, wohl wissend, was das bedeutete, er erlebte es tagein tagaus.
Etwas in ihm hatte sterben wollen. Dieser Gedanke war Josephine geradezu erschienen, als sie auf der Rückfahrt durch ein weiteres menschenleeres Dorf mit zerlöcherten Fassaden und von Fliegen umschwirrten Hundekadavern fuhr. Zum ersten Mal, seit das Telegramm sie erreicht hatte, brach sie in Tränen aus. Es war nicht zu begreifen. Wie grausam musste dieser Krieg sein, wenn nicht einmal die Aussicht darauf, zu deiner Frau und deinen Kindern zurückzukehren, den Wunsch besiegen konnten, diesem sinnlosen Leiden ein Ende zu setzen?
»Mutter?«
Marlene stand vor ihrer Mutter wie ein Rennpferd in der Startbox. Den Glanz in Josephines Augen hielt sie offenbar für einen Ausdruck freudiger Rührung.
»Durchaus präsentabel«, entschied Josephine. Danach hatte sie sich wieder im Griff. In Zeiten wie diesen war kein Platz für Sentimentalitäten. An Marlene vorbei blickte sie den Kapellmeister an. »Ich verlasse mich darauf, dass meine Tochter im Anschluss an die Premiere wieder wohlbehalten hier abgeliefert wird.«
»Ich werde sie persönlich nach Hause geleiten«, versprach Becce, Betonung auf »ö«.
Beinahe hätte Josephine erwidert, dass dieser Umstand wenig zu ihrer Beruhigung beitrage, doch das hätte ihr etwas Gouvernantenhaftes verliehen. Den Rücken Becce zugewandt, rollte Marlene für ihre Mutter mit den Augen.
»Mir ist lediglich daran gelegen, deinen guten Ruf zu wahren«, sagte Josephine streng.
Marlene beugte sich vor, wie um ihrer Mutter die Wange zu küssen. »Dir war noch nie an etwas anderem gelegen, als deinen guten Ruf zu wahren«, flüsterte sie und drückte ihre Hand. »Aber ich danke dir trotzdem.«
Becce hatte bereits eine Verbeugung angedeutet und sich zur Tür gewandt, als Josephine ausrief: »Marlenchen!«
Marlene drehte sich um. Selbst diese einfache Bewegung hatte etwas Aufreizendes an sich, wie Josephine bemerkte. Wenn die einmal aus der Box war, würde sie nicht mehr einzufangen sein.
Im Laufschritt eilte die Mutter in den Salon und kehrte mit dem neuen, glänzenden Geigenkasten zurück. »Wolltest du ohne die spielen?«
2
Becce war mit einem eigenen Automobil vorgefahren, einem grünen Wanderer, allerdings keinem von der Sorte, die man Puppchen nannte, sondern einem neuen, bei dem die Sitze nebeneinander angeordnet waren. Die Messingeinfassungen der Lampen glänzten wie verbotene Wünsche.
Marlene fragte sich, woher Becce das Benzin bekommen hatte. Diesen Winter waren sogar Kartoffeln knapp. Aber Becce hatte Beziehungen, und wer Beziehungen hatte, für den gab es alles. Solche Menschen musste man sich warmhalten, wie Mutter meinte. Der Dirigent schlang seinen Schal um den Hals, zog die Handschuhe aus dem Hut und öffnete Marlene die Tür. Als sie ihren Fuß auf das vereiste Trittbrett setzte und er sie unnötigerweise am Arm fasste, um ihr in den Wagen zu helfen, spürte sie bereits am Druck seiner Finger und durch ihren Mantel hindurch, weshalb er ausgerechnet sie als Ersatz für Lörsch und Rosenberg ausgewählt hatte.
Er stellte sich vor den Wagen, verschwand kurz aus Marlenes Sichtfeld und kurbelte den Motor an. Als er wieder auftauchte, wölbten sich die Enden seines Schnauzbarts nach oben und etwas Jungenhaftes lag in seinem Blick. Männer. Gib ihnen ein Spielzeug, und sie werden zu Kindern, ganz gleich wie alt sie sind. Behände stieg er in den Wagen und schloss die Tür.
»Festhalten, junges Fräulein. Dieses Ungetüm verfügt über nicht weniger als zwanzig Pferdestärken.« Becce hob den Arm, als gebe er einen Einsatz. Offenbar glaubte er, das Automobil dirigieren zu können, jedes der Pferde unter der Haube ein Mitglied seines Orchesters.
Marlene erwiderte sein Lächeln. Sie wusste, es waren nur fünfzehn Pferdestärken – sie kannte sich aus mit Automobilen –, doch es schmeichelte ihr, dass er sie zu beeindrucken versuchte. Sie drückte ihre Hände auf den Geigenkasten, der quer auf ihren Knien lag, während die Reifen sich knirschend durch den Schnee gruben.
Becce fuhr auf dem schnurgeraden Kaiserdamm Richtung Zoologischer Garten. Auf die Straße wagte sich nur noch, wer musste. Oder keinen anderen Ort mehr hatte. Dabei war Freitagnachmittag. Erst vor wenigen Jahren war die Nord-Süd-Achse in die Berliner Landschaft gewalzt worden, jetzt waren die Läden verrammelt und aller Glanz erloschen. Ecke Trautenaustraße steckte ein Dampftriebwagen in einer Schneeverwehung fest, zwei Männer versuchten, die Schienen freizuschaufeln. Als Becce den Wanderer mit geübtem Schwung durch die Wehe steuerte, warfen einige der Fahrgäste Marlene durch die vereisten Scheiben leere Blicke zu. Sie wandte den Kopf ab und sah einen Einbeinigen mit Krücken durch den Schnee stapfen. Er hatte einen Strick um die Hüfte gebunden, an dem er ein Wägelchen hinter sich herzog, in dem er abgebrochene Zweige sammelte.
»Man fragt sich, wie lange er sich noch halten wird«, sagte Becce, der den Einbeinigen ebenfalls gesehen hatte.
»Wer?«
»Der Kaiser.« Der Dirigent sah sie aus seinen schwarzen Augen an. Die waren das Schönste an ihm. Marlene konnte sich darin spiegeln. »Du kannst einen Kriegskredit von zehn Milliarden bewilligen, aber dann darfst du nicht gleichzeitig den kleinen Mann verhungern lassen«, erklärte er. »Ein Volk ohne Kaiser, das geht. Ein Kaiser ohne Volk ...«
Er drückte die Hupe und überholte einen Pferdewagen. Der arbeitsmüde Haflinger, der vor den Wagen gespannt war, stieß in asthmatischen Abständen Dampfwolken aus den Nüstern.
Marlene verstand den Krieg nicht. Er war ein monströses, gefräßiges, bösartiges Wesen, das scheinbar von allen gehasst und das dennoch beständig gefüttert wurde. Als hätten die Herren da oben Angst davor, es könnte sich von ihnen abwenden.
Sie schloss die Augen und sah den Mozartsaal vor sich, die riesigen, elektrisch betriebenen Kronleuchter, die Flügeltüren, das Fresko über dem Mittelbalkon, roch das Holz und den Samt.
Seit Jahren fanden die Porten-Premieren im Mozartsaal statt, mit Becces Orchester als festem Bestandteil. Dutzende Male war Marlene zu diesen Gelegenheiten an den Nollendorfplatz gepilgert, um einen der Stehplätze oberhalb der Seitenbalkone zu ergattern – mit Blick hinunter in den Saal –, und zu beobachten, wie die Zuschauer sich verstohlen die Tränen aus den Augenwinkeln wischten, wenn Henny endlich ihr Glück an der Seite eines ehrenhaften Mannes gefunden hatte. Niemand herrschte über die Emotionen des Publikums so virtuos wie die Porten.
Marlenes Herz entflammte bei jedem Kinobesuch aufs Neue. Henny war so nahbar und zugleich so märchenhaft entrückt. In Marlenes Leben gab es nichts, das sie stärker berührt hätte als die tränenreiche Erfüllung, die sie dort erlebte. In Henny Portens geheimnisvollem Körper versammelte sich die ganze Macht des Kinos, durch sie erlebte Marlene eine Liebe, die einem keine andere Wahl ließ, als an ihr zu leiden, schön, rein und bedingungslos.
Heute würde sie ihrer Henny ganz nah sein, würde von ihrem Platz aus zu ihr emporsehen, wenn die, wie sollte es anders sein, sich einmal mehr mit unnachahmlichem Pathos für die Liebe opferte. Ohne Liebe, das hatte Marlene schon vor Jahren entschieden, ohne das schmerzliche Verlangen des Herzens, waren die Tage, war das ganze Leben öd.
»Hast du geübt?« Offenbar wollte Becce Konversation machen.
»Den ganzen Vormittag.«
»Hättest du nicht in der Schule sein müssen?«
»Die Schulen sind geschlossen«, erklärte Marlene, deren Finger steif gefroren waren. »Weil doch nicht mehr geheizt wird. Wenn es wieder warm wird, soll ich auf die Viktoria-Luisen-Schule gehen. Mutter will, dass ich Abitur mache.«
Sie fuhren an einem Metzger vorbei. In der Auslage erkannte Marlene zwei Eichhörnchen, einen Specht und etwas, das nach Bussard oder Habicht aussah. Sie dachte an den Druck von Becces Fingern, als der ihr in den Wagen geholfen hatte.
»Warum ich?«, fragte sie.
Becce hielt seinen Blick auf die verschneite, nur notdürftig beleuchtete Straße gerichtet. »Wie ich sagte: Lörsch und Rosenberg haben die Kriegspest.«
»Sie hätten Silbermann fragen können, der ist mindestens genauso gut wie ich. Und älter. Und ein Mann.«
Becce tat, als nehme es seine ganze Konzentration in Anspruch, das Lenkrad festzuhalten.
»Also?«, insistierte Marlene. Sie kannte die Antwort, aber sie wollte sie aus Becces Mund hören.
Er sog die Luft ein wie vor einem Fortissimo. Vielleicht machte das seine besondere Qualität aus. Wenn er dirigierte, dann mit jeder Faser seines Körpers. Für Marlene würde Musik niemals das sein, was sie für Becce war.
»Du bringst mich um den Verstand, Mädchen!«
Marlene sah Becce herausfordernd an, der jedoch schien noch immer ganz von dem Festhalten des Lenkrads in Anspruch genommen. Wie er sie Mädchen genannt hatte. Als gehöre sie bestraft. Männer waren wirklich einfach zu durchschauen. Selbst im Moment der Kapitulation mussten sie sich das Gefühl der Überlegenheit erhalten. Und Schuld hatten grundsätzlich die anderen.
»Das bezweifle ich doch sehr«, erwiderte Marlene.
Sie hatten den Nollendorfplatz erreicht. Becce lenkte den Wanderer auf die Freifläche hinter dem Mozartsaal. Er wartete, bis der Motor Ruhe gab, bevor er sagte:
»Lenchen, ich liebe dich.«
Das, befand Marlene, war eines reifen Mannes nun wirklich unwürdig. Becce war fast vierzig, und eine Berühmtheit noch dazu. Da wäre etwas mehr Souveränität angezeigt. Sie mochte die Sicherheit, die sich über das Orchester legte, wenn er dirigierte. Sobald er das Pult betrat, hatte man das Gefühl, es könne nichts mehr schiefgehen. Ihn jetzt neben sich sitzen zu haben wie einen Unterprimaner, diese Verlegenheit ... Das war nicht, wonach Marlene sich sehnte. Wären diese Worte von Henny Portens Lippen geformt worden ...
»Sie begehren mich«, erwiderte Marlene. »Das sind zwei Paar Schuhe.«
Becce legte eine Hand auf ihren Muff. »Sechzehn Jahre und weiß mehr über die Liebe als ich.« Er beugte sich zu ihr hinüber.
»Sie wollen mich jetzt aber nicht küssen – hier draußen im Wagen.«
»Ich muss.«
Marlene stand im Foyer und blickte durch die noch verschlossenen Türen auf den Platz hinaus. In ihrem Rücken bereiteten sich die Garderobieren auf den Ansturm vor, Kleiderbügel klackerten gegeneinander. Ansonsten herrschte gespannte Stille, die Ruhe vor dem Sturm. Messter, Produzent sämtlicher Porten-Filme, war auf die Idee verfallen, die gesamte Fassade des riesigen Gebäudes für die Premiere in gleißendem Licht erstrahlen zu lassen – mitten im schlimmsten Kriegswinter. Und das tat sie jetzt, natürlich, leuchtete im dunklen Häusermeer wie eine Fackel.
Der Mann mit der Fliege und dem Einstecktuch wirkte nach außen hin stets besonnen, ruhig, wurde niemals laut. Doch wenn sich eine Idee einmal in seinem Kopf eingenistet hatte, dann bearbeitete er sie mit stoischer Beharrlichkeit so lange, bis er einen Weg gefunden hatte, sie umzusetzen. Man erzählte sich, dass, wann immer in Messters Atelier in der Blücherstraße ein technisches Problem auftauchte, er seine Freude darüber kaum zu unterdrücken vermochte, denn das bedeutete, dass er sich wieder auf die Suche nach einer neuen Lösung begeben musste. Die Arbeit an einem Problem befriedigte ihn mehr als dessen Lösung.
Jetzt also erstrahlte die Fassade des Mozartsaals, und zwar derart, dass die Reflexion des Lichts ausreichte, ein großzügiges Oval des davor liegenden Platzes verheißungsvoll erglänzen zu lassen. Eine geniale Inszenierung, denn in diesem Oval hatten sich etwa 3000 Menschen eingefunden – der Verkehr musste umgeleitet werden –, die sich die Beine in den Bauch standen, um bei klirrender Kälte das Eintreffen ihrer Stars zu erwarten. Der Rest des Platzes versank in Dunkelheit, es hätten also ebenso gut 100 000 sein können. Die Ehe der Luise Rohrbach war ein Triumph, bevor die erste Filmrolle eingelegt war.
Becce hatte recht behalten, die Partien für die zweite Geige stellten Marlene vor keine nennenswerten Herausforderungen. Einige Passagen kannte sie bereits, die übrigen schienen, auch wenn Marlene sie noch nie gespielt hatte, so vertraut, dass sie nach dem Probedurchlauf mit dem Orchester sicher war, während der Aufführung nirgends ins Stolpern zu geraten.
Als der Saal sich zu füllen begann, wuchs dennoch ihre Nervosität. 1500 Menschen nahmen ihre Plätze ein, redeten, grüßten einander, zeigten vor, was sie hatten oder was ihnen geblieben war. Die zahllosen geflüsterten Stimmen vereinigten sich unter der Saaldecke zu einem Rauschen, sichtbar beinahe, das anschwoll, als die Stars in der von Blumen umkränzten Privatloge Einzug hielten, Trautmann, sich höflich verneigend, Jannings, der gebieterisch die wohlverdiente Huldigung des Publikums entgegennahm, und schließlich Henny Porten, ganz in weiß und dankbar lächelnd, während der Saal die Contenance verlor, das Publikum sich geschlossen erhob und ihr zujubelte, bis sie sich endlich setzen durfte, das Saallicht erlosch, Ruhe einkehrte.
Sie stimmten sich ein, Marlene genoss den Moment, in dem die Instrumente zueinanderfanden, den Moment davor. War der nicht immer der eigentliche Glücksmoment – wenn man wusste, dass es geschehen würde, es aber noch nicht geschehen war? Entfernt hörte sie, wie der Vorhang zur Seite gezogen wurde.
3
»Du warst wunderbar, ganz wunderbar.« Becce nun wieder.
Die Kälte hatte noch einmal angezogen, unmöglich, ihr Widerstand zu leisten. Man konnte sie nur aushalten, in eine Starre verfallen und darauf warten, dass es vorbei war. Sogar das Knirschen des Schnees unter den Rädern war harscher geworden. Marlene antwortete nicht. Sie war noch bei Henny, ganz und gar bei ihrer Henny.
Heute hatte Deutschlands beliebteste Schauspielerin den Olymp ihrer noch jungen Karriere erklommen. Und sie hatte es gespürt, jeder im Saal spürte es – als sie nach der Aufführung auf die Bühne kam und sich verneigte, noch mal und noch mal. Marlene, nur zwei Armlängen entfernt, merkte, wie mit jeder weiteren Verbeugung die Anspannung von der Schauspielerin abfiel, wie Hennys Körper, der vor der Aufführung hart und sehnig gewesen war, weich und biegsam wurde.
»So wie heute habe ich dich noch nie spielen hören.«
Becce konnte es einfach nicht lassen. Und plötzlich sprach er auch noch mit diesem italienischen Akzent, den er längst abgelegt hatte. Marlene hörte ihn, mochte sich aber noch nicht von ihrer Erinnerung verabschieden.
Vergangenes Jahr, nachdem Portens Mann an der Siebenbürger Front gefallen war, hatte Ludendorff, dieser Brummbart, den noch niemals jemand hatte lachen sehen, die Schauspielerin zur größten deutschen Kriegsheldin erklärt. Der Verlust ihres Mannes adelte Henny, mehr noch, es war, als hätte sie durch seinen Tod erst ihre eigentliche Bestimmung gefunden: die sich tapfer aufopfernde Frau. Und heute, an der Seite von Jannings, hatte sie sich tapferer und standhafter gezeigt als jemals zuvor.
Vor der Premiere war viel darüber spekuliert worden, ob Porten dieser Urgewalt, die auf der Leinwand wie im Leben die Verdrängung eines Riesendampfers entfaltete, standhalten könnte. Schließlich war es das erste Mal, dass sie und Jannings gemeinsam vor der Kamera standen. Gut, es gab auch noch Trautmann, aber an den würde sich nach dem Film ohnehin kaum einer erinnern. Und Jannings, in der Rolle des jähzornigen, groben und rücksichtslosen Fabrikanten Rohrbach, zürnte und schäumte und walzte durch diesen Film, dass man fürchten musste, er würde nicht nur den Mann erschlagen, der im Film seine Frau ansprach, sondern alle, die es wagten, neben ihm einen Platz auf der Leinwand für sich in Anspruch zu nehmen.
Und was machte Henny Porten? Sie hielt Jannings nicht nur stand, sie nahm seinen Groll und seine wütende Verzweiflung und verwandelte sie in das Leid aller zu Unrecht misshandelten Ehefrauen. Ihre moralische Überlegenheit war unanfechtbar. Neben Jannings wurde ihr Leid noch tragischer, das dargebrachte Opfer noch größer und das schließlich errungene Glück noch wertvoller.
»Ich engagiere dich hiermit als festes Ensemblemitglied. Was sagst du?«
Wenn sie ihm nicht bald ein paar Brocken hinwarf, würde Becce noch vor lauter Verzweiflung um ihre Hand anhalten. Nein, würde er nicht. Er war schon verheiratet, ein Glück. Der Wanderer arbeitete sich den Kaiserdamm hinunter, gleich würde ihr Haus ins Blickfeld kommen.
»Das wäre wunderbar«, erwiderte Marlene.
»Ich wusste, du würdest ›Ja‹ sagen!«
Jetzt klang er wirklich, als hätte er ihr einen Antrag gemacht. »Das mit dem ›Ja-Sagen‹ hat bereits Ihre Frau übernommen«, erinnerte sie ihn. »Ich spiele lediglich die zweite Geige in Ihrem Orchester.«
Umständlich steuerte Becce den Wagen dahin, wo er in etwa den Straßenrand vermutete. Seit Tagen waren Schülerbrigaden damit beschäftigt, die Bürgersteige von Eisplatten zu befreien und Schnee aufzutürmen. So waren zwar Hunderte provisorischer Rodelbahnen entstanden, aber der Straßenverlauf war vielerorts nur noch an den Laternenpfählen auszumachen.
»Ich bin verrückt nach dir!« Was sollte man von einem Vollblutmusiker mit italienischen Wurzeln anderes erwarten?
»Ich fürchte, Sie verwechseln da schon wieder etwas«, parierte Marlene. »Und versuchen Sie erst gar nicht, mich zu küssen. Sie können sicher sein, dass meine Mutter in diesem Moment am Fenster steht und uns beobachtet – nicht hinaufsehen! Benehmen Sie sich doch nicht so tölpelhaft.«
Becce wusste offenbar nicht, wie es jetzt weitergehen sollte. Und offenbar hatte er vergessen, dass der Wanderer nur über eine Tür verfügte – auf der Fahrerseite.
»Ich werde nicht über Sie hinwegsteigen«, sagte Marlene.
Das brachte ihn in die Gegenwart zurück. »Selbstverständlich.« Eilig stieg er aus. »Wertes Fräulein ...« Er reichte ihr die Hand und verneigte sich so tief, dass es auch vom dritten Stock aus zu sehen sein musste.
Natürlich gab sich Josephine den Anschein, nicht am Fenster gestanden und die Rückkehr ihrer Tochter erwartet zu haben. Ein kurzer Blickwechsel mit ihrer Schwester allerdings reichte Marlene aus, um bestätigt zu finden, was sie ohnehin wusste.
»Irgendwelche interessanten Beobachtungen gemacht?«, fragte sie im Vorbeigehen.
Josephine strich sich den Rock glatt und wandte sich ab, ohne zu antworten. Marlene stieg in ihre Kammer hinauf.
Allein auf dem Bett, die Tür geschlossen und den Geigenkasten neben sich, erlaubte sie den emotionalen Erschütterungen des Tages, ungestört von ihr Besitz zu ergreifen. Was war das nur, das sie mit solcher Macht zu Henny Porten hinzog? War es Liebe? Fühlte sich so wahre Liebe an – unbezwingbar? Wonach genau sehnte sich ihr Herz eigentlich? Sie wollte so sein wie Henny – rein, überlegen, unantastbar, makellos – und ahnte doch, dass sie all das niemals sein würde.
Sie öffnete den mit rotem Samt gefütterten Koffer. 2100 Reichsmark hatte Josephine sich die Geige kosten lassen, hatte nach Vaters Tod sämtliche Ersparnisse in ihre Jüngste »investiert«, wie sie das nannte. Seither ließ sie kaum eine Gelegenheit verstreichen, Marlene in Erinnerung zu rufen, wie unendlich groß das Opfer gewesen war, das sie ihrer Tochter mitten im Krieg dargebracht hatte. Die Rechnung war einfach: Die Geige war zugleich Versprechen und Verpflichtung, und je höher der Preis, desto größer die Verpflichtung, an die Marlene sich gebunden fühlen sollte. Folglich hatte Josephine das Instrument gar nicht teuer genug sein können.
Was Josephine gerne unerwähnt ließ, war die Tatsache, dass mit Kriegsbeginn die Mark vom Goldstandard entkoppelt und durch die Papiermark ersetzt worden war. Auch die in Umlauf befindlichen Münzen waren nicht länger aus Gold, Silber oder Kupfer, sondern aus Eisen, Zink und Aluminium. Die Inflation, die lange wie ein unsichtbarer Bazillus durch die Straßen gestrichen war, hatte längst für alle sichtbar die Wirtschaft infiziert. Keiner konnte mehr sagen, was die Reichsmark morgen noch wert sein würde. Eine gute Geige war also auch ohne die damit erkaufte Verpflichtung eine sinnvolle Investition.
»Für diese Geige wirst du mir noch dein Leben lang dankbar sein.« So, wie Josephine diesen Satz aussprach, war er zur Hälfte Anklage, zur Hälfte Drohung. Und um zu unterstreichen, dass er genau das tatsächlich war, fügte sie gerne hinzu: »Auch wenn ich wohl kaum das Glück haben werde, diese Dankbarkeit noch zu erleben.«
Insgeheim hatte Marlene längst andere Pläne. Sie war eine passable Geigerin, aber sie war keine gute Musikerin. Die Musik erfüllte sie nicht. Nicht auf dieselbe Art, wie ihre Liebe zu Henny es tat. Auf Musik hätte sie verzichten können, ungern zwar und mit dem Gefühl, einen Verlust zu erleiden. Am Ende aber eben doch. Auf das wilde Schlagen des Herzens niemals. Leider war das Vorhaben, Marlene zu einer klassischen Konzertgeigerin ausbilden zu lassen, für ihre Mutter zu einer fixen Idee geworden. Sie zu desillusionieren, würde unweigerlich endlose Vorträge und Diskussionen nach sich ziehen. Warum also früher als notwendig?
Ein Gedanke, den sie zuvor erfolgreich verscheucht hatte, nahm erneut Gestalt an: Liebte sie Henny so sehr, weil die so rein war, wie Marlene selbst es niemals sein würde? Weinte Marlene in jedem ihrer Filme, weil etwas in ihr schon lange ahnte, dass ihr das glückliche Finale niemals beschieden sein würde, weil ihr Herz niemals aufhören würde, sich zu sehnen? Hatte sie immer nur um ihrer selbst willen geweint? Auch, und das trat ihr jetzt klar vor Augen, würde Marlene niemals die dankbare Rolle des Opfers zufallen. Frauen hatten sich aufzuopfern, für was auch immer, am besten für einen Mann. Das war nicht sie, würde es niemals sein. Henny Porten würde für Marlene immer unerreichbar bleiben. Sicher konnten Entsagung und Hingabe einer Frau Erfüllung geben und sollten es vielleicht auch. Nicht aber ihr.
4
Berliner Tagblatt
3. Februar 1917
Endgültige Einführung des Einheitsbrotes
In der gestrigen Vollsitzung der Groß-Berliner Brotkartengemeinschaft trat die Versammlung den Beschlüssen über die Herstellung des Großgebäcks von 1000 Gramm und von 1900 Gramm unter Verbot des kleineren Gebäcks mit allen gegen eine Stimme bei.
Ferner billigte die Versammlung einstimmig das Kuchenbackverbot. Der Tag der Ausgabe des Einheitsbrotes ist noch nicht festgelegt, doch sind die Vorbereitungen hierfür bereits im Gange.
Die Tage, an denen kein Wagen vorfuhr, um Henny für die anstehenden Aufnahmen in Messters Studio abzuholen, waren gefährlich. Dann rückten die Wände ihres Hauses enger zusammen, und eine ungute Schwere befiel sie. Gegen die musste sie angehen. Ihr gesamtes Leben – ihre Kindheit und ihre Jugend hindurch, ungebrochen – war sie stets ein positiver Mensch gewesen. Jetzt zu erleben, dass es Tage gab, an denen sie nicht aufstehen mochte, besser noch nicht einmal aufgewacht wäre, an denen ihr jede Zuversicht abhandengekommen war, machte ihr Angst.
Nach einem Erfolg wie dem gestrigen war es besonders schlimm. Sie erwachte mit bleischweren Gliedern, ihre Gelenke schmerzten, ohne dass sie sie bewegte. Rheuma? Unsinn. Oder doch? Sie wusste, dass es kein Rheuma war. Rheuma verging nicht. Aber was, wenn auch diese Schwere nicht verging? Was, wenn von nun an jeder neue Tag so sein würde wie dieser, wenn jede noch so kleine Bewegung eine Überwindung bedeutete, ihr Schmerzen bereitete? Henny öffnete die Augen, sah dicke Flocken am Fenster vorbeiwehen. An anderen Tagen hätte sie das schön gefunden, hätte sich daran erfreut. Doch diese Tage waren vergangen. Nicht heute. Nicht morgen. Vielleicht nie mehr. Sie schloss die Augen, drehte dem Fenster den Rücken zu.
Gestern Abend hatte sie noch einmal vom großen Glück kosten dürfen. Einen Applaus wie nach der Premiere von Die Ehe der Louise Rohrbach hatte sie noch nie erlebt. Und der Applaus hatte vor allem ihr gegolten. Das hatte auch Jannings gemerkt, der neben ihr gestanden und es dennoch fertiggebracht hatte, in der Mitte zu stehen – jeder Raum schien sich nach ihm auszurichten –, der große Jannings, wie er sich hundertmal verbeugte, als klatschten sie alle ausschließlich für ihn, dabei wurde für Henny anhaltender und lauter applaudiert. Der arme Mann. Sein Ego war wie dieses neue Woolworth-Building in New York – so groß, dass man die Spitze kaum sah. Aber eben auch leicht zu erschüttern. Henny hatte Jannings Verunsicherung gespürt, als würde die U-Bahn unter ihren Füßen hindurchfahren, hatte ihm kollegial die Hand gedrückt. Vielleicht hatte es das für ihn nur noch schlimmer gemacht.
Sie hörte Otto durchs Haus geistern, verfolgte mit geschlossenen Augen, wie er sich im Erdgeschoss durch die Räume bewegte. Jetzt gerade war er im Esszimmer, deckte den Tisch für ihr Frühstück ein – mit seinem linken Arm. Der rechte lag noch in Siebenbürgen. Curt und er waren Freunde gewesen, im Schützengraben. Jetzt hatte sie einen einarmigen Diener, dem sie ständig zu Hilfe eilen wollte. Unmöglich, ihm zu kündigen.
Gleich würde die Haustür gehen, und Otto würde die Zeitung und frische Schrippen holen, mit besten Grüßen des Bäckermeisters. Henny hatte ihm ausrichten lassen, sie wolle keine Sonderbehandlung – fürs Fußvolk gab es auch nur noch das Einheitsbrot –, doch der Bäcker hatte Otto mit der Antwort zurückgeschickt, das möge sie ihm bitte nicht antun, keine Brötchen mehr für sie backen zu dürfen.
Neben dem Tisch, an dem zwölf Menschen Platz gehabt hätten und der doch nur für einen gedeckt war, würde der Korb mit der Feldpost auf sie warten. Seit Curt gefallen war, schienen die ledigen Soldaten an der Front alle eine Autogrammkarte von Henny bei sich tragen zu wollen, bevor sie sich in den Kugelhagel stürzten. Als ließe es sich mit ihr an der Seite leichter sterben. Sie musste Otto bitten, den Korb wegzuräumen, sonst bekäme sie heute keinen Bissen hinunter, und das wiederum würde ihr die missbilligenden Blicke des Dieners eintragen. Wie kochte man ein Ei und schreckte es ab – mit einem Arm? Was machte das mit einem Mann, als Held in den Krieg zu ziehen und dann heimzukehren und sich jeden Morgen von seiner Mutter das Hemd zuknöpfen lassen zu müssen? Henny drehte sich auf die linke Seite zurück, sah das Fenster, den von Schneeflocken umwirbelten Kirchturm und schloss die Augen.
Der Kaffeeduft zog durchs Haus und hinauf bis ins Schlafzimmer. Otto hatte eingeheizt. Schwerfällig richtete Henny sich auf, bewegte eins nach dem anderen die Beine aus dem Bett, spürte den angewärmten Teppich unter den Fußsohlen. Sie musste aufstehen. Seit drei Stunden werkelte Otto im Haus herum, war über vereiste Bürgersteige balanciert, hatte sich die Kälte aus den Schuhen gestampft – einzig und allein zu dem Zweck, dass, wenn Henny aufstand, alles perfekt war. Henny streifte sich den Morgenmantel über. Sie konnte nicht liegen bleiben, das konnte sie Otto unmöglich antun. Gut, dass er da war. Er sorgte dafür, dass sie funktionierte.
Der erste Brief, den Henny aus dem Korb zog, war aus einem Lazarett bei Lemberg. Ein Fähnrich namens Hartmann vererbte ihr, auf dem Sterbebett liegend, sein Eisernes Kreuz zweiter Klasse. Ihre Hände seien der schönste Ort, den er sich dafür vorstellen könne. Sie brauche ihm nicht zu antworten. Bis dieser Brief sie erreiche, »bin ich nicht länger«. Henny blickte auf die frischen Schrippen, das Frühstücksei, das glänzende Silberbesteck, den Porzellanteller.
Vorsichtig bettete sie das Kreuz in die Schachtel zurück, schloss den Deckel. »Bitte, Otto – würde es Ihnen etwas ausmachen, den Korb aus dem Esszimmer zu entfernen. Ich ...«
»Ich bitte Sie, Frau Porten. Das müssen Sie doch nicht erklären.«
Der geflochtene Korb war zu groß, um ihn unter den Arm zu klemmen oder mit einer Hand zu tragen. Otto zog ihn möglichst lautlos hinter sich her aus dem Raum. Dann stand er wieder neben ihr und fingerte an seiner imaginären Koppeltasche herum, die er schon längst nicht mehr trug.
»Ja, Otto?«
Er nahm Haltung an. »Sie ist wieder da, Frau Porten.«
Henny schloss die Augen. »Seit wann?«
»Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, gnädige Frau. Als ich ging, die Schrippen zu holen, stand sie bereits unter ihrem Baum.«
Jetzt war es schon ihr Baum. »Bei dieser Kälte? Und steht sie immer noch da?«
Otto trat seitlich ans Fenster und blickte zur Kirche hinüber. »Ja.«
»Warum macht sie das nur?«
»Ich weiß es nicht, gnädige Frau. Aber sie hat, glaube ich, einen Geigenkasten bei sich.«
Henny stand auf und schob sich ebenfalls an das Fenster heran.
Unter einem der Bäume, die die Seiten der Matthäikirche säumten, stand eine gertenschlanke, ungewöhnlich groß gewachsene Frau, die zugleich stolz und verloren wirkte, selbstsicher und schüchtern. Und jung! Henny betrachtete sie interessiert. Das war keine, vor der man Angst haben musste. Und doch standen sie hier, Otto und sie, und versteckten sich hinter dem Vorhang.
»Otto, würden Sie bitte gehen und die junge Dame fragen, was ihr Ansinnen ist – sofern sie eines hat.«
»Sehr wohl, gnädige Frau.«
Von ihrem Platz hinter dem Vorhang aus verfolgte Henny, wie ihr Diener mit tastenden Schritten die Straße überquerte und auf die junge Frau zusteuerte, die ihren Geigenkasten an den Körper gedrückt hielt, wie um ihn zu wärmen. Als Otto sie ansprach, wechselte sie Stand- und Spielbein, schien plötzlich größer als er. Fasziniert beobachtete Henny die Szene. Einen Körper zu lesen, war ihr Beruf, ihre Leidenschaft. Beim Film war jede noch so kleine Geste wichtig, jeder Ausdruck, jede Haltung. Und die Haltung dieser Frau hatte etwas ... Herausforderndes? Als Otto zurückkam und mit seinen Schuhen eine zweite Spur in den frischen Schnee drückte, klemmte etwas unter seiner Achsel, das Henny nicht identifizieren konnte. Die Frau stand unverändert, wartend.
Henny ging ihrem Diener entgegen, im Flur trafen sie aufeinander. Er zog das Päckchen unter seinem Arm hervor.
»Sie hat Ihnen ein Kissen bestickt.«
Mit einem seidigen Faden hatte die junge Frau ein großes rotes Herz auf das Kissen gestickt, in dessen Mitte schräg und schwungvoll »für Henny Porten« zu lesen war. Henny befühlte die Stickerei. Sehr gleichmäßig. Da hatte sich jemand viel Mühe gegeben.
»Reizend, finden Sie nicht?«
Otto schien von der Begegnung mit der jungen Frau noch ganz in Anspruch genommen zu sein. »Sicher.«
»Hat sie sonst noch etwas gesagt?«
»Nur, ob ich Ihnen wohl das Kissen überbringen würde.«
»Sonst nichts?«
»Sonst nichts.«
Henny kehrte ins Esszimmer zurück. Da stand sie, noch immer, unter ihrem Baum, und wärmte ihren Geigenkasten.
»Die Ärmste muss ja schon halb erfroren sein.« Henny wandte sich an ihren Diener. »Warum gehen Sie nicht und bitten sie herein? Ich decke derweil einen zweiten Teller auf.«
5
»Das warst du?«
Henny war zum Du übergegangen, ohne es zu bemerken. Plötzlich sah sie Marlene mit anderen Augen. Bereits während der Vorführung gestern Abend hatte sie die aufrecht sitzende Geigerin mit den auffallend ebenmäßigen Gesichtszügen in Becces Orchester bemerkt.
»Die andern haben Fleckfieber«, erklärte Marlene. »Aber künftig soll ich festes Ensemblemitglied sein.«
Wie froh Henny war, die junge Frau von der Straße geholt zu haben! Alleine ihr beim Essen zuzusehen machte, dass man selbst Appetit bekam. Noch vor einer Stunde hätte Henny keinen Bissen schlucken können. Jetzt saß sie hier mit dieser unbefangenen Frau, einem halben Mädchen noch, lachte sogar, und beschmierte ihr Brötchen lustvoll mit Marmelade. Otto hatte inzwischen eine zweite Fuhre Schrippen vom Bäcker geholt und schien sehr zufrieden mit seiner Herrin.
»Und hat dir der Film gefallen?«
»Na, viel hab ich ja nicht sehen können, weil ich doch mit Geigen beschäftigt war.« Marlene klang überraschend ernst. »Am Ende war ich aber trotzdem verliebt.«
»Das verstehe ich gut. Der Trautmann hat so etwas ganz und gar Galantes, nicht?«
»Nicht in Trautmann.«
Marlene blickte Henny auf eine Weise an, die keinen Zweifel daran ließ, wer die Person war, in die sie sich letzte Nacht verliebt hatte.
Henny lachte hell auf. Wie über einen Scherz. Die junge Frau war so erfrischend direkt. Marlene hob den Kopf. Sie hatte wirklich ein erstaunlich ebenmäßiges Gesicht, wie gemalt.
»Sie waren wunderbar«, sagte sie, »ganz wunderbar. Noch besser als in Gefangene Seele oder der Ruf der Liebe.«
»Dann kennst du also noch mehr Filme von mir?«
»Ich kenne alle Ihre Filme.« Marlene blickte Henny offen ins Gesicht. Dann schlug sie die Beine übereinander, anschließend nahm sie die Schultern zurück. Eines nach dem anderen. Anschließend sagte sie: »Ich habe mich schon oft verliebt.«
Henny versuchte, das Gespräch in sicheres Fahrwasser zu steuern. Marlene war so offensiv. Und hübsch! Meine Güte, Henny war tatsächlich ... verwirrt.
»Ach so? Und für Männer schwärmst du wohl gar nicht?«
»Doch, schon, aber es sind ja kaum noch welche übrig. Nur noch die alten und kranken und die« – sie vergewisserte sich, dass Otto außer Hörweite war, bevor sie flüsterte – »einarmigen. Die feschen sind entweder an der Front oder schon tot.«
»Sag, wie alt bist du?«
»Sechzehn.«
Sechzehn. Und kannte alle ihre Filme. Und hatte sich schon wer weiß wie oft in sie verliebt. Und die feschen Männer waren entweder an der Front oder schon tot. Was sollte man von so einer halten?
Henny lehnte sich zurück, betrachtete ihr Gegenüber, schlug ebenfalls ein Bein über das andere. Dabei glitten die Schöße ihres Morgenmantels auseinander und gaben den Blick auf ihre Oberschenkel frei. Marlene bemerkte es, und damit Henny nicht entging, dass sie es bemerkte, kräuselte sie ihre Lippen. Herausfordernd war das Wort, das Henny in den Sinn kam. Sie beeilte sich, den entflohenen Stoff wieder über ihre Knie zu schieben. Warum hatte sie das getan – die Beine so keck übereinandergeschlagen –, wo sie doch nur ihr Nachthemd unter dem Mantel trug? Sie hatte richtiggehend Herzklopfen.
Otto brachte unaufgefordert zwei Gläser mit frisch gepresstem Orangensaft. Was der alles auftrieb.
Marlene traute ihren Augen nicht.
Henny führte aufmunternd ihr Glas an die Lippen. »Trink ruhig.«
Marlene trank, als fürchtete sie, ein anderer könne ihr sonst den Saft wegtrinken. Etwas daran kam Henny bekannt vor. Dann wusste sie es:
»Hast du ältere Geschwister?«, fragte sie.
»So etwas hab ich seit Jahren nicht getrunken.« Marlene stellte das Glas ab. »Ja, eine Schwester. Elisabeth.«
»Genau wie ich!«
»Ja, aber meine ist nur ein Jahr älter.«
Die war ja wirklich bestens informiert. Henny spürte eine Schieflage. Vor ihr saß dieses rätselhafte Wesen, sie selbst jedoch schien für Marlene ein offenes Buch zu sein oder eher noch: ein ausgelesenes.
»Na, wenn du so viel über mich weißt, dann weißt du ja sicher auch, dass meine Schwester Rosa ebenfalls Schauspielerin ist.«
Marlene zog beiläufig die Schultern hoch. »Ich hab sie in Die Wäscher-Resl gesehen und in« – sie zupfte an der Unterlippe – »Die nicht lieben dürfen. Sie ist gut, aber ...«
»Ja?«
»Na, verliebt hab ich mich nicht.«
»Interessant. Und kannst du mir auch sagen, was an ihr so anders ist?«
»In Ihrer Schwester ist nicht dieselbe Sehnsucht. Bei Rosa geht es um Ja oder Nein, bei Ihnen geht es um Leben oder Tod.«
Henny spürte, wie ihr die Röte in die Wangen stieg, ein heißes Prickeln in den Handflächen und ... ein Spannen in den Brüsten? Grundgütiger! Vor zwei Stunden hatte sie nicht gewusst, wie sie aus dem Bett kommen, geschweige denn, die Stufen ins Erdgeschoss hinabsteigen sollte.
Marlene hatte sich vorgebeugt und strich mit ihren Violinenfingern über die Borte von Hennys cremefarbenem Morgenmantel. Durch ihr Kleid zeichneten sich die Wirbel ihres Rückgrats ab. So verletzlich. Henny wäre gerne mit dem Finger daran entlanggefahren.
»Der ist schön«, sagte Marlene, als sie sich wieder aufrichtete. Zwei Locken waren ihr in die Stirn gefallen.
»Ja?«, erwiderte Henny. Als sei ihr das selbst noch nie aufgefallen. »Curt hat ihn mir letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt«, erklärte sie. »Mein Mann. Mein verstorbener Mann.«
»Ich weiß. Er ist gefallen, nicht? An der Front. Komisch, dass man das so sagt – gefallen. Als wäre man gestolpert. Bei mir war’s der Vater.«
Sie blickten gemeinsam zum selben Fenster hinüber. Noch immer wirbelten Flocken vorüber. Seit einiger Zeit war der Tod allgegenwärtig. An jeder zweiten Straßenecke traf man auf ihn. Erst denkt man, daran wirst du dich nie gewöhnen, aber so unbegreiflich er ist: Man gewöhnt sich sogar an den Tod.
»Mutter ist noch einmal an die Front gefahren, als es zu Ende ging«, erzählte Marlene. »Sie hatte eine Sondergenehmigung bekommen. Mit uns darüber gesprochen hat sie nicht. Aber als sie zurückkam, waren ihre Haare plötzlich grau.«
Mittlerweile wusste Henny, was zu tun war, wenn der Tod das Haus betrat. Man musste ihm einen Ort zuweisen, streng sein mit ihm, ihn domestizieren. Ließ man ihm seinen Willen, dann verpestete er das ganze Haus und nahm einem die Luft zum Atmen.
Sie wandte sich ihrem Gast zu: »Sag: Wie kommt es, dass du deine Geige dabeihast? Musst du heute noch proben?«
»Schon, aber erst am Nachmittag. Ich ... Ich weiß nicht.«
»Möchtest du mir vielleicht etwas vorspielen?«
»Soll ich?«
»Kalt«, diagnostizierte Marlene, als sie die Geige aus dem Koffer nahm. Die Wirbel ließen sich nur unwillig drehen. »Die mag noch nicht.«
Sie war vom Tisch zurückgetreten, was sie seltsamerweise noch größer machte. Henny wandte sich ihr zu.
Marlene setzte den Bogen an: »Also dann.«
Den ersten lang gezogenen Tönen haftete etwas Sprödes an, das Instrument gab sie nur unwillig preis. Nach einigen Takten jedoch schien die Geige ihren Widerstand aufzugeben. Was danach geschah, hätte Henny selbst nur schwer in Worte fassen können. Da saß sie in ihrem goldbestickten Morgenmantel an der polierten Tafel und ließ sich etwas vorspielen, so wie man es von einer Tante und ihrer Nichte erwarten würde. Doch hier war nach wenigen Minuten klar: Das lief andersherum. Nicht Marlene war nervös, sondern Henny. Sie wusste nicht, was sie erwartet hatte, auf jeden Fall aber nicht diese ... Tiefe! Natürlich hätte sie sich denken müssen, dass Marlene mehr als ein paar Volksweisen fiedeln konnte, schließlich hatte sie gestern in Becces Orchester gesessen. Aber dass diese zarten, langgliedrigen Finger der schlanken Geige derart kraftvolle Töne entlocken würden, das hatte sie nicht geahnt. Der gesamte Raum füllte sich mit Musik, warm und traurig, fremd und vertraut.
Henny wurde von einem Unbehagen erfasst. Sie fühlte sich zunehmend ausgeliefert. Ohnmacht war ein Zustand, gegen den sie sich instinktiv zur Wehr setzte. Wer sich in diesen Zeiten gehen ließ, die Kontrolle verlor, der fand sich schnell an einem Ort wieder, der keine Türen mehr hatte. Sie wusste das, kannte den Ort, hatte ihn erlebt. Sie blickte auf ihre Hände herab, die nervös über das Kissen strichen, das Marlene ihr bestickt hatte und das jetzt in ihrem Schoß lag, und dann spürte sie, wie etwas in ihr nachgab, wie ihr Rückgrat zum Resonanzboden wurde. Sämtliche Härchen an ihren Unterarmen richteten sich auf, und dann, plötzlich, war ein dunkler Fleck auf dem Kissen, ein Tropfen, dann noch einer und noch einer.
Hennys Blick verschleierte sich. Was da gerade mit ihr geschah, hatte darauf gewartet zu geschehen – seit Curt gestorben war, hatte es darauf gewartet zu geschehen –, und jetzt löste es sich und strömte aus ihr heraus, schmerzhaft und unsagbar traurig, wie es nur der Abschied von einem geliebten Menschen sein konnte, aber eben auch kostbar und glänzend und wunderschön.
Undeutlich nahm sie wahr, wie in Marlenes Rücken die Tür aufschwang und Otto erschien. Den gesamten Türrahmen füllte er aus, stocksteif. Und wie Henny ihn so in der Tür stehen sah, eine alte knorrige Eiche, bereit, gefällt zu werden, um irgendetwas Neuem Platz zu machen, da wurde ihr klar, dass er sich nachts, allein in seiner Kammer, wünschte, die Granate hätte nicht nur seinen Arm erwischt.
»Sie bluten ja!«
Mitten im Spiel hatte Marlene den Bogen abgesetzt.
Henny war zu konsterniert für eine brauchbare Antwort: »Ich blute?«
»Da!« Marlene deutete mit dem Bogen auf ihren Morgenmantel.
Henny blickte an sich herab. Tatsächlich, da war Blut. Sie nahm die Serviette und presste sie sich unter die Nase.
»Und Sie weinen!«, stellte Marlene fest.
»Ist nicht schlimm«, versicherte Henny, »ist nicht schlimm, wirklich.«
Sie senkte den Blick und musste lachen, während ihr die Tränen über die Wangen kullerten. Und dann musste sie lachen, weil es so absurd war, dass sie lachen musste, wo sie doch Nasenbluten hatte und die Tränen nicht aufhören wollten zu fließen.
Sie streckte eine Hand nach Marlene aus, die Finger gespreizt, den Kopf gesenkt, und dann sah sie Marlene auf sich zukommen, die Geige neben ihrem Oberschenkel, und dann spürte sie, wie kühle Finger nach ihrer Hand griffen.
Endlich, es war wirklich zu albern, gelang es ihr, Marlene ins Gesicht zu sehen. »Deine Hände sind ja immer noch ganz kalt.«
»Geht schon«, sagte Marlene.
»Otto, wären Sie so freundlich, oben im Bad den Boiler einzuheizen? Dieses junge Fräulein hier benötigt dringend ein heißes Bad.«
6
Ein blauer Frauenkopf mit halb geschlossenen Lidern und Blumen im Haar, schön und geheimnisvoll. Luxus. Mit dem Zeigefinger fuhr Marlene die Ränder des Reliefs entlang, erforschte das Gesicht, strich über den Nasenrücken und hinterließ eine glänzende Spur auf den beschlagenen Lippen. Jede einzelne der Bordürenfliesen war ein Kunstwerk. Ebenso die Badewanne mit den geschwungenen Goldfüßen, die auf einer Seite erhöht war, um sich besser anlehnen zu können. Und die zwei Armaturen hatte, eine für kaltes und eine für heißes Wasser.
Otto hatte sich alle erdenkliche Mühe gegeben, den Raum in eine Dampfsauna zu verwandeln. Dabei musste dieses Badezimmer unmöglich zu heizen sein – bei dieser Größe.
»Gefällt sie dir?«, fragte Henny.
Sie hatte aus einer Ansammlung von Flakons einen ausgewählt und goss etwas von dessen Inhalt ins Badewasser. Nur Augenblicke später breitete sich der Duft von Rosenblüten aus. Zu diesem Zeitpunkt konnte Marlene es noch nicht wissen, doch von nun an und für den Rest ihres Lebens sollte dieser Geruch ihr mehr als jeder andere das Gefühl von Luxus vermitteln.
Sie wandte sich von dem blauen Frauenkopf ab und betrachtete die über die Wanne gebeugte Henny. »Das ist Jugendstil, nicht?«
Die Schauspielerin richtete sich auf. »Findest du sie schön?«, wiederholte sie ihre Frage.
Nicht halb so schön wie dich, dachte Marlene, sagte es aber nicht. Nicht, weil sie sich geschämt hätte, sondern weil es überflüssig war. Henny konnte sehen, was Marlene dachte.
Marlenes Blick ruhte weiter auf der berühmten Schauspielerin. Niemals hätte sie gedacht, dass sie ihrem Idol einmal so nah sein würde, doch jetzt, da sich der Traum erfüllt hatte, würde sie an ihm festhalten, so lange es ging.
»Wer würde sie nicht schön finden?«, antwortete sie und ließ offen, ob damit die Fliesen oder Henny gemeint waren.
»Es war Curts Idee«, sagte Henny, »ein Badezimmer ganz in Jugendstil.«
Sie stellte den Flakon auf den Servierwagen zurück – ein ganzer Servierwagen eigens für Badezusätze! – und wollte Marlene das Badezimmer überlassen, als die vor dem Spiegel stehend ihr Kleid über die Schultern und zu Boden gleiten ließ. Prüfend betrachtete Marlene ihre verschwommenen Umrisse im beschlagenen Glas, brachte schwungvoll ihre Haare in Unordnung, knöpfte ihren Büstenhalter auf und ließ ihn neben ihr Kleid auf die Fliesen fallen.
Marlene nahm die Hände über Kopf, drehte Henny brüsk den Oberkörper zu und lachte sie an. Ertappt. Henny war zu überrascht, um irgendetwas anderes zu tun, als ihrem Blick standzuhalten.
»Im Spiegel sehe ich aus wie von einem Impressionisten gemalt, finden Sie nicht?«
Als sei es das Normalste von der Welt, sich in fremden Badezimmern zu entkleiden und in Anwesenheit der Hausherrin im Spiegel zu betrachten. Noch immer lächelnd streifte Marlene ihren Schlüpfer ab. Henny stockte der Atem. Wenn sie jetzt das Bad verließ, würde es nach Flucht aussehen. Marlene drehte sich ihr zu, präsentierte sich ihr, stemmte eine Hand in die Hüfte, schob das Becken vor.
»Gefalle ich Ihnen?«
Henny rang nach Luft. Wen hatte sie sich da ins Haus geholt? Eine Lilith mit einem Engelsgesicht? Eine Artemis mit Geige und Bogen statt Pfeilen und Köcher?
»Du solltest schleunigst in die Wanne steigen, junges Fräulein«, erwiderte sie. »Wir wollen doch nicht, dass Otto den Badeofen ganz umsonst eingeheizt hat.«
»Bleiben Sie nicht?«, hatte Marlene gefragt, als Henny das Bad verlassen wollte.
Also war sie geblieben, umschleiert von Wasserdampf und Rosenduft, und hatte sich auf den samtbezogenen Hocker neben der Tür gesetzt. Mehr Abstand konnte sie zwischen sich und die Badewanne nicht bringen, außer sie wäre durch die Tür geschlüpft. Doch das hatte sie offenbar auch nicht gewollt, sonst säße sie jetzt nicht immer noch hier. Sorgsam achtete Henny darauf, die Flügel ihres Morgenmantels nicht wieder über die Knie rutschen zu lassen.
»Was war das«, fragte sie, »das du vorhin gespielt hast?«
Marlene streckte ein Bein in die Luft, seifte es ein. »Das Adagio aus Torellis Violinkonzert. Ist eins von meinen Lieblingsstücken.«
»Ich wünschte, ich könnte das auch – ein Instrument spielen.«
»Wünschen Sie sich das lieber nicht. Jeden Tag üben, stundenlang ... Meine Mama hat sich in den Kopf gesetzt, mich zur Konzertgeigerin ausbilden zu lassen.«
»Das klingt, als wollten deine Mutter und du nicht dasselbe.«
Marlene hob ihr Bein noch weiter an, streckte es über den Kopf, bis die Zehen zur Decke zeigten. »Mama weiß es noch nicht«, sagte sie, »aber ich werde auch Schauspielerin – so wie Sie. Nein, nicht wie Sie. Anders.«
»Täusch dich nicht. Auch die Schauspielerei erfordert viel Arbeit, wie jede Kunst. Mit deinen Beinen solltest du ohnehin lieber Tänzerin werden. Die hören ja gar nicht mehr auf.«
»Meine Tante meint auch, dass meine Beine es noch weit bringen werden. Ich werde aber trotzdem Schauspielerin.«
»Obwohl du so schön geigen kannst?«
»Hat Ihnen der Torelli denn gefallen?«
»Sehr. Aber er hat auch etwas ...«
Marlenes Bein tauchte wieder ins Wasser ein. »Ich weiß. Deshalb spiele ich das Adagio auch am liebsten, wenn ich Sehnsucht hab.«
»Und was passiert dann?«
»Dann habe ich noch mehr Sehnsucht.«
»Dann hattest du vorhin also Sehnsucht.«
»Nein, aber da hab ich es ja auch nicht für mich gespielt.«
Statt zu antworten, strich Henny mit dem Daumen über die dunklen Flecken, die das Blut auf ihrem Morgenmantel hinterlassen hatte. Die Leichtigkeit, die sich gerade zwischen ihnen eingestellt hatte, versank.
»Es ist wegen Ihrem Mann, nicht?«, sagte Marlene. Und weil Henny nur weiter an den Flecken rieb: »Wegen Curt.«
Plötzlich also sprachen sie über Curt. Das war Henny zwar nicht angenehm, aber auch nicht unangenehm. Sieben Monate war es her, dass sie die Nachricht von seinem Tod erhalten hatte, und in der gesamten Zeit war sie mit ihrer Trauer allein geblieben, hatte sie ignoriert, oder, wie es ihr jetzt schien, sie vernachlässigt. Konnte man das – seine Trauer vernachlässigen? Nicht einmal mit Rosa hatte sie wirklich darüber gesprochen, hatte nur immer weiter Filme gedreht, wie besessen.
»Wir hatten es gut zusammen, weißt du«, erklärte Henny. »Wir hatten es wirklich gut. Es war nur so furchtbar kurz.« Ihr Blick verlor sich zwischen den kompliziert gemusterten Bodenfliesen. »Wir waren ja kaum verheiratet, bevor der Krieg ausbrach. Und Curtchen ist dann auch gleich eingezogen worden. Wie waren wir alle so stolz auf diesen Krieg. Als wäre er eine Belohnung.«
»Er war schön, nicht?«, sagt Marlene, während sie ihren Brüsten dabei zusah, wie sie von Wasser umspült wurden.
Henny löste ihren Blick von den Fliesen. »Findest du?«
»Oh ja! Er hatte etwas kolossal Weltgewandtes. Als wäre er überall zu Hause.«
»Das stimmt.«
Henny sah ihren Mann, wie sie ihn lange nicht gesehen hatte, aufrecht und glücklich, im Hintergrund den Golf von Neapel – mit diesem italienischen Hut, den er sich damals gekauft hatte, und angewinkelten Armen. Als blicke er auf sein Reich, im Scherz natürlich, aber ein bisschen auch im Ernst.
»Bevor der Krieg kam, haben wir eine Filmreise unternommen, das ganze Team. Wir sind raus aus dem Studio und die Mittelmeerküste entlanggefahren, bis hinunter nach Sizilien, haben überall die Kamera aufgebaut.«
»Ich weiß«, sagte Marlene, »Das Tal des Traumes.«
Die Essenz hatte das Badewasser weich gemacht, wie Milch. Marlene ließ heißes Wasser nachlaufen. Verstohlen betrachtete sie ihre Hand, wie sie unter der Oberfläche ihre Leiste entlangfuhr, um langsam zwischen ihre Schenkel zu gleiten. Wie um sich zu testen, jagte Marlene sich ein, zwei kleine Stromstöße durch den Körper. Das war aufregend. Schon die geringste Berührung brachte ihre Schenkel zum Zittern.
»Langsam frage ich mich«, erwiderte Henny, »ob es etwas gibt, das du nicht über mich weißt.«
Marlene wandte ihr den Kopf zu, während sie heimlich einen weiteren Stromstoß durch ihren Körper schickte, einen, der sie heimlich nach Luft schnappen und kleine Wellen den Wannenrand entlanglaufen ließ.
»Ich weiß nicht, wovon Sie träumen«, sagte sie.
»Wie beruhigend«, lachte Henny. »Dann habe ich wenigstens noch ein Geheimnis vor dir. Curtchen jedenfalls, der wusste immer, was zu tun war. Wenn es ein Problem gab, wir nicht weiter kamen ... Curt war da. ›Henny, Liebes‹, sagte er dann zu mir, ›das kriegen wir schon hin.‹ Und er kriegte es hin. Im Zweifelsfall gab er vor, ein amerikanischer Geschäftsmann zu sein. Er sprach fließend Englisch, weißt du, weil er zwei Jahre in Amerika gelebt hatte. Und im Handumdrehen hatten alle ein Hotelzimmer.« Ihr Blick wandte sich nach innen. »Er war ein guter Mann, mein Curt. Ein durch und durch guter Mann.«
Ein guter Mann, dachte Marlene, war im Grunde genauso langweilig wie ein gutbürgerlicher Haushalt. Und während sie im heißen Wasser lag, saß Henny auf dem Hocker neben der Tür, tragisch und dadurch noch begehrenswerter, als Marlene sie je im Film erlebt hatte. Sie erhöhte den Druck ihrer Hand, indem sie die Oberschenkel zusammenpresste. Jede Faser ihres Körpers war bereit. Ein anderes Wort fiel ihr nicht ein. Ich bin so sehr bereit.
Plötzlich stand sie in der Wanne, aufrecht, überragte Henny um einen guten Kopf, von ihren Brüsten tropfte Wasser, und ihr Körper glühte. Dampf stieg auf. »Darf ich mir Ihren Morgenmantel leihen?«
Vor Schreck fuhr Henny vom Hocker auf. »Gute Güte, du bist aber wirklich ...«
»Ich bin was?«, fragte Marlene.
Impulsiv, dachte Henny. Und das war ihre geringste Sorge. »Aber ich hab nur mein Nachthemd darunter an.«
»Ich verrate es auch keinem.«
Unschlüssig stand Henny neben der Tür. »Warte, ich hab ...« Sie schlüpfte aus dem Bad, ließ die Tür angelehnt und kehrte kurz darauf mit einem zusammengefalteten Morgenmantel über dem Arm zurück. Marlene war aus der Wanne gestiegen und dampfte und tropfte und glühte noch immer. Ihre Nacktheit schien sie gar nicht wahrzunehmen.
Henny hielt ihr den Arm hin. »Der ist von ...«
Erst in diesem Moment schien ihr klar zu werden, dass sie im Begriff war, das Andenken ihres verstorbenen Ehemanns zu entehren. Sie wollte die Hand zurückziehen, doch Marlene hatte den Mantel bereits von ihrem Arm gelupft und strich über die geschwungenen Initialen.
»Curt«, stellte sie fest, entfaltete ihn und schlüpfte hinein, machte aber keinerlei Anstalten, den Gürtel zu schließen. »Wie für mich gemacht«, stellte sie fest.
Henny stand vor ihr, hilflos und unerlöst. Beinahe hätte Marlene Mitleid mit ihr gehabt. Blind griff sie nach Hennys Gürtel, der sich praktisch von alleine löste.
Ihre Lippen kräuselten sich zu einem Lächeln. »Die sind ja ganz hart.«
Entsetzt blickte Henny an sich herab, sah ihre Brustwarzen, die sich durch den Stoff abzeichneten, und verfolgte stumm, wie Marlenes Hand ihre Brust umschloss. Das geschieht nicht, dachte sie, doch Marlene saß bereits auf dem Wannenrand, hatte die Schöße von Curts Morgenmantel zur Seite geschoben und zog sie zu sich heran.
Henny spürte das Blut durch ihren Körper pulsieren, hörte sich selbst atmen. Lass das nicht zu, dachte sie, aber die Worte schienen an eine andere gerichtet zu sein, und wer auch immer das sein mochte – sie war nicht hier.
Marlenes geöffnete Lippen erschienen vor ihrem Gesicht, voll und rot. Henny schmeckte ihren Atem.
»Was machst du denn?«
Marlene lächelte nur.
»Du bist doch noch ein halbes Kind!«, protestierte Henny.
»Nicht mit dir«, flüsterte Marlene, und bevor Henny noch etwas erwidern konnte, hatten sich Marlenes Lippen bereits auf ihre gelegt und nahmen sie in Besitz.