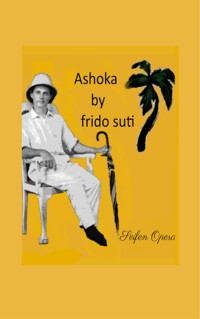
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Historische Biografie einer Kunstmalerin erzählt von ihrem Ehemann.
Das E-Book Ashoka wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Abenteuer, Mit Velo in Frankreich, Indien Schweiz, Seifen Opera, Gurkha
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 60
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hommage
an Vreni Camenzind
Wir sitzen im Theater. Der Vorhang öffnet sich. Auf der Bühne wird eine Seifenoper gespielt.
Ein erwachsener Mann liegt auf dem Bett und weint. Es ist später Nachmittag. In der Wohnung herrscht Chaos, sehr chaotisch. Kleider liegen verstreut auf dem Boden. Die rote Reisetasche, eine Damentasche, ist weg. Als er das erkennt, fällt der Groschen. Seine Frau hat ihn verlassen. Das Geld ist weg und die Lugger Pistole ist nicht mehr da, wo sie sein sollte, hinter dem Toilettenkasten neben der Eingangstür.
Kurz vor Sonnenuntergang, in der Abenddämmerung, fährt er mit dem Fahrrad ins Dorf. Im Restaurant „Maria Halle“ an der Kreuzung trifft er den Tuk-Tuk Fahrer Bernhard. Der erzählt, dass er mit der Faktoryfrau kurz nach der Mittagspause zum Flughafen gefahren sei und sie dort abgesetzt habe. Dem weinenden Mann geht der Gedanke durch den Kopf, ob sie wohl in der Lage wäre, die Pistole am Sicherheits-Gate vorbei zu schmuggeln. Die Frau hat Charme, denkt er, sie ist in Indien, sie ist geistesgegenwärtig, sie kann frech auftreten. Ihr gelingen solche Sachen. Gedanken haben Nachfolger. Für ihn steht fest, diese Frau muss er sich zurückholen.
Schon einmal hat sie ihm gedroht, wieder in die Schweiz zurückzukehren, wenn er nicht mit der Freundschaft dieses Mordbuben Ashoka aufhören würde. Sie halte das nicht mehr aus. Sein Verhältnis mit diesem Kerl belaste sie zu stark.
Derweil heult er wie ein Schlosshund. Es zerreißt ihm das Herz, dass ihn seine Frau verlassen hat.
Um sieben Uhr, als es dunkel wird, kommt Bob, ein befreundeter Bekannter, der im Dorf ein Stück weiter die Küste hinunter wohnt und oft bei ihm zu Gast ist. Eigentlich ein Amerikaner oder Engländer, man weiß es nicht so genau. Es heißt, er arbeite für den Geheimdienst. In Wirklichkeit arbeitet er für die örtliche Polizei als Detektiv. Er ist einer derjenigen, die nach der Unabhängigkeit Indiens weiterhin als Beamte im Staatsdienst blieben. Er kommt gerne her, obschon das für ihn riskant ist, denn da wird heimlich Schnaps gebrannt. Und sein Lieblingsgetränk ist Gin Tonic.
Aus dem Norden Indiens kommen getrocknete
Wacholderzweige. Der da auf dem Bett liegt und weint ist chemischer Laborgehilfe und kann aus Palmwein, den sie hier Todi nennen und billig verkaufen, klaren Alkohol destillieren.
Um Gin zu machen, muss er Wacholderduft mit Tonic Water mischen das er in einem Absorber kühlt, einem Kühlschrank, der keinen Strom braucht, sondern einen
Bunsenbrenner. Darum veräppeln ihn gewisse deutsche
Touristen als Pfahlbauer. Weil sein Kühlschrank mit einer Kerzenflamme betrieben wird und nicht mit elektrischem Strom.
Nachbar Bob kennt hier jeder. Er ist 1,90 m groß, war früher blond, jetzt grau meliert und hat eine sportliche Figur, schlank, ohne Bauch.
Er packt den Weinenden am Hemdkragen, zieht ihn hoch. Väterlich sagt er: „Nimm dich zusammen! Was ist in dich gefahren, Meyer?“ Es sprudelt aus Meyer heraus. Er berichtet, dass ihn seine Frau verlassen hat.
„Warum?“
„Sie glaubt, Ashoka sei ein Mörder. Sie will ihn nicht mehr im Haus sehen.“
„Du holst jetzt die Gin-Flasche und zwei Gläser Tonicwater“, befiehlt Bob. Er schiebt Meyers Beine über den Bettrand und für sich selbst zieht er einen Stuhl heran. «Gehen wir die Sache durch“ meint er: „erzähl mal. Es gefällt mir nicht, dass du flennst!“
Meyer erzählt die Geschichte seiner Jugend. Warum er nach Indien gekommen ist und, wie er meint, eine glückliche Ehe geführt zu haben.
Liebes Publikum, wir blenden zurück nach Basel, um die Wurzeln der Geschichte zu beleuchten. Basel schloss sich 1501 den Schweizern an, nachdem sie den deutschen Kaiser Maximilian in Dornach besiegten, weil sie den „gemeinen Pfennig“ nicht bezahlen wollten. Eine neue Steuer, die Kaiser Max eingeführt hatte. In diesem Krieg war Basel neutral geblieben.
Dann, zwei Jahre später, schloss sich Basel den Eidgenossen doch an, was vielen Baslern nicht gefiel. Aber Handels Interessen zwang die Bevölkerung am Rheinknie, auf die nördlichen Nachbarn Rücksicht zu nehmen.
Wir haben unseren Helden weinend auf dem Bett liegend kennengelernt. Wir können jetzt ruhig seinen Namen erwähnen. Er heißt Felix Meyer, geboren kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, an der Grenze zu Lörrach. Damals an das „Dritte Reich“ grenzend, in jener Zeit eine schwierige Situation für die Eidgenossen. Was sich dort einst abspielte, nennt man heute beschönigend „Geschichte.»
Uns beschäftigt jedoch eher der Charakter von Felix Meyer, dessen Mutter früh verstarb, sodass sich der Vater des Jungen allein um die Erziehung des Sohnes kümmern musste.
Felix war kein Kirchenlicht in der Schule, und vom Lehrer einmal befragt, was er über die Schweizer Geschichte zu erzählen wisse, war ihm nur eingefallen, dass sich 1501 die Eidgenossen vom Deutschen Reich trennten und sich den Kuhschweizern anschlossen.
Als der Sohn zwanzig Jahre alt wird, hat er keine höhere Schule besucht und auch noch keine Berufslehre abgeschlossen. Der Vater spürt, sein Sohn will kein spießbürgerliches Leben führen, er bezeichnet die Kultur solcher Leute als „Fudi“. Für ihn sind das „Fudibürger“. Anstatt zu arbeiten, treibt er sich in Kneipen herum, sehr zum Verdruss des Vaters. Oft gesehener Gast ist dieser Felix in einer Gaststätte, die als Frauenhaus bekannt ist. Die Kneipe liegt in Sichtweite eines Theaters, es ist das grüne Glas.
Vater Meyer ist von Beruf Wildhüter und arbeitet als Beamter bei der Stadt Basel, wobei er sich hauptsächlich um Ungeziefer und Krankheiten der Tiere auf den Höfen am Stadtrand kümmern muss. In erster Linie ist dies die Maul- und Klauenseuche und andere Krankheiten. Zu seinem Job gehört auch die Vernichtung von Maikäfern und Engerlingen in Wald und Feld, wenn es zu viele davon gibt. Und die Hauswanzen, die niemand liebt.
Vater Meyer ziert sich nicht, während seiner Arbeitszeit Pilze zu suchen, obschon der Sohn meint, dies sei nicht gestattet. Denn für den Sohn ist der Vater nicht über alle moralischen Zweifel erhaben. Er raucht, er trinkt, er ist ein Quartalssäufer in den Augen des Sohnes. Doch den Vater Meyer quält kein schlechtes Gewissen. Im Gegenteil, er denkt: „Schlechtes Gewissen ist ein gutes Ruhekissen.“
Zu seinen Aufgaben gehört die Beobachtung der Maikäfer Population. Darüber hinaus kennt er über hundert Schädlinge. An vorderster Front die blutsaugenden Flöhe und Wanzen. Vertreiben kann er sie professionell mit der chemischen Keule. Um nur zwei zu nennen sind das Stäubemittel oder Fraßgifte auf der Basis von Arsen, Schwefel und Kupfer. Treffend heißt eines der Präparate: „Satanat“, erhältlich nur gegen Giftschein. In diesem Umfeld wächst Felix Meyer auf. Er begleitet den Vater bei seiner Tätigkeit und langsam fließt das Wissen der Wildhüter auch in seinen Kopf. Ihm gefällt die Suche nach Speisepilzen.
Die werden nach Hause mitgenommen, getrocknet und als Vorrat für die Winterzeit in Büchsen aufbewahrt. Er kennt nicht nur Pfifferlinge und Steinpilze, sondern eine Reihe giftiger Pilze, die ein Pilzsammler kennen sollte, so der Vater.
Im grünen Glas verkehren Grafiker, Gestalter, Texter, Reinzeichner. Die Hälfte davon sind Frauen. Unter der anderen Hälfte gibt es Machos, die finden, den Frauen würde es gut anstehen, den Männern jeweils bei Arbeitsbeginn eine Tasse Kaffee neben den PC zu stellen.
Jedoch ein Teil der Frauen sind der Ansicht, sie seien Werbe Mitarbeiterinnen und keine Kaffebringerinnen. Der Chef einer Werbeagentur im Quartier, Wirz sein Name, hat das widerwillig schlucken müssen.





























