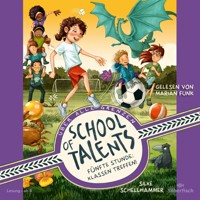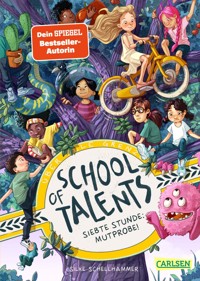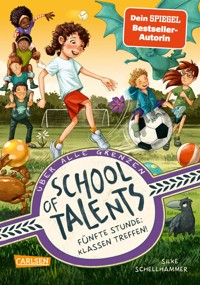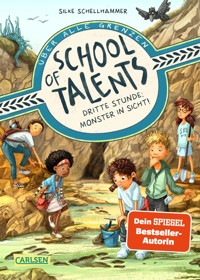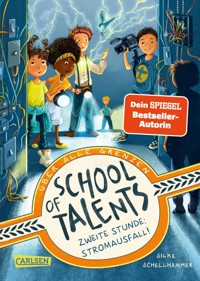12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Komm mit nach Askendor! Ein Mädchen, das sich plötzlich in einer virtuellen Fantasywelt wiederfindet. Ein Furcht einflößender Thronfolger, der um sein Reich kämpft. Und unerwartete Gefahren in beiden Welten … Florentine interessiert sich nicht für Online-Rollenspiele – eigentlich. Doch dann gelangt sie durch ein Portal in die virtuelle Welt Askendor und begegnet dem überraschend menschlichen Thronfolger Thosse von Baar. Plötzlich wird ihr Leben von einer tödlichen Rebellion und ihren Gefühlen für diesen unbeugsamen Krieger komplett auf den Kopf gestellt und sie muss sich entscheiden, was ihr wirklich wichtig ist. - Ein Fantasyabenteuer, in dem Fantasy und Realität faszinierend miteinander verwoben sind - Für Fans von ›Vortex‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Ein Mädchen, neugierig auf das Leben. Ein Thronfolger, der um sein Reich kämpft. Und ein Portal, das beide Welten verbindet …
Florentine interessiert sich nicht für Online-Rollenspiele – eigentlich. Doch dann gelangt sie durch ein Portal in die virtuelle Welt Askendor und begegnet dem überraschend menschlichen Thronfolger Thosse von Baar. Plötzlich wird ihr Leben von einer tödlichen Rebellion und ihren Gefühlen für diesen unbeugsamen Krieger komplett auf den Kopf gestellt und sie muss sich entscheiden, was ihr wirklich wichtig ist.
Der fesselnde Pageturner von Bestsellerautorin Silke Schellhammer
SILKE SCHELLHAMMER
ASKENDOR
SPIEL MIT DER WIRKLICHKEIT
Roman
Für meine Paula, die eigentlich Fatima heißt.
1
Gedankenverloren kaute ich am Ende des Kugelschreibers. Mein Blick wanderte aus dem Fenster und verfing sich in den Schneeflocken, die langsam durch die Dämmerung des Spätnachmittags tänzelten. Nicht träumen – konzentrier dich!
Na super, das Einpeitschprogramm meiner Mutter zeigte Wirkung. Sogar wenn sie nicht da war, konnte ich ihre Ermahnungen hören.
Was ich von meinem Leben erwartete? Die viel dringendere Frage schien mir, welches bescheuerte Vögelchen unserer Deutschlehrerin ihre Aufsatzthemen zwitscherte. Missmutig starrte ich auf das Blatt. »Was erwartest du von deinem Leben?« Ja, da stand es. Schwarz auf weiß. Hatte ich da überhaupt ein Mitspracherecht? Meine Mutter sollte diesen Aufsatz schreiben. Oder mein Trainer. Meine Klavierlehrerin oder meine Lehrer. Mir fielen spontan jede Menge Menschen ein, die große Pläne für mich und mein Leben hatten. Ich gehörte nicht dazu. Doch ich spürte ihre Bemühungen, etwas Bedeutendes aus mir zu machen. Etwas, worauf sie stolz sein konnten. Immerhin waren sie nicht wählerisch. Klaviervirtuosin, Olympiateilnehmerin, Nobelpreisträgerin, alles vertretbare Ziele. Unumgänglich waren jedenfalls Bestnoten, freie Studienplatzwahl, Abschluss summa cum laude. »Durchschnittlich« schien für meine Mutter ein Schimpfwort zu sein. So direkt sagte sie mir das natürlich nicht. Doch ich konnte es ihr ansehen. Die Panik, mit der sie an mir rumpolierte, als wäre ich ein Rohdiamant. Immer mit der Angst im Nacken, ich könnte mich als einfacher Kieselstein entpuppen. Einer, wie es Millionen gab. Dabei sollte ich Spuren hinterlassen. Und mal ehrlich, wir redeten hier nicht von Schleifspuren in der Geschichte oder ungelenken Tapsern auf meinem Lebensweg, sondern von richtungsweisenden Schritten in eine bessere Zukunft. Sowohl für mich als auch für die gesamte Menschheit. Ganz ohne jeden Zweifel: Weniger würde meine Mutter nicht akzeptieren. So viel zu den Erwartungen an mein Leben.
Mein Brainstorming wurde durch das dumpfe Brummen meines Handys unterbrochen. Außenweltkontakt. Rettung. Die beste Möglichkeit, diesem quälenden Aufsatz zu entkommen, war, mit meiner Freundin Paula darüber zu lästern. Kaum hatte ich das Gespräch angenommen, schrillte mir mehrstimmiges Kindergeschrei entgegen. Paula hatte drei kleinere Geschwister. Bei ihr zu Hause war es laut, die Türklinken klebten und man musste aufpassen, wo man sich hinsetzte. Ich liebte es, dort zu sein.
»Flo, Flo …«, hörte ich Paula im Hintergrund.
Da ich wusste, dass sie das Telefon noch nicht einmal am Ohr hatte, sparte ich mir eine Antwort. Wir waren noch in Phase 1 des Anrufs: Geschwister bedrohen – Privatsphäre schaffen.
»Ben, wenn du mich jetzt nicht telefonieren lässt, kannst du dir jemand anderen suchen, der ›Mopsi, das traurige Riesenungeheuer‹ mit dir liest.«
Eine Durchhalteparole für mich: »Flo, Flo, ich bin gleich da …«
Neues von der Chaosfront: »Lilly, nimm sofort den Klebestift aus dem Mund. Fiiiiiinn, beweg deinen faulen Hintern hierher, aber pronto!«
Dann plötzlich Ruhe. Mein Ohr näherte sich vorsichtig dem Hörer.
»Flo?!« Ihre Stimme klang jetzt ganz nah und verzweifelt.
»Bin da«, beruhigte ich sie und unterdrückte ein Lachen.
»Ich schwör dir, die sind ganz friedlich, bis ich mein Telefon in die Hand nehme, dann drehen sie alle durch!«, jammerte sie.
»Ist schon in Ordnung. Was gibt’s?«
»Hausaufgabendesaster!«, raunte ihre Stimme sensationslüstern.
»Echt jetzt? In Deutsch?« Das klang gar nicht nach Paula. Irgendwie hatte ich angenommen, dass sie problemlos den weiteren Verlauf ihres Lebens unter Missachtung realistischer Chancen in den schillerndsten Farben darstellen konnte.
»Ich doch nicht!«, widersprach sie auch sofort. »Der kleine Freak scheitert am großen Cäsar.« Dechiffriert: Finn hatte Schwierigkeiten mit seinen Lateinhausaufgaben. Heute war Montag und Paulas Mutter arbeitete außer Haus.
»Soll ich vorbeikommen?«
»Jaaaa!«
Nachdem ich meiner Mutter glaubhaft versichern konnte, dass alle Hausaufgaben gemacht wären, ließ sie mich trotz noch nicht gelernter Vokabeln für zwei Stunden aus dem Haus. Wahrscheinlich sah sie in Finns Lateinnotfall eine willkommene Wiederholung der Unterrichtsinhalte der ersten Jahre.
Inzwischen hatte es aufgehört zu schneien. Die Luft war trocken und bitterkalt. Ich lauschte dem knarzenden Geräusch, das jeden meiner Schritte begleitete. Die Straßen der Wohnsiedlung, in der ich mit meinen Eltern wohnte, waren menschenleer. Doch in den meisten Häusern waren mehrere Fenster erhellt. Fast alle unsere Nachbarn kannte ich, seit ich auf der Welt war. Paula wohnte mit ihrer Familie zwei Parallelstraßen weiter. Ich hatte sie in der Grundschule getroffen. Damals gab es nur sie und ihren Bruder Finn. Bereits kurz nach dessen Geburt entdeckte Paula, dass ihr Bedarf an Geschwistern mehr als gedeckt war. Sie wäre das geborene Einzelkind. Und obwohl sie nie müde wurde, dies zu betonen, setzten ihre Eltern noch Ben und Lilly ins Nest und machten sie zur dreifachen großen Schwester. Laut Paula das Schlimmste, was einem im Leben passieren konnte. Mir fallen da zwar spontan ein paar Alternativen ein, aber was weiß ich schon! Einzelkind!
Paulas Familie hatte meiner Meinung nach gigantischen Unterhaltungswert. Von Chaos sprach man dort erst, wenn die entlaufenen Springmäuse sich wie wild im Haus vermehrten. Oder wenn Ben mit einer selbst installierten Wasserleitung den gesamten oberen Stock flutete. Der alltägliche Wahnsinn von Kleinkindern, die sich in Schubladen übergaben, Knallfröschen, die in geschlossenen Marmeladegläsern gezündet wurden, oder der geheimen Wurmfarm unterm Bett wurde meist nur schulterzuckend registriert. Und genauso wie Paula die Ruhe in meinem Elternhaus schätzte, liebte ich das schrille Durcheinander in ihrem.
»Super, dass du da bist. Das Genie schmollt oben in seinem Zimmer!«, begrüßte mich Paula, während sie Lilly im Schwitzkasten hinter sich herzog und ihr mit einem Waschlappen energisch das Gesicht abwischte.
Ich schälte mich aus meiner Jacke. Die Stimmung schien angespannt zu sein.
Paula bugsierte Lilly unsanft ins Badezimmer. »Wenn ich sage ›Wasch dir das Gesicht‹, dann hat das auch ohne Springflut stattzufinden, comprende, amiga?« Lilly begann zu zetern.
Leise schlich ich die Treppe rauf.
Als ich die Tür zu Finns Zimmer öffnete, bekam ich eine volle Dröhnung seiner pubertierenden Drüsen. Vielleicht sollte sich mal jemand dranmachen, das Gen, das für die gleichzeitige Entwicklung von Schweißfüßen und der Abneigung gegen Frischluft zuständig war, zu isolieren. Das wäre ein wirklich hilfreicher Beitrag der Wissenschaft. Finn lümmelte, vom Gestank vollkommen unbeeindruckt, vor seinem Computer. Er ignorierte mich und meinen Erstickungsanfall.
Wenn es jemanden gab, der für mich einem kleinen Bruder nahekam, so war es Finn. Ich war praktisch mit ihm aufgewachsen. Aber ohne die ganzen Streitereien und geschwisterlichen Rivalitäten. Unser meist entspannter Umgang miteinander war für Paula vollkommen unerklärlich. Zehn Minuten mit ihm im selben Raum und sie fing an, über mittelalterliche Foltermethoden und qualvolle Tötungsrituale nachzudenken.
»Hey, ich habe gehört, hier gibt es ein paar Probleme?«, versuchte ich mich in sein Bewusstsein zu schieben.
Umsonst, er drosch unvermindert auf seine Tastatur ein. Das schnelle Klicken bestätigte, was ich ohnehin schon wusste: Nur noch der müffelnde Teil seiner Person war hier. Sein Geist war längst in einem Paralleluniversum verschwunden. Askendor, ein imaginäres Land voller Gnome, Drachen, Krieger und Magier. Laut Paula war das Finns wahre Heimat. Dort gab es keine Schulpflicht, die ihn zwang, an so etwas wie einem sozialen Leben teilzunehmen. Keine nervige Familie, keine Verpflichtungen, kein Druck, und ich schätze, auch kein Latein.
»Hallo? Erde an intergalaktische Außenstelle …!«, unternahm ich einen weiteren Versuch.
»Moment noch«, flüsterte er, ohne den Blick vom Bildschirm zu lösen.
Hurra, wir hatten Kontakt. Zumindest kurzzeitig.
Dann hämmerte er wie ein Bekloppter gleichzeitig auf mehrere Tasten ein und knurrte: »Nimm das, du Opfer!«
Im nächsten Moment entspannte er sich plötzlich und sank erschöpft in seinen Stuhl zurück. Herzinfarkt mit zwölf? Oder doch nur das Ende eines Kampfes? Zwei tiefe Atemzüge später reckte er sich zufrieden.
»Denen haben wir’s gegeben.« Er gähnte herzhaft.
»Hallo, Flo!«, begrüßte er mich dann, als würde ich täglich eben mal so in seinem Zimmer vorbeischneien.
»Schwierigkeiten? Latein?«, half ich ihm auf die Sprünge. Warum hatte ich immer geglaubt, Paula würde übertreiben, wenn sie sich darüber beschwerte, dass man ihm außerhalb seiner imaginären Welt jeden Handschlag erklären müsse?
Er würgte grollende Laute hervor, die wohl sein nicht in Worte zu fassendes Entsetzen zum Ausdruck bringen sollten. Das zog bei mir nicht. Ich unterstrich mein Desinteresse an seiner unartikulierten Meinungsäußerung, indem ich betont gelangweilt die Spitzen meiner langen braunen Haare begutachtete. Er stellte die Geräuschkulisse wieder ab.
Stattdessen blinzelte er mir zu. Seine dunkelbraunen Augen leuchteten fast. Hey, vergiss es! Ich kenne deine Schwester! Oft genug hatte ich miterlebt, wie Paula es schaffte, mithilfe ihrer hinreißenden Blicke das Eis zum Schmelzen zu bringen. Versucht dieser kleine Scheißer etwa mich weichzuklopfen?
»Hey, Don Juan, spar dir das für jemanden, der drauf steht!«, wies ich ihn zurecht.
Sofort senkte er schuldbewusst den Kopf.
»Komm schon! Mit einem Hauch mehr Motivation könnten wir schon fast fertig sein«, versuchte ich ihn wieder auf das Thema zu bringen.
Sein Widerstand bröckelte. »Kann ich vorher noch was erledigen?«, fragte er kleinlaut.
»Holst du etwa dein Gehirn aus dem Safe?« Man darf ja hoffen!
»Nee!« Er richtete sich wieder auf, legte die Hände auf die Tastatur und begann für einen Zwölfjährigen erstaunlich routiniert zu tippen.
»Ich geb den anderen schnell noch Bescheid.«
»Was? Kommen etwa noch ein paar versetzungsgefährdete Zwerge vorbei?«
Endlos vernichtender Blick. Erst das Blinken auf dem Bildschirm erlöste mich von seiner visuellen Voodoo-Beschwörung. Finns Aufmerksamkeit richtete sich wieder voll und ganz auf seine imaginären Freunde.
»Scheiße zum Quadrat, das geht aber gar nicht!«, polterte er plötzlich los. »Wie lange brauchen wir hier für diesen Mist?« Die Frage galt mir.
»Kommt darauf an, wie begriffsstutzig du bist. Und wann wir anfangen. Ich habe auch nicht ewig Zeit.«
Er fuhr sich mit beiden Händen durch seine rötlich braunen Haare. Danach standen sie wild in alle Richtungen ab.
»Na, dann mal los.« Hektisch zog er einen Hocker für mich unter seinem Schreibtisch hervor. Dann fischte er sein Lateinbuch und ein vollkommen zerfleddertes Heft aus einem Haufen Müll, der sich bei näherer Betrachtung als wildes Tohuwabohu von Schulbüchern, Heften, Stiften, Turnschuhen, jeder Menge Kleidungsstücke, Lebensmittel, Comics, CDs und unfassbar viel Kleinkram entpuppte. Interessantes Ordnungssystem.
Er legte mir ein Gekrakel vor, das seine Übersetzung sein sollte. Ich vertiefte mich in den Text. Es schien ihn überhaupt nicht zu stören, dass seine Sätze, soweit ich sie entziffern konnte, vollkommen sinnfrei waren. Aussagelose Wortketten, die willkürlich von Punkten unterbrochen wurden. Mehr war es nicht.
Während ich ihm meine Schnelldiagnose mitteilte, sprang sein Blick immer wieder zum Bildschirm. Ich versuchte ihn auf die Existenz von Zeitformen aufmerksam zu machen. Er trommelte nur nervös mit dem Stift.
»Finn, so wird das nichts. Entweder du machst jetzt die Kiste aus und konzentrierst dich, oder wir lassen es bleiben!« Uuuh, wir hören uns aber extrem nach Oberstreberzicke an.
»Nein, nein, ich konzentrier mich«, versuchte er zu beteuern, konnte aber selbst jetzt den Blick nicht vom Bildschirm lösen.
»Das war’s!« Ich sprang auf und war schon an der Tür.
»Stopp, halt, warte!«, rief er verzweifelt. »Wenn ich durchfalle, nimmt mir Ma den Computer weg.«
»Nicht die schlechteste Idee!« Bloß kein Mitleid zeigen.
»Du verstehst das nicht.« Da hatte er sogar recht.
»Wir haben ewig gebraucht, uns bis hierher durchzukämpfen«, begann er unaufgefordert zu erzählen. Sehe ich etwa aus, als würde ich mich für irreale Zwergenschicksale interessieren?
»In einer halben Stunde treffen wir uns mit dem wichtigsten Stammesführer des Landes.«
»Kann der dir Latein erklären?«, fragte ich genervt. Unten war inzwischen Ruhe eingekehrt. Paula hatte nun sicher Zeit. Und für mich gab es wirklich spannendere Themen als die Sorgen von Finns kleinen Freunden. Ich hatte die Türklinke bereits in der Hand, als er einen weiteren Versuch unternahm. Einen ganz verzweifelten. Er bettelte!
»Ich würde nur noch mit den anderen auf die Lichtung gehen. Das dauert höchstens fünf Minuten. Dann müssen wir sowieso warten.«
Oh, da war er schon wieder, der Welpenblick. Er hatte Glück, dass ich in ›Rettet-die-Zwerge-Laune‹ war.
»Na gut, aber mach schnell!« Widerwillig setzte ich mich zurück auf meinen Hocker und blätterte in seinem Lateinbuch.
»Fertig!«, vermeldete er nach ein paar Minuten fröhlich.
»Das ging wirklich schnell«, musste ich zugeben, während ich einen kurzen Blick auf den Bildschirm warf. »Ihr veranstaltet ein Barbecue?« Ernsthaft?! Ich verplempere hier meine Zeit, damit die Zwerge gegrillte Marshmallows essen können!?
»Nein, es ist dunkel, und falls du es noch nicht bemerkt haben solltest: Wir haben kein elektrisches Licht.«
»Gibt es denn keinen Coffeeshop, in dem ihr euch treffen könnt?«
Neugierig musterte ich die Trolle, die sich um ein Lagerfeuer scharten. Eigentlich sahen sie ganz putzig aus mit ihren langen Ohren. Die Haare standen ihnen wild vom Kopf ab. Sie hatten dünne Gliedmaßen und überproportional große Hände und Füße. Einer hielt eine flammende Rede. Seine Augen schienen Funken zu sprühen und seine riesigen Hände flogen wie wild durch die Luft.
»Hat dem Kleinen einer die Schaufel geklaut oder warum regt der sich so auf?«
»Das ist Sankor, unser Anführer.«
»Wenn er so weitermacht, wird er gleich einen imaginären Minischlaganfall bekommen!«, entfuhr es mir, während ich fasziniert das kleine Rumpelstilzchen beobachtete.
»Keine Sorge, der macht das immer so. Du solltest ihn mal schreien hören.«
»Hören?« Mein Blick fiel auf das Textfeld am unteren Rand des Bildschirms, in dem der Dialog zu lesen war. »Wie kannst du ihn hören?«
»Speechoption! Die Stimmen klingen aber alle voll blechern.«
»Welcher davon bist du?«, fragte ich und tippte vorsichtig an den Joystick. Ein rothaariger Zwerg fiel rückwärts von seinem Baumstamm. Ich konnte mir das Lachen nicht verkneifen.
»Hey, lass das!«, fuhr Finn mich an.
»Süß, du hast rote Haare.«
Er hatte nur ein abwertendes Schnauben für mich übrig und verdrehte entnervt die Augen. »Lernen wir jetzt oder willst du weiterspielen?«, fragte er gereizt.
»Oh, ich vergaß, du kannst es ja kaum erwarten!«, zog ich ihn auf.
Meinen Spott ignorierend schnappte er sich das Lateinbuch, angelte aus dem Drucker zu seinen Füßen ein leeres Blatt und schaute mich erwartungsvoll an.
»Wirst du jetzt wie ein Marienkäfer auf dem Rücken strampelnd liegen bleiben?«, wollte ich wissen und deutete auf den Bildschirm.
Ohne mich aus den Augen zu lassen, drückte er auf eine Taste. Der Zwerg sprang auf und setzte sich wieder zu seinen Kumpels.
»Jetzt zufrieden?«, murrte Finn.
Ich ging mit ihm den ersten Satz durch. Seine Anstrengung, nicht auf das Spiel zu schauen, minderte seine Konzentration deutlich. Ich drehte den Bildschirm so, dass nur noch ich ihn sehen konnte.
»Hey, was soll das?«, motzte er sofort los.
»Nichts, ich beobachte das nur ein bisschen für dich.«
»Sicher?« Die Ungläubigkeit in seiner Stimme hatte etwas Beleidigendes.
»Na klar, kann ja nicht so schwer sein. Ein paar Zwerge sitzen ums Feuer und warten auf einen weiteren.«
Er holte tief Luft. Doch bevor er protestieren konnte, hob ich die Hand. »Schschschtttt! Oder ich mach es ganz aus.«
Er gab sich geschlagen und konzentrierte sich in der nächsten halben Stunde tatsächlich auf Latein. Ich kontrollierte pflichtbewusst alle paar Minuten den Bildschirm, kämpfte gegen den fiesen Wunsch, den rothaarigen Zausel noch mal vom Baumstamm zu werfen, und korrigierte Finns wilden Endungensalat.
Plötzlich kam Bewegung in die kleine Truppe auf dem Bildschirm. Alle Zwerge drehten sich wie auf ein Kommando zum Wald hin. Erst jetzt erkannte ich eine dunkle Gestalt, die sich aus dem Schatten eines Baumes löste.
»Spielen bei euch auch Menschen mit oder ist das nur ein großer Zwerg?«, entfuhr es mir und sofort drehte Finn den Bildschirm zu sich.
»Das ist Thosse von Baar«, war sein einziger Kommentar. Dem ehrfürchtigen Klang seiner Stimme nach zu urteilen, war das wohl ein ganz, ganz großer Zwerg. Dann schaltete er den Lautsprecher neben dem Monitor ein. Ich konnte das Lagerfeuer prasseln hören.
»Sankor, Gnome des Epistemes …«, hörte ich eine Stimme aus dem Lautsprecher. Sie klang wirklich blechern.
»Gnome des Epistemes?«, wiederholte ich amüsiert.
»Ja, wir sind keine Zwerge, wir sind Gnome!«, gab Finn pikiert zurück. Wie konnte mir dieser Unterschied nur entgehen?
Fast augenblicklich versank Finn völlig im Spiel.
Was gab es dort nur so Spannendes? Ich verrenkte mir fast den Hals, um irgendetwas sehen zu können. Während Thosse von Baar weiterhin zu den Zwergen sprach, erhaschte ich einen Blick auf ihn.
»Schick!«, entfuhr es mir.
Finns Mimik war deutlich zu entnehmen, dass gutes Aussehen nicht spielrelevant war. Immerhin hatte ich genug Interesse gezeigt, dass er den Bildschirm ein Stück in meine Richtung drehte.Es reichte, um zu erkennen, dass Finn die Perspektive im Spiel geändert haben musste. Der Blickwinkel war nun mehr von oben.
»Was hast du jetzt gemacht?«, wollte ich von ihm wissen.
»Späherfunktion.« Okay, geh einfach weiter davon aus, dass ich diese Spielersprache perfekt verstehe.
Ich beobachtete, wie er mit den Pfeiltasten den Ausschnitt hin- und herschwenkte und mit der Auf- und Abwärtstaste einzelne Dinge heranzoomte.
Dann hörte ich Paula nach ihm rufen. Stimmgewaltig. Sie könnte einen Ruderachter über die Ziellinie dirigieren, ohne Megafon, vom Ufer aus! Trotzdem gelang es Finn, sie zu ignorieren.
»Finn? Bist du taub? Paula ruft nach dir. Unten ist ein Anruf für dich.«
Widerwillig erhob er sich. Kaum war er draußen, drehte ich den Bildschirm zu mir. Na, dann lasst mal sehen, was hier so los ist!
Die Grafik war erstaunlich. Alles sah richtig echt aus. Die Flammen des Lagerfeuers züngelten und knisterten, als könnten sie wirklich wärmen. Die Schatten der Gnome sprangen bei jeder ihrer Bewegungen über die dunklen Baumstämme und der Wald war von solcher Tiefe, dass man dachte, man könnte hineingehen.
Ich fuhr mit der Späherfunktion das Gelände ab, zoomte mal hier, mal dort ran. Krabbelt dort tatsächlich eine Spinne über ein Blatt? Dann streifte mein Blick Thosse von Baar. Ziemlich überzeugende Erscheinung. Ich war mir nicht sicher, was seine Attraktivität ausmachte. Vielleicht war es die perfekte Balance zwischen gefährlicher Bedrohung und gelassener Würde. Das schwarze Cape, die klobigen Stiefel, der schillernde Schwertgriff, der bei jeder Bewegung unter dem Umhang hervorblitzte – eine durch und durch düstere Figur. Ich konnte ihn mir problemlos als kraftstrotzenden, erbarmungslosen Krieger vorstellen. Dazu die wilde schwarze Mähne, die ihm bis weit über die Schultern reichte, und die fest entschlossene, unerbittliche Miene. Puh! Niemand, dem man im Dunkeln begegnen möchte. Doch die Art, wie er das Gespräch führte, widersprach dem Bild der hirnlosen Kampfmaschine. Besonnenheit und Intelligenz bei einer imaginären Gestalt? Bisher hatte ich noch kein Online-Rollenspiel gesehen. War es üblich, dass die Charaktere derart ausgefeilt waren? Ich zoomte ein Stück heran. Respekt! Da hat sich jemand richtig Mühe mit seiner Spielfigur gegeben. So widersprüchlich wie seine Ausstrahlung war sein Gesicht. Seine markanten Züge mit kantigem Kinn und hohen Wangenknochen waren faszinierend. Nicht übertrieben maskulin, aber unverschämt wirkungsvoll. Plötzlich stockte mir der Atem. Starrt er mich etwa an? Ich zuckte zurück. Das war kein unverbindliches Anschauen. Kein kurzes Mit-den-Augen-Streifen. Er starrte richtig, ziemlich sauer sogar!
Erschrocken wich ich ein Stück vom Bildschirm zurück. Ohne nennenswerten Erfolg. Es hatte den Anschein, als ob er mich weiterhin sehen konnte. Ich glaubte sogar zu beobachten, dass er sich minimal in meine Richtung bewegte. Meine Haut begann zu kribbeln. Langsam und vorsichtig legte ich meine Finger auf die Abwärtstaste und zoomte von seinem Gesicht weg. Entschuldigung, war vielleicht ein wenig aufdringlich dicht.
Doch die finster dreinblickenden Augen fixierten mich weiterhin. Vorsichtig bewegte ich mich nach rechts. Sein Blick verfolgte mich unbeirrt. Wäre jetzt ein kleiner Nervenzusammenbruch angebracht? Um ganz sicherzugehen, dass es kein Zufall war, neigte ich mich zur anderen Seite. Was soll ich sagen? Seine Augen folgten jeder meiner Bewegungen. Sein Blick bohrte sich direkt in meine Pupillen. Das hat nichts mehr mit Technik zu tun! Das ist gruselig! Inzwischen traute ich mich nicht einmal mehr zu blinzeln.Ich spürte, wie sich Schweißperlen auf meiner Stirn bildeten. Das ist kompletter Schwachsinn. Augen zu! Es war verrückt, ich bekam es nicht hin, meine Lider zu schließen. Er hatte mich visuell am Haken. Und er starrte mich unvermindert finster an. Äußerst einschüchternd! Plötzlich, ohne erkennbaren Grund, lösten sich seine Augen von mir und er beteiligte sich wieder an dem Gespräch am Lagerfeuer. Erleichtert atmete ich aus. Hatte ich etwa die ganze Zeit die Luft angehalten?
Im selben Moment kam Finn ins Zimmer gestürmt.
»Finn«, flüsterte ich, »kann mich jemand von da drin sehen?«
Sichtlich amüsiert grinste er mich an. »Aber klar doch, und wusstest du, dass sie festgestellt haben, dass die Erde doch eine Scheibe ist?«
»Nein, jetzt bleib mal ernst. Funktioniert das über eine Kamera, wie bei Facetime oder so?«
»Nein«, antwortete er zögernd. Ihm war anzumerken, dass er sich fragte, was in den letzten paar Minuten geschehen war.
»Er hat mich gerade angeschaut.« Ich hielt meine Stimme gesenkt, als könnte er uns hören, und zeigte unauffällig auf Thosse von Baar.
»Wer, er hier?«, fragte Finn laut und pikste mit dem Finger so fest auf seinen geliebten Flachbildschirm, dass ein dunkler Kreis erschien. Fast erwartete ich, dass Thosse von Baar ausweichen würde, aber nichts geschah. Außer dass Finn nun absolut die Oberhand hatte.
»Oh, hoffentlich habe ich ihm jetzt nicht wehgetan.« Er grinste mich überlegen an.
Idiot. Ich schnaubte verächtlich.
Er wedelte mit seiner Hand vor dem Bildschirm herum. »Das sind Animationen, nur ionisiertes Gas, keine echten Menschen.«
Seine Überheblichkeit ging mir gehörig auf den Geist. Ich wusste schließlich, was ich gerade erlebt hatte.
»Ach, Animationen? Abgeleitet vom lateinischen Begriff animare, was so viel bedeutet wie ›zum Leben erwecken‹?«
Wissen konnte ganz schön cool sein, stellte ich vergnügt fest, als Finn wie ein Fisch auf dem Trockenen nach Luft schnappte, weil ihm keine schlagfertige Antwort einfallen wollte. Doch dem kurzen Triumph folgte der schale Geschmack der Gemeinheit. Nur weil es mir unheimlich war, hackte ich auf Finn rum. Aber mein Hirn forderte eine logische Erklärung. Sofort!
»Vielleicht kann der Spieler, der ihn steuert, irgendwie durch ihn in dein Zimmer sehen«, flüsterte ich. Computertechnik gehörte definitiv nicht zu meinen Kernkompetenzen.
»Thosse von Baar ist ein NPC«, erklärte mir Finn. Ein bitte was?
Meine Unwissenheit war so deutlich zu spüren, dass ich nicht laut um weitere Erklärungen bitten musste. »Ein Non-Player Character. Er ist ein personifiziertes Steuerungsprogramm des Spielbetreibers, um den Spielverlauf zu kontrollieren.«
Yeah, ging es noch erbärmlicher? Ich hatte mich gerade von einem personifizierten Steuerungsprogramm in Angst und Schrecken versetzen lassen. Es musste also doch eine optische Täuschung gewesen sein.
»Übrigens lässt Paula fragen, ob wir nicht bald fertig sind«, erinnerte er sich, bevor er wieder in sein Spiel versank.
Mein Blick fiel auf die fast fertige und fehlerfreie Übersetzung. Nur noch ein Satz fehlte. Den würde er allein verbocken müssen. Ich wollte einfach nur noch weg von hier.
Auf dem Weg nach unten hörte ich Paula lautstark mit ihrer Mutter diskutieren.
»Jetzt komm schon, ich bin sechzehn«, jammerte sie.
»In zwei Monaten, meine Liebe.«
»Och, Ma, echt jetzt! Da gehen echt viele aus meiner Klasse hin.«
»Dann sind sie entweder sechzehn oder machen sich alle strafbar.«
»Es ist doch aber eine geschlossene Veranstaltung! Und da gibt es jede Menge volljähriges Aufsichtspersonal!«
»Laut Jugendschutzgesetz sind Discobesuche unter sechzehn nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erlaubt.«
»Wie peinlich ist das denn? Du willst mich wirklich mit Dad oder dir dort auflaufen lassen?«
»Na, wenn es dir zu peinlich ist, bleiben wir einfach zu Hause. Ich brenne nicht darauf, meine alten Knochen in einen Tanzschuppen zu schleppen.«
»Tanzschuppen?! Das sind hier nicht die Siebziger. Wir reden von einer hippen, coolen Bar, in der Eltern nichts verloren haben. Ma, es sind doch nur zwei Monate«, motzte Paula.
Ich schob mich leise in die Küche.
»Hallo, Florentine«, begrüßte Paulas Mutter Susanne mich. »Was sagen deine Eltern denn zu dieser Schnapsidee?« Sollte ich eingeweiht sein?
Unsicher schaute ich zu Paula, die mir tatsächlich mittels Blicken etwas mitteilen wollte. Falls es nicht ›Mir fallen gleich die Augen raus‹ heißen sollte, hatte ich keine Ahnung, um was es ging. Ich war noch nie gut im Zeichenlesen. Allerdings konnte ich improvisieren:
»Ich habe es ihnen noch nicht erzählt.«
Susanne wollte mich weiter befragen, doch Paula war schneller: »Und, hat das Siebhirn irgendetwas begriffen?«
Ich nickte langsam. Das komische Erlebnis drängte sich wieder in mein Bewusstsein. Vielleicht hatte ich einfach ungünstig gesessen. Aber nein, seine Augen hatten mich definitiv verfolgt, als ich mich bewegt hatte. Mit einem Blick, als ob er mich zertreten wollte.
»Florentine, was ist denn? Du bist ja ganz blass«, bemerkte Susanne plötzlich und legte mir fürsorglich die Hand auf die Stirn.
»Das ist dieser Mief in Finns Pumakäfig. Irgendwann ersticke ich da drin mal«, fiel Paula sofort ein.
»Halluziniert man unter Sauerstoffmangel?«, fragte ich leise.
»Was?« Sie musterte mich irritiert.
»Ach, vergiss es.«
»Ich finde es sehr lieb, dass du dich dieses Chaos angenommen hast«, mischte sich Susanne wieder ins Gespräch ein.
»Kein Problem.«
»Ich wollte dich schon lange mal fragen, ob du Finn Nachhilfe geben könntest«, fing sie an.
»Ja, eigentlich ganz gern«, antwortete ich vorsichtig. Dass ich mich um die Schulprobleme anderer kümmerte, stand definitiv nicht in den Top Ten meiner Mutter.
»Wir würden dich selbstverständlich dafür bezahlen«, ergänzte Susanne, die mein Zögern bemerkte und prompt falsch verstand.
Ich schüttelte den Kopf. Darum ging es nicht.
»Und lüften!«, krähte Paula. Sie konnte es einfach nicht lassen.
Darum ging es auch nicht. Im Gegensatz zu Paula lebte ich in einer Diktatur. Da konnte man nicht einfach sagen, was man wollte. Paula und ihre Ma diskutierten ihre unterschiedlichen Standpunkte. Manchmal holperten die Verhandlungen oder wurden laut, aber sie kamen immer irgendwie zu einer Einigung.
Bei mir zu Hause lief es viel ruhiger und ungerechter. Meine Mutter teilte mir ihre Entscheidung mit. Punkt. Veto? Ein Fremdwort. Diskussionen? Mehr was für Hippies.
»Ich überleg es mir«, versprach ich.
»Gehen wir nach oben?«, fragte Paula. Ihr Blick verriet: gigantische Neuigkeiten. Das konnte selbst ich problemlos erkennen.
Uhrencheck. Meine Mutter war mit Pünktlichkeit extrem pingelig.
»Halbe Stunde!«, nickte ich und folgte Paula nach oben.
Ihr Zimmer lag unter der Dachschräge im zweiten Stock.
Um dem Horror der zwei Kinderzimmer zu entgehen und das Überleben all seiner Kindern zu sichern, hatte Paulas Vater letzten Sommer den Speicher ausgebaut. Jetzt konnte sie von ihrem Bett durch ein riesiges Dachflächenfenster den Himmel sehen. Sie hatte einen begehbaren Kleiderschrank. Eigentlich war es mehr ein bestehbarer Kleiderschrank, aber er hatte eine Lampe und eine Tür. In einer Nische unter der Dachschräge, die voll mit Polstern, Decken und einem gigantischen Sitzsack war, konnte man sich stundenlang verkriechen und reden, lesen, Musik hören, träumen. Einfach der Oberhammer!
»Wohin gehen wir denn, wo alle aus unserer Klasse hingehen?«, fragte ich gespannt, während ich mich auf ihr Bett setzte.
»In die Makabar!«, antwortet sie mit unverkennbarem Stolz, schob ein paar Bücher zur Seite, schwang sich auf ihren Schreibtisch und lächelte mich erwartungsvoll an.
Ehrlich, mir blieb vor Entsetzen der Mund offen stehen.
»Du meinst … zur Oberstufenparty?«, vergewisserte ich mich ungläubig. Der heilige Gral der Schulfeste! Mir blieb die Spucke weg.
Die Veranstaltung fand nicht wie alle anderen in unserer miefigen Aula statt. Sie hatten eine total coole Bar organisiert. Jeder wollte auf diese Party. Doch eine ziemlich exklusive Gästeliste und mehrere Türsteher machten es eigentlich unmöglich, dort reinzukommen.
Doch so begeistert, wie Paula nickte, waren wir jetzt wohl mit dabei.
»Das hat nicht rein zufällig etwas mit, äh, wie heißt er doch gleich, zu tun?«, fragte ich lauernd.
Ihr Nicken blieb, sie setzte noch ein Honigkuchenpferdgrinsen darauf.
»Marc«, hauchte sie ehrfürchtig.
Seit er vor etwa einem halben Jahr mit seinen Eltern aus Norwegen gekommen war, galt Marc Nygård als der unangefochtene Gott an unserer Schule. Er sah aus, wie man sich einen Sohn Odins vorstellte. Groß, blond, stahlblaue Augen und von der Aura, Naturgewalten beherrschen zu können, umweht. Lässig mit einem Finger an der Felswand baumeln, Spaß in einer Zwanzig-Meter-Welle, all das traute man Marc sofort zu. Was äußerst witzig war, da man kaum einen unsportlicheren Jungen an unserer Schule finden konnte. Er war der lebendige Beweis dafür, dass die Figur sehr wohl etwas mit Genen zu tun haben musste. Doch selbst die Weigerung des Hockeyteams, ihn aufzunehmen, tat seiner Popularität keinen Abbruch. Es gab kaum jemanden, der nicht für ihn schwärmte. Doch ganz vorne stand die halbe Oberstufe, ungeachtet ihres aktuellen Beziehungsstatus. Erst dahinter, praktisch außerhalb seines Blickfelds, dümpelten wir aus der Zehnten rum und mussten uns mit schmachtenden Blicken und ferner Anbetung zufriedengeben. Bis jetzt.
»Ich will jede Einzelheit wissen!«, forderte ich Paula auf.
Das ließ sie sich nicht zweimal sagen. Mit leuchtenden Augen begann sie zu erzählen: »Ich musste doch heute nach der Theater-AG im Sekretariat vorreiten. Frankenstein, unsere monsterhafte Schulsekretärin, Frau Frankenhauser, machte mich wegen der fehlenden Unterschriften im Klassenbuch rund. Und dass ich das S-O-F-O-R-T zu ändern hätte. Ich hab ja nichts Besseres vor, schnapp mir das Buch, schau draußen auf den Stundenplänen, wo die Lehrer stecken, und was, glaubst du, entdecke ich da?«
»Marc!«, antwortete ich wie aus der Pistole geschossen.
»Hab ich WEN oder WAS gefragt? Du musst schon ein bisschen mitdenken!«, rügte sie mich. »Lehmann gab in der Q12 Sport. Ich spurtete also schnell rüber zu den Außenplätzen.«
»Zu den Außenplätzen? Es hat heute Nachmittag geschneit!«
»Mir musst du das nicht erzählen. Weißt du nicht, dass Ich-hab-einen-an-der-Waffel-Lehmann glaubt, Sporthallen sind nur was für Turnbeutelvergesser und bodenturnende Weicheier? Deshalb jagt er die Jungs bei jeder Temperatur, im Schneesturm, bei Gewitter oder Dauerregen über den Sportplatz.«
Ich konnte nur ungläubig den Kopf schütteln. Da ich weder Brüder noch sonstige männliche Vertraute an der Schule hatte, war mir diese spezielle Facette unseres zum Wahnsinn neigenden Sport- und Mathelehrers entgangen. Paula erzählte weiter.
»Ich komm also vollkommen durchnässt am Sportplatz an. Es war alles andere als der Look meiner Wahl. Und wer steht da bibbernd und nass wie ein Hund am Spielfeldrand?«
Ich schnappte nach Luft, um die Antwort rauszuposaunen, aber sie stoppte mich mit einer Handbewegung: »Rhetorische Frage! Dramatischer Moment. Wir wissen beide, wer dort stand!«
Okay! Ihr Auftritt.
»Er sah so elend aus. Glaub mir, seine Haare waren an den Spitzen gefroren. Kaum hatte ich ›Hallo‹ gesagt, da bellte Lehmann schon übers Feld, was ich hier verloren hätte. Ich wedelte mit dem Klassenbuch und er winkte mich huldvoll zu sich, um seine zwei Lehmänner in die leeren Kästchen zu kritzeln. Dann blaffte er mich an, ob ich sonst noch was zu erledigen hätte. Ich schaute rüber zu Marc. Echt, der konnte gar nicht so schnell zittern, wie er fror. Lehmann hatte ihn wahrscheinlich die ganze Zeit rausgestellt. Und plötzlich hörte ich mich sagen, dass Frau Frankenhauser mir aufgetragen hätte, Marc zu ihr zu bringen, da es irgendwelche Unstimmigkeiten gab. Norwegen, Zeugnisse, Übersetzung, Tralala, was weiß ich, was ich gefaselt hab.«
Erschrocken starrte ich sie an. Auf Lehmann-Anlügen steht die Todesstrafe!
»Bist du wahnsinnig?«, entfuhr es mir trotz Redeverbots.
»Hey, was sollte ich machen. You never get a second chance for a first impression! Lehmann war es total schnuppe. Er knurrte, dass ich ihm die Lusche aus den Augen schaffen solle. Als ich ihn fragte, ob er für den Rest der Stunde wiederkommen müsse, hat er abgewunken.«
»Du bist echt lebensmüde.« Ich wüsste gar nicht, woher ich so viel Mut nehmen sollte.
»Du hättest Marcs Gesicht sehen sollen, als ich an ihm vorbeiging und sagte, er könne mitkommen. Selbst wenn Lehmann mich vierteilen sollte. Das war es wert!«
»Wie ging es weiter?«
»Nachdem ich Marc alles erklärt hatte, meinte er, dass er mir etwas schulde. Und ich, ganz lässig: ›Spendier mir einen Kaffee, dann sind wir quitt.‹«
»Wie geistesgegenwärtig! Cool!«
»Warte, das Beste kommt erst noch! Er zwinkerte mir zu: ›Wie wär’s in einer halben Stunde?‹ Ehrlich, ich dachte, mein Herz hüpft mir gleich aus dem Hals.«
Ich konnte sie nur fassungslos anstarren. Das ist ganz großes Kino. Das ist Hollywood.
»Wir saßen zwei Stunden im Coffeeshop. Er hatte es nicht die Bohne eilig, wegzukommen. Du glaubst nicht, wie süß er war. Total nett, gar nicht eingebildet. Hat von sich erzählt. Mir alle möglichen Fragen gestellt. Es war echt der Hammer. Er kommt aus einem kleinen Kaff, Trömsöm oder so. Stell dir vor, nördlich vom Polarkreis! Da kannst du dir echt den Arsch abfrieren. Deutsch kann er, weil seine Mutter von hier kommt. Aber ihm ist es hier viel zu hektisch. Zu viele Menschen. Er würde gern wieder zurück. Doch seine Mutter packt das mit der Polarnacht nicht.«
»Polarnacht?«
»Wenn es im Winter nicht mehr hell wird. Da ist es zwei Monate lang zappenduster.«
»Da würde ich auch durchdrehen.«
»Dafür scheint im Sommer aber zwei Monate durchgängig die Sonne.«
»Auch da würde ich durchdrehen.« Wer schläft schon gern mit Licht?
»Wir haben ein bisschen über die Schule geredet. Er hat mir erzählt, dass er bei der Oberstufenparty nächsten Samstag zusammen mit einem Freund auflegt. Ob ich vorbeikommen möchte.«
»Wow! Du hast ein Date mit Marc, dem Göttlichen! Wahnsinn!«, stammelte ich perplex.
»Ich denke nicht, dass es ein Date ist. Er meinte, ich soll noch jemanden mitbringen, wenn ich will. Und dieser Jemand wird auf keinen Fall meine Mutter sein!«
Oh! Mist! Mutter! Meine halbe Stunde war längst um. Wahrscheinlich stiegen meiner Erziehungsberechtigten bereits wütende Rauchwölkchen aus der Nase.
Entsetzt sprang ich auf: »Paula, alles spannend, aber ich muss gehen.«
Ich umarmte sie kurz. »Das hast du echt super gemacht, ich bin stolz auf dich.«
»Ja, ich auch! Dir ist doch hoffentlich klar, dass du da mitkommen musst, oder?«
»Mir schon! Mal sehen, was meine Mutter dazu meint!«
2
Trotz über zwanzigminütiger Verspätung wehte mir zu Hause nur ein laues Lüftchen der Empörung entgegen:
»Wir hatten 18:30 Uhr ausgemacht!«
Lag wahrscheinlich daran, dass meine Mutter mit ihrer Freundin Adelheid telefonierte. Somit war sie abgelenkt und hatte die Zeit nicht damit verbracht, dem Zeiger der Uhr zuzuschauen, wie er nach vorne kroch, um ihr mit jedem Millimeter meinen Ungehorsam und ihre mangelnde Autorität zu demonstrieren.
Zum Abendessen waren meine Mutter und ich meistens allein. Mein Vater würde, wenn überhaupt, erst spät am Abend heimkommen. Er war Anwalt und arbeitete in der Stadt. Häufig hatte er abends noch Termine mit Mandanten oder einfach länger in der Kanzlei zu tun. Um ihm die einstündige Heimfahrt zu ersparen, hatten meine Eltern ein kleines Apartment in der Stadt gemietet. Ursprünglich auch in dem Glauben, die Wohnung für kulturelle Wochenenden fernab des Kleinstadtmiefs zu nutzen. Was für eine putzige Idee! Doch offenbar fand meine Mutter nicht mal Opernpremieren, Theaterinszenierungen und Kunstausstellungen spannender, als jede Sekunde meines Lebens zu beobachten. Deshalb nutzte mein Vater die Wohnung überwiegend für sich, wenn es sich nicht lohnte, spätabends noch zu uns heimzufahren.
Die leichte Kost des Abends stand bereits auf dem Tisch. Häppchenteller. Das Vollkornbrot mit Frischkäse und Kresse war in mundgerechte Stücke zerteilt. Die Vitamine einer Tomate, geachtelt, und einer Gurke, sechs Scheiben, hübsch daneben dekoriert. Ein Krönchen aus Radieschen thronte in der Mitte des Tellers. Als ich acht oder neun war, verlor sich meine Begeisterung für geschnitztes Gemüse. Trotzdem setzte mir meine Mutter jeden Abend ein Mäuschen, Krönchen, Sternchen, Gurkenschiffchen oder sonstiges Schwachsinnchen auf meinen Teller. Beschwerte ich mich, bekam sie diesen Blick, mit dem sie den riesigen roten Schriftzug in meinem Kopf anknipsen konnte. Dann leuchtete dort stundenlang das Wort SCHULD. Davon bekam ich regelmäßig Kopfschmerzen. Ich fühlte mich schuldig, weil ich keine dankbare Tochter war. Schuldig, weil ich nicht sah, wie gut es mir ging. Schuldig, weil ich nicht an die Kinder dachte, deren Mütter ihnen kein Abendessen machten. Schuldig, weil ich kein Elend kannte. Also aß ich kommentarlos das Radieschenkrönchen, die Vitamine, das Brot und beteuerte mindestens dreimal, wie gut alles schmeckte. Meine Mutter konnte fünfzig Punkte auf ihrem Supermami-Konto verbuchen und ich hatte meine Ruhe. Während des Essens befragte mich meine Mutter zur Schule. Es war die immer gleiche Leier. Noten bekommen? Viel gemeldet? Mit Zusatzwissen geglänzt? Andere in den Schatten gestellt? Gelobt worden?
Als sie ihren Katalog abgearbeitet hatte, wollte sie wissen, wie es bei Paula gewesen war. Primär wollte sie wohl hören, wie eklatant Finns Wissenslücken waren. Gab ihr, glaube ich, irgendwie das Gefühl, besser zu sein.
»Susanne hat mich gefragt, ob ich Finn Lateinnachhilfe geben kann.«
In ihrer Antwort steckten Panik und Entsetzen: »Kannst du dir das erlauben? Du bist immerhin in der zehnten Klasse. Die Fächer, die du zum Ende des Schuljahrs abwählst, zählen doch schon zum Abitur.« Ja, nur kein Druck! Erinnere mich ruhig bei jedem Atemzug daran, sonst könnte ich es eine Minute vergessen!
»Wäre aber doch eigentlich nicht schlecht, die Basics zu wiederholen, oder?«, trumpfte ich auf und beobachtete, wie es hinter ihrer Stirn zu rattern begann. Manchmal war sie echt leicht zu manipulieren.
»Meinst du?«, fragte sie.
Ich zuckte scheinbar unbeteiligt mit den Schultern. Jetzt nur nicht zu viel Interesse zeigen. Ich hatte ihr einen Köder hingeworfen. Sie hatte ihn geschluckt. In ein paar Tagen würde sie mich drängen, die Nachhilfe bei Finn zu übernehmen, und glauben, dass es ihre Idee gewesen war.
Nach dem Abendessen verabschiedete ich mich mit dem Hinweis auf meine noch ungelernten Vokabeln in mein Zimmer. Meine Mutter war auf dem Weg ins Wohnzimmer, um, wie sie betonte, die Nachrichten anzusehen. ICH wusste, dass sie spätestens in zehn Minuten vor einem dieser Kitschfilme, die bevorzugt in Schottland oder Skandinavien spielten, schmachten würde. Aber SIE wusste zum Glück nicht, dass ich keine Vokabeln lernen, sondern meine ersten Erfahrungen in einem Online-Rollenspiel sammeln würde.
In meinem Zimmer schaltete ich den Laptop ein. Sicherheitshalber legte ich das Englischbuch aufgeschlagen neben den Computer. Ich wollte nicht beim Spielen ertappt werden, falls meine Mutter zur Kontrollinspektion angeschlichen kam. Computerspiele standen nämlich so was von auf dem Index. Wahrscheinlich noch vor Drogenkonsum. Doch ich wollte mir dieses Spiel genauer ansehen. Ich war kein Freak. Ich wusste, was ich gesehen hatte. Er hatte mich angeschaut. Ohne jeden Zweifel. Da drängte sich doch die Frage auf, warum er das konnte.
Mit einem flauen Gefühl im Magen rief ich die Startseite von Askendor auf. Sie war erstaunlich schlicht. Dunkler Hintergrund, vor dem sich in hellem Grau das Anmeldeformular abhob. Nach der üblichen Prozedur mit Name, Nutzername, Passwort, E-Mail, Nutzungsbestimmungen wurde ich weitergeleitet. Auf der nächsten Seite prangte in großen Buchstaben der Name des Spiels. Darunter stand eine kurze Einleitung:
›Nach der Entführung der königlichen Familie teilten die Stammesführer das Reich. Sie prägten Erscheinungsbild und Möglichkeiten ihrer Länder. Entscheide, welches Volk du unterstützen möchtest, um Askendor wieder zu einem …‹
Ach, möchte ich das? Eigentlich wollte ich nur mal kurz einem der Stammesführer meine Meinung sagen! Doch das System nahm keine direkten Beschwerden entgegen. Es blieb mir also nichts weiter übrig, als dem Programm zu folgen.
Als Nächstes entrollte sich eine Landkarte. Askendor bestand aus fünf Ländern mit den klangvollen Namen Ignousia, Baskir, Cundar, Tragun und Frastella. Hört sich alles ein bisschen sperrig an!
Ich klickte mich durch die Vorstellungsrunde.
Ignousia war ziemlich bizarr. Offenbar verzichtete man hier auf die altbewährte Einteilung von oben und unten. Was immer eine Landschaft ausmachte, es flog durch die Luft. Auf Wolken wuchsen Bäume, und tosende Wasserfälle ergossen sich aus dem Nichts.Noch abgedrehter als das Land war sein Stammesführer Svantjor nam Vorg! Mit einer Frisur, die aussah, als würden die Haare vor dem Gesicht weglaufen, posierte er auf einem Schimmel mit strassbesetzter Schabracke. Sein dunkelroter Umhang sah aus, als wäre er mit Glitzer überzogen. Eine Discokugel als Stammesführer. Erfrischende Alternative zu Würde und Respekt!
Weiter zu Frastella, das sofort ausschied. Da reichte ein einziger Blick. Willkommen in Deprihausen! Dichte schwarze Wolken zogen über den verdunkelten Himmel. Dort, wo sie sich aufzulösen begannen, fiel gleißend weißes Licht in gespenstischen Strahlen auf eine fahle Steinwüste. Nebelverhangene Gebirge ragten schroff und abweisend empor. Der Fels, nass und grau, ohne einen Hauch von Vegetation. In der bedrückenden Geröllwüste streckten sich riesige Findlinge dem trostlosen Himmel entgegen. Tatsächlich sahen einige bewohnt aus. In einem Stein leben? Nicht wirklich! Das könnte das Land von Thosse von Baar sein. Finster, düster und hart. Weit gefehlt! Im Vergleich zur echten Chefin von Frastella wirkte Thosse von Baar wie ein Babybär. Felstina von Rutjar umgab das Flair einer Pandemie biblischen Ausmaßes. So stellte ich mir das Grauen auf zwei Beinen vor. In keiner Lebenslage eine Wunschkandidatin! Außer man plant eine extrem blutige Revolution!
Da war mir Baskir doch lieber. Das Land der freien Völker hatte keinen Anführer. Es beherbergte, neben einigen Splittergruppen, die Völker der Tegoster, Gonoxore und die Gnome des Epistemes, die jeweils von einem Clanchef geleitet wurden. Hallo, Finn! Ich könnte ihn in den Wahnsinn treiben und mich bei den Zwergen anmelden. Durfte man im eigenen Stamm morden? Außerdem gab es in Baskir noch Zirkelmeister. Die hatten offenbar höhere Aufgaben. Sehr geheimnisvoll und undurchsichtig!
Cundar hingegen, mit Ripinett am Cijunt als Stammesführerin, war ein ziemlich unspektakulärer Bauernstaat. Mir stand der Sinn nicht nach Schafezüchten, Hüttchenbauen, Getreidemahlen und Brotbacken.Vielleicht fragt ihr in fünfzig Jahren noch mal an.
Blieb nur noch Tragun übrig. Es wurde mir als ›Land des Geistes und der Weisen, die die Rätsel dieser Welt erforschen‹ vorgestellt. Aha! Jetzt bin ich so schlau wie vorher!
Anscheinend hatte der jüngste Stammesfürst tatsächlich das größte Land. Land? Na ja, wohl eher einen gigantischen Garten! Tragun war ein undurchdringliches Dickicht. Der Bildschirm schillerte in den leuchtendsten Grüntönen, die man sich vorstellen konnte. Aber bis auf die paar gelblichen Felsen, die weit über die Spitzen der Baumkronen hinausragten, war es eben nur grün. Im Hintergrund erhob sich als kolossale Felswand ein Gebirge. Das war’s. Städte? Wege? Häuser? Fehlanzeige! Wahrscheinlich wohnten sie dort auf Bäumen! Denn außer einer beeindruckenden Vielfalt an Pflanzen gab es nichts. Nothing! Niente! Nada! Thosse von Baar, der Präsident des Gartenbauvereins von Askendor? Oder vielleicht doch nicht? Bei genauerer Betrachtung erkannte ich, dass die Felsen, die aus dem Urwald herausragten, keine Steine, sondern Türme waren. Mit ihren schräg abfallenden Dächern erinnerten sie an Müslischalen, die mit der Öffnung nach unten übereinandergestapelt worden waren. Okay, ich nehm’s zurück, sie wohnen nicht auf Bäumen.
Als ein Bild Thosse von Baars eingeblendet wurde, zuckte ich kurz zurück. Zu tief hatte mich das merkwürdige Erlebnis des Nachmittags verunsichert. Erst als ich sicher war, dass es nur ein Bild war, riskierte ich einen genaueren Blick. So gut können Jungs also aussehen, wenn man sie am Computer zusammenbaut.
Spielfiguren, Chars genannt, wurden aufgeführt. In Tragun standen Impostare, Putaratoren, Exkrieter und Nylerer zur Auswahl. Warum hießen sie nicht Kämpfer, Zauberer, Sammler und Chemiker? Dann wüsste man wenigstens, woran man wäre.
Einen kurzen Moment zögerte ich. Wollte ich das wirklich? In ein Online-Rollenspiel einsteigen? Einzig die Frage, warum Thosse von Baar mich sehen konnte, interessierte mich.Aber vielleicht war das der einzige Weg, es herauszufinden. Ich entschied mich nach rein optischen Gesichtspunkten für die Exkrieter und bastelte mir eine blonde Schönheit mit braunen Augen in einer Art Catwoman-Kostüm. Am Ende fügte ich noch einen langen braunen Mantel mit großem Kragen und Ärmelaufschlägen hinzu, und schon erinnerte sie mich an eine verwegene Piratin. Wenn schon auf merkwürdiger Mission, dann wenigstens gut aussehend! Sie bekam den klangvollen Namen Lanrina. Damit nicht genug. Ich konnte mithilfe kleiner Regler ihre Fertigkeiten einstellen. Sehr praktisch. Warum gibt es das nicht für Menschen?
Etwas planlos fuhr ich mit den kleinen Knöpfchen hoch und runter. Irgendwie hingen sie alle zusammen. Man konnte nicht bei allem einfach hundert Prozent einstellen. Und auf einmal hatte ich nicht alltägliche Entscheidungen zu treffen. Wie wichtig war hellseherisches Potenzial? War es möglich, durch geringe Kampfkraft bereits beim Überqueren einer Straße zu sterben? Wozu brauche ich Heilkraft? Auf mehreren erklärenden Seiten konnte man alles über die Fertigkeiten nachlesen. Aber mal ehrlich: Gebrauchsanleitung? Wie unsportlich!
Ich entschied die Sache mehr aus dem Bauch heraus. Hellsehen fand ich cool. Mein medizinisches Interesse war dagegen schon immer sehr gering gewesen. Kämpfen wollte ich nur, wenn es sich nicht vermeiden ließ.
Plötzlich hörte ich es im Nebenzimmer rumoren. Blitzschnell klappte ich den Laptop zu, schnappte mein Englischbuch und stieß mich mit den Füßen ab, sodass mein Stuhl ein Stück nach hinten flitzte und ich die Beine auf den Tisch schwingen konnte. Kaum hatte ich meine entspannte Lernhaltung eingenommen, öffnete sich die Tür einen Spaltbreit und meine Mutter streckte den Kopf ins Zimmer.
»Florentine, du lernst immer noch?«
»Ja, ich hab erst ein bisschen später angefangen!« Nicht gelogen!
»Es schon fast zehn. Du solltest schlafen.«
Wie alt bin ich? »Ja, mach ich gleich.« Vergiss es!
»Gute Nacht, träum was Schönes.« Damit zog sie die Tür leise wieder zu.
Ich verharrte in meiner Position, bis ich sie die Treppe hinuntergehen hörte. Jetzt musste es schnell gehen. Ich hatte noch ungefähr zwanzig Minuten, dann würde sie wiederkommen, um sich zu überzeugen, dass ich schlief.
Ich feuerte mein Buch aufs Bett und klappte den Laptop wieder auf.
Wo war ich? Fertigkeiten. Mir eigentlich egal. Schnell drückte ich auf ›Charakter erstellen‹. Der Bildschirm wechselte die Farbe und ich stand mitten im Dschungel auf einer kleinen Lichtung. Kurze Einweisung? Nein? Na gut, dann eben nicht!
Unentschlossen tanzte ich mit Lanrina ein bisschen auf dem Platz herum. Ich hatte ja keine Blaskapelle und Begrüßungscocktails erwartet, aber etwas mehr Reaktion wäre hilfreich gewesen. Die Späherfunktion fiel mir ein. Vielleicht bekam ich so mehr Informationen. Ich ließ meine Figur stehen und fuhr mit der Maus das Gebiet rundherum ab. Tatsächlich fand ich an einem Busch einen versteckten Link. Kaum klickte ich darauf, flatterte ein kleines Etwas ins Bild. Zuerst dachte ich, es wäre ein Mistkäfer, aber welcher Käfer trägt ein braunes Kleid, das an eine Lederrüstung erinnert? Der Kopf steckte in einem imposanten Helm, der immerhin das Gesicht erkennen ließ. Die fliegende Amazone stellte sich als »Vönska« vor und versprach, mir hilfreich zur Seite zu stehen. Tatsächlich wirkte sie nicht gerade hoch motiviert. Immerhin nannte sie mir aber meine erste Aufgabe. Ich sollte zwanzig Blätter des Dugorunbaumes pflücken. Oh, wie spannend! Haltet mich fest, bevor mich die Aufregung umbringt! Was soll’s, wenn’s der Mission dient, dann geh ich jetzt mal Blätter sammeln.
Aber wie? Ratlos drehte ich mich im Kreis. Bäume, Büsche, Gräser, Wildnis. Einer ’ne Ahnung, wie die Dinger aussehen? Der flatternde Mistkäfer stellte sich taub. Ich beschloss, das Problem beim Zähneputzen zu überdenken. Auf dem Weg ins Bad begegnete ich meiner Mutter auf ihrer zweiten Inspektionsrunde.
»Ich bin schon beim Zähneputzen«, entgegnete ich ihr noch vor ihrer aktuellen Zeitansage. Dann fiel mir ein, dass meine Zimmertür halb offen stand. Schreibtisch und Computer waren von der Tür aus problemlos einzusehen. Meine Mutter würde sofort erkennen, dass dort ein Spiel geladen war.
Schnell drängelte ich mich an meiner Mutter vorbei zurück ins Zimmer, drückte so unauffällig wie möglich den Laptop zu und öffnete das Fenster.
Als ich mich umdrehte, stand meine Mutter im Türrahmen und musterte mich irritiert.
»Mir ist wieder eingefallen, dass ich lüften wollte, solange ich im Bad bin«, erklärte ich ungefragt. Wie gesagt, improvisieren kann ich.
»Soso.« Sie glaubte mir kein Wort. Ich sah, wie ihr Blick durchs Zimmer streifte, um irgendetwas Verdächtiges zu finden. Hehlerware? Anstößige Literatur? Heimlicher Verehrer? Drogen? Was traut diese Frau mir alles zu?
Sie konnte nichts entdecken. Nur der Lichtsensor meines Laptops blinkte verräterisch. Doch genau dem schenkte sie keinerlei Beachtung. Zumindest tendenziell schuldbewusst taxierte ich ebenfalls mein Zimmer. Auf dem kniehohen Regal neben meinem Schreibtisch, das auch als Sitzbank diente, lagen nur Kissen. Rechts im Erker auf dem alten Clubsessel aus abgewetztem braunem Leder waren ein Buch und eine Decke. Unordentlich, aber unverdächtig! Auf der anderen Seite befand sich mein Bett. An dessen Fußende stand ein hohes Regal, das als Raumteiler zur Tür fungierte. Der Kleiderschrank neben der Tür war geschlossen, so konnte meine Mutter zum Glück nicht sehen, dass ich meine Sporttasche nur reingepfeffert hatte. Sie kugelte sich fast den Kopf aus, um den Titel des Buches auf dem Sessel zu erkennen. Platon. Schullektüre. Besser hätte es nicht laufen können.
»Dreh bitte die Heizung zurück«, ermahnte sie mich noch und klang fast ein bisschen enttäuscht.
Ich nickte und flitzte zurück ins Bad. Waschen und Zähneputzen im Eilverfahren. In meinem Zimmer herrschte arktische Kälte, als ich zurückkam. Ich schlüpfte schnell in meinen Schlafanzug, schnappte mir den Computer und kuschelte mich ins Bett.
Okay, wo waren wir? Diese bescheuerten Blätter. Ich ließ Vönska den Auftrag noch einmal wiederholen. Und weil sie so unkooperativ war, gleich noch mal! Dann wurde meine Aufmerksamkeit auf ein Buch gelenkt, das wild auf und ab hüpfte. Ein Handbuch, wie praktisch. Ich gab den Namen der Pflanze ein und erhielt ein Bild. Na, dann mal los. Ich wanderte durchs Gelände und sammelte per Mausklick Blätter. Fantastisch! Vönska flatterte die ganze Zeit um mich herum. Wirkte ein bisschen, als wäre sie eine Stalking-Fee.
Als ich die Blätter zusammenhatte, klatschte sie so euphorisch in ihre Hände, als ob ich die achte Potenz von 236 im Kopf ausgerechnet hätte. Die schnelle Wende von absolutem Desinteresse zur frenetischen Ekstase ließ sie nicht sehr glaubwürdig wirken. Vielleicht sollte ich ihre Regler mal neu einstellen!
Immerhin übermittelte sie mir gleich den nächsten Auftrag. Die Blätter sollten bei Granerius abgegeben werden. Ende der Information.
Gereizt zog ich das Handbuch zurate. Wozu habe ich eigentlich diese fliegende Amazone, wenn ich sowieso alles nachschlagen muss? Selbst dort waren die Auskünfte spärlich. Granerius lebte in Hariam, dem südlichen Teil von Tragun. U-Bahn-Karte? Busverbindung? Natürlich nicht! Ich bekam eine Landkarte, und wenn die Entfernung nur annähernd stimmte, würde Granerius sich mit welkem Laub zufriedengeben müssen.
Mein Weg führte mich durchs Unterholz. Riesige Farne, fremdartige Büsche, moosbewachsene Baumstämme, so weit das Auge reichte. Immer wieder fielen Sonnenstrahlen durch das Blätterdach und zauberten grün schimmernde Lichtreflexe in die Luft. Plötzlich hatte Lanrina Probleme mit der Geschwindigkeit. Obwohl ich die Steuerknöpfe fest gedrückt hielt, wurde sie immer langsamer. Vönska zog engere Kreise um mich. Ah, können wir jetzt eine Minute für mich erübrigen? Über ihrem Kopf tanzte ein kleines Ausrufezeichen. Ich klickte darauf und wurde umgehend informiert, dass meine Energie abgesunken sei und ich dringend Nahrung brauchte. Wie lästig! Immerhin schien Lanrina nicht wählerisch zu sein. Reptilien, Insekten, Beeren, Wurzeln, Pflanzen, Säugetiere, sie futterte offenbar alles, was nur ansatzweise lebte. Mühsam unterdrückte ich ein Gähnen. Heute würde nicht mehr gejagt werden. Ich klappte den Computer zu und stellte ihn auf den Schreibtisch. Zurück in meinem Bett, wälzte ich mich von einer Seite auf die andere. Die Bilder des Nachmittags gewannen wieder die Oberhand. Es war eine Albtraumnacht. Jemand verfolgte mich durch eine grüne Hölle. Sobald ich stehen blieb, spürte ich eine Präsenz direkt hinter mir. Ich konnte den Atem in meinem Nacken fühlen. Aber wenn ich mich umdrehte, war dort niemand. Außerdem raunte dauernd jemand meinen Namen. Es klang wie der Wind, doch ich konnte deutlich »F-l-o-r-e-n-t-i-n-e« hören. Sehr, sehr gruselig!
Selten war ich so froh gewesen, aufstehen zu können. Meine Mutter fragte mich beim Frühstück, wie oft die Nachhilfe für Finn stattfinden sollte. Wenigstens das lief nach Plan. Ich schaufelte mir gerade die letzten Löffel Müsli rein, als Paula klingelte. Schnell zog ich mir Parka, Mütze, Schal und Handschuhe an, schnappte meinen Rucksack und schaffte es vor der dritten mütterlichen Ermahnung aus dem Haus.
Es hatte die ganze Nacht geschneit. Ich liebte das. Der Schnee dämpfte die lauten Töne und verlangsamte die Hektik. Als wären alle damit beschäftigt, die Welt neu zu entdecken. Paula und ich stapften schweigend zur Bushaltestelle.
»Wie, heute kein Glückwunschtelegramm?«, fragte ich enttäuscht, als wir fast dort waren. Jeden Morgen kürte Paula die coolsten Geburtstagskinder des Tages. Es war eines ihrer legendären Projekte.
Vor Urzeiten hatte sie mit dem Fremdwort des Tages angefangen. Jeden Morgen wählte sie blind ein Wort aus dem Fremdwörterlexikon, das sie tagsüber mindestens zehnmal mehr oder weniger passend ins Gespräch einstreute. Zu dieser Zeit hatten wir ziemlich abgedrehte Unterhaltungen. Als sie das Wort »Konnotat« zog, musste sie allerdings passen. Von den japanischen Schimpfwörtern, die folgten, konnte ich mir immerhin »Aho« merken.
Und seit Kurzem gab es das Glückwunschtelegramm für ein aktuelles Geburtstagskind.
»Heut wird im Bus gesungen!«, verkündete sie stolz. »Ozzy Osbourne hat, entgegen aller Vorhersagen, ein weiteres Jahr geschafft.«
Who the hell is Ozzy Osbourne?
Paula kannte meine Defizite. »Godfather of Metal? Frontmann von Black Sabbath? Klingelt da was? Seit Jahren totgesagt und trotzdem noch am Leben«, half sie mir auf die Sprünge.
»Ach, dieser Spinner, der auf der Bühne Hinrichtungen veranstaltet?«
»Quatsch, das war Alice Cooper, und …«, fauchte sie mit bösem Blick, »… es war eine Nachbildung seines eigenen Kopfs, den er da abgeschlagen hat!«
»Trotzdem nicht mein Ding.«
»Vielleicht solltest du aufhören, diesen gequirlten Stimmchenmist zu hören, und mal auf richtige Musik umsteigen!«
Im Bus schaffte es Paula tatsächlich, dass alle, na ja, bis auf die Streber, die direkt hinter dem Fahrer saßen, für Ozzy Osbourne ein Ständchen sangen. Ich wäre vor Peinlichkeit gestorben. Paula genoss es.
Auf dem Weg zur Schule rückte uns Phillip, ein wortkarger Gothic-Vamp-Punk, mit dem wir noch nie ein Wort gewechselt hatten, auf die Pelle.
»Coole Aktion!«, nickte er und klopfte Paula im Vorbeigehen anerkennend auf die Schulter.
Von ihrem neuen Fan vollkommen unbeeindruckt, erzählte sie mir, dass ihre Eltern ihr nach zähen Verhandlungen nun doch erlaubt hatten, auf die Oberstufenparty zu gehen.
»Super, dann steht ja euer Date«, gratulierte ich ihr.
»Es ist kein Date. Er hat UNS eingeladen!«, verbesserte sie mich, während wir uns an unsere Plätze setzten.
»Na, hoffentlich musst du dann nicht allein hin«, murmelte ich und tauchte in die Tiefen meines Rucksacks ab. Um mein Federmäppchen zu suchen, nicht um mich vor Paula zu verstecken, ehrlich!
»Wie?!«, erboste sie sich alarmiert. »Du hast noch gar nicht gefragt?«
Ich tauchte mit hochrotem Kopf wieder auf. »Du weißt doch, wie meine Mutter ist.«
»Jetzt ehrlich, Flo, wie lange willst du noch den Bückling spielen, hä?«
Das Eintreffen von Frau Flasching, unserer Deutschlehrerin, erlöste mich von diesem unerfreulichen Thema. Führte allerdings nahtlos zum nächsten.
»Denkt bitte an eure Aufsätze für Freitag«, erinnerte sie uns mit ihrer durchdringenden Stimme. Ein Grummeln und Murren zog durch die Klasse. Ich war wohl nicht die Einzige, die noch keinen Masterplan für ihr Leben hatte. Den Rest der Deutschstunde verbrachte ich damit, interessiert zu nicken und mich zu fragen, wie ich den Häschen in Tragun eins überbraten könnte. Virtuell natürlich.
In der Pause drängten wir uns bibbernd zu einem Pulk zusammen. Als Marc vorbeischlenderte und Paula lässig grüßte, konnte ich die Woge der Ungläubigkeit, die uns umspülte, förmlich spüren.
»Meint der etwa dich?«, krähte Sophie so laut, dass Marc es selbst jenseits des Polarkreises noch hätte hören können. Paula stieg ihr unsanft auf den Fuß. Woraufhin Sophie zeterte: »Sag mal, spinnst du jetzt völlig? Wieso trittst du mich?«
»Du schreist danach!«, zischte Paula drohend.
»Jetzt, wo er weg ist, möchte ich es aber auch wissen«, mischte sich Mara in den Streit der beiden ein. »Hat der Konge dich etwa gerade gegrüßt?«
Konge war unser zugegebenermaßen höchst alberner Spitzname für Marc. Es war norwegisch und hieß »König« und außerdem »geil«. Behauptete zumindest Sophie.
»Könnten wir vielleicht damit aufhören, dieses bekloppte Pseudonym zu benutzen? Wie alt seid ihr eigentlich?«, fragte Paula genervt.
»So alt wie du letzte Woche, als du behauptet hast, er hätte den heißesten Knackarsch der nördlichen Hemisphäre«, kreischte Sophie amüsiert und eindeutig zu laut. So war sie einfach. Peinlich bis zum Anschlag, aber ein Händchen für Timing und schlecht verpackte Wahrheiten.
Paula bedachte sie mit einem vernichtenden Blick. Dann hakte sie sich bei mir unter und zog mich von den anderen weg.
»Du erzählst niemandem von Samstag«, beschwor sie mich.
»Was soll ich nicht erzählen? Dass du kein Date mit dem Konge hast?«, fragte ich übertrieben naiv.
Sie schlug mir warnend auf den Oberarm. Es tat höllisch weh. »Hast du heute Nachmittag Zeit vorbeizukommen?«, wollte sie, von meinem Schmerzgewimmer unbeeindruckt, wissen.
Dienstag. Zuerst Klavierstunde, dann Englischvertiefung. Früher hieß es Nachhilfe. Dann fand meine Mutter ihre »Bibel« – ein vollkommen bescheuertes Ratgeberbuch einer durchgeknallten Amerikanerin, voll mit selbst gezimmerten Weisheiten, positiven Schwingungen und bekloppten Motivationssätzen. Und deshalb hatte ich jetzt keine destruktive Nachhilfe mehr, sondern hochmotivierende Englischvertiefung. Anschließend standen noch Hausaufgaben, Vokabeln pauken und einen virtuellen Hasen erlegen auf dem Plan.
»Könnte knapp werden«, antwortete ich daher zögernd.
»Du musst mir aber bei der Auswahl meines Outfits für Samstag helfen«, begann Paula zu jammern.
»Morgen ist besser. Da hab ich Zeit«, tröstete ich sie. Doch wo sollte ich sie zwischen Deutschaufsatz, Klavierüben und Fechtstunde reinquetschen? »Du könntest mich vom Fechten abholen«, fiel mir ein.
Sie nickte erleichtert.
Es klingelte zum Unterricht. Den Rest meines Schultages verbrachte ich damit, so zu tun, als ob ich aufpasste.
Der Nachmittag war etwas kniffeliger. Da stand ich unter Einzelbeobachtung. Klavierspielen bei Frau Yang machte Spaß. Englischvertiefung bei Annabell war dagegen Hochleistungssport.
Als ich zu Hause ankam, dämmerte es bereits. Dabei war es erst vier Uhr nachmittags. Im Flur strömten mir wohlige Wärme und der Geruch nach frisch gebackenem Kuchen entgegen.
»Bist du es, Florentine?«, hörte ich meine Mutter aus der Küche rufen. Nein, der Papst!
»Na, wie war’s in der Schule?« Weiß nicht, hab nicht aufgepasst.
»Schön.« Ich legte meine Handschuhe auf die Heizung im Windfang.
»Und bei Frau Yang?« Das Klicken der Mikrowelle kündigte mein spätes Mittagessen an.
»Lustig, sie hat gesungen.«
»War Annabell mit dir zufrieden?«
»Ich glaub schon.« Ein besorgter Blick empfing mich in der Küche.
»Was soll das heißen, du glaubst schon?« Kein Lob in Englisch? Weltuntergang!
»Annabell redet nicht viel, außer: richtig, falsch, weitere Bedeutung, schneller«, versuchte ich ihr zu erklären.
»Hast du Hunger?«, wollte meine Mutter wissen. Sie bestand auf einer warmen Mahlzeit nach der Schule – egal zu welcher Uhrzeit. Skeptisch beäugte ich den Teller. Brokkoliauflauf feat. Mikrowelle. Schon optisch ein Erlebnis. Meine Ernährungslage war real genauso miserabel wie virtuell.
»Hast du Kuchen gebacken?«, fragte ich hoffnungsvoll.
»Plätzchen, aber die gibt’s erst nach dem Abendessen!« Vielleicht war jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Vorstoß wegen Samstag.
»Die Oberstufe veranstaltet am Samstag … ein Konzert.« Mit der Aussage habe ich noch Spielraum.
»Ein Konzert, wie schön! Wo?« Schon wird’s eng.
»Irgendwo in der Stadt. Paula darf auch hingehen.« Lange Pause. Der Röntgenblick meiner Mutter scannte bereits mein Gehirn.
»Auf ein Konzert? Mit Paula?!« Ihre Stimme klang, als hätte ich sie gefragt, ob ich mit einer Punkband auf Welttournee gehen dürfte.
»Ja, die haben da so ein experimentelles Musikprojekt.« Konkreter! Schwall nicht rum! Ich räusperte mich und fuhr hoch konzentriert fort: »Ein fächerübergreifender Ansatz aus Informatik, Mathematik und Musik. Die Klangsynthese unter Berücksichtigung mathematisch definierter Frequenzmodulationen. Soll extrem schräg klingen.« Ergab das irgendeinen Sinn? Ich hatte keine Ahnung, woher ich diesen Schwachsinn bezog. Er kam einfach aus der Tiefe meiner Gehirnwindungen. So wie man in lebensbedrohlichen Situationen scheinbar unmenschliche Kräfte mobilisieren konnte.
Auf alle Fälle ließ die Anzahl der Fremdwörter meine Mutter nachdenklich die Stirn runzeln.
»Dann ist das eine schulische Veranstaltung?«, hakte sie skeptisch nach. Wäre das schön, einfach »Ja« zu sagen! Doch meine Mutter war zwar extrem nervig und humorresistent, aber definitiv nicht auf den Kopf gefallen. Sie würde mich im Nullkommanix in meinem Lügennetz festtackern. Zeit, ein paar Tatsachen beizumischen.
»Nein, aber es kommen nur Leute aus der Schule. Paulas Vater würde uns hinfahren und abholen.« Ihr nachdenklicher Blick war schwer zu deuten.
»Ich würde wirklich sehr, sehr gerne mitgehen, Mama«, hängte ich leise an. Hochsensibler Moment. Demütiges Bitten, ohne unterwürfig zu klingen.
»Und Paulas Vater holt euch ab?«, erkundigte sie sich. Zielgerade! Ich begnügte mich damit zu nicken.
»Wann wärst du dann wieder zu Hause?«
»Allerspätestens um zwölf.« Blickkontakt halten!
»Du bleibst den ganzen Abend in der Nähe von Paula!« Klar, ich hak mich mit einem Karabiner bei ihr ein.
»Du trinkst keinen Alkohol, sprichst mit keinen Fremden, bist pünktlich um zwölf Uhr wieder hier!« … und amüsierst dich auf keinen Fall!
»Geht klar«, versprach ich.
»Gut, dann darfst du gehen.« Strike!
Hochzufrieden setzte ich mich an meinen Schreibtisch. Der Samstag war gerettet. Im Eiltempo erledigte ich die nötigsten Hausaufgaben. Der Aufsatz? Nicht heute. Wer weiß, vielleicht konkretisieren sich meine Vorstellungen über mein Leben in den nächsten Tagen.
Ich verzog mich mit meinem Laptop aufs Bett. Würde meine Mutter auftauchen, hätte ich genügend Zeit, ein Schreibprogramm zu aktivieren. Ich rief Askendor auf und wartete ungeduldig, bis Lanrina erschien. Meine Energie dümpelte immer noch im roten Bereich. Gelangweilt brummte Vönska ins Bild. Wie viele Energiepunkte die wohl bringt? Sicher war es verboten, das helfende Wesen zu verspeisen.
Ich entdeckte eine zusammengerollte Schlange, die in einer Astgabel döste. Nach Brokkoliauflauf jetzt noch Reptiliendessert. Lecker! Aber meine Energiebilanz erholte sich. Ich spurtete weiter.