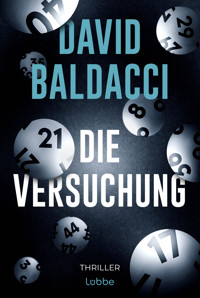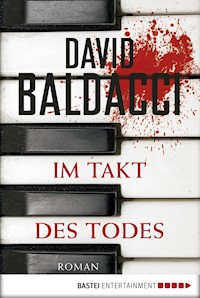9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mace Perry war mit Herz und Seele Polizistin in Washington, D.C., bis sie durch einen missglückten Undercovereinsatz alles verlor: ihre Marke, ihre Karriere, ihre Freiheit. Jetzt ist die junge Frau zurück - und getrieben von dem Ziel, wieder in den Dienst aufgenommen zu werden. Um das zu erreichen, bleibt Mace nur eine Möglichkeit: Sie muss einen bedeutenden Fall lösen und dadurch beweisen, dass sie es verdient, die Polizeiuniform zu tragen. Als eine prominente Anwältin ermordet wird, wittert sie ihre Chance. Doch was zunächst wie ein normaler Mordfall aussieht, nimmt bald eine unerwartete Wendung und führt Mace in die Kreise des US-Geheimdienstes - und in tödliche Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Kapitel 113
Kapitel 114
Danksagungen
David Baldacci, geboren 1960, war Strafverteidiger und Wirtschaftsanwalt, ehe er 1996 mit Der Präsident seinen ersten Roman veröffentlichte, der sofort zum Bestseller wurde; ebenso wie alle folgenden Romane, die weltweit regelmäßig unter den Top 10 zu finden sind. David Baldacci lebt mit seiner Familie in der Nähe von Washington, D. C.
David Baldacci
AUFBEWÄHRUNG
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch vonRainer Schumacher
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2009 by Columbus Rose, Ltd.
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »True Blue«
Originalverlag: Warner Books/Grand Central, Hachette Book Group
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Gerhard Arth
Titelillustration: © getty-images/Tim Ridley
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-1084-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Scott und Natasha,
Veronica und Mike,
Teil meiner Familie und vier der coolsten Leute,
Kapitel 1
Jamie Meldon rieb sich energisch die Augen, doch als er wieder auf den Computermonitor starrte, war es noch immer nicht gut. Er schaute auf seine Uhr. Es war fast zwei Uhr morgens, und er war fix und fertig. Mit seinen fünfzig Jahren war er schlicht nicht mehr in der Lage, die Nacht durchzuarbeiten. Er zog die Jacke an und schob sein dünner werdendes Haar zurück, das ihm ins Gesicht gefallen war.
Als er seine Aktentasche packte, dachte er an die Stimme aus der Vergangenheit. Er hätte es nicht tun sollen, doch er hatte angerufen, und sie hatten miteinander gesprochen. Und dann hatten sie sich getroffen. Dabei hätte er diesen Teil seines Lebens am liebsten vergessen. Und doch würde er etwas tun müssen. Fast fünfzehn Jahre lang hatte er als Freiberufler gearbeitet, doch nun bekam er sein Geld von Onkel Sam. Er würde darüber schlafen müssen. Das half immer.
Vor zehn Jahren war Jamie Meldon ein angesagter und hochbezahlter Anwalt für Strafrecht in New York City gewesen, und er hatte einige der zwielichtigsten Gestalten der Unterwelt vertreten. Es war die aufregendste Zeit seiner Karriere gewesen, aber auch der Tiefpunkt. Er hatte die Kontrolle über sein Leben verloren, war seiner Frau untreu gewesen und zu etwas geworden, das er inzwischen zutiefst verachtete.
Als seine Frau ihm gesagt hatte, dass sie bestenfalls noch sechs Monate zu leben habe, hatte es bei Meldon endlich klick gemacht. Er hatte seine Ehe wiederbelebt und seiner Frau beim Kampf gegen den Tod beigestanden. Meldon war mit seiner Familie nach Süden gezogen, und seit nunmehr zehn Jahren verteidigte er keine Kriminellen mehr, sondern sorgte dafür, dass sie ins Gefängnis kamen. Das fühlte sich irgendwie richtig an, auch wenn Meldons finanzielle Situation nicht mehr ganz so rosig war wie früher.
Meldon verließ das Gebäude und machte sich auf den Weg nach Hause. Auch um zwei Uhr morgens herrschte noch Leben auf den Straßen der Hauptstadt; doch kaum hatte er den Highway verlassen und näherte sich seinem eigenen Viertel, da wurde es ruhig und er immer schläfriger. Plötzlich sah er ein blinkendes Blaulicht im Rückspiegel, und er war wieder hellwach. Sie waren nur noch eine Straße von seinem Haus entfernt, in einer Allee. Meldon fuhr rechts ran und wartete. Seine Hand glitt zu seiner Börse mit den Papieren. Er hatte Sorge, dass er vielleicht in einen Sekundenschlaf gefallen und Schlangenlinien gefahren war.
Meldon sah die Männer zu seinem Wagen kommen. Sie trugen keine Uniformen, sondern dunkle Anzüge und gestärkte, strahlend weiße Hemden. Jeder der beiden war gut sechs Fuß groß und sportlich gebaut. Ihre Gesichter waren glatt rasiert und die Haare kurz – zumindest soweit Meldon das im Mondlicht erkennen konnte. In der rechten Hand hielt er sein Handy. Er gab die Notrufnummer ein, 911, wählte aber noch nicht, sondern hielt den Daumen über der Wahltaste. Dann ließ er das Fenster herunter und wollte gerade seine Papiere zeigen, doch einer der beiden Männer war schneller als er.
»Mr. Meldon, FBI. Ich bin Special Agent Hope, und mein Partner hier ist Special Agent Reiger.«
Meldon schaute sich den Ausweis an; dann wurde das Ledermäppchen umgeklappt, und die vertraute Dienstmarke des FBI kam zum Vorschein. »Ich verstehe nicht. Worum geht es denn, Agent Hope?«, fragte Meldon.
»Um E-Mails und Telefonanrufe, Sir.«
»Mit wem?«
»Sie müssen uns begleiten.«
»Was? Wohin?«
»In unser Washingtoner Büro.«
»Warum?«
»Zur Befragung«, antwortete Hope.
»Zur Befragung? Worüber denn?«
»Man hat uns nur angewiesen, Sie zu holen, Mr. Meldon. Der stellvertretende Direktor will Sie sehen.«
»Kann das nicht bis morgen warten? Ich bin Staatsanwalt.«
Hope schaute ihn stirnrunzelnd an. »Ihr Hintergrund ist uns durchaus bekannt. Wir sind immerhin das FBI.«
»Ja sicher, aber ich will trotzdem …«
»Sie können den stellvertretenden Direktor gerne anrufen, Sir, aber unsere Befehle lauten, Sie ins Büro zu bringen, und zwar sofort.«
Meldon seufzte. »Ist schon in Ordnung. Darf ich Ihnen in meinem eigenen Wagen hinterherfahren?«
»Sicher. Aber mein Partner wird Sie auf dem Beifahrersitz begleiten.«
»Warum?«
»Einen hervorragend ausgebildeten Agenten auf dem Beifahrersitz zu haben, ist niemals schlecht, Mr. Meldon.«
»Fein.« Meldon steckte das Handy wieder in die Tasche und öffnete die Beifahrertür. Agent Reiger setzte sich neben ihn, während Hope zu seinem Wagen zurückging. Meldon reihte sich hinter der anderen Limousine ein, und gemeinsam fuhren sie in Richtung D. C.
»Ich wünschte, ihr Jungs wärt zu mir ins Büro gekommen. Ich komme gerade erst aus der Stadt.«
Reiger hielt den Blick auf den anderen Wagen gerichtet. »Darf ich Sie fragen, warum Sie so spät noch unterwegs sind, Sir?«
»Wie gesagt … Ich war in meinem Büro und habe gearbeitet.«
»Am Sonntagabend? Und so spät?«
»In meinem Job gibt es keine festen Arbeitszeiten. Ihr Partner hat Telefonate und E-Mails erwähnt. Meinte er damit welche, die an mich gerichtet waren oder die von mir kamen?«
»Vielleicht keins von beiden.«
»Was soll das denn heißen?«, erwiderte Meldon ein wenig gereizt.
»Das FBI schnappt ständig irgendwelches Geschnatter oder Gerüchte aus der Unterwelt auf. Es könnte zum Beispiel sein, dass jemand, den Sie mal angeklagt haben, es Ihnen heimzahlen will. Und wenn ich richtig informiert bin, dann haben Sie sich von einigen Ihrer Mandanten nicht gerade in Freundschaft getrennt, als Sie Ihre Privatkanzlei in New York City aufgegeben haben. Es könnte also auch aus dieser Richtung kommen.«
»Aber das ist schon gut zehn Jahre her.«
»Der Mob hat ein langes Gedächtnis.«
Meldon schaute ängstlich drein. »Falls irgendein Irrer es tatsächlich auf mich abgesehen haben sollte, dann will ich Polizeischutz für meine Familie.«
»Ein Wagen von uns mit zwei Beamten steht bereits vor Ihrem Haus.«
Sie überquerten den Potomac, erreichten D. C., und ein paar Minuten später kam das FBI-Büro in Sicht. Doch kurz bevor sie das Gebäude erreichten, bog der Führungswagen links in eine Gasse ein. Meldon fuhr ihm hinterher.
»Warum hier lang?«, fragte er.
»Sie haben gerade eine neue Tiefgarage für uns geöffnet, von der ein Tunnel direkt ins Büro führt. Das ist schneller, und Garage und Tunnel werden vierundzwanzig Stunden am Tag überwacht. Heutzutage muss man ja auf alles und jeden gefasst sein, von Al-Kaida bis Timothy McVeigh.«
Meldon schaute Reiger nervös an. »Ich verstehe.«
Und das waren Jamie Meldons letzte Worte.
Der starke Stromschlag lähmte ihn im selben Augenblick, als ein großer Fuß auf die Bremse trat. Falls Meldon noch zur Seite hätte schauen können, hätte er gesehen, dass Reiger Handschuhe trug. Und in einem dieser Handschuhe hielt er einen kleinen schwarzen Kasten, aus dem zwei Metallnadeln ragten. Reiger stieg aus dem Wagen, während der zuckende Meldon langsam zur Seite sackte.
Der andere Wagen hatte ein Stück weiter vorne gehalten. Hope sprang heraus und lief zu ihnen. Gemeinsam hoben er und Reiger Meldon aus dem Wagen und legten ihn mit dem Gesicht voran an einen großen Müllcontainer. Reiger zog eine Pistole mit Schalldämpfer. Er trat vor, drückte die Waffe auf Meldons Hinterkopf, schoss und beendete so das Leben des Mannes. Anschließend entsorgten er und Hope die Leiche im Container.
Reiger stieg in den Wagen des toten Staatsanwalts, folgte seinem Partner aus der Gasse hinaus, bog nach links ab und fuhr in Richtung Norden.
Reiger drückte eine Schnellwahltaste auf seinem Handy. Es klingelte nur einmal, dann hob jemand ab. »Alles erledigt«, sagte Reiger. Dann legte er auf und steckte das Handy wieder weg.
Der Mann am anderen Ende der Leitung tat es ihm nach.
Jarvis Burns, dessen schwerer Aktenkoffer gegen sein schlimmes Bein drückte, mühte sich, den anderen hinterherzukommen, die über den Asphalt und die Metallstufen hinauf ins Flugzeug eilten.
Ein Mann mit weißem Haar und ungewöhnlich faltigem Gesicht blieb kurz stehen und schaute zu Burns zurück. Das war Sam Donnelly, der Geheimdienstkoordinator der Regierung, was ihn de facto zum obersten Spion der USA machte.
»Alles okay, Jarv?«, fragte er.
»Alles okay, Herr Direktor«, antwortete Burns.
Zehn Minuten später erhob sich die Air Force One in den klaren Nachthimmel und flog zur Andrews Air Force Base in Maryland zurück.
Kapitel 2
Achtundsechzig … neunundsechzig … siebzig …«
Mace Perrys Brust berührte kurz den Boden; dann setzte sie zum letzten Liegestütz an. Beide Trizepse zitterten vor Anstrengung. Mace streckte sich aus und sog gierig die Luft ein. Ihr stand der Schweiß auf der Stirn. Sie drehte sich herum und begann mit Sit-ups. Einhundert. Zweihundert. Sie verlor den Überblick. Nach fünf Minuten war der Schmerz in ihrem Sixpack nahezu unerträglich; trotzdem machte sie weiter.
Als Nächstes waren Klimmzüge an der Reihe. Als sie zum ersten Mal hierhergekommen war, hatte sie es auf sieben gebracht. Jetzt schaffte sie es, ihr Kinn dreiundzwanzig Mal über die Stange zu ziehen. Mit einem letzten Schrei voller Endorphin gefüllter Wut stand Mace auf und begann durch den großen Raum zu rennen, einmal, zweimal, zehnmal, zwanzigmal. Und mit jeder Runde beschleunigte sie ihr Tempo, bis ihr Tanktop und ihre Shorts vollkommen durchnässt waren und ihr am Leib klebten. Es fühlte sich sowohl gut als auch beschissen an, denn die Fenster waren noch immer vergittert. Mace konnte nicht von hier weglaufen … jedenfalls die nächsten drei Tage noch nicht.
Mace schnappte sich einen alten Basketball, dribbelte damit ein paarmal zwischen ihren Beinen hindurch und sprang dann zum Korb, der eigentlich nur ein Eisenring war, den man provisorisch an ein Brett geschraubt hatte. Sie legte den Ball im Korb ab, ein Dunking, dribbelte dann ein Stück nach links, setzte zu einem Sprungwurf an und versenkte auch diesen Ball. Sie dribbelte weiter durch den Raum, sprang wieder, traf den Korb, und das gelang ihr auch noch ein viertes Mal. Zwanzig Minuten lang versenkte sie Ball um Ball. Sie konzentrierte sich voll und ganz auf das Spiel und versuchte zu vergessen, wo sie war. Mace stellte sich sogar den Jubel der Menge vor, wenn Mace Perry den Siegtreffer erzielte, so wie sie das auch in ihrem letzten Jahr auf der Highschool bei den Schulmeisterschaften getan hatte.
Plötzlich knurrte eine tiefe Stimme: »Trainierst du für Olympia, Perry?«
»Ich trainiere einfach nur«, antwortete Mace, ließ den Ball fallen und drehte sich um. Vor ihr stand eine große, uniformierte Frau mit einem Schlagstock in der Hand. »Aber vielleicht will ich ja auch nur nicht den Verstand verlieren.«
»Nun, dann trainier noch was, und dann sieh zu, dass du deinen Arsch wieder in die Zelle bewegst. Jetzt gibt’s Futter.«
»Okay«, erwiderte Mace. »Ich gehe sofort.«
»Hafterleichterung bedeutet nicht, dass es mit einem Mal gar keine Sicherheitsmaßnahmen mehr gibt. Hast du verstanden?«
»Jaja«, sagte Mace.
»Du bist zwar nicht mehr lange hier, aber im Augenblick gehört dein Arsch noch mir. Klar?«
»Klar!« Mace joggte den Gang hinunter, der zu beiden Seiten von grauen Betonblöcken eingerahmt war, als wären die Insassen nicht schon depressiv genug. Der Gang endete an einer massiven Metalltür mit einem Panzerglasfenster darin. Die Wache auf der anderen Seite der Tür drückte einen Knopf, und die Stahltür öffnete sich mit einem Klicken. Mace ging hindurch. Betonblöcke, Stahlstäbe, massive Türen mit winzigen Fenstern, aus denen wütende Gesichter starrten. Ein Klick zum Reingehen, ein Klick hinaus. Willkommen zur Kerkerhaft für Mace und drei Millionen andere Amerikaner, die den Luxus einer kostenlosen staatlichen Unterkunft von drei Quadratmetern genossen. Alles, was man dafür tun musste, war, das Gesetz zu brechen.
Als Mace sah, welche Wache sie auf der andren Seite der Tür erwartete, murmelte sie: »Scheiße!«
Es war ein älterer Mann, Mitte fünfzig vielleicht, mit bleicher, glänzender Haut, einem Bierbauch, kahl, mit knackenden Knien und Raucherlunge. Er hatte offensichtlich den Posten mit einem anderen Wachmann getauscht, der hier gesessen hatte, als Mace zu ihrem Training gegangen war, und Mace wusste auch, warum. Der Kerl hatte ein Auge auf sie geworfen, und jetzt verbrachte sie viel von ihrer Zeit damit, ihm aus dem Weg zu gehen. Ein paarmal hatte er sie dennoch erwischt, und keines dieser Zusammentreffen war sonderlich angenehm verlaufen.
»Du hast vier Minuten zum Duschen, bevor es zur Futterkrippe und dann wieder in die Zelle geht, Perry!«, schnappte er und stellte sich mit seinem massigen Leib in den schmalen Gang, durch den Mace musste.
»Das habe ich schon schneller geschafft«, erwiderte Mace und versuchte, an ihm vorbeizuspringen, doch das gelang ihr nicht. Der Kerl riss sie herum und drückte sie mit dem Gesicht an die Wand. Dann schob er seine fetten Latschen unter ihre Sohlen, bis sie nur noch auf den Zehenspitzen stand, und Mace spürte die Hand des Fieslings auf ihrem Hintern. Und der Kerl hatte sich genau die richtige Stelle dafür ausgesucht: im toten Winkel der Überwachungskameras.
»Zeit für eine kleine Leibesvisitation«, sagte er. »Ihr Mädels versteckt doch alles Mögliche an den unmöglichsten Orten.«
»Ach ja?«
»Ich kenne eure Tricks.«
»Wie Sie gesagt haben … Ich habe nur vier Minuten.«
»Ich hasse Weiber wie dich«, keuchte der Kerl Mace ins Ohr.
Zigaretten und Fruchtkaugummi sind wirklich eine widerliche Mischung, dachte Mace. Der Mann strich ihr mit der Hand über die Brust und drückte so hart zu, dass ihr die Tränen in die Augen traten.
»Ich hasse Weiber wie dich«, sagte er noch einmal.
»Ja klar. Das sehe ich«, erwiderte Mace.
»Halt’s Maul!«
Mit dem Finger fuhr er ihr durch die Arschspalte.
»Da ist keine Waffe. Ich schwöre.«
»Ich habe gesagt: Halt’s Maul!«
»Ich will nur duschen.« Jetzt mehr denn je.
»Darauf möchte ich wetten«, knurrte der Kerl. »Ja, darauf möchte ich wetten.« Er schob seine Stiefelspitzen weiter unter Mace’ Fersen, bis sie das Gefühl hatte, auf Stöckelschuhen zu stehen. Was hätte sie jetzt nicht für ein Messer gegeben.
Mace schloss die Augen und versuchte, an alles Mögliche zu denken, nur nicht an das, was der Kerl gerade mit ihr machte. Seine Gelüste waren relativ simpel: Wann immer er die Gelegenheit dazu bekam, betatschte er eine Gefangene oder rieb seinen steifen Schwanz an ihr. In der Außenwelt hätte ihm so ein Verhalten mindestens zwanzig Jahre auf der anderen Seite der Gitter eingebracht. Doch hier drinnen stand seine Aussage gegen die der Gefangenen, und ohne DNA-Beweis würde niemand einer der Frauen glauben. Deshalb machte der fette Sack es auch nur mit Kleidung; er tat nur so. Und hätte Mace ihm eins in die Fresse gegeben, hätte ihr das nur ein weiteres Jahr im Knast eingebracht.
Als er fertig war, sagte er: »Du hältst dich für was Besonderes, stimmt’s? Du bist Gefangene Nr. 245, Zellenblock B. Mehr nicht!«
»Ja, das bin ich«, erwiderte Mace, strich ihre Kleidung glatt und betete, dass man möglichst bald bei Mr. Bierbauch Lungenkrebs diagnostizieren würde. Dabei hätte sie am liebsten eine Waffe gezogen und diesem Widerling das Hirn aus dem Schädel geblasen … falls er denn überhaupt eins hatte.
Unter der Dusche schrubbte Mace sich intensiv und schnell. Das war etwas, was man hier drin rasch lernte. Den Initiationsritus hatte Mace schon nach zwei Tagen durchlaufen. Sie hatte der Frau das Gesicht zertrümmert. Die Tatsache, dass Mace meist für sich allein geblieben war und sich Privilegien erkämpft hatte, hatte sie bei ihren Mitgefangenen nicht gerade beliebt gemacht, und das war ein Problem in einer Welt, in der nur der persönliche Ruf zählte. Doch fast zwei Jahre später stand sie immer noch … auch wenn sie nicht wusste, wie sie das geschafft hatte.
Mace machte einfach immer weiter. Jetzt, auf dem Weg zur Freiheit, zählte jede Minute, und Mace schaute dieser Freiheit mit Freude und Angst zugleich entgegen, denn auf dieser Seite der Mauer war nichts garantiert, außer dem Elend.
Kapitel 3
Ein paar Minuten später ging Mace mit nassen Haaren in die Kantine und bekam ein derart matschiges und fettes Essen, das an jedem anderen Ort für ungenießbar erklärt worden wäre – außer vielleicht in einer Schulcafeteria oder in der Touristenklasse eines Billigfliegers. Sie schluckte genug von diesem Müll herunter, um nicht vor Hunger das Bewusstsein zu verlieren, und stand dann auf, um den Rest wegzuwerfen. Als sie an einem Tisch vorbeikam, schoss ein Bein darunter hervor, und Mace stolperte. Scheppernd fiel das Tablett auf den Boden und hinterließ einen hübschen braun-grünen Fleck. Entlang der Wand spannten sich die Wachen an. Die Gefangene, die Mace das Bein gestellt hatte, eine Frau mit Namen Juanita, schaute nach unten, als Mace sich langsam wieder aufrappelte.
»Ungeschickte Schlampe«, knurrte Juanita. Sie drehte sich zu ihrem Gefolge um, denn Juanita war die Königin hier. »Ist sie nicht ungeschickt?«
Und jede ihrer Hofdamen erklärte voller Inbrunst: Ja, Mace sei die ungeschickteste Schlampe, die es je gegeben hatte.
Juanita war sechs Fuß groß, schleppte zweihundertfünfzig Pfund mit sich herum, und ihre Schenkel waren so breit wie die Trätschlappen eines 40-Tonners. Mace wiederum war fünf Fuß sechs groß. Nach außen hin war Juanita weich wie ein Schwamm, während Mace so hart wie die Stahltüren wirkte, die die bösen Mädchen in ihren Zellen hielten. Trotzdem hätte Juanita sie einfach so zerquetschen können. Sie saß wegen Totschlags hier, obwohl die Anklage ursprünglich auf Mord gelautet hatte, denn schließlich hatte sie auch einen Wagenheber, ein Feuerzeug und jede Menge Brandbeschleuniger bei ihrer Tat eingesetzt.
Es hieß, dass es Juanita hier drinnen wesentlich besser gefiel, als es ihr draußen je gefallen hatte, denn hier war sie die Königin. Draußen war sie nur eine einfache Schlampe ohne Schulbildung, die man misshandeln und vögeln konnte, wie man wollte. Außerhalb des Gefängnisses hatte Mace tausend Juanitas gekannt. Juanita war schon verflucht gewesen, kaum dass sie den Mutterleib verlassen hatte.
Das erklärte vermutlich auch, warum Juanita hier drin genug Mist gebaut hatte, um sich zwölf Jahre zusätzlich einzuhandeln, von Körperverletzung bis hin zum Drogenhandel. Wenn sie so weitermachte, würde sie den Knast erst mit den Füßen voran wieder verlassen. Erinnern würde sich dann jedenfalls keiner mehr an sie.
Andererseits war das wohl auch der Grund, warum sie nichts mehr zu verlieren hatte, und das wiederum machte sie so gefährlich, denn sie hatte sich zu einer völligen Soziopathin entwickelt. Und das war es dann auch, was schwabbeliges Fett in Titan verwandelt hatte. Egal, wie viel Klimmzüge Mace auch machte, egal, wie lange und wie weit sie lief, sie würde es nie mit Juanita aufnehmen können. Denn Mace hatte noch immer Mitgefühl, und sie wusste nach wie vor, was Reue bedeutete. Juanita hingegen kannte nichts dergleichen mehr … falls es denn je anders gewesen war.
Mace hielt die Gabel bereit. Kurz schaute sie auf Juanitas fette Hand, die flach auf dem Tisch lag, die orangefarbenen Fingernägel in starkem Kontrast zu der Haut, die von einem Spinnentattoo verunstaltet war. Die Hand … so ein offensichtliches Ziel …
Nein, nicht heute. Ich habe bereits mit Mr. Bierbauch getanzt. Da kann ich auf dich verzichten.
Mace ging weiter und schob das Tablett mit dem Geschirr in einen Regalwagen.
Erst als sie den Raum verließ, drehte sie sich noch einmal zu Juanita um und sah, dass die Frau sie noch immer beobachtete. Den Blick stur auf Mace gerichtet, flüsterte Juanita einer ihrer Frauen etwas zu, einem Klappergestell mit Namen Rose. Rose saß hier drin, weil sie das Sexspielzeug ihres Mannes auf der Toilette einer Bar fast mit dem Angelmesser ihres Kerls geköpft hatte. Mace hatte gehört, dass Rose’ Mann nicht zu ihrem Prozess gekommen war; allerdings nur, weil er so wütend gewesen war, dass sie sein bestes Messer ruiniert hatte. Das war definitiv eher ein Stoff für Jerry Springer als für Oprahs Couch.
Mace sah, wie Rose nickte und grinste und dabei die neunzehn Zähne entblößte, die ihr geblieben waren. Es war schwer zu glauben, dass sie einst ein hübsches kleines Mädchen gewesen war, das auf dem Knie seines Vaters gesessen und nicht gerade davon geträumt hatte, einhundertachtzig Monate im Knast zu verbringen und ständig einer Königinmutter mit der Psyche eines Jeffrey Dahmer hinterherlaufen zu müssen.
Rose hatte Mace am zweiten Tag ihrer Haft besucht und ihr erklärt, dass Juanita der Messias sei, und was der Messias wollte, das würde er auch bekommen. Wenn die Zellentür sich öffnete, und der Messias erschien, dann würde ihr das gefallen. Das waren die Regeln hier. So war das nun mal in Juanita-Land. Mace hatte Juanitas Angebot mehrmals abgelehnt, doch bevor die Situation hatte außer Kontrolle geraten können, hatte Juanita einen Rückzieher gemacht. Mace glaubte zu wissen, warum, aber sie war sich nicht sicher. Doch wie auch immer … In der Folge davon hatte sie zwei Jahre lang jeden Tag ums Überleben gekämpft und dabei all ihren Verstand und all ihre neu entwickelten Muskeln einsetzen müssen.
Mace trottete zum Zellenblock B, und um exakt sieben Uhr schlossen sich dort die Türen. Mace setzte sich auf das stählerne Bett. Die Matratze war so dünn, dass Mace fast durch das verdammte Ding hätte hindurchschauen können. Zwei Jahre hatte sie nun hier geschlafen, und inzwischen kannte ihr Körper jede Delle und jede Kante in dem alten Metall. Sie hatte noch drei Tage. Nun, jetzt eigentlich nur noch zwei, wenn sie denn die Nacht überstand.
Juanita wusste, dass Mace bald entlassen werden würde. Deshalb hatte sie ihr auch ein Bein gestellt. Sie wollte sie provozieren. Sie wollte nicht, dass Mace ging. Also saß Mace in ihrer Zelle und kauerte sich in eine Ecke. Sie hatte die Fäuste geballt, und in beiden hielt sie etwas Glänzendes und Scharfes, das sie normalerweise an einem Ort versteckte, wo noch nicht einmal die Wachen es finden konnten. Die Dunkelheit kam, gefolgt von jenem Teil der Nacht, in dem man glaubte, das Gute sei tot, denn das Böse an diesem Ort war überwältigend. Und dann wartete Mace noch ein wenig mehr, denn sie wusste, dass sich ihre Zellentür irgendwann öffnen würde, wenn die Wachen der Nachtschicht in die andere Richtung schauten, bestochen mit Sex, Drogen oder beidem.
Und dann würde der Messias erscheinen, und er hätte nur ein Ziel: Mace sollte nie wieder einen Tag in Freiheit erleben. Zwei Jahre lang hatte Mace sich auf diesen Augenblick vorbereitet. Mit jedem Atemzug füllte sich ihr stählerner Körper mit Adrenalin.
Und drei Minuten später glitt die Zellentür auf, und da war sie.
Nur war es nicht Juanita.
Diese Besucherin war zwar auch groß, über sechs Fuß, und sie trug polierte Stiefel. Aber die Uniform war nicht die der Vollzugsbeamten. Sie war vollkommen makellos, nicht ein Fleck und nicht eine Knitterfalte. Das Haar der Frau war blond und roch so gut, wie es hier drinnen niemals riechen konnte.
Die Besucherin trat einen Schritt vor, und das Licht reichte gerade so aus, dass Mace die vier Sterne auf den Schultern erkennen konnte. Es gab elf Ränge im Metropolitan Police Department von D. C., und diese vier Sterne repräsentierten den höchsten.
Mace hob den Blick. Sie hatte noch immer die Fäuste geballt, als die Frau sie anschaute.
»Hey, Schwesterlein«, sagte die Polizeichefin von D. C. »Was hältst du davon, wenn wir von hier verschwinden?«
Kapitel 4
Roy Kingman machte eine Finte und spielte den Ball dann durch die Beine eines Verteidigers und unter den Korb, wo ein Riese namens Joachim den Punkt machte. Der Kerl hatte Raketen in den Beinen und kam beim Sprung mit dem Kopf fast über den Korb.
»Das wären dann Einundzwanzig, und damit bin ich fertig«, verkündete Roy, und der Schweiß rann ihm übers Gesicht.
Die zehn jungen Männer suchten ihre Sachen zusammen und schlurften zur Dusche. Es war halb sieben Uhr morgens, und Roy hatte schon drei Spiele fünf gegen fünf in seinem Sportclub in Nordwest D. C. gespielt. Es war nun acht Jahre her, dass er zum ersten Mal das Trikot der University of Virginia Cavaliers übergestreift hatte, um als Point Guard für sie zu spielen. Damals war er »nur« sechs Fuß zwei gewesen und hatte noch keine Raketen in den Beinen gehabt. Trotzdem hatte Roy im letzten Jahr an der Uni mit harter Arbeit, Können und auch ein wenig Glück sein Team zur ACC-Meisterschaft geführt. Mit diesem Glück war es jedoch vorbei gewesen, als sie im Viertelfinale der NCAA auf das wie immer starke Kansas gestoßen waren.
Der Point Guard der Jayhawks war so schnell und wendig wie eine Katze gewesen. Er hatte einen förmlich schwindlig gespielt, und trotz seiner lediglich sechs Fuß Körpergröße hatte er den Ball mit Leichtigkeit dunken können. Und dann hatte er auch noch zwölf Dreier geworfen – und das zumeist mit Roys Hand in seinem Gesicht –, zehn Assists erzielt und den Point Man der Cavs so unter Druck gesetzt, dass der mehr Rückpässe gespielt als Körbe geworfen hatte. So hatte Roy seine vierjährige Karriere im College-Basketball eigentlich nicht in Erinnerung behalten wollen.
Roy duschte und zog sich ein weißes Polohemd, eine graue weite Hose und eine blaue Sportjacke an, seine typische Arbeitskleidung. Dann warf er die Sporttasche in den Kofferraum seines silbernen Audi und fuhr zur Arbeit. Es war erst kurz nach sieben, doch in seinem Job arbeitete man lange.
Um halb acht fuhr Roy in die Garage seines am Wasser gelegenen Bürogebäudes in Georgetown. Er schnappte sich die Aktentasche vom Beifahrersitz, schloss seinen Audi per Fernsteuerung ab und fuhr mit dem Aufzug in die Lobby. Dort begrüßte er Ned, den dicklichen Mittdreißiger, der hier als Wachmann arbeitete und sich gerade einen Hotdog in den Mund stopfte, während er in der neuesten Ausgabe des Muscle Mag blätterte. Wenn Ned von seinem Stuhl aufstehen müsste, um einen Bösewicht zu verfolgen, würde er den Kerl nicht nur nicht einholen, sondern anschließend auch eine Mund-zu-Mund-Beatmung benötigen; das wusste Roy.
Na ja, solange ich das nicht machen muss.
Roy betrat den Büroaufzug und drückte den Knopf für den sechsten Stock, nachdem er seine Keycard durch den Kartenleser gezogen hatte. Eine Minute später erreichte er die Kanzlei. Da Shilling & Murdoch offiziell erst um halb neun öffneten, musste Roy seine Keycard auch an der großen Glastür benutzen.
Shilling & Murdoch beschäftigten achtundvierzig Anwälte in D. C., zwanzig in London und zwei in Dubai. Roy war schon an allen drei Orten gewesen. Er war im Privatflugzeug irgendeines Scheichs in den Nahen Osten geflogen, der mit einem von Shillings Mandanten Geschäfte machte. Es war ein Airbus A380 gewesen, die größte Passagiermaschine der Welt. Sie konnte entweder sechshundert Normalsterbliche oder zwanzig außergewöhnlich Glückliche im ultimativen Luxus transportieren. Roys Suite an Bord hatte ein Bett, eine Couch, einen Schreibtisch, einen Computer, eine Minibar und einen Fernseher mit zweihundert Kanälen und einer schier endlosen Online-Videothek gehabt. Auch hatte man Roy eine persönliche Assistentin zugeteilt, in seinem Fall eine junge Jordanierin, die dermaßen perfekt gebaut gewesen war, dass er den ganzen Flug über immer wieder auf den Rufknopf gedrückt hatte, nur um sie sich anzuschauen.
Roy ging den Flur hinunter und zu seinem Büro. Die Räumlichkeiten der Kanzlei waren nett, aber nicht protzig, und im Vergleich zum Innenleben des A380 sogar der reinste Slum. Doch Roy brauchte ohnehin nur einen Stuhl, einen Schreibtisch, einen Computer und ein Telefon. Der einzige Luxus in seinem Büro war ein Basketballring an der Innenseite der Tür, durch den Roy immer einen kleinen Gummiball warf, während er telefonierte oder nachdachte.
Als Gegenleistung für zehn, zwölf Stunden Arbeit pro Tag und gelegentliche Wochenendarbeit bekam Roy 220 000 Dollar pro Jahr an Grundgehalt zuzüglich eines Bonus von mindestens 60 000 Dollar, einer goldenen Krankenversicherungskarte und eines Monats bezahlten Urlaubs, den er nach Herzenslust genießen konnte. Gehaltserhöhungen betrugen im Durchschnitt zehn Prozent pro Jahr; also würde er bei seinem Festgehalt demnächst die 300 000-Dollar-Grenze überschreiten. Das war nicht schlecht für einen Ex-Collegebasketballer, der gerade mal fünf Jahre von der Uni war und erst vierundzwanzig Monate in dieser Kanzlei arbeitete.
Roy machte heutzutage nur noch Vergleiche; also setzte er auch nie einen Fuß in einen Gerichtssaal. Und das Beste war, dass er sich auch nie eine Arbeitsstunde aufschreiben musste, denn die Kanzlei hatte für all ihre Mandanten die Generalvertretung, und Dienstleistungen wurden pauschal abgerechnet. Natürlich konnte sich das ändern, wenn etwas Außergewöhnliches geschah, doch solange Roy hier war, war das noch nie passiert. Drei Jahre lang hatte Roy seine eigene Einmannkanzlei gehabt. Am liebsten wäre er Offizialverteidiger in D. C. geworden, doch diese Beamtenstellen waren dünn gesät und die Konkurrenz groß. Also hatte Roy sich stattdessen als offiziell eingetragener Strafverteidiger verdingt. Das klang zwar wichtig, bedeutete de facto aber nur, dass sein Name auf einer vom Gericht anerkannten Liste von Anwälten stand, und das wiederum hatte es ihm erlaubt, die Krümel aufzusammeln, die vom Teller der Offizialverteidiger gefallen waren.
Roy hatte seine Einzimmerkanzlei ein paar Blocks vom Obersten Gericht entfernt gehabt. Sie war Teil eines größeren Büros gewesen, das er sich mit sechs anderen Anwälten geteilt hatte. Und das war nicht das Einzige gewesen, was sie sich geteilt hatten. Sie hatten auch nur eine Sekretärin für alle gehabt, eine Rechtsanwaltsgehilfin, die dort in Teilzeit gearbeitet hatte, eine Kopiermaschine, ein Fax und Gallonen von schlechtem schwarzem Kaffee. Da die meisten von Roys Mandanten damals schuldig gewesen waren, hatte er die meiste Zeit damit verbracht, irgendwelche Deals mit den Staatsanwälten auszuhandeln. Und diese Staatsanwälte gingen nur vor Gericht, wenn sie jemandem mal so richtig in den Arsch treten wollten, weshalb sie sich dafür auch nur solche Fälle aussuchten, in denen die Beweislage mehr als nur eindeutig war.
Früher hatte Roy davon geträumt, irgendwann einmal in der NBA zu spielen, doch dann hatte er akzeptiert, dass es eine gefühlte Million Spieler gab, die besser waren, als er je sein würde, und so gut wie keiner von denen schaffte den Sprung ins Profileben. Das war der Hauptgrund gewesen, warum Roy sich schließlich für Jura eingeschrieben hatte: Seine Ballbeherrschung war einfach zu schlecht für die Profis, und Dreier konnte er auch nicht am Fließband werfen. Gelegentlich fragte sich Roy, ob viele Anwälte wohl ein ähnliches Schicksal hatten wie er.
Nachdem er die Arbeit für seine Sekretärin herausgelegt hatte, die gleich kommen musste, brauchte er erst einmal einen Kaffee. Es war Punkt acht, als er in die Küche ging und den Kühlschrank öffnete. Das Küchenpersonal verwahrte hier den Kaffee, um ihn länger frisch zu halten.
Roy sollte seinen Kaffee jedoch nicht bekommen.
Stattdessen fiel ihm eine Frau aus dem Kühlschrank entgegen.
Kapitel 5
Sie fuhren in einer schwarzen Limousine, gefolgt von einem SUV voller Sicherheitskräfte. Mace schaute über die Schulter zu ihrer älteren Schwester Elizabeth, die von ihren Freunden und ein paar Kollegen Beth genannt wurde. Die meisten Leute nannten sie jedoch einfach »den Chief«.
Mace drehte den Kopf und schaute zu dem Wagen, der ihnen folgte. »Was soll die Karawane?«, fragte sie.
»Da gibt es keinen besonderen Grund.«
»Und warum bist du ausgerechnet heute Nacht gekommen?«
Beth Perry schaute zu dem uniformierten Fahrer vor sich. »Keith, machen Sie das Radio an. Ich möchte nicht, dass Sie einschlafen. Auf diesen Straßen stürzen wir sonst noch ab.«
»Jawohl, Chief.« Pflichtbewusst schaltete Keith das Radio ein, und Kim Carnes’ raue Stimme drang bis zum Rücksitz, als sie »Bette Davis Eyes« krächzte.
Beth drehte sich zu ihrer Schwester um. Als sie sprach, hatte sie die Stimme gesenkt. »Auf diese Art meiden wir die Presse. Und nur damit du’s weißt: Ich hatte vom ersten Tag an Augen und Ohren an diesem Ort und habe versucht, mein Bestes für dich zu tun.«
»Deshalb hat die fette Kuh also einen Rückzieher gemacht.«
»Du meinst Juanita?«
»Ich meine die fette Kuh.«
Beth senkte ihre Stimme noch mehr. »Ich habe mir gedacht, dass sie vielleicht ein Abschiedsgeschenk für dich haben. Deswegen bin ich auch ein wenig früher gekommen.«
Es irritierte Mace, dass die Polizeichefin in ihrem eigenen Wagen das Radio anstellen lassen und flüstern musste, aber sie verstand den Grund dafür. In Beths Welt hatten die Wände Ohren. Bei jemandem in ihrer Stellung ging es nicht mehr um Verbrechensbekämpfung, sondern um Politik.
»Wie hast du es geschafft, dass ich zwei Tage vor meinem Termin entlassen worden bin?«
»Haftverkürzung wegen guter Führung. Du hast dir damit ganze achtundvierzig Stunden zusätzliche Freiheit verdient.«
»Nach zwei Jahren kommt mir das jetzt nicht wirklich wie eine Leistung vor.«
»Das ist es auch nicht.« Beth tätschelte Mace den Arm und lächelte. »Nicht, dass ich etwas anderes von dir erwartet hätte.«
»Und wo soll ich jetzt hin?«
»Ich dachte, du könntest bei mir bleiben. Ich habe genug Platz. Die Scheidung ist seit sechs Monaten durch. Ted ist schon lange weg.«
Die achtjährige Ehe von Mace’ Schwester mit Ted Blankenship hatte schon lange erste Auflösungserscheinungen gezeigt, bevor Mace ins Gefängnis gekommen war. Sie hatten keine Kinder, und irgendwann hatte der Mann seine Frau einfach nur gehasst, weil sie viel klüger und erfolgreicher war, als er es je sein würde.
»Ich hoffe, dass ich in den Knast gekommen bin, hat nichts mit dem Ende eurer Ehe zu tun.«
»Das Einzige, was etwas damit zu tun hat, ist mein schlechter Geschmack, was Männer betrifft. Aber wie auch immer … Jetzt bin ich jedenfalls wieder Beth Perry.«
»Wie geht’s Mom?«
»Sie jagt noch immer dem Geld hinterher und nervt wie eh und je.«
»Sie hat mich nicht einmal besucht oder mir auch nur einen einzigen Brief geschrieben.«
»Denk nicht weiter darüber nach, Mace. So ist sie nun mal, und weder du noch ich werden die Frau ändern.«
»Was ist mit meiner Wohnung?«
Beth schaute aus dem Fenster, und Mace sah in der spiegelnden Scheibe, wie ihre Schwester die Stirn runzelte. »Ich habe sie so lange gehalten, wie ich konnte, aber die Scheidung hat mich eine Menge Geld gekostet. Ich muss Ted sogar noch Unterhalt zahlen. Die Presse hat sich wie ein Geier darauf gestürzt, obwohl die Akten eigentlich unter Verschluss hätten bleiben sollen.«
»Ich hasse die Presse. Und nur um es mal erwähnt zu haben: Ich habe auch Ted immer gehasst.«
»Wie auch immer …« Beth seufzte. »Die Bank hat deine Wohnung vor vier Monaten zwangsräumen lassen.«
»Ohne mich zu informieren? Und das können sie so einfach?«
»Du hast mir alle Vollmachten gegeben, bevor du in den Knast gegangen bist. Also haben sie sich bei mir gemeldet.«
»Und du konntest mir wohl nicht Bescheid sagen, hm?«
Beth funkelte Mace an. »Was genau hättest du denn getan, wenn ich dir was gesagt hätte?«
»Es wäre zumindest nett gewesen, davon zu erfahren«, knurrte Mace.
»Tut mir leid«, sagte Beth. »Es war eine Ermessensentscheidung. Aber wenigstens hast du keine Schulden mehr deswegen.«
»Ist mir denn überhaupt noch was geblieben?«
»Nachdem wir deine Anwaltsrechnungen bezahlt hatten …«
»Wir?«
»Das war der andere Grund, warum ich deine Wohnung nicht mehr habe halten können. Anwälte bekommen immer ihr Geld. Und du hättest das Gleiche für mich getan.«
»Nur dass du nie in so eine Scheißsituation gekommen wärst.«
»Möchtest du auch noch die anderen schlechten Nachrichten hören?«
»Warum nicht? Wir sind doch gerade so schön dabei.«
»Während der Krise ist dein Investmentfonds, genau wie alle anderen auch, den Bach runtergegangen. Deine Polizeipension war im selben Augenblick Geschichte, als du verurteilt worden bist. Du hast insgesamt eintausendzweihundertfünfzehn Dollar auf deinem Konto. Ich habe deine Gläubiger bequatscht, deine Schulden auf ungefähr sechs Riesen zu reduzieren und die Raten erst dann einzufordern, wenn du wieder auf eigenen Füßen stehst.«
Mace schwieg eine ganze lange Minute, während der Wagen sich die Interstate hinaufschlängelte, die sie irgendwann nach Virginia und dann nach D. C. bringen würde. »Und das hast du alles in deiner Freizeit gemacht«, sagte sie schließlich, »und gleichzeitig noch die zehntgrößte Polizeibehörde im Land geleitet und die Sicherheitsmaßnahmen für die Amtseinführung des Präsidenten geregelt. Niemand hätte das besser machen können. Das weiß ich. Und hätte ich stattdessen deine Finanzen regeln müssen, würdest du jetzt vermutlich in China in einem Schuldturm sitzen.« Mace legte ihrer Schwester die Hand auf den Arm. »Danke, Beth!«
»Eine Sache habe ich dir aber doch erhalten können«, sagte Beth.
»Und das wäre?«
»Das wirst du sehen, wenn wir dort sind.«
Kapitel 6
Die Sonne ging auf, als die Limousine in eine ruhige Sackgasse einbog, die in einem Wendehammer endete. Ein paar Sekunden später hielten sie vor der Einfahrt eines gemütlich aussehenden zweistöckigen Ziegelhauses mit großer, überdachter Veranda. Das Einzige, was darauf hindeutete, dass hier die ranghöchste Polizistin von D. C. wohnte, waren die Sicherheitsbeamten draußen und die Straßensperren, die man beiseitegeschoben hatte, als sie in die Straße gefahren waren.
»Wozu zum Teufel ist das denn, Beth?«, fragte Mace. »Du hattest doch noch nie Polizeischutz am Haus. Und normalerweise hattest du auch keinen Fahrer.«
»Leider haben die böse Welt und der Bürgermeister darauf bestanden.«
»Hat es Drohungen gegeben?«
»Ich bekomme jeden Tag Drohungen – egal ob im Präsidium oder daheim.«
»Ich weiß. Aber was hat sich geändert?«
»Darüber brauchst du dir nicht den Kopf zu zerbrechen.«
Der Wagen fuhr auf das Grundstück, und Beth Perry ließ das Fenster herunter, um ein paar Worte mit dem diensthabenden Beamten zu wechseln. Dann ging sie mit Mace ins Haus. Mace ließ die Tasche fallen, die alles enthielt, was sie mit ins Gefängnis gebracht hatte, und schaute sich um. »Willst du mir wirklich nicht die Wahrheit sagen, was diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen betrifft?«
»Da gibt es nicht viel zu erzählen. Es gefällt mir nicht sonderlich, aber wie gesagt … Der Bürgermeister hat darauf bestanden.«
»Aber warum hat er …?«
»Lass es, Mace!«
Die Schwestern starrten einander an, und schließlich gab Mace nach.
»So … Wo ist Blind Man?«
Wie aufs Stichwort kam ein alter, fünfzig Pfund schwerer Köter mit grau-schwarzem Fell hereingetrottet. Als er die Luft schnüffelte, stieß er ein Jaulen aus und sprang zu Mace. Mace kniete sich hin, kraulte Blind Man hinter den Ohren, drückte den Hund an sich und vergrub die Nase in dem weichen Fell, während Blind Man ihr glücklich das Ohr leckte.
»Ich glaube, ich habe den Burschen genauso vermisst wie dich«, bemerkte Mace.
»Er hat sich förmlich nach dir verzehrt.«
»Hey, Blind Man, hast du mich vermisst? Ja, hast du mich vermisst?«
»Ich kann noch immer nicht glauben, dass wir ihn mal einschläfern lassen wollten, nur weil er nicht sehen kann. Dabei hat dieser Hund eine so gute Nase, dass er sich auch mit Adleraugen nicht besser orientieren könnte.«
Mace stand auf, streichelte Blind Man aber weiter den Kopf. »Du hast dir ja schon immer die schwierigen Fälle ins Haus geholt. Ich denke da nur an die taube Katze und Bill, den dreibeinigen Boxer.«
»Alles und jeder verdient eine Chance.«
»Gilt das auch für kleine Schwestern?«
»Du hast an Gewicht verloren«, bemerkte Beth. »Aber ansonsten scheinst du in guter Form zu sein.«
»Ich habe jeden Tag trainiert«, antwortete Mace. »Das ist das Einzige, was mich hat weitermachen lassen.«
Beth schaute sie seltsam an. Es dauerte ein wenig, bis Mace den Blick deuten konnte. »Ich bin clean, Beth. Ich war clean, als ich in den Knast gekommen bin, und auch drinnen habe ich nichts angefasst, obwohl es da mehr Drogen gab, als du dir in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst – das kann ich dir sagen. Ich habe Meth gegen Endorphine getauscht. Wenn du willst, kannst du eine Urinprobe haben.«
»Will ich nicht, aber dein Bewährungshelfer wird eine verlangen, um deinen Zustand nach der Entlassung zu ermitteln.«
Mace atmete tief durch. Sie hatte ganz vergessen, dass sie ja noch ein volles Jahr auf Bewährung war, weil es bei ihrer Verurteilung ein paar Komplikationen gegeben hatte. Wenn sie jetzt Mist baute, konnten sie sie noch einmal für weit mehr als vierundzwanzig Monate wegsperren.
»Ich kenne den Kerl«, sagte Beth. »Er ist okay. Spielt fair. Nächste Woche hast du deinen ersten Termin bei ihm.«
»Ich dachte, das ginge schneller.«
»Das stimmt normalerweise auch, aber ich habe ihm gesagt, dass du bei mir wohnen wirst.«
Mace schaute ihrer Schwester in die Augen. »Gibt es schon irgendetwas Neues darüber, wer mich in die Pfanne gehauen hat?«
»Lass uns später darüber reden. Aber ich habe da so ein paar Ideen.«
Da war ein Unterton in Beths Stimme, und Mace beschloss, ihr nicht zu widersprechen. »Ich verhungere«, sagte Beth. »Aber kann ich vorher noch duschen? Wenn man zwei Jahre lang nur zwei Minuten pro Tag kalt duschen kann, dann hat man einen gewissen Nachholbedarf.«
»Handtücher, Seife und Shampoo sind oben. Der Rest deiner Kleider ist im Gästezimmer.«
Dreißig Minuten später setzten sich die beiden Schwestern in die große, luftige Küche und aßen das Frühstück aus Rührei, Kaffee, Bacon und Toast, das Beth gemacht hatte. Die Polizeichefin hatte ihre Uniform gegen eine Jeans und ein Sweatshirt getauscht, auf dem »FBI Academy« stand. Das Haar hatte sie sich zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden, und sie war barfuß. Mace trug ein weißes langärmeliges Hemd und eine Cordhose, die sie zuletzt vor über zwei Jahren getragen hatte. Doch während die Hose ihr früher zu eng gewesen war, schlotterte sie ihr nun um die Hüfte.
»Du wirst neue Sachen brauchen«, sagte ihre Schwester. »Was wiegst du jetzt? Hundertfünfzehn?«
»Etwas weniger.« Mace strich mit dem Daumen über den Hosenbund. »Mir war ja gar nicht bewusst, dass ich früher so dick war.«
»Ja, klar. Richtig dick. Du warst doch schon damals fitter als die meisten anderen. Donuts hat es für dich nie gegeben.«
Sonnenlicht fiel durch die Fenster, und Beth beobachtete, wie Mace sich bei jedem Bissen Zeit ließ und den Kaffee ganz langsam trank. Als Mace den Blick ihrer Schwester bemerkte, stellte sie den Becher beiseite und legte die Gabel auf den Tisch.
»Das ist erbärmlich. Ich weiß«, sagte Mace.
Beth beugte sich über den Tisch und legte die schlanken Finger um den Unterarm ihrer Schwester. »Ich kann dir gar nicht sagen, wie schön es ist, dich sicher wieder bei mir zu haben. Es ist so eine Erleichterung und …«
Beth versagte die Stimme, und Mace sah, wie ihrer großen Schwester plötzlich die Tränen in die Augen traten. Wie Mace, so hatte auch Beth als Streifenpolizistin in den übelsten Vierteln von D. C. angefangen, in die sich nie ein Tourist verirrte, es sei denn, er war seines Lebens überdrüssig.
Die Polizeichefin ging zur Arbeitsplatte, goss sich eine weitere Tasse Kaffee ein und schaute aus dem Fenster und in den kleinen Hinterhof, während sie um Fassung rang. Mace wandte sich wieder ihrer Mahlzeit zu. Zwischen zwei Bissen fragte sie: »Und? Was hast du nun für mich verwahrt?«
Erleichtert ob dieses Themenwechsels sagte Beth: »Komm mit, dann zeige ich es dir.«
Sie öffnete die Tür zur Garage und schaltete das Licht mit dem Ellbogen an. Es war eine Doppelgarage, und auf einem Stellplatz stand Beths schwarzer Jeep Cherokee. Und das Fahrzeug daneben zauberte Mace ein Grinsen aufs Gesicht.
Es war ein Motorrad, eine Ducati Sport 1000 S in Kirschrot. Es war das Einzige, wofür Mace jemals bereit gewesen war, richtig viel Geld in die Hand zu nehmen. Und trotzdem hatte sie es geradezu spottbillig bekommen. Sie hatte das Motorrad von einem untersetzten Cop gekauft, dem in der Midlifecrisis plötzlich klar geworden war, dass er schlicht Angst hatte, das verdammte Ding zu fahren.
Mace betrat die Garage und strich mit der Hand über die Hightechgabel von Marzocchi, die aus wunderbarem, poliertem Aluminium gefertigt war. Dann glitten ihre Finger über die Sachs-Stoßdämpfer, die selbst auf dem rauesten Terrain eine sichere Fahrt garantierten. Sie waren so gut, dass Mace früher oft ihre Privatmaschine benutzt hatte, wenn sie Kriminelle abseits der Straße hatte verfolgen müssen. Das abnehmbare Heck verlieh dem Bike ein sportliches, aerodynamisches Aussehen, und darunter verbarg sich ein zweiter Sitz, sodass man notfalls noch jemanden mitnehmen konnte. Mace hatte die Maschine jedoch stets allein gefahren. Sie hatte ein Sechsganggetriebe, eine elektronische Einspritzanlage, L-Twin-Zylinder, und der Motor brachte zweihundert Pferdestärken bei achttausend Umdrehungen auf die Straße. Mace hatte die Ducati schon länger, als sie je einen Mann gehabt hatte, denn sie liebte diese Maschine weit mehr, als sie je einen Kerl geliebt hatte, mit dem sie ausgegangen war.
»Wie haben meine Gläubiger das denn übersehen?«
»Ich habe die Maschine auf mich überschrieben. Also hatten sie keinen Zugriff mehr darauf. Begründet habe ich das als ›Bezahlung‹ dafür, dass ich deine finanziellen Angelegenheiten geregelt habe.« Sie hielt Mace den Schlüssel hin. »Gilt dein Führerschein noch?«
»Selbst wenn nicht, könntest du mich nicht vom Fahren abhalten.«
»Es ist wirklich clever, das ausgerechnet der Polizeichefin zu sagen«, neckte Beth sie.
»Ich bin gleich wieder zurück.«
Mace zog den Helm an.
»Warte mal eine Sekunde.«
Mace drehte sich noch einmal um, und Beth warf ihr die schwarze Lederjacke zu, die sie damals zusammen mit dem Bike gekauft hatte. Mace zog sie an. Die Jacke saß ein wenig eng an den inzwischen breiter gewordenen Schultern, aber das fühlte sich einfach wunderbar an, denn diese Schultern waren jetzt frei, genau wie der Rest auch.
Mace startete den Motor. Von der Küchentür war Kratzen zu hören, und Blind Man begann zu jaulen.
»Er hat es schon immer gehasst, wenn du das Ding angelassen hast«, brüllte Beth über das Brüllen des Motors hinweg.
»Aber Gott! Hört sich das geil an!«, schrie Mace zurück.
Beth hatte bereits auf den Knopf gedrückt, um das Garagentor hochzufahren. Und das war auch gut so, denn ein paar Sekunden später raste die Ducati mit lautem Brüllen in die kühle Morgenluft hinaus und hinterließ eine schwarze Reifenspur auf dem Zement.
Bevor die Sicherheitsbeamten auch nur reagieren und die Sperren wegräumen konnten, hatte Mace sich bereits um sie herumgeschlängelt. Die Maschine reagierte makellos auf jede noch so kleine Lenkbewegung, als wäre sie mit Mace verschmolzen. Und dann verschwand Mace in einer italienischen Abgaswolke.
Die Beamten kratzten sich verwirrt die Köpfe, drehten sich um und schauten zu ihrem Chief. Beth prostete ihnen ob ihrer ach so großen Wachsamkeit spöttisch mit dem Kaffeebecher zu und ging wieder ins Haus. Das Garagentor ließ sie jedoch auf. Vor vier Jahren war so ein Tor mal zu Bruch gegangen, als ihre kleine Schwester ein wenig überschwänglich bei ihr aufgetaucht war. Diesen Fehler würde sie nicht noch einmal begehen.
Kapitel 7
Mace wusste, dass D. C. jene Art von Stadt war, wo man in einem Block so sicher war wie in einer Kleinstadt in Süd-Kansas am Sonntagmorgen vor der Methodistenkirche. Doch einen Block weiter sollte man besser eine kugelsichere Weste tragen, wenn man nicht von irgendwelchen Gangs niedergemäht werden wollte. Und genau dort wollte Mace hin. Ihr Gehirn war schlicht darauf trainiert, in Richtung der Schießerei zu laufen anstatt weg davon … genau wie bei ihrer Schwester.
Mace hatte gerade an einem Fall gearbeitet, als eine Stelle bei der Abteilung für Drogendelikte und Sonderermittlungen frei geworden war. Sie hatte sich beworben. Ihre Verhaftungsquote war atemberaubend, und sie war so gut wie nie zu spät zum Dienst erschienen oder hatte sich sonst etwas zu Schulden kommen lassen. Sie hatte bei der 4D Mobile Force Vice gearbeitet, die man inzwischen Focused Mission Unit nannte, was Mace’ Meinung nach jedoch nicht annähernd so cool klang.
Mace war Zivilstreife gefahren, was im Grunde genommen hieß, man fuhr so lange herum, bis man einen Dealer sah, sprang raus und schnappte sich den Kerl. In bestimmten Gegenden von D. C. fand man die Typen an jeder Ecke. Mace hatte so viele von denen einbuchten können, wie sie wollte. Das Einzige, was sie manchmal zurückgehalten hatte, war der damit verbundene Papierkram und die Vorstellung, sich durch unzählige Gerichtsverhandlungen quälen zu müssen.
Sie hatte sich besonders an den Straßendealern festgebissen, die den Stoff kiloweise verkauften und zwei Riesen am Tag machten. Natürlich waren das im Endeffekt auch nur kleine Fische, aber sie erschossen auch Leute, wenn ihnen danach war. Und dann waren da die »Rubbler«, die entweder einen Rock Crack prüften oder mit einem Rubbellos beschäftigt waren – das war de facto die gleiche Handbewegung. Und dort, wo Mace arbeitete, wurden viele Rubbellose verkauft. Allerdings war sie irgendwann so gut geworden, dass sie anhand der Bewegung des Zeigefingers aus zwanzig Fuß Entfernung hatte erkennen können, ob der Betreffende einen Rock oder ein Los in der Hand hielt. Später hatte sie dann undercover in der mörderischen Drogenhölle des Sechsten und Siebten Bezirks gearbeitet. Und genau da hatte all der Ärger auch begonnen, und Mace hatte zwei ganze Jahre ihres Lebens verloren.
Mace flog förmlich durch ein Viertel nach dem anderen und genoss ihren ersten freien Tag seit fast vierundzwanzig Monaten. Ihr dunkles Haar ragte unter dem Rennhelm heraus und flatterte im Wind, während sie vom Haus ihrer Schwester, der Festung der Einsamkeit, durch die verhältnismäßig sicheren Teile von D. C. raste und von dort durch die Gegenden, in denen der Kampf zwischen Räuber und Gendarm noch nicht entschieden war, hin zu jenen Vierteln, wo Vater Staat bis dato noch nicht einmal einen Brückenkopf hatte errichten können.
Das war der Sechste Bezirk – oder »Six-D« im sauber unterteilten Lehen des Metropolitan Police Department. Hätte Mace hundert Dollar für jeden nackten PCP-Zombie bekommen, den sie hier nachts schreiend durch die Straßen hatte laufen sehen, dann wäre ihr heute scheißegal gewesen, dass sie durch die Haft ihre Pensionsberechtigung verloren hatte. In bestimmten Teilen von Six-D standen mit Brettern vernagelte Häuser, Abrissgebäude und ausgeschlachtete Autos auf Ziegelsteinen. Nachts ging hier nahezu an jeder Ecke etwas Illegales vor, und Kugeln flogen hier genauso viele wie Moskitos. Alle ehrlichen, hart arbeitenden Menschen – und das waren die meisten Leute, die hier lebten – blieben nachts einfach drinnen und hielten den Kopf geduckt.
Selbst bei Tageslicht schauten die Menschen auf der Straße sich ständig wachsam um. Sie wussten, dass jederzeit selbstgebastelte Dumdumgeschosse aus Glocks mit abgefeilten Seriennummern in ihre Richtung fliegen konnten. Sogar die Luft stank hier nach Verbrechen, und das Sonnenlicht wurde von der Aura der Hoffnungslosigkeit gedämpft, die wie Smog über dem Viertel hing.
Mace bremste die Ducati ab und beobachtete ein paar Passanten. Die Mordrate in D. C. war nicht mehr annähernd so hoch wie Ende der Achtziger und Anfang der Neunziger, als jugendliche Drogenbarone dank des Kokainbooms eine Schreckensherrschaft errichtet hatten. Damals war täglich irgendwer erschossen worden, wirklich jeden Tag, sogar am Sabbat. Auch jetzt noch war die Gegend alles andere als gewaltfrei, auch wenn »nur noch« gut zweihundert Todesfälle jährlich von der Gerichtsmedizin untersucht werden mussten, zumeist von jungen Männern afroamerikanischer Abstammung. Die Männer hier in der Gegend verlangten Respekt, und sie schienen zu glauben, dass sie sich diesen Respekt nur mit einer erhöhten Anzahl Geschosse des Kalibers 9 mm verdienen konnten. Und vielleicht hatten sie sogar recht damit.
Mace hielt an, nahm den Helm ab und schüttelte sich das Haar aus. Normalerweise war es nicht gerade klug, sich mit einer fetten Maschine hierherzuwagen – egal um welche Tageszeit –, vor allem nicht, wenn man weiß und unbewaffnet war wie Mace. Doch niemand belästigte sie; ja es näherte sich ihr noch nicht einmal jemand. Vielleicht hielten die Leute eine weiße Frau, die allein auf einer Ducati hier rumgurkte, ja für eine gefährliche Psychopathin oder gar eine mögliche Selbstmordattentäterin.
»Hey, Mace! Bist du das?«
Mace drehte sich um.
Der Kerl, der auf sie zukam, war klein, spindeldürr und hatte einen kahlgeschorenen Kopf. Er trug Zweihundert-Dollar-Sneakers von LeBron James, allerdings ohne Schnürsenkel.
»Eddie?«
Der Mann kam näher und ließ seinen Blick über das Bike schweifen.
»Echt geil, Mann … Habe gehört, du wärst im Bau.«
»Ich bin wieder draußen.«
»Seit wann?«
»Seit ungefähr fünf Sekunden.«
»Aber du warst nur kurz zum Scheißen drin, oder? Damit du damit angeben kannst, gesessen zu haben.« Eddie grinste.
»Ja, es waren nur zwei Jahre«, erwiderte Mace. »Ein Knasti bin ich also immer noch nicht. Ich habe nur mal reingeschnuppert.«
»Mein kleiner Bruder hat schon zehn hinter sich, und der ist erst fünfundzwanzig. Für mein Brüderchen gab es nicht so einen Jugendrechtsscheiß. Da ging’s gleich hart zur Sache«, erklärte Eddie stolz.
»Wie viele Leute hat er umgebracht?«
»Zwei. Aber die beiden Arschlöcher haben es auch darauf angelegt.«
»Darauf möchte ich wetten. Aber nun ja … Zwei Jahre haben mir gereicht.«
Eddie tätschelte den Tank der Ducati, grinste und entblößte dabei eine Reihe perfekter weißer Zähne. Vermutlich hatte er die Zahnbehandlung gegen ein paar Pillen getauscht, nahm Mace an.
Sich mit einer ehemaligen Polizeibeamtin sehen zu lassen, war in dieser Gegend nicht gerade klug, doch Eddie war auch nur ein ganz kleines Licht auf der Straße. Er war weder sonderlich klug, noch hatte er allzu gute Verbindungen, und seine illegalen Aktivitäten beschränkten sich auf die ein oder andere Tüte Gras, ein paar Pillen und die gelegentliche Portion Koks, die er auf der Straße vertickte. Die großen Fische wussten das, und sie wussten auch, dass Eddie über keinerlei Informationen verfügte, die er den Cops hätte verkaufen können. Trotzdem war Mace überrascht, dass er noch lebte. Die Dummen und Schwachen rottete man in dieser Gegend für gewöhnlich rasch aus. Also steckte Eddie vielleicht doch tiefer im Geschäft, als Mace dachte, und das wiederum könnte ihn zu einem nützlichen Kontakt machen.
»Und?«, fragte sie. »Alles beim Alten hier?«
»Manche Dinge ändern sich nie, Mace. Das weißt du doch.«
»Ich weiß, dass irgendjemand mich gelinkt hat.«
Eddies Grinsen verschwand. »Darüber weiß ich nichts.«
»Jaja, aber du kennst vielleicht jemanden, der etwas weiß.«
»Du bist jetzt draußen, Mädchen. Lass die Vergangenheit ruhen. Auch könnte da etwas sein, was du nicht sehen willst. Außerdem hat deine Schwester ihre Jungs hier schon jeden Stein umdrehen lassen. Himmel, sie waren gerade erst letzte Woche hier!«
»Ach ja? Und was haben sie gemacht?«
»Fragen gestellt und irgend so einen CSI-Kram. Siehst du? Das ist das Coole, wenn man eine Polizeichefin in der Familie hat: Alte Fälle werden nicht einfach zu den Akten gelegt. Aber ich wette, sie bekommt trotzdem Zunder. Die große Dame in Blau hat nicht nur Freunde, Mace.«
»Was meinst du mit ›Zunder‹?«
»Woher zum Teufel soll ich das denn wissen? Ich versuche nur, auf der Straße zu überleben.«
»Haben ihre Jungs auch mit dir gesprochen?«
Eddie nickte. »Und ich habe ihnen die Wahrheit gesagt. Ich weiß nichts, gar nichts.« Wieder tätschelte er den Tank der Ducati. »Hey, kann ich mal eine Runde fahren?«
Mace schob seine Hand vom Tank. »Es gibt da eine alte Redensart, Eddie: Um vorwärtszugehen, muss man erst einmal zurückschauen.«
»Wer auch immer das gesagt hat, kommt nicht von hier.«
Mace schaute auf Eddies Jacke und betrachtete die Art, wie er den linken Ellbogen an die Seite drückte, und wie das Gewicht in seiner Tasche ihn leicht nach unten zog. »Weißt du, Bruder, wenn du eine Waffe trägst und nicht willst, dass die Cops das merken, dann solltest du lernen, aufrechter zu gehen und deinen Arm entspannen.«
Eddie sah auf seine linke Tasche und grinste Mace an. »Hier in der Gegend muss man sich schützen, Mace.«
»Solltest du etwas herausfinden, lass es mich wissen.«
»Hmmm«, erwiderte Eddie.
Mace fuhr durch das Viertel und zog dabei die Blicke der Leute auf sich, die auf ihren winzigen Terrassen hockten oder an den Straßenecken herumlungerten. Und hier wurde viel geglotzt – zumeist, weil man wissen wollte, weshalb gerade mal wieder die Sirenen heulten.
Mace fuhr hier jedoch nicht herum, um ihre Freilassung zu feiern. Sie wollte gewisse Mächte wissen lassen, dass Mace Perry den Knast nicht nur überlebt hatte. Sie war wieder in ihrem alten Revier, wenn auch ohne Dienstmarke, Knarre und die Macht des MPD im Rücken.
Doch was Eddie ihr gesagt hatte, war besorgniserregend. Beth hatte den Fall offenbar noch lange weiterverfolgt, nachdem Mace ins Gefängnis gekommen war, und einen beachtlichen Teil der ohnehin beschränkten Polizeiressourcen dafür aufgewendet. Mace kannte mehrere Leute, die das ausnützen würden, um Beth zu schaden. Ihre Schwester hatte schon genug für sie getan.
Schließlich wendete Mace und fuhr zum Haus zurück. Einer der Cops, die davor Wache standen, winkte ihr zu halten, als sie sich der Straßensperre näherte. Mace bremste und klappte das Visier hoch.
»Ja?«, sagte sie zu dem Mann, einem jungen Cop mit Stoppelhaarschnitt. Sie sah sofort, dass er ein Frischling war.
Der braucht ja noch die Flasche.
Mace erinnerte sich noch gut an ihren Ausbilder. Er war ein Veteran gewesen, ein »Slow-Walker«, der seine Schicht so ruhig wie möglich angegangen war und vor allem eins gewollt hatte: in einem Stück nach Hause kommen. Wie viele Cops damals mochte er keine Frauen in seinem Streifenwagen, und seine Regeln waren einfach: Fass das Funkgerät nicht an, frag gar nicht erst, ob du fahren darfst, und beschwer dich nicht, wenn es dahin geht, was Cops ihren »Club« nennen. Dabei handelte es sich um einen Versammlungsort, für gewöhnlich einen Parkplatz, wo die Cops sich trafen, um sich zu entspannen, zu schlafen oder Papierkram zu erledigen. Doch die wichtigste Regel von Mace’ Ausbilder lautete: Halt’s Maul!
Mace hatte diese Ausbildungsfahrten ertragen, bis ein Sergeant sie für fähig erklärt hatte, auf eigenen Beinen zu stehen. Und von diesem Tag an war 10–99 ihr Rufzeichen gewesen, und das hieß, dass sie allein Dienst schieben durfte.
»Wenn ich richtig informiert bin, dann sind Sie die Schwester des Chiefs.«
»Stimmt«, bestätigte Mace, die weiter nichts dazu sagen wollte.
»Und Sie waren im Gefängnis?«
»Stimmt auch. Haben Sie noch eine persönliche Frage, oder reichen Ihnen die beiden?«
Der junge Cop trat einen Schritt zurück. »Ich war nur neugierig.«
»Jaja, nur neugierig. Und warum steht ein junger Kerl wie Sie hier an der Sperre, anstatt sich auf der Straße eine Beförderung und genug Kohle zu verdienen, um seinem Mädchen was Schönes zu kaufen?«
»Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Hey, legen Sie beim Chief ein gutes Wort für mich ein.«
»Was das betrifft, braucht sie meine Hilfe nicht. Sind Sie gerne Cop?«
»Bis ich etwas Besseres gefunden habe, ja.«
Mace zog sich der Magen zusammen. Sie hätte alles dafür getan, wieder Uniform zu tragen.
Der Mann nahm die Mütze ab, wirbelte sie herum, grinste und überlegte sich vermutlich irgendeinen dummen Anmachspruch.
Mace biss die Zähne zusammen und knurrte: »Ich will Ihnen mal einen Rat geben: Nehmen Sie nie die Mütze ab, wenn Sie Schutzdienst haben.«
Die Mütze hörte auf, sich zu drehen, und der junge Kerl starrte Mace an. »Und warum?«
»Aus dem gleichen Grund, warum Sie sie nicht abnehmen sollen, wenn Sie im Revier eines Verdächtigen sind: Müssen Sie Ihre Waffe ziehen, ist sie Ihnen nur im Weg, Frischling.«