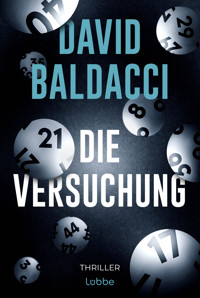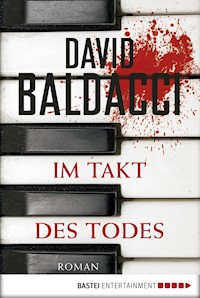7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman mit einem großen Herz und viel Gefühl
Amerika 1940: Ein einziger schrecklicher Moment ändert das Leben der zwölfjährigen Lou von Grund auf. Bei einem Autounfall kommt ihr Vater ums Leben, und ihre Mutter fällt ins Koma. Die einzige Verwandte, die sich um Lou und ihren kleinen Bruder Oz kümmern kann, ist ihre Urgroßmutter Louisa Mae, die auf einer Farm in Virginia wohnt. Doch das Leben in den Bergen ist hart, und die Kinder müssen schwer mitarbeiten. Nur allmählich erschließt sich ihnen die Schönheit der Welt, die sie umgibt. Erst als eine Bergbaugesellschaft die Hände nach dem Besitz ausstreckt, wird Lou klar, wie viel ihr das Land, das ihr Vater so liebte, bedeutet, und dass es sich dafür zu kämpfen lohnt ...
Mit "Das Versprechen" hat Bestsellerautor David Baldacci einen fesselnden Roman geschrieben, der den Leser in das ländliche Amerika der 40er Jahre versetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
INHALT
CoverÜber den AutorTitelImpressumWidmungVorwortKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40HeuteDanksagungenÜber den Autor
David Baldacci, geboren 1960, war Strafverteidiger und Wirtschaftsjurist, bevor er mit Der Präsident (verfilmt als Absolute Power) seinen ersten Weltbestseller schrieb. In Das Versprechen hat er einen Teil seiner eigenen Familiengeschichte hineingewoben. David Baldacci lebt mit seiner Familie in Virginia, wo der Roman mittlerweile als Schullektüre gelesen wird (was seine kleine Tochter »echt cool« findet).
DAVID
BALDACCI
Das Versprechen
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Wish You Well,
erschienen bei Warner Books, New York
Copyright © 2000 by Columbus Rose, Ltd
Copyright © für die deutschsprachige Ausgabe 2001
by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Guido Klütsch, Köln
unter Verwendung zweier Fotos von IFA und Photonica
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-1713-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für meine Mutter, die mich zu diesem Roman inspirierte
VORWORT
Von den Ortsnamen abgesehen, ist Das Versprechen frei erfunden, nicht aber die Bühne, auf der die Geschichte spielt: die Appalachen. Ich bin in diesen Bergen aufgewachsen, in der Obhut zweier Frauen. Viele Jahre lang war das Bergland unser Zuhause. Meine Großmutter mütterlicherseits, Cora Rose, wohnte die letzten zehn Jahre ihres Lebens bei meiner Familie in Richmond, verbrachte zuvor aber ungefähr sechs Jahrzehnte auf den Gebirgshöhen im Südwesten Virginias. Wenn ich als Junge auf Cora Roses Schoß saß, lernte ich viel über das Land und das Leben dort. Meine Mutter, die jüngste von zehn Geschwistern, verbrachte ihre ersten siebzehn Lebensjahre auf dem Berg und erzählte mir, als ich heranwuchs, faszinierende Geschichten aus ihrer Jugend. Das harte, entbehrungsreiche Leben in den Bergen und die Abenteuer, die meine Romanfiguren dort erleben, wären meiner Mutter aus eigener realer Erfahrung vertraut.
Außerdem verbrachte ich im Rahmen der Vorbereitung auf diesen Roman viel Zeit damit, Gespräche mit meiner Mutter zu führen – eine für mich in vieler Hinsicht aufschlussreiche Zeit.
Wenn wir erwachsen sind, glauben die meisten von uns, alles über die eigenen Eltern und andere Familienangehörige zu wissen. Doch wer sich die Zeit nimmt, nachzufragen und den Antworten mit wachem Ohr zu lauschen, wird die Erfahrung machen, dass man noch viel Neues über die Menschen lernen kann, denen wir so nahe sind und die wir deshalb so gut zu kennen glauben. Auch Das Versprechen stützt sich zum Teil auf mündliche Überlieferung: Geschichten darüber, wo meine Mutter aufwuchs und unter welchen Lebensumständen. Solche Geschichten weiterzuerzählen, gehört zu einer aussterbenden Kunst – was traurig stimmt, denn in der mündlichen Überlieferung liegen sowohl tiefer Respekt vor den Lebenden als auch die Erfahrungen und das Wissen der Ahnen verborgen. Ebenso bedeutsam ist, dass die Oral History, die erzählte Geschichte, persönliches Erleben und Erinnerungen von Menschen bewahrt, die nach deren Tod anderenfalls für immer verschüttet blieben. Fatalerweise leben wir gegenwärtig in einer Zeit, in der man ausschließlich nach vorn zu blicken scheint, als gäbe es in der Vergangenheit nichts, das unserer Beachtung wert wäre. Die Zukunft ist stets angenehmer und faszinierender und übt eine Anziehungskraft auf uns aus, der die Vergangenheit nichts Vergleichbares entgegenzusetzen hat. Doch es ist durchaus denkbar, dass sich der kostbarste Besitz unseres Menschseins gerade durch solche Rückschau offenbart.
Wenngleich ich mir als Autor von Spannungsromanen einen Namen gemacht habe, fühlte ich mich stets von Geschichten angezogen, die in der Vergangenheit meiner Heimat Virginia wurzeln, sowie von den Erzählungen von Menschen, deren Wünsche und Erwartungen durch ihre Umwelt stark eingeschränkt sind, was auf der anderen Seite ein Gewinn ist, denn diese Menschen werden gerade durch ihre außergewöhnlichen Lebensumstände mit einer Fülle besonderer Fertigkeiten und Erfahrungen ausgestattet. Ironischerweise habe ich als Schriftsteller die letzten zwanzig Jahre damit verbracht, Jagd auf Stoff für Geschichten zu machen, und dabei völlig übersehen, dass eine Fülle von Material in meiner eigenen Familiengeschichte zu finden ist. Ich entdeckte diese Materialien zu einem späteren Zeitpunkt, als es eigentlich der Fall hätte sein sollen. Aber vielleicht ist gerade dies der Grund dafür, dass das Schreiben dieses Romans zu einer der lohnendsten Erfahrungen meines Lebens wurde.
KAPITEL 1
Die Luft war feucht; dichte graue Wolkenbänke waren aufgezogen und kündeten von bald einsetzendem Regen, und der strahlend blaue Himmel war rasch verblasst. Der 1936er Lincoln Zephyr, eine viertürige Limousine, bewegte sich träge, ohne besondere Eile über die kurvenreiche Straße. Der appetitliche Duft von frisch gebackenem Brot und Hähnchen, von Pfirsich- und Zimtkuchen stieg aus dem Picknickkorb auf, der verlockend zwischen den beiden Kindern auf der Rückbank platziert war, und erfüllte das Wageninnere.
Die zwölfjährige Louisa Mae Cardinal – von ihrer Familie kurz »Lou« genannt – war groß und schlank für ihr Alter; ihr Haar hatte die Farbe von sonnengebleichtem Stroh, und ihre Augen waren strahlend blau. Sie war ein hübsches Mädchen, von dem man zuversichtlich annehmen durfte, dass es zu einer sehr schönen Frau heranwachsen würde. Doch Lou würde sich strikt weigern, Teepartys auszurichten oder sich einen Zopf zu flechten oder Rüschenkleider zu tragen – und würde sich durchsetzen. Das war Teil ihres Wesens.
Ein Notizblock lag auf Lous Schoß, und emsig wie ein Fischer sein Netz füllte sie die leeren Seiten, indem sie alles niederschrieb, was ihr bedeutsam erschien. Ihrem eifrigen, ja begeisterten Gesichtsausdruck nach zu schließen, schien das Mädchen mit jedem Wort, jedem Satz einen fetten Fang einzuholen. Lou war hoffnungslos dem Schreibteufel verfallen – ein Wesenszug, der keineswegs einer kindlichen Laune entsprang, sondern den sie vom Vater hatte, der die Lust am Schreiben noch ungleich stärker verspürte.
Auf der anderen Seite des Picknickkorbes saß Lous Bruder Oz. Der Name war eine Kurzform seines Taufnamens Oscar. Er war erst sieben und zierlich für sein Alter, obgleich seine großen Füße hoffen ließen, dass aus ihm mal ein stattlicher Mann werden mochte. Doch er besaß weder die schlanken Gliedmaßen noch die körperliche Anmut seiner älteren Schwester noch deren natürliche Zuversicht, die so klar und funkelnd in ihren Augen zu lesen war. Stattdessen hielt Oz seinen abgewetzten Plüschteddy im unentrinnbaren Griff eines Catchers an sich gedrückt, ängstlich beinahe und Halt suchend, was ihm eine Ausstrahlung verlieh, die andere Menschen auf Anhieb für ihn einnahm. Wer Oz Cardinal kennen lernte, gelangte unausweichlich zu der Überzeugung, dass er ein kleiner Junge mit großem Herzen war – so groß und überströmend, wie Gott es nur den schwachen und verletzlichen Seelen gab.
Gedankenverloren saß Jack Cardinal hinter dem Steuer. Das drohende Unwetter nahm er nicht zur Kenntnis; nicht einmal der Insassen des Wagens schien er sich gewahr zu sein. Seine schlanken Finger trommelten auf dem Lenkrad. Die Fingerkuppen hatten mit den Jahren, in denen sie monoton auf Schreibmaschinentasten eingehämmert hatten, Schwielen bekommen. Deutlich sichtbar war auch eine kleine Einkerbung am rechten Mittelfinger, an dem sich über die Jahre hinweg ungezählte Bleistifte beharrlich ihr Bett geschaffen hatten. Ein Stigma, wie Jack oft spöttisch bemerkte.
Wie viele Schriftsteller bevorzugte auch Jack überschaubare »Bühnen«, dicht bevölkert von Figuren voller Fehler und Schwächen – Figuren, die sich von Seite zu Seite weiterentwickelten und für den Leser greifbarer und vertrauter wurden, als es die eigene Familie augenblicklich für Jack war. So mancher Leser mochte zu Tränen gerührt sein, sobald eine lieb gewordene Romanfigur durch die Feder des Autors sterben musste, doch selbst die Schönheit und Ausdruckskraft der Sprache Jack Cardinals überdeckte niemals den Ernst seiner Geschichten, denn die Themen, die darin steckten, waren von machtvoller Größe. Doch dann gab es hier und da wieder eine besonders gut formulierte Zeile, die einen zum Lächeln, mitunter sogar zum lauten Lachen brachte; denn eine Prise Humor war in der Regel das wirksamste Mittel, einen schmerzlichen Sachverhalt möglichst schonend zu vermitteln.
Jack Cardinals schriftstellerische Begabung hatte ihm viel Lob von Seiten der Kritiker, aber wenig Geld eingebracht. Nicht einmal der Lincoln Zephyr gehörte ihm; der Luxus eines eigenen Automobils, ob der Wagen nun schmuck oder schlicht war, schien für Jack auf immer unerreichbar zu sein. Der Lincoln war für den heutigen Picknick-Ausflug lediglich von einem Freund und Bewunderer Jacks ausgeliehen. Und die Frau auf dem Beifahrersitz hatte ihren Mann bestimmt nicht seines Geldes wegen geheiratet.
Amanda Cardinal trug die besondere Eigenart ihres Gatten gewöhnlich mit Fassung. Auch diesmal ließ ihre Miene eine Art gutherzige Resignation erkennen: Sie hatte sich damit abgefunden, dass Jacks Gedanken wieder einmal durch die Welten seiner Fantasie schweiften – Welten, die ihm stets die Flucht vor den unangenehmen Dingen des Lebens ermöglichten. Später dann, wenn die Decke auf dem Rasen ausgebreitet und das Picknick angerichtet war und die Kinder spielen wollten, würde Amanda ihren Mann behutsam aus seinem literarischen Universum zurück auf die Erde holen müssen.
Doch ausgerechnet heute wurde sie von einer tiefen Unruhe erfasst, während sie Meile um Meile dahinfuhren. Sie brauchten diesen gemeinsamen Ausflug dringend, nicht allein wegen der frischen Luft und der Ruhe und des guten Essens in freier Natur. Dieser außergewöhnlich warme Vorfrühlingstag erwies sich in vielerlei Hinsicht als ein Geschenk des Himmels. Amanda schaute zu den düsteren Wolken hinauf.
Verzieh dich, Unwetter. Bitte, verschwinde.
Um ihre angespannten Nerven zu beruhigen, drehte Amanda sich zu Oz um und lächelte. Ihr wurde immer warm ums Herz beim Anblick des kleinen Jungen, obgleich er ein sensibles, leicht zu ängstigendes Kind war. Amanda hatte ihren Sohn oft in den Armen gewiegt, wenn er von einem Albtraum geplagt worden war. Zum Glück wich Oz’ schreckerfülltes Weinen rasch einem Lächeln, sobald er die Mutter erkannte, und jedes Mal hätte Amanda ihn dann am liebsten für immer so sicher und geborgen in den Armen gehalten.
Oz hatte sein Äußeres unverkennbar von der Mutter geerbt, während Lous Gesicht Amandas hohe Stirn und Jacks schmale Nase und sein spitzes Kinn verband – eine anziehende Kombination. Doch hätte man Lou gefragt, nach wem sie käme, hätte sie auf Anhieb geantwortet: »Nach Dad natürlich.« Was keineswegs hieß, dass sie ihre Mutter nicht respektierte; es zeigte bloß, dass Lou sich in erster Linie als Tochter des Schriftstellers Jack Cardinal betrachtete.
Amanda wandte sich wieder ihrem Mann zu und streifte mit ihren Fingern seinen Unterarm. »Neue Story im Anflug?«, fragte sie.
Jack löste sich langsam aus seiner neuesten Geschichte, und entführt aus seinen Fantasiewelten schaute er seine Frau an, ein Grinsen auf den vollen Lippen, das neben einem vieldeutigen Blitzen seiner grauen Augen für Amanda das attraktivste körperliche Merkmal ihres Gatten war.
»Wie ein Vogel im Wind«, sagte Jack. »Die Freiheit des Schriftstellers.«
»Als Gefangener deiner eigenen Ideen«, erwiderte Amanda sanft und nahm die streichelnde Hand von seinem Arm.
Während ihr Mann wieder in seine Gedankenwelt abdriftete, beobachtete Amanda, wie Lou an ihrer eigenen Story arbeitete. Sie sah deutlich das Potenzial für viel Glück, aber auch manch unvermeidbaren Schmerz im späteren Leben ihrer Tochter. Doch Amanda konnte nicht Lous Leben für sie führen; sie war zum Zuschauen verdammt, wenn ihr kleines Mädchen Nackenschläge und Niederlagen hinnehmen musste.
Ohnehin hätte Amanda niemals helfend die Hand nach Lou ausgestreckt; denn wie Lou nun einmal war, hätte sie diese sicher zurückgewiesen. Sollten jedoch Lous Finger einmal Hilfe suchend nach der Hand der Mutter greifen, würde Amanda immer für ihr kleines Mädchen da sein. Es war ein prekäres Verhältnis, das stets die Gefahr von Missverständnissen barg, doch schien es die einzig mögliche Lösung für Mutter und Tochter zu sein.
»Und wie geht es mit deiner Story voran, Lou?«
Den Kopf weiterhin gesenkt, während die Hand sich, vom Enthusiasmus jugendlicher Schreibkunst geführt, über das Papier bewegte, sagte Lou: »Gut.« Amanda spürte nur zu deutlich die Mitteilung, die hinter dieser knappen Antwort an sie gerichtet war: Das Schreiben gehörte zu den Dingen, bei denen es nicht lohnte, mit Nichtschreibern darüber zu reden. Amanda nahm die versteckte Kritik so nachsichtig hin wie alles, was sie im Umgang mit ihrer eigenwilligen Tochter hinnehmen musste. Manchmal jedoch brauchte sogar eine Mutter ein weiches Kissen, auf das sie ihr Haupt betten konnte; deshalb drehte Amanda sich nun halb im Sitz, streckte die Hand nach hinten aus und zerwuselte das Haar ihres Jüngsten. Söhne waren bei weitem nicht so kompliziert, und in dem Maße, wie Lou sie strapazierte, richtete Oz sie wieder auf.
»Und wie geht’s dir so, Oz?«, fragte Amanda.
Der kleine Junge stieß einen krähenden Laut aus, der wie eine Bombe im Wagen explodierte und sogar Jack aus seinen Gedanken riss.
»Miss English sagt, ich bin der beste Hahn, den sie je gehört hat«, erklärte Oz und krähte noch einmal, wobei er die Arme wie Flügel schlug.
Amanda lachte, und sogar Jack schaute sich kurz nach seinem Sohn um und lächelte ihn an.
Lou bedachte ihren kleinen Bruder mit einem gequälten Blick, langte dann jedoch über den Korb und tätschelte sanft Oz’ Hand. »Bist du auch, Oz. Sogar viel besser, als ich in deinem Alter gewesen bin«, sagte sie.
Amanda lächelte über Lous Bemerkung; dann wandte sie sich ihrem Mann zu. »Sag mal, Jack, du kommst doch zur Aufführung von Oz’ Schultheater, oder?«
Lou kam ihrem Vater mit der Antwort zuvor: »Du weißt doch, Mommy, dass Pa an einer Geschichte arbeitet. Er hat bestimmt keine Zeit zuzugucken, wie Oz einen Hahn spielt.«
»Ich werd’s versuchen, Amanda. Diesmal wirklich«, sagte Jack. Doch Amanda kannte den Zweifel in seiner Stimme, der eine neuerliche Enttäuschung für Oz ankündigte. Und für sie.
Amanda drehte sich weg und starrte durch die Windschutzscheibe. Ihre Gedanken standen ihr ins Gesicht geschrieben: Ein Leben lang verheiratet mit Jack Cardinal – ein Leben voll mit Ich-werd’s-versuchen.
Oz’ Enthusiasmus blieb Gott sei Dank ungebrochen. »Und nächstes Mal bin ich der Osterhase. Kommst du dann auch, Mom? Du kommst doch, ja?«
Amanda schaute ihn mit dem strahlenden Lächeln und dem unschuldigen Augenaufschlag eines liebreizenden Engels an.
»Du weißt doch, dass Mommy das nie verpassen würde«, sagte sie und wuschelte ihm noch einmal sanft durchs Haar.
Doch Mommy würde es verpassen. Sie alle würden es verpassen.
KAPITEL 2
Amanda schaute aus dem Wagenfenster. Ihre Gebete waren erhört worden; das Unwetter war vorübergezogen und hatte lediglich ein paar Tropfen eines ländlichen Nieselregens und gelegentliche schwache Windböen gebracht, die es nicht einmal geschafft hatten, die Äste der Bäume richtig zu schütteln. Amanda, Jack und die Kinder waren ziemlich aus der Puste gewesen, als sie die ausgedehnten Rasenflächen, die sich durch den Naturpark wanden, von einem Ende zum anderen durchquert hatten. Man musste es Jack hoch anrechnen, dass er so ausgelassen mitgespielt hatte. Wie ein Kind war er über die kiesbedeckten Wege gestürmt, während er Lou oder Oz, die begeistert lachten, huckepack trug. Einmal war er sogar ohne seine Mokassins losgerannt, hatte sich von den Kindern jagen lassen und die Schuhe in einem beherzten Kampf zurückerobert. Später hängte er sich zur Freude aller kopfüber an eine Schaukel. Genau so etwas brauchten die Cardinals zurzeit.
Am Ende dieses schönen Tages hatten die Kinder vor Müdigkeit regelrecht schlappgemacht, und sie alle hatten an Ort und Stelle ein Nickerchen eingelegt, dicht an dicht, ein großes Knäuel aus ineinander verschlungenen Gliedmaßen. In tiefem Schlummer hatten sie wohlig geseufzt: müde, glücklich ruhende Menschen. Ein Teil Amandas hatte für den Rest ihres Lebens so liegen bleiben wollen; sie hatte das Gefühl gehabt, in diesem Moment all das geschafft zu haben, was die Welt ihr jemals an halbwegs erträglichen Prüfungen auferlegen würde.
Als die Familie nun in die Stadt zurückfuhr – in ihr kleines, schmuckes Zuhause, das ihnen nicht mehr lange gehören würde –, machte sich ein wachsendes Gefühl des Unbehagens in Amanda breit. Sie hatte keine besondere Freude an Konfrontationen, wusste jedoch, dass dergleichen mitunter notwendig war, wenn es einen wichtigen Grund gab. Sie schaute auf die Rückbank. Oz schlief. Lous Kopf lehnte an der Scheibe; sie schien vor sich hin zu dösen. Da Amanda ihren Mann kaum einmal für sich allein hatte, packte sie die Gelegenheit beim Schopf.
»Wir müssen wirklich mal über Kalifornien reden, Jack«, sagte sie leise.
Ihr Ehemann blinzelte, obgleich kein Sonnenstrahl durch die Windschutzscheibe fiel; inzwischen lag tiefe Dunkelheit über dem Land.
»Das Filmstudio hat schon Aufträge für Drehbücher auf Halde liegen«, sagte er.
Sie bemerkte, dass er diese Feststellung ohne eine Spur von Enthusiasmus machte. Davon ermutigt, bohrte sie weiter. »Du bist ein preisgekrönter Romancier. Deine Bücher werden sogar an Schulen gelesen. Du wirst als der begabteste Erzähler unserer Generation bezeichnet.«
Er schien müde ob dieser Lobeshymnen. »Ach ja?«
»Warum also gehst du nach Kalifornien und lässt dir von anderen sagen, was du zu schreiben hast?«
Sein Blick wurde trüb. »Ich hab keine andere Wahl.«
Amanda packte seine Schulter. »Doch, Jack, du hast eine Wahl. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass die Schreiberei für den Film alle Probleme löst. Denn das wird sie nicht!«
Die erhobene Stimme ihrer Mutter brachte Lou dazu, langsam den Kopf zu drehen und die Eltern anzustarren.
»Oh, danke, vielen Dank für dein Vertrauen«, sagte Jack sarkastisch. »Ich weiß es zu schätzen, Amanda. Besonders jetzt. Du weißt, dass es für mich nicht gerade einfach ist.«
»So habe ich es nicht gemeint. Wenn du nur mal darüber nachdenken würdest …«
Lou beugte sich plötzlich nach vorn und berührte die Schulter ihres Vaters, kaum dass Amanda die Hand weggezogen hatte. Das Lächeln des Mädchens war strahlend, doch unverkennbar gezwungen. »Also, ich fänd Kalifornien toll, Dad.«
Jack grinste gequält und gab Lou einen Klaps auf die Hand. Amanda konnte förmlich spüren, wie Lous Herz schon bei dieser kleinen Geste einen freudigen Hüpfer machte. Ihr war bewusst, dass Jack nicht einmal ahnte, wie stark sein Einfluss auf seine Tochter war; alles, was Lou tat, wog sie sorgfältig danach ab, ob es Daddy gefiel oder nicht – eine Tatsache, die Amanda zusehends ängstigte.
»Jack, Kalifornien ist nicht die Antwort auf unsere Probleme, ganz bestimmt nicht«, sagte Amanda. »Du musst das endlich einsehen. Du wirst damit nicht glücklich.«
Seine Stimme wurde gereizter. »Ich bin die überschwänglichen Kritiken leid. Ich habe die Ehrungen und Auszeichnungen satt. Davon kann ich meine Familie nicht ernähren. Meine gesamte Familie.« Er schaute flüchtig nach Lou, und es schien Amanda, als zeige sich ein Anflug von Scham auf seinem Gesicht. Sie wollte sich zu ihm beugen, ihn in die Arme schließen und ihm sagen, dass er der wunderbarste Mann sei, dem sie je begegnet war. Aber das hatte sie ihm schon gesagt, und er wollte immer noch nach Kalifornien ziehen.
»Ich könnte zurück in meinen Lehrberuf. Das würde dir die Freiheit verschaffen, zu schreiben, was du willst. Die Leute werden Jack Cardinals Werke noch lesen, wenn es uns schon lange nicht mehr gibt.«
»Ich würde lieber irgendwohin gehen und anerkannt sein, solange ich noch lebe.«
»Aber du bist anerkannt. Oder zählen wir gar nicht?«
Jack schaute zerknirscht drein: ein Schreiber, von den eigenen Worten überführt. »So habe ich ’s doch nicht gemeint, Amanda. Tut mir leid.«
Lou langte nach ihrem Notizblock. »Pa, ich bin jetzt mit der Geschichte fertig, von der ich dir erzählt habe.«
Jacks Blick blieb auf Amanda gerichtet. »Deine Mutter und ich haben gerade was Wichtiges zu bereden, Lou.«
Amanda hatte seit Wochen darüber nachgedacht, seit dem Augenblick, da Jack ihr seine Pläne für ein neues Leben vorgestellt hatte: Drehbücher in Kalifornien schreiben, inmitten von Sonnenschein und Palmen und für Unsummen an Geld. Sie glaubte zu wissen, dass Jacks Fähigkeiten als Schriftsteller verblassen würden, sobald er die Bildwelten fremder Menschen in Worte fasste und seine eigenen Geschichten durch die anderer ersetzte – aus dem einzigen Grund, mehr Geld damit zu verdienen.
»Warum gehen wir eigentlich nicht nach Virginia?«, fragte sie, verstummte jedoch im gleichen Atemzug.
Jacks Finger spannten sich fest um das Lenkrad. Draußen waren weit und breit keine anderen Autos zu sehen, keine Lichter außer denen des Lincolns. Der Himmel zeigte sich als eine einzige, wenig Vertrauen erweckende Wolkenbank; kein einziger heller Stern war zu sehen, der ihnen den Weg weisen konnte. Genauso gut hätten sie über einen flachen, tiefblauen Ozean gleiten können, egal in welche Richtung. Bei einem solch unheimlichen Zusammenspiel von Himmel und Erde ließ der Verstand sich leicht täuschen.
»Was soll das jetzt mit Virginia?« Jacks Tonfall war misstrauisch und lauernd geworden.
Amanda drückte in ihrer wachsenden Verzweiflung seinen Arm.
»Deine Großmutter! Die Farm in den Bergen. Der Schauplatz all dieser wundervollen Romane. Dein Leben lang hast du darüber geschrieben und bist nie dorthin zurückgekehrt. Die Kinder haben Louisa bis heute nicht kennen gelernt. Du meine Güte, selbst ich bin ihr noch nie begegnet. Findest du nicht, dass es langsam Zeit dafür wird?«
Die lauter gewordene Stimme seiner Mutter weckte Oz. Lous Hand langte zu ihm hinüber, streichelte seine schmächtige Brust und übertrug ihre Ruhe auf ihn. Lou reagierte ganz von selbst auf die Situation, denn Amanda war nicht die einzige Beschützerin des Kleinen.
Jack blickte nach vorn, sichtlich verärgert über dieses Gespräch.
»Wenn alles so kommt, wie ich es geplant habe, wird Louisa in absehbarer Zeit für immer bei uns wohnen können. Wir werden uns schon um sie kümmern. In ihrem Alter kann sie nicht in den Bergen bleiben. Es ist ein verdammt hartes Leben da oben«, fügte er grimmig hinzu.
Amanda schüttelte den Kopf. »Louisa würde die Berge niemals verlassen. Ich kenne sie zwar nur aus ihren vielen Briefen und deinen Geschichten, aber das weiß selbst ich.«
»Man kann nicht immer in der Vergangenheit leben. Und jetzt Schluss mit diesem Thema. Wir gehen nach Kalifornien. Und werden dort glücklich sein.«
»Das glaubst du doch nicht im Ernst, Jack. Das kannst du nicht glauben!«
Einmal mehr wagte Lou einen Vorstoß. »Willst du jetzt meine Geschichte hören, Pa?«
Amanda legte eine Hand auf Lous Arm, während sie gleichzeitig zu dem verängstigten Oz hinschaute und versuchte, ihm ein beruhigendes Lächeln zu schenken, wenngleich innere Ruhe das Letzte war, das sie empfand. Doch jetzt war eindeutig nicht die rechte Zeit für eine Diskussion über ihre Zukunft.
»Lou, Schatz, warte bitte einen Augenblick … Jack, wir können uns später weiter unterhalten. Aber bitte nicht jetzt, nicht vor den Kindern.« Plötzlich erfasste sie eine unsägliche Furcht, wohin das alles führen könnte.
»Was meinst du damit, ich könne das nicht im Ernst glauben?«, sagte Jack.
»Bitte, Jack, nicht jetzt.«
»Du selbst hast diesen Streit vom Zaun gebrochen. Wirf mir nicht vor, ihn jetzt auch beenden zu wollen.«
»Jack, lass uns bitte später darüber …«
»Nein! Jetzt, Amanda!«
Diesen scharfen Tonfall kannte sie bei ihm nicht, doch er schüchterte sie nicht ein, sondern machte sie noch wütender. »Also gut. Du hast kaum einmal so viel Zeit mit den Kindern verbracht wie heute. Immer bist du auf Reisen, Lesungen, Veranstaltungen … Schon jetzt möchte jeder ein Stück von Jack Cardinal, auch wenn sie dir für dieses Privileg nichts zahlen wollen. Glaubst du wirklich, das würde in Kalifornien besser? Lou und Oz werden dich da genauso selten zu Gesicht bekommen.«
Jacks Augen, Wangenknochen und Lippen bildeten einen einzigen Verteidigungswall gegen Amanda. Je mehr er sich anspannte, desto mehr war seine Stimme angefüllt mit einer aggressiven Mischung aus seiner eigenen Qual und der Absicht, sie auf seine Frau abzuwälzen. »Willst du mir etwa unterstellen, ich würde mich nicht um meine Kinder kümmern?«
Amanda durchschaute seine Taktik sofort; dennoch gab sie nach. Mit ruhiger Stimme sagte sie: »Vielleicht nicht mit Absicht. Aber du bist so sehr deiner Schreiberei verfallen …«
Lou kletterte beinahe auf die Vordersitze. »Dad kümmert sich wohl um uns. Du weißt ja nicht, was du redest. Das stimmt doch alles gar nicht! Du spinnst ja!«
Jacks Verteidigungswall richtete sich nun gegen seine Tochter. »Sprich nicht in diesem Ton mit deiner Mutter. Niemals! Hast du verstanden?«
Amandas Blicke streiften Lou, doch gerade, als sie ein versöhnliches Wort zu finden versuchte, kam die Tochter ihr zuvor.
»Pa, das hier ist die mit Abstand beste Geschichte, die ich je geschrieben habe. Ich schwör’s. Ich les dir mal den Anfang vor, ja?«
Doch zum wahrscheinlich ersten Mal in seinem Leben war Jack Cardinal nicht an einer Geschichte seiner Tochter interessiert. Er drehte den Kopf nach hinten und schaute Lou streng an. Bevor Amanda Luft holen konnte, verwandelte sich unter Jacks vernichtendem Blick der hoffnungsfrohe Gesichtsausdruck des Mädchens in tiefste Enttäuschung.
»Nicht jetzt, Lou, hab ich gesagt!«
Jack wandte den Blick langsam wieder nach vorn – und sah im selben Augenblick das Gleiche wie Amanda, und beiden trieb es schlagartig das Blut aus den Gesichtern. Der Mann war über den Kofferraum seines liegen gebliebenen Autos gebeugt. Sie waren ihm bereits so nahe, dass Amanda im Scheinwerferlicht die viereckige Ausbuchtung seines Portmonees in der Gesäßtasche der Hose sehen konnte. Der Mann würde nicht einmal mehr die Zeit haben, sich umzudrehen und seinen Tod mit fünfzig Meilen die Stunde heranrasen zu sehen.
»Mein Gott!«, schrie Jack.
Er riss das Steuer hart nach links. Der Lincoln Zephyr reagierte mit unerwarteter Wendigkeit, schoss um eine Handbreite an dem fremden Wagen vorbei und schenkte dem achtlosen Mann einen weiteren Tag Leben. Der Lincoln aber kam von der Straße ab und geriet auf eine abfallende Böschung. Vor ihnen ragten drohend Bäume auf. In hektischer Verzweiflung kurbelte Jack das Steuer wieder nach rechts.
Amanda schrie und langte nach ihren Kindern, als der Wagen unkontrolliert hin und her geschleudert wurde. Sie merkte, dass der schwere, hecklastige Zephyr jeden Moment aus dem Gleichgewicht geraten konnte.
Jacks Augen waren zu Silberdollars der Angst geweitet, sein Atem stockte. Als der Wagen zurück über die Straße auf den unbefestigten Seitenstreifen schleuderte, stürzte Amanda nach hinten auf die Rückbank. Ihre Arme schlossen sich um ihre Kinder, zogen sie an sich. Ihr Körper befand sich irgendwie zwischen Lou und Oz und all dem Schrecklichen draußen, das dem Auto zusetzte. Jack kurbelte erneut das Steuer zurück, doch der Wagen war endgültig außer Kontrolle geraten; die Bremsen waren nutzlos. Das Auto schrammte knapp an irgendetwas vorbei, bei dem es sich um Bäume handeln konnte, die einen Aufprall niemals verziehen hätten – und dann geschah das, was Amanda von Anfang an befürchtet hatte: Der Lincoln überschlug sich.
Als das Dach des Wagens auf dem Boden aufschlug, flog die Fahrertür auf, und wie ein Schwimmer, den eine plötzliche Woge erfasste, wurde Jack Cardinal hinausgeschleudert und verschwand in der Dunkelheit. Der Zephyr überschlug sich erneut und streifte einen Baum, der seinen Schwung bremste. Gesplittertes Glas ergoss sich über Amanda und die Kinder. Das Geräusch von berstendem Metall, vermischt mit ihren Schreien, war schrecklich anzuhören. Der ätzende Geruch auslaufenden Benzins breitete sich aus; Rauchschwaden stiegen auf. Und bei jedem Überschlag, jedem Aufprall und jedem Stoß hielt Amanda ihre Kinder mit schier übermenschlicher Kraft, die nicht von ihr allein zu kommen schien, sicher in den Sitz gedrückt. Jeden Stoß fing sie ab, so gut es ging, und hielt ihn von den Kindern fern.
Das Blech des Zephyrs kämpfte eine verbissene Schlacht mit dem harten Erdboden neben der Straße, doch die Erde trug am Ende den Sieg davon und zerdrückte das Dach und die rechte Seite des Wagens. Ein scharfes Metallteil traf Amanda am Hinterkopf, und Blut schoss hervor. Während sie kraftlos zusammensank, kam der Wagen mit einem letzten Dreher auf dem Dach liegend zur Ruhe. Seine Schnauze wies in die Richtung, aus der sie gekommen waren.
Verzweifelt versuchte Oz, seine Mutter zu erreichen; das Nichtbegreifen war die einzige Mauer zwischen dem kleinen Jungen und einer möglicherweise tödlichen Panik.
Mit einer peitschenschnellen Bewegung jugendlicher Gewandtheit befreite Lou sich aus den zerfetzten Eingeweiden des Wagens. Die Scheinwerfer des Zephyrs funktionierten seltsamerweise noch, und im diffusen Gewirr aus grellem Licht und schattigem Dunkel suchte das Mädchen verzweifelt nach ihrem Vater. Sie hörte Schritte näher kommen und schickte ein Dankgebet zum Himmel, weil ihr Daddy überlebt hatte. Doch ihre Worte erstickten im Ansatz. Im Schein der Autolampen sah sie den Körper ihres Vaters ausgestreckt auf dem Erdboden, den Hals in einem unmöglichen Winkel abgeknickt, der auf den ersten Blick erkennen ließ, dass Jack Cardinal tot war.
Dann hämmerte jemand mit bloßen Händen gegen das Wrack des Wagens, und der Mann, den Jack beinahe über den Haufen gefahren und getötet hätte, sagte irgendetwas. Lou beachtete den Fremden gar nicht, dessen Leichtsinn soeben ihre Familie zerstört hatte. Sie drehte sich um, schaute ihre Mutter an.
Auch Amanda hatte Jack entdeckt, der im unbarmherzigen Scheinwerferlicht starr und verrenkt am Boden lag. Für einen unglaublich langen Moment tauschten Mutter und Tochter einen Blick, der aber nur in eine einzige Richtung verlief. Vorwürfe, Zorn, Hass – all dieses Schreckliche erblickte Amanda auf dem Gesicht ihrer Tochter, und die Empfindungen legten sich so schwer über Amanda Cardinal wie eine Steinplatte, die auf ihre Gruft herabgesenkt wurde; das Empfinden war schlimmer als die Summe aller Albträume, die sie je durchlitten hatte. Als Lou sich von der Mutter abwandte, ließ sie ein menschliches Wrack zurück. Und als Amandas Augen sich endgültig schlossen, hörte sie Lou nur noch hysterisch nach ihrem Vater schreien.
»Pa, komm zurück! Pa, verlass uns nicht!«
Dann versank Amanda Cardinal im Nichts.
KAPITEL 3
In dem gleichmäßigen Schlag der Totenglocke lag eine Art stille Frömmigkeit. Wie ein monotoner, trostloser Landregen bestrich der Klang die Umgegend, in der die ersten Bäume ausschlugen und das Gras sich nach der Ruhe des Winters wieder aufzurichten begann. Rauchwölkchen aus den Kaminen der kleinen Siedlung in der Nähe trafen sich am blauen Himmel zu einem friedlichen Stelldichein. Im Süden waren die steil emporragenden, berühmten Wolkenkratzer New Yorks zu erkennen. Doch vor dem majestätisch blauen Himmel verblassten diese steinernen Monumente, die von Millionen Dollars und Tausenden müder Rücken zeugten, zur Belanglosigkeit.
Die große Natursteinkirche wirkte wie ein fester Anker, wie etwas, das unmöglich von der Stelle bewegt werden konnte, egal wie gewaltig die menschlichen Probleme waren, von denen ihr Portal bestürmt würde. Dennoch konnte dieser trutzige Fels in der Brandung für denjenigen, der sich ihm langsam näherte, Geborgenheit und Trost ausstrahlen. In seinem Innern erscholl hinter den dicken Mauern neben dem Läuten der Glocke noch ein anderer Klang.
Christlicher Gesang.
Die fließenden Klänge von »Amazing Grace« wogten das Mittelschiff hinunter und brandeten gegen die Porträts von Männern mit weißen Krägen, die einst die meiste Zeit ihres Lebens damit verbracht hatten, sich die Beichten der Gläubigen anzuhören und ihnen als Buße und für ihr Seelenheil ganze Rosenkränze von Gegrüßet-seist-du-Marias aufzuerlegen. Dann wogte die Welle des Liedes weiter, schwappte um Christusfiguren herum, die den Heiland sterbend am Kreuz zeigten oder wie er aus dem Grabe erstand, und brach sich endlich am Weihwasserbecken, das sich unmittelbar am Eingangsportal befand. Das Sonnenlicht drängte sich durch die kräftigen Farben der Glasfenster und übergoss Gläubige und Sünder gleichermaßen mit allen Schattierungen des Regenbogens. Die Kinder riefen angesichts dieses farbenprächtigen Spektakels stets voller Staunen Oooh! und Aaah!, bevor sie es widerstrebend auf dem Weg ins Kircheninnere durchschritten, zweifellos in dem Glauben, dass Kirchen vor allem dazu da seien, eine Fülle bunten Lichts hervorzubringen.
Durch das eichene Doppelportal hörte man bis in den letzten Winkel der Kirche den Gesang des Chors, und der kleine Organist pumpte mit einer für sein Alter und seine schwächliche Konstitution erstaunlichen Energie in sein Instrument, was das Zeug hielt. »Amazing Grace« dröhnte immer lauter. Der Priester verharrte am Altar und hielt die langen Arme unverdrossen erhoben, wie um nach des Himmels Weisheit und Trost zu greifen. Ein stilles Gebet der Hoffnung erhob sich just in dem Moment von ihm, als die Woge des Kummers ihn zu überrollen drohte, die ihm von den Trauergästen entgegenschlug. Und an diesem Tag benötigte der Priester wahrhaftig besonders viel göttlichen Beistand, denn es war nicht immer einfach, Tragödien durch den Verweis auf Gottes Willen zu rechtfertigen.
Der Sarg stand vor dem Altar. Das polierte Holz war bedeckt mit Wolken von Engelshaar, einem dicken Strauß roter Rosen und einigen wenigen, besonders schönen Schwertlilien, und doch blieb beim Anblick des massigen Mahagoni-Ungetüms einem jeden ein Kloß in der Kehle stecken. Jack und Amanda Cardinal hatten sich in dieser Kirche ihr Eheversprechen gegeben. Seitdem hatten sie das Gotteshaus nicht mehr betreten. Bis heute hätte niemand ahnen können, dass ihre Rückkehr knapp vierzehn Jahre später zu ihrer eigenen Totenmesse stattfinden würde.
Lou und Oz saßen in der vordersten Reihe der voll besetzten Kirche. Oz hatte wie immer seinen Teddy an die Brust geknuddelt und hielt den Kopf gesenkt. Tränen tropften auf den abgeschliffenen Holzboden zwischen dünnen Beinchen, die diesen Boden noch gar nicht erreichen konnten. Ein blaues Gesangbuch lag ungeöffnet neben ihm; nichts lag dem Jungen in diesem Moment ferner als Singen.
Lou hatte einen Arm um Oz’ Schultern gelegt, doch ihre Blicke blieben auf den Sarg geheftet. Es machte keinen Unterschied für sie, dass der Deckel geschlossen war. Auch der Schild aus wunderschönen Blumen konnte das Bild nicht vertreiben, das sie von dem Toten im Inneren hatte. Lou hatte beschlossen, aus Anlass des heutigen Tages ein Kleid zu tragen. Bisher hatte es nur wenige solche Anlässe gegeben; die verhassten Uniformen, die sie und Oz hatten tragen müssen, um die Vorschriften an der katholischen Schule zu erfüllen, zählten nicht. Ihr Vater hatte Lou immer gern in Kleidern gesehen, hatte sie sogar einmal für ein Kinderbuch, das er geplant, aber nie veröffentlicht hatte, im Kleid gezeichnet. Lou zog sich die weißen Strümpfe hoch, die bis zu ihren knochigen Knien reichten. Ein Paar neue schwarze Lackschuhe drückte ihre schmalen Füße, die ganz fest auf dem Boden standen.
Lou hatte sich nicht die Mühe gemacht, »Amazing Grace« mitzusingen. Sie hatte dem Priester zugehört, der behauptete, der Tod sei im Grunde ein Anfang und in Gottes unerforschlichen Ratschlüssen müsse dies eigentlich eine Zeit der Freude sein, nicht des Leids, und dann hörte sie gar nicht mehr zu, betete nicht einmal für die verlorene Seele ihres Vaters. Sie wusste, Jack Cardinal war ein guter Mensch gewesen, ein hervorragender Schriftsteller, ein Erzähler wunderschöner Geschichten. Sie wusste, man würde ihn sehr vermissen. Kein Chor und kein Geistlicher, nicht einmal Gott brauchte ihr diese schlichten Tatsachen vor Augen zu halten.
Der Gesang erstarb, und einmal mehr redete der Priester drauflos, während Lou eine Unterhaltung zweier Männer hinter ihr aufschnappte. Schon ihr Vater war ein skrupelloser Lauscher gewesen, stets auf der Suche nach dem authentischen Wortlaut von Gesprächen, und seine Tochter teilte diese Neugier. Jetzt hatte sie noch mehr Grund denn je.
»Wie sieht’s aus? Hast du irgendwelche brillanten Einfälle gehabt?«, flüsterte der ältere Mann seinem jüngeren Begleiter zu.
»Was für Einfälle? Wir sind Verwalter eines Nachlasses, den es gar nicht gibt«, hörte sie die hitzige Antwort des jüngeren Mannes.
Der Ältere schüttelte den Kopf und fuhr noch leiser fort, sodass Lou sich anstrengen musste, um überhaupt etwas zu verstehen.
»Doch, es gibt etwas. Jack hat immerhin zwei Kinder und eine Frau hinterlassen.«
Der Jüngere schaute zur Seite. »Eine Frau?«, sagte er dann mit leisem Zischen. »Die Kinder könnten genauso gut Waisen sein.«
Es war nicht klar, ob Oz diese Worte gehört hatte, aber er hob plötzlich die Hand und legte sie auf den Arm der Frau neben ihm: seine Mutter im Rollstuhl. Eine weiß gewandete Pflegerin saß auf der anderen Seite Amandas, die Arme unter ihrem Hängebusen verschränkt; die Frau blieb sichtlich unberührt vom Tod eines ihr Fremden.
Ein dicker Verband lag um Amandas Kopf, und ihr kastanienbraunes Haar war kurz geschoren. Ihre Lider waren geschlossen. In Wirklichkeit hatte sie die Augen seit dem Unfall nicht mehr geöffnet. Die Ärzte hatten Lou und Oz deutlich gemacht, dass ihre Mutter körperlich zum größten Teil wiederhergestellt sei. Das Problem bestand jetzt anscheinend nur darin, dass ihre Seele aus dem Körper geflüchtet war.
Später, draußen vor der Kirche, brachte der Leichenwagen Lous Vater fort, und Lou schaute ihm nicht einmal mehr nach. Im Kopf hatte sie sich von ihrem Vater bereits verabschiedet. In ihrem Herzen aber würde sie niemals Abschied von ihm nehmen können.
Sie führte Oz durch die Reihen der dunklen Anzüge und Trauerkleider. Lou war der Trauermienen müde, der tränenfeuchten Blicke, die sich auf sie richteten, der Beileidsbekundungen, der Münder, die ob ihres herben Verlustes – und des Verlustes für die literarische Welt – eine Salve der Betroffenheit nach der anderen abfeuerten. Diese Leute! Deren Vater lag nicht tot in dem Kasten. Es war und blieb ganz allein ihr Verlust, ihrer und der ihres Bruders. Und Lou war es leid, sich für diese selbst für sie unverständliche Tragödie in ihrem Leben bei den Leuten entschuldigen zu müssen. »Es tut mir ja so leid«, säuselten sie. »Wie traurig. Ein großer Mann. Ein wundervoller Mann. Aus dem Leben gerissen auf dem Höhepunkt seines Schaffens. So viele Geschichten bleiben nun unerzählt.«
»Seid nicht traurig«, überlegte Lou sich schon die Antwort. »Habt ihr den Priester denn nicht gehört? Das ist eine Zeit der Freude. Der Tod ist schön. Der Tod ist gut. Kommt und singt mit mir.«
Die Leute würden sie anstarren, unsicher lächeln und sich dann zurückziehen, um ihre »Freude« mit jemandem zu genießen, der weniger unverständliches Zeug brabbelte.
Danach würden sie an das ausgehobene Grab gehen, an dem der Priester zweifellos noch weitere erbauliche Worte bereithielt, die Kinder segnete und die heilige Erde benetzte; dann würde das anderthalb Meter tiefe Loch mit gewöhnlicher schmutziger Erde aufgefüllt, und dieses widerliche Spektakel würde endlich ein Ende haben. Der Tod verlangte ein Ritual, weil die Gesellschaft es so wollte. Doch Lou hatte nicht vor, sich dieses Ritual jemals aufdrängen zu lassen. Sie musste sich jetzt um wichtigere Dinge kümmern.
Jene beiden Männer, die in der Kirche hinter Lou und Oz miteinander geflüstert hatten, standen beisammen auf dem grasbewachsenen Parkplatz. Außerhalb des Kirchenraumes besprachen sie nun in normaler Lautstärke die ungewisse Zukunft der so arg geschrumpften Familie Cardinal.
»Ich wünschte, bei Gott, Jack hätte uns nicht als Nachlassverwalter benannt«, seufzte der Ältere und zog ein Päckchen Zigaretten aus der Brusttasche. Er zündete sich eine an und drückte das Streichholz zwischen Daumen und Zeigefinger aus. »Hab immer geglaubt, eher ins Gras beißen zu müssen als er.«
Der jüngere Mann starrte betreten auf seine Schuhe, die auf Hochglanz poliert waren. »Wir können sie nicht einfach im Stich lassen«, sagte er, »in der Obhut fremder Menschen. Die Kinder brauchen jemanden – dringend.«
Der andere blies Rauch in die Luft und blickte dem unförmigen Leichenwagen hinterher. Weit über ihnen bildete ein Schwarm Krähen eine lose Formation, ein letzter, formloser Gruß an Jack Cardinal. Der Mann stippte die Asche ab. »Kinder gehören in ihre Familie. Diese beiden haben aber keine mehr.«
»Bitte, entschuldigen Sie.«
Als die Männer sich umdrehten, standen Lou und Oz hinter ihnen und blickten sie an.
»Aber wir haben doch noch Familie«, sagte Lou. »Unsere Urgroßmutter, Louisa Mae Cardinal. Sie wohnt in Virginia, wo mein Vater aufgewachsen ist.«
Die Miene des jüngeren Mannes hellte sich auf, als wäre die Last der Welt – oder zumindest zweier Kinder – von seinen schmalen Schultern genommen worden. Der ältere Mann blickte erstaunt drein.
»Eure Urgroßmutter? Die lebt noch?«, fragte er.
»Meine Eltern haben kurz vor dem Unfall darüber gesprochen, zu ihr nach Virginia zu ziehen.«
»Meinst du denn, dass sie euch nehmen würde, dich und deinen Bruder?«, hakte der jüngere Mann ungeduldig nach.
»Sie wird uns nehmen«, war Lous prompte Antwort, obgleich sie in Wahrheit keine blasse Ahnung hatte, ob die alte Frau sich tatsächlich auf so etwas einließ.
»Uns alle?« Die Frage kam von Oz.
Lou wusste, dass ihr kleiner Bruder an die Mutter im Rollstuhl dachte. Und sie sagte mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete, zu den beiden Männern: »Ja, uns alle.«
KAPITEL 4
Als Lou aus dem Fenster des fahrenden Zuges blickte, kam ihr der Gedanke, dass sie eigentlich nie viel um New York City gegeben hatte. Klar, in ihrer Kindheit hatte sie die zahlreichen Angebote der Stadt genießen können, hatte sich die Zeit mit Besuchen in Museen und Tierparks und Theatern vertrieben. Sie hatte sich auf der Aussichtsplattform des Empire State Building über die ganze Welt erhoben, hatte gelacht und geschrien über die Possen der Stadtbewohner, zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, hatte Szenen von großer emotionaler Intimität beobachtet und war Zeugin leidenschaftlicher Zurschaustellung öffentlicher Empörung geworden. Einige dieser Ausflüge in die Stadt hatte sie gemeinsam mit ihrem Vater unternommen, der ihr dabei öfters gesagt hatte, dass die Entscheidung für das Schreiben weniger mit der schlichten Wahl eines Berufs zu tun hatte als vielmehr mit der Entscheidung für eine Grundeinstellung dem Leben gegenüber. Und das Geschäft eines Autors, führte Jack behutsam weiter aus, war das Geschäft des Lebens an sich, sowohl in seinem erhebenden Glanz als auch in seiner komplizierten Zerbrechlichkeit. Und so war Lou auf diesen Erkundungszügen eine Eingeweihte geworden, ständig in Bann gezogen von der Belesenheit und den Träumereien eines der wortgewandtesten Autoren der Gegenwart, aber ebenso häufig auch in der Zurückgezogenheit der bescheidenen Wohnung der Cardinals in einem Haus ohne Aufzug in Brooklyn.
Und ihre Mutter hatte Lou und Oz durch sämtliche Stadtteile New Yorks geschleift, hatte die Kinder Stück für Stück vertraut gemacht mit den verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Stufen einer urbanen Gesellschaft, denn Amanda Cardinal war als gebildete Frau selbst überaus neugierig auf solche Zusammenhänge. Die Kinder hatten in der Folge eine umfassende Allgemeinbildung erhalten; Lou hatte überdies Respekt, eine tiefe Nachdenklichkeit und das Verlangen entwickelt, ihre Mitmenschen eingehend zu beobachten.
Aber deswegen gerade hatte sie sich nie richtig für diese Stadt begeistern können. Viel gespannter war sie jetzt auf ihr neues Ziel. Jack Cardinal hatte den größten Teil seines Erwachsenenlebens in New York City verbracht; dort war er zwar umgeben von einem unerschöpflichen Reservoir an Stoff für Geschichten, das andere Autoren auf Jahre hinaus mit guten Kritiken und finanzieller Sicherheit ausgestattet hätte, doch Jack hatte sich dafür entschieden, seine Erzählungen dort anzusiedeln, wohin seine Kinder nun unterwegs waren: in den Bergen Virginias, die im großen Zeh des topografischen Stiefels dieses Bundesstaats aufragten. Da ihr verstorbener Vater diese Gegend für wert befunden hatte, sein Lebenswerk dort anzusiedeln, war Lou die Entscheidung, dorthin zu gehen, umso leichter gefallen.
Sie rutschte zur Seite, damit Oz aus dem Fenster schauen konnte. Falls Hoffnung und Furcht jemals als ein Gefühl zum Ausdruck gebracht werden und auf einem einzigen Gesicht Platz finden konnten, dann auf dem des kleinen Jungen. Mit jedem Atemzug sah Oz Cardinal aus, als wollte er entweder lachen, bis ihm die Rippen aus der Brust hervorbrachen, oder angesichts unsäglichen Schreckens in Ohnmacht fallen. In letzter Zeit jedoch hatte es nur Tränen gegeben.
»Es sieht von hier kleiner aus«, bemerkte er, während er das Gesicht der Stadt zuwandte, die mit ihren Lichtern und den Beton- und Steinkolossen mit ihren Skeletten aus verschweißtem Stahl rasch hinter ihnen zurückblieb.
Lou nickte beipflichtend. »Warte erst mal, bis wir die Berge Virginias sehen – die sind noch viel größer als Wolkenkratzer. Und die bleiben auch so groß, egal, aus welcher Richtung du schaust.«
»Woher willst du das wissen? Du hast die Berge doch noch nie gesehen.«
»Und ob ich sie gesehen habe! In Büchern.«
»Sehen die auf Papier denn auch so groß aus?«
Hätte Lou es nicht besser gewusst, hätte sie Oz’ Bemerkung als klugscheißerisch aufgefasst, doch sie wusste genau, dass ihr Bruder keine Spur dieses Wesenszugs besaß.
»Glaub mir, Oz, die Berge sind groß. Und ich habe darüber auch in Dads Büchern gelesen.«
»Aber alle Bücher hast du nicht gelesen. Dad hat mal gesagt, du wärst nicht alt genug dafür.«
»Na ja, ein Buch hab ich ganz gelesen. Aus den anderen hat Dad mir aber Teile vorgelesen.«
»Hast du schon mal mit dieser Frau gesprochen?«
»Mit wem? Louisa Mae? Nein, aber sie freut sich, dass wir kommen. Das haben die Leute gesagt, die ihr geschrieben haben.«
Oz dachte darüber nach. »Ist ’ne gute Nachricht, würd ich sagen.«
»Aber sicher.«
»Sieht die eigentlich so aus wie Pa?«
Diesmal war seine Schwester aufgeschmissen. »Nun ja, ich kann nicht behaupten, dass ich sie schon mal auf ’nem Bild gesehen habe.«
Es war klar, dass diese Antwort den kleinen Oz nun wieder beunruhigte. »Und was ist, wenn sie böse ist? Oder gruselig aussieht? Können wir dann wieder nach Hause fahren?«
»Virginia ist jetzt unser Zuhause, Oz.« Lou lächelte ihn an. »Sie wird schon nicht so unheimlich aussehen und auch nicht böse sein. Wenn sie so wäre, hätte sie uns wohl gar nicht erst aufgenommen.«
»Aber Hexen sind manchmal so, Lou. Denk nur an Hänsel und Gretel. Hexen überlisten einen. Die wollen dich nämlich aufessen. Das tun die alle. Ehrlich! Ich hab nämlich auch Bücher gelesen.«
»Solange ich bei dir bin, wird keine Hexe auch nur den Versuch wagen, dich anzufassen.« Sie griff nach seinem Arm und zeigte, dass es ihr ernst war, und schließlich entspannte Oz sich wieder und schaute hinüber zu den anderen Insassen des Schlafwagenabteils.
Die Fahrt war von Freunden Jacks und Amandas bezahlt worden; gemeinsam hatten sie keine Kosten und Mühen gescheut, die Kinder in ein gesichertes Leben zu entlassen. Das schloss sogar eine Krankenpflegerin mit ein, die sie begleitete, um eine gewisse Zeit mit ihnen in Virginia zu bleiben und für Amanda zu sorgen.
Unglücklicherweise schien die in Dienst gestellte Pflegerin es als ihre Pflicht zu betrachten, nicht nur ein Auge auf ihre Mutter zu haben, sondern auch als Erzieherin widerspenstiger Kinder auftreten zu müssen. Kein Wunder also, dass Lou und die Frau einander von Anfang an nicht hatten ausstehen können. Lou und Oz beobachteten, wie die hoch gewachsene, knochige Frau sich mit ihrer Patientin beschäftigte.
»Könnten wir eine Weile mit ihr alleine sein?«, fragte Oz schließlich leise. Für ihn war die Pflegerin ein Mittelding aus Giftschlange und böser Fee; sie jagte ihm eine Heidenangst ein. Es kam Oz so vor, als könne die Hand der Frau sich im nächsten Augenblick in ein Messer und er, Oz, sich in das einzig mögliche Ziel der Klinge verwandeln: Das Märchen von Hänsel und Gretel war somit nicht der einzige Grund für die schreckliche Vorstellung gewesen, einer Hexe in die Hände zu fallen. Oz hegte keine große Hoffnung, dass die Pflegerin seiner Bitte folgen würde, doch überraschenderweise tat sie es.
Als die Frau die Tür des Abteils ins Schloss gleiten ließ, schaute Oz seine Schwester an. »Ich glaube, die ist doch nicht so übel.«
»Von wegen, Oz. Die will nur eine rauchen.«
»Woher weißt du, dass sie raucht?«
»Wegen der Nikotinflecken an ihren Fingern. Außerdem stinkt sie nach Zigarettenqualm; hast du es nicht gerochen?«
Oz setzte sich neben seine Mutter, die in einer der unteren Kojen lag. Die Arme waren über der Brust gekreuzt, die Augen geschlossen, und ihr Atem ging leise, aber zumindest atmete sie.
»Wir sind’s, Mom. Ich und Lou.«
Lou schaute verärgert drein. »Oz, sie kann uns nicht hören.«
»Und ob sie kann!« In den Worten des Jungen lag eine Aggressivität, die Lou erschreckte, da sie sein Wesen zu kennen glaubte. Sie verschränkte die Arme und wandte den Blick ab. Als sie Oz’ wieder anschaute, hatte der ein kleines Kästchen aus seinem Koffer genommen und es geöffnet. An der Halskette, die er daraus hervorzog, hing als Anhänger ein kleiner Quarzstein.
»Oz, bitte«, beschwor ihn seine Schwester, »hörst du auf damit?«
Er beachtete sie nicht und hielt die Kette über seine Mutter.
Amanda konnte essen und trinken, wenngleich sie aus für die Kinder unerfindlichen Gründen ihre Glieder nicht bewegen und nicht sprechen konnte, und ihre Augen öffneten sich nie. Das war es, was Oz am schlimmsten zusetzte, ihm andererseits aber auch die meiste Hoffnung machte. Er war der Ansicht, dass bloß irgendeine Kleinigkeit beseitigt werden müsse – so wie ein Steinchen im Schuh oder ein Pfropfen, der ein Rohr verstopfte. Er musste bloß dieses kleine Hindernis aus dem Weg räumen, und seine Mom wäre wieder bei ihnen.
»Du bist so was von bescheuert, Oz! Hör auf damit!«
Oz hielt kurz inne und schaute seine Schwester an. »Weißt du, Lou, dein Problem ist, dass du an gar nichts glaubst.«
»Und dein Problem ist, dass du an alles glaubst.«
Oz schwang die Kette langsam über seiner Mutter hin und her. Er schloss die Augen und murmelte Worte, die man kaum verstehen konnte und die er wahrscheinlich selbst nicht verstand.
Lou stand dabei und wurde zusehends nervöser, bis sie den Unsinn nicht länger erdulden wollte. »Wenn jemand dich sieht, hält er dich für verrückt. Und weißt du was? Du bist verrückt!«
Oz hielt mit seinen Beschwörungen inne und warf ihr einen bösen Blick zu. »Jetzt hast du alles verdorben. Für diese Behandlung muss es ganz still sein.«
»Behandlung? Was für ’ne Behandlung? Wovon redest du überhaupt?«
»Möchtest du, dass Mom so bleibt, wie sie jetzt ist?«
»Von mir aus. Ist schließlich ihre eigene Schuld!«, schnauzte Lou ihn an. »Hätte sie nicht diesen dämlichen Streit mit Pa vom Zaun gebrochen, wäre der verdammte Unfall nicht passiert.«
Oz war wie betäubt von diesen Worten. Sogar Lou selbst schaute überrascht, dass sie so etwas hatte sagen können. Doch ihr Naturell ließ nicht zu, irgendetwas zurückzunehmen, das sie einmal gesagt hatte.
Keiner der beiden schaute in diesem Augenblick zu Amanda. Hätten sie es getan, wäre ihnen etwas aufgefallen: ein Zucken des Augenlids, das vermuten ließ, dass Amanda ihre Tochter irgendwie gehört hatte – um dann noch tiefer in jenen Abgrund zu fallen, der sie bereits so unentrinnbar gefangen hielt.
Wenngleich die meisten Fahrgäste es nicht merkten, wechselte der Zug allmählich die Richtung, als die Gleise sich von der Innenstadt weg in Richtung Süden schlängelten. Als sie über eine Weiche rumpelten, rutschte Amandas Arm von ihrem Oberkörper und pendelte an der Seite ihres Bettes.
Oz war einen Augenblick lang überrascht. Man konnte deutlich spüren, wie der Junge glaubte, Zeuge eines Wunders geworden zu sein, eines Wunders von biblischen Ausmaßen, ähnlich dem, als ein geschleuderter Stein einen Goliath gefällt hatte. Er schrie aus Leibeskräften: »Mom! Mommy!«, und war so aufgeregt, dass Lou ihn beinahe zu Boden gezerrt hätte. »Lou, hast du das eben gesehen?«
Doch Lou brachte kein Wort heraus, hatte sie doch angenommen, ihre Mutter würde nie wieder solch eine Reaktion zeigen. Gerade hatte sich auch auf Lous Lippen das Wort »Mom« gebildet, als die Tür sich öffnete und die Pflegerin, von Oz’ Schrei herbeigerufen, wie eine weiße Steinlawine ins Abteil rollte. Ihr Gesicht war ein einziger schroffer Block der Missbilligung. Kleine Schwaden Zigarettenrauch waberten um ihren Kopf, als wäre jeden Moment mit einer spontanen Selbstentzündung zu rechnen. Wäre Oz nicht gerade dermaßen auf seine Mutter fixiert gewesen, er wäre beim Anblick der Frau wohl panisch aus dem Fenster gesprungen.
»Was ist denn hier los?« Sie taumelte vorwärts, als der Zug erneut ruckelte, bevor er seine schnurgerade Bahn Richtung New Jersey fand.
Oz ließ die Kette fallen und wies auf seine Mutter.
»Sie hat sich bewegt. Ehrlich. Mom hat den Arm bewegt. Wir haben’s beide gesehen, stimmt’s, Lou?«
Doch Lou konnte nur von ihrer Mutter zu Oz und wieder zurück starren. Es kam ihr vor, als hätte jemand ihr einen Pfahl durch die Kehle getrieben; sie brachte kein Wort heraus.
Die Pflegerin untersuchte Amanda flüchtig, und ihr sauertöpfisches Gesicht wurde noch mürrischer; offenbar hielt sie die Unterbrechung ihrer Zigarettenpause für unverzeihlich. Sie legte Amandas lose baumelnden Arm zurück auf ihren Oberkörper und bedeckte ihn mit dem Bettzeug.
»Der Zug ist bloß durch eine Kurve gefahren. Mehr war da nicht.« Als sie sich daranmachte, das Laken zu richten, entdeckte sie die Kette auf dem Abteilboden, den belastenden Beweis für Oz’ Versuch, die Rückkehr seiner Mutter in die Wirklichkeit zu beschleunigen.
»Was ist das denn?« Zorn schwang in ihrer Stimme mit, als sie sich bückte und Beweisstück eins im Fall gegen den kleinen Jungen aufhob.
»Ich hab’s doch nur gebraucht, um Mom zu helfen. Das ist ’ne Art« – nervös blickte Oz seine Schwester an – »’ne Art Zauber.«
»So ein Unsinn.«
»Ich würd’s aber gern zurückhaben.«
»Eure Mutter befindet sich in einem katatonischen Zustand«, beharrte die Frau in einem kalten, rechthaberischen Tonfall, den sie stets dann anzunehmen schien, wenn sie den Verletzlichen und Unsicheren Schrecken einjagen wollte, und in Oz fand sie ein leichtes Opfer. »Es gibt kaum Hoffnung, dass sie jemals das Bewusstsein wiedererlangt. Und am allerwenigsten wegen einer kleinen Kette, junger Mann.«
»Bitte, geben Sie sie mir zurück«, sagte Oz und presste die Hände wie zum Gebet zusammen.
»Ich habe dir gerade gesagt …« Die Frau hielt inne, als sie eine Berührung an der Schulter spürte, und drehte sich um. Lou stand ganz dicht vor ihr. Das Mädchen schien in den letzten paar Sekunden merklich gewachsen zu sein, und die Art, wie sie Kopf, Hals und Schultern vorstreckte, ließ Mut und Entschlossenheit erkennen. »Geben Sie ihm sofort die Kette zurück!«
Das Gesicht der Pflegerin lief ob dieser Ungehörigkeit rot an. »Von Kindern nehme ich keine Anweisungen entgegen.«
Schnell wie der Wind schnappte Lou sich die Kette, doch die Pflegerin war überraschend kräftig. Es gelang ihr, die Kette einzustecken, obgleich Lou wie eine Furie kämpfte.
»Das hilft eurer Mutter nicht«, fauchte die Pflegerin in einer Wolke von Lucky Strike. »Jetzt setzt euch bitte hin und seid still!«
Oz schaute seine Mutter an, und der Schmerz darüber, seinen kostbaren Quarzstein wegen der Kurve eines Eisenbahngleises verloren zu haben, stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben.
Lou und Oz setzten sich ans Fenster und verbrachten die nächsten träge dahingleitenden Meilen damit, stumm den Sonnenuntergang zu beobachten. Dann wurde Oz wieder zappelig, und Lou fragte ihn, was los sei.
»Ich fühle mich schlecht, weil wir Pa so allein zurücklassen.«
»Er ist doch gar nicht allein, Oz.«
»Doch. Ist er wohl. In dem Holzkasten. Und jetzt wird’s dunkel. Bestimmt hat er Angst. Das ist nicht richtig, Lou.«
»Er ist nicht in diesem Kasten. Er ist jetzt bei Gott. Die sitzen da oben, schauen zu uns runter und reden über uns.«
Oz blickte zum Himmel. Seine Hand hob sich, als wollte er winken; dann aber hielt er verunsichert inne.
»Wink ihm ruhig, Oz. Er ist da oben.«
»Schwör es. Auf Ehre und Gewissen.«
»Alles, was du willst. Nun wink schon.«
Oz tat wie geheißen und grinste ein wenig geziert.
»Was ist?«, fragte seine Schwester.
»Ich weiß nicht. Fühlt sich irgendwie gut an. Glaubst du, er winkt zurück?«
»Na klar. Und auch der liebe Gott. Du weißt doch, wie Pa ist. Der erzählt jedem seine Geschichten. Die beiden haben sich bestimmt schon angefreundet.«
Lou winkte nun auch, und als ihre Finger sich auf das kühle Fensterglas zubewegten, machte sie sich für einen Augenblick vor, dass sie selbst an das glaubte, was sie soeben ihrem Bruder vorgeflunkert hatte. Und sie fühlte sich tatsächlich besser dabei.
Seit Jacks Tod hatte der Winter beinahe vor dem Frühling kapituliert. Lou vermisste ihren Vater Tag für Tag mehr, und in ihrem Innern breitete sich mit jedem Atemzug eine gewaltige Leere aus, dehnte sich ins Unermessliche. Ach, wenn ihr Vater doch lebend und gesund wäre! Und bei ihnen. Aber das war unmöglich. Ihr Vater war ein für alle Mal von ihnen gegangen. Ein Gefühl unendlicher Qual erfüllte sie. Sie schaute zum Himmel empor.
Hallo, Dad. Bitte vergiss mich nie, denn auch ich werde dich nie vergessen. Lou formte die Worte unhörbar für Oz. Als sie endete, glaubte sie weinen zu müssen, doch sie konnte es einfach nicht – nicht, wenn Oz dabei war. Wenn sie weinte, würde höchstwahrscheinlich auch ihr Bruder in Tränen ausbrechen, und das womöglich für den Rest seines Lebens.
»Wie fühlt es sich wohl an, tot zu sein?« Oz starrte in die Nacht hinaus, als er die Frage stellte.
Es dauerte eine Weile, bis Lou ihm antwortete. »Na ja, wenn man tot ist, fühlt man wohl gar nichts mehr. Aber auf eine ganz andere Art fühlt man dann doch irgendwie alles. Alles, was gut ist. Wenn man ein anständiges Leben geführt hat, versteht sich. Wenn nicht … na, du weißt ja.«
»Die Hölle?«, fragte Oz, und als er das schreckliche Wort aussprach, lag das ungeschminkte Grauen in seinem Blick.
»Du brauchst keine Angst davor zu haben. Und Dad sowieso nicht.«
Oz’ Blick wanderte weiter, bewegte sich zögernd, aber stetig auf Amanda zu. »Wird Mom auch sterben?«
»Wir alle sterben eines Tages.« Lou wollte diesmal nichts beschönigen, nicht einmal für Oz, doch sie drückte ihn an sich. »Aber eins nach dem anderen. Wir haben noch ’ne Menge vor.«
Lou starrte hinaus, während sie ihren Bruder in den Armen hielt. Nichts galt für ewig, das wusste sie genau.
KAPITEL 5
Es war noch sehr früh am Morgen. Die Vögel waren gerade erst erwacht und schüttelten ihre Flügel auf. Kalte Dunstschleier stiegen vom warmen Boden empor, und die Sonne zeigte sich vorerst nur als glühender Strich am östlichen Horizont. Sie hatten in Richmond Halt gemacht, wo die Lokomotive gewechselt worden war; dann hatte der Zug das Shenandoah Valley mit seinem fruchtbaren Boden und dem milden Klima durchquert, das dort praktisch alles wachsen ließ. Doch nach und nach wurde dieser Winkel des Landes schroffer.
Lou hatte nur wenig geschlafen, denn sie hatte sich mit Oz die harte Bank geteilt, und ihr Bruder war in der Nacht sehr unruhig gewesen. In einem schaukelnden Zug unterwegs in eine neue, beängstigende Welt … das hatte den schlafenden kleinen Kerl in eine wahre Wildkatze verwandelt. Lous Arme und ihr Oberkörper waren mit blauen Flecken übersät, denn Oz hatte im Schlaf um sich geschlagen, obwohl die große Schwester ihn fest im Arm gehalten hatte; ihre Ohren waren taub von seinen Schreien, obwohl sie ihm beruhigende Worte zugeflüstert hatte. Schließlich war Lou mit bloßen Füßen auf den kalten Abteilboden gestiegen, im Dunkeln zum Fenster gestolpert, hatte die Vorhänge zurückgezogen und war mit einem ersten Blick auf einen Berg in Virginia belohnt worden.
Jack Cardinal hatte seiner Tochter einmal erzählt, die Berge in dieser Gegend seien tatsächlich die Folge von zwei geologischen Aufwerfungen. Die erste sei vor Millionen von Jahren durch das Zurückweichen des Urmeeres und die Schrumpfung des Kontinents gebildet worden und habe sich zu einer gewaltigen Höhe emporgehoben, höher als die Rocky Mountains heute. Später seien die gewaltigen Gipfel durch Regen und Wind zu Hügeln abgetragen worden. Dann habe die Welt sich noch einmal geschüttelt, hatte Dad ihr erklärt, und das Gestein sei ein zweites Mal hochgedrückt worden, allerdings nicht ganz so hoch wie zuvor, und bilde seitdem die Appalachen, die wie drohende Hände zwischen Teilen Virginias und West-Virginias aufragten und sich von Kanada bis hinunter nach Alabama erstreckten.
Die Appalachen hätten eine frühe Ausdehnung der Siedler nach Westen verhindert, lehrte Jack seine stets wissbegierige Lou, und die amerikanischen Kolonien lange genug zusammengehalten, um deren Unabhängigkeit von der britischen Krone zu erringen. In späterer Zeit hatten die Bodenschätze in den Bergen und deren Ausläufern dazu beigetragen, dass eines der größten Industriegebiete entstand, das die Welt je gesehen hatte. Trotzdem, hatte Jack mit einem resignierten Lächeln hinzugefügt, war der Mensch nie auf den Gedanken gekommen, sich bei den Bergen zu bedanken, die seiner Sache immer so dienlich gewesen waren.
Lou wusste, wie sehr ihr Vater die Berge Virginias geliebt hatte und dass er vor den schroffen Felszinnen in Ehrfurcht erstarrt war. Oft hatte er Lou erzählt, dass etwas Magisches an einem Gebirgszug sei; er glaube fest daran, dass es im Gebirge Kräfte gebe, die mit Vernunft und Logik niemals zu erklären seien. Lou hatte sich häufig gefragt, wie ein Haufen Dreck und Steine, so hoch er auch war, ihren Vater derart beeindrucken konnte. Nun aber bekam sie zum ersten Mal ein Gespür dafür, denn etwas Vergleichbares hatte sie noch nie gesehen.
Die baumbestandenen Erhebungen aus Erde und Schiefer, auf die Lous Auge zunächst gefallen war, hatten sich lediglich als erste Ausläufer erwiesen. Hinter diesen »Kindern« zeichneten sich bald die Umrisse ihrer größeren »Eltern« ab, der eigentlichen Berge. Sie schienen sich von der Erde bis zum Himmel zu erstrecken; so riesig und gewaltig, dass sie unnatürlich wirkten, wenngleich sie direkt aus der Erdkruste geboren waren. Und irgendwo da draußen in diesen Bergen lebte die Frau, nach der Lou benannt, der sie aber nie begegnet war. Trost und Misstrauen gleichermaßen begleiteten den Gedanken an Louisa Mae Cardinal. Für eine Schrecksekunde hatte Lou das Gefühl, als habe sie der ratternde Zug in ein fremdes Universum hineingetragen. Dann erkannte sie Oz neben ihr, und obwohl der kleine Kerl nicht gerade dazu angetan war, anderen Vertrauen einzuflößen, fühlte Lou sich augenblicklich ruhiger, weil er bei ihr war.