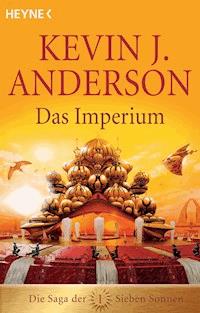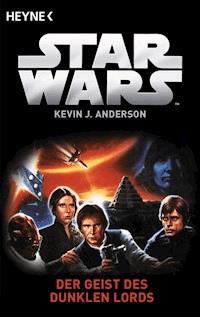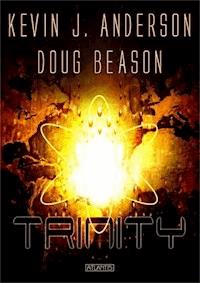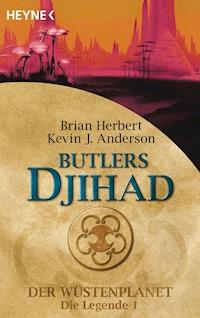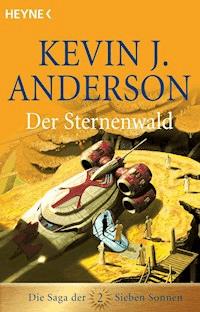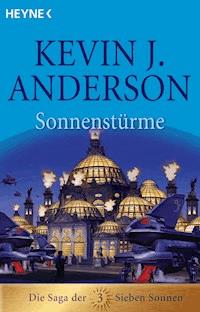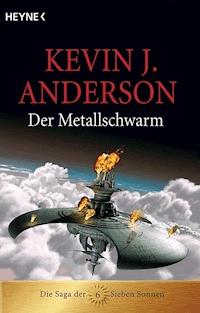11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Als eine uralte Macht erwacht, müssen zwei verfeindete Reiche ihre Vergangenheit hinter sich lassen und eine Allianz schmieden – oder gemeinsam untergehen
Tief unter der Erde, geschützt von einem mächtigen Gebirge, lauert der Drache, die Verkörperung alles Bösen in dieser Welt. Über ihm liegen das magische Imperium der Drei Königreiche und Ishara, das Reich der Menschen, seit Jahrhunderten miteinander im Krieg. Doch als aus den sengenden Dünen der Wüste ein seit Langem verschollenes Volk auftaucht, müssen sich Ishara und die Drei Königreiche miteinander verbünden, um sich der neuen Bedrohung entgegenzustellen. Unterdessen wird der Drache rastloser und rastloser, und wehe den Menschen und magischen Völkern, wenn er aus den Tiefen der Erde aufsteigt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 997
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Seit Jahrhunderten liegen der Staatenbund und das magische Reich Ischara miteinander im Krieg. Conndur, König aller Könige und Herrscher über den Bund, strebt seit Langem den Frieden mit den Ischaranern an, der allerdings immer wieder von Intrigen an seinem eigenen Hof verhindert wird. Eines Tages macht sein Sohn Adan bei einem Ausritt in die Wüste eine Entdeckung, die den Lauf der Dinge grundlegend verändern soll: Die Wreth, ein seit Langem verloren geglaubtes Volk, sind zurückgekehrt, und sie verfolgen ihre ganz eigenen, geheimnisvollen – und nicht immer friedlichen – Absichten. Doch damit nicht genug: Tief unter dem gewaltigen Drachengrat-Gebirge schläft seit Äonen der riesige Drache Ossus, eine Kreatur so mächtig und böse, dass weder Menschen noch Magier noch Wreth ihm etwas entgegenzusetzen haben. Und nun, ausgerechnet in der Stunde, in der alte Feindschaften aufbrechen und neue Bündnisse geschmiedet werden, ist Ossus erwacht …
Der Autor
Kevin J. Anderson, geboren 1962, studierte Physik und ist einer der meistgelesenen Science-Fiction-Autoren unserer Zeit. Er wurde durch seine Star Wars-Romane und -Anthologien international bekannt. Seine High-Tech-Thriller und Akte X-Romane stürmen in den USA die Bestsellerlisten. Zusammen mit seiner Ehefrau Rebecca Moesta verfasste er die Romanreihe um die Young Jedi Knights. Zuletzt ist von ihm die gefeierte Saga der Sieben Sonnen erschienen. Außerdem schreibt er gemeinsam mit Frank Herberts Sohn Brian dessen großen Wüstenplanet-Zyklus fort. Auf den Schwingen des Drachen ist der Auftakt zu einer epischen Fantasy-Saga.
KEVIN J. ANDERSON
AUF DEN
SCHWINGEN
DES
DRACHEN
Roman
Aus dem Amerikanischen übersetzt
von Michael Siefener
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Titel der OriginalausgabeSPINE OF THE DRAGON
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 08/2020
Redaktion: Joern Rauser
Copyright © 2019 by WordFire, Inc.
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe
und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München
Umschlagillustration: Kerem Beyit
Karten: Bryan G. McWhirter
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-25520-6V001
www.heyne.de
Dieses Buch widme ich dem gesamten Stamm der Superstars
Writing Seminars für seine Unterstützung und seinen Eifer.
Lernen und Kreativität sind keine Einbahnstraße,
und während der letzten zehn Jahre hat die Arbeit mit euch
mein Leben so farbenfroh gemacht, wie es meine fiktiven Welten
nur sein können.
1
Wie ein lebendiges Wesen wogte der große Sandsturm über die Berge im Grenzgebiet. Braun und voller Wut stieg er immer höher in den Himmel hinauf, während er sich von Westen der Hauptstadt Bannriya näherte. In deren Mitte flatterten und peitschten auf den hohen Sandsteintürmen der Burg gelbe und rote Flaggen im anschwellenden Wind.
Im Schutz der Stadtmauern huschten die Menschen durch die Straßen. Gewürzhändler deckten ihre Körbe voller Zimtrinde, klobiger Kurkumawurzeln und getrocknetem Pfeffer ab und zogen sie ins Innere ihrer Läden. Wirte rollten die Baldachine aus Leinwand zusammen und banden sie fest. Straßenköche trugen ihre Tische in die Schuppen. Mütter riefen ihre Kinder herein, und das Schlagen von Fensterländen, die rasch geschlossen wurden, hallte durch die unteren Gassen.
Adan Sternenfall, der junge König von Suderra, stand allein auf dem Turm der Burg von Bannriya und sah zu, wie sich seine große und prächtige Stadt auf den Sturm vorbereitete. »Es wird schlimm werden«, flüsterte er sich selbst zu. »Furchtbar.« Die starke Burg war auf einer Anhöhe innerhalb der großen ummauerten Stadt errichtet worden, und böige Windstöße umwirbelten den höchsten Turm.
Er liebte es, in klaren Nächten auf dieser Aussichtsplattform zu stehen und die Sterne zu betrachten, doch nun sah er nur die dichter werdende trübe Finsternis am Himmel. Die herannahenden Wolken trieben wie Rauch umher, als wären sie von irgendeiner gigantischen Macht aus der Wüste tief im Westen aufgewirbelt worden. Angesichts eines solchen Unwetters zerrann seine Königsmacht zur Bedeutungslosigkeit. Er vermutete, dass die ganze Gewalt des Sturms in etwa zwei Stunden über sie hereinbrechen würde.
Adan schob sich einige rotbraune Haarsträhnen aus der hohen Stirn, aber die Böen trieben sie sofort wieder zurück. Das hübsche Gesicht und das rundliche Kinn wurden von einem rostbraunen Spitzbart geschmückt, während die blauen Augen für einen König jung wirkten und von Neugier und Barmherzigkeit zeugten.
Adan regierte zwar erst seit drei Jahren, doch Bannriya selbst war schon vor fast zweitausend Jahren erbaut worden, und seitdem hatte die Hauptstadt zahlreiche Stürme durchlitten. Die Menschen wussten also, wie sie Schutz suchen und den Sturm überstehen konnten, und hinterher kamen sie dann immer mit ihren Besen hervor und fegten die Bürgersteige und die Treppen, die zu den Haustüren hochführten, und sie schüttelten die Banner aus, für die diese uralte Stadt berühmt war.
Aber er war entschieden, seine Untertanen nicht sich selbst und ihren Sorgen zu überlassen. Als er den Thron von Suderra bestiegen hatte, das eines der drei Königreiche des Staatenbundes war, hatte er versprochen, eine andere Art von König zu sein. Während er auf das Labyrinth der Straßen unter sich blickte, sann er darüber nach, wie hier zu helfen wäre. Er wollte seinem Volk zeigen, dass er nicht zu den verbitterten, überheblichen Königen oder zu den korrupten Regenten gehörte, an die die Suderraner so lange schon gewöhnt waren.
Unerwartet wurde hinter ihm die Tür zur Burg geöffnet, und seine Frau Penda trat auf die Aussichtsplattform. Sie war schlank und geschmeidig und hatte große braune Augen, die sogar noch dunkler waren als ihr üppiges brünettes Haar. Ihr herzförmiges Gesicht und ihre selbstsicheren Bewegungen waren für die wilden Utauk-Stämme typisch – dabei handelte es sich um die nomadisierenden Händler-Clans, die durch den Staatenbund zogen.
»Ich habe den Sturm sogar innerhalb der Burg gespürt, mein Sternenfall.« Sie trat neben ihn und betrachtete die noch ferne, aber rasch näher kommende Staubwolke. Aus Gewohnheit zeichnete sie einen Kreis über ihrem Herzen. »Cra, dieser Sturm ist mächtig!« Der große Reptilienvogel auf ihrer Schulter sträubte die Federn und hielt sich an einem ledernen Schutzpolster fest, damit er das Gleichgewicht nicht verlor.
Mit ihren einundzwanzig Jahren war Penda zwei Jahre jünger als Adan, aber auf ihren Reisen mit den Utauk-Karawanen hatte sie mehr von der Welt gesehen als er. Adan redete sich oft ein, er habe seine exotische Frau gezähmt, doch vermutlich war eher sie es, die ihn gezähmt hatte. Das war ihm auch ganz recht. Sie war keine kriecherische Prinzessin und würde nie zu einer solchen werden – genauso wollte er es. Seit zwei Jahren waren sie verheiratet, und noch immer hatte seine Liebe zu ihr nichts von ihrer Frische und Neuartigkeit verloren. Und Penda vergötterte ihn – daran hegte er keinen Zweifel.
Pendas mutwilliger Schlingel von einem Ska war so groß wie ein Falke, hatte smaragdgrüne Schuppen am Leib, ein blassgrünes Gefieder und Facettenaugen wie eine Motte. Ein dünnes Band war um seinen schuppigen Hals geschlungen und in der Mitte mit einem Diamanten geschmückt. Nur die Utauk waren in der Lage, diese fliegenden Geschöpfe zu halten und sich um sie zu kümmern, und einige Besitzer, zu denen auch Penda gehörte, hatten eine deutliche Herzensverbindung zu ihren Tieren und waren in der Lage, Gefühle mit ihnen zu teilen. Hochmütig neigte der Ska den Kopf von der einen Seite zur anderen, als erwartete er, dass Adan etwas gegen den Sturm unternehmen würde.
»Ganz ruhig, Xar.« Penda tätschelte die Seite des schmalen Ska-Gesichts, dann drehte sie sich zu Adan um. »Ich habe schon viele Sandstürme überstanden, die draußen in den Bergen an unseren Zelten gezerrt haben, aber das hier ist mehr als bloß ein Sturm. Er fühlt sich anders an … nicht natürlich.« Sie versteifte sich und unterdrückte ein unwillkürliches Zittern.
Über ihnen flatterte ein gelbes Banner und zerrte an seinem Pfosten. Der Staub, den Adan einatmete, roch bitter und wies eine seltsame Beimischung von Holzrauch auf. »Es ist doch nur ein Sturm. Was sonst sollte es sein?«
Penda schloss die Augen, als könnte sie den Sturm deutlicher wahrnehmen, wenn sie ihn nicht betrachtete. Xar regte sich auf ihrer Schulter und erspürte die Welt für sie. »Er wurde tief im Schmelzofen erschaffen. Vielleicht ist er ein … ein Vorbote.« Sie riss die Augen auf und sah wieder zu den Bergen hinüber. Der Reptilienvogel gab einen summenden Laut von sich, der nicht ganz ein Knurren war, dann vergrub er das Gesicht in ihrem dichten Haar, als wollte er sich darin verstecken. »Skas sind besonders feinfühlig, was solche Dinge angeht.«
»Genau wie du.« Adan drückte ihre Schulter, und sie trat näher an ihn heran und lehnte sich gegen ihn. Er vertraute den Gefühlen seiner Frau, denn er wusste, dass die Utauk eine besondere Nähe zu den schwachen Überresten von Magie besaßen, die noch im Land verblieben waren. »Die Stadt bereitet sich schon vor, aber wir sollten die Zeit nutzen, um den Bewohnern beizustehen. Ich rufe die Bannergarde, und wir reiten von Haus zu Haus und bieten unsere Hilfe an.«
Gerade als sie sich umdrehten und nach unten gehen wollten, stürmte ein breitschultriger Mann mit sauber gestutztem dunklem Bart durch die Tür, die zu der Aussichtsplattform führte. »Was tust du noch hier oben, mein liebes Herz? Cra, geh nach drinnen!« Hale Orr, Pendas Vater, schwenkte den schon lange verheilten Stumpf seiner linken Hand. Er trug purpurrote und schwarze Seide, ein lockeres, über dem Bauch mit einer Schärpe zusammengebundenes Wams und eine sackartige Hose. Einer seiner Schneidezähne bestand aus Gold, die anderen strahlten weiß. »Als wir in den Zelten gelebt haben, hätte eine solche Staubwolke Angst in unsere Herzen gesenkt.«
»Dann sei froh, dass du das Nomadenleben aufgegeben hast und mit uns in die Burg gezogen bist, Vater Orr«, sagte Adan. »Hinter den Mauern sind wir in Sicherheit, aber ich möchte noch rasch auf Patrouille durch die Stadt reiten, bevor der Sturm auf uns trifft.«
»Aber du kannst doch nichts gegen ihn ausrichten«, schnaubte Hale. »Bleib lieber drinnen und beschütze meine Tochter.«
Penda ergriff den Arm des Königs. »Ich werde mit meinem Sternenfall reiten. Los geht’s!«
Der ältere Mann gab einen verärgerten Laut von sich, aber Adan sagte in mitfühlendem Ton: »Weißt du, du wirst sie nicht davon abhalten können.«
Rasch zog Hale einen Kreis um sein Herz und murmelte erzürnt: »Der Anfang ist das Ende ist der Anfang.« Dann folgte er den beiden nach drinnen und verriegelte die Holztür hinter ihnen.
Adan sagte: »Penda und ich, wir werden zusammen mit der Bannergarde nach draußen gehen. Die Leute sollen sehen, dass wir uns um sie kümmern.« Sein Vater, der Konag des gesamten Staatenbundes, König aller Könige, hatte ihn sein ganzes Leben lang auf solche Situationen vorbereitet. »Für sie bin ich noch neu hier.«
Hale stapfte vor ihnen die Treppe hinunter. »Wenn ihr nach draußen geht, sollte ich mich hier drinnen ans Werk machen. Die Burg wird zwar nicht wie ein Zelt wegfliegen, aber es gibt eine Menge Spalten und Ritzen, die der Sturm leicht finden könnte. Die Stadtbewohner wissen nicht immer, wie man ein Bauwerk am besten sichert.«
Während Xar sich bemühte, auf Pendas Schulter das Gleichgewicht nicht zu verlieren, stiegen sie in den Hauptteil der Festung hinunter, in dem sich die Diener abmühten, die äußeren Fensterläden vorzulegen und das vergitterte Glas von innen abzudecken. Sie stopften Stoff in die Spalten und lauschten auf jedes Pfeifen eines verirrten Luftzuges.
Adans elfjähriger Knappe, ein übereifriger Junge namens Hom, eilte herbei. Sein lockiges Haar war zerzaust, und das Hemd saß schief. »Sire, wie kann ich helfen? Soll ich Euch die Pantoffeln bringen? Etwas Tee zum Sturm? Oder …«
Adan hob die Hand. »Der Sturm ist noch nicht hier, Hom, und wir haben da draußen einiges zu erledigen. Sei versichert, dass ich dir noch genug zu tun geben werde.« Hom Santis, der jüngere Sohn eines der kürzlich abgesetzten Regenten, strengte sich regelmäßig an, seine Verlässlichkeit zu beweisen. Jeden Tag folgte der Knappe Adan und versuchte, alle Bedürfnisse seines Herrn und Meisters im Voraus zu erahnen. Dabei schien er aber nicht zu begreifen, dass der König auch hin und wieder ein wenig Ruhe und Zurückgezogenheit brauchte. Andauernd machte er sich Notizen über Adans bevorzugte Speisen, über seine Lieblingsfarben und -kleider. Der Junge war so eifrig, dass Adan sich vorgenommen hatte, ihm irgendwann eine Stelle im Ministerium für Finanzen oder Handel zu verschaffen.
Hale Orr legte seinen langen Arm um Homs Schulter. »Komm, Junge, du kannst mir dabei helfen, diesen Leuten zu zeigen, wie man eine Burg auf den Sturm vorbereitet.«
Penda wollte ihren Ska nicht noch nervöser machen, indem sie ihn mit nach draußen nahm. Darum setzte sie Xar auf seiner Stange im Speisesaal ab und begleitete Adan zu den Ställen, wo ihre Pferde schon gesattelt waren und die Bannergarde bereitstand. Ein magerer junger Soldat von fünfzehn Jahren führte zwei Fuchsstuten für den König und die Königin herbei. Der junge Gardist, in dem Adan Homs Bruder Seenan erkannte, hatte genauso störrische Haare, die teilweise von einem Helm aus Leder und Stahl bedeckt waren. »Hab sie für Euch vorbereitet, Sire. Die Nachricht kam, und wir wollten keine Zeit verlieren.«
Der junge Gardist half ihm in den Sattel, während sich Penda mit der Anmut einer Tänzerin auf ihre Stute schwang. Die beiden Pferde führten eine Gruppe von zwölf Bannergardisten an. »Uns bleibt nicht viel Zeit, Sire. Die Straßen sind schon ziemlich leer geworden, und wir möchten doch gewiss hinter verschlossenen Türen sein, wenn der Sturm auf uns trifft.«
Mit den Knien trieb Penda ihre Stute zu einem Trab an, und die ganze Gruppe setzte sich in Bewegung. Die Pferdehufe klapperten auf dem Kopfsteinpflaster der Straßen, die sich von der hoch gelegenen Burg weg wanden. Als sie unter dem großen Torbogen hindurchritten, warf Adan einen Blick auf die Statue eines alten Wreth-Königs, die symbolisch vom Sockel gestoßen worden war und nun auf dem Boden vor der Burg lag. Die Schöpferrasse ähnelte jener der Menschen, doch sie wirkte auf den Bildwerken, die noch von ihr existierten, hochmütiger und unnahbarer; diese Wesen wiesen große mandelförmige Augen, ein spitzes Kinn, eine hohe Stirn und eine breite Brust auf. Die Statue war als Trophäe aus einer der zerstörten Wreth-Städte mitgenommen worden, die noch immer die Landschaft sprenkelten, obwohl schon so viele Jahrhunderte seit ihrem Untergang verstrichen waren.
Bannriya war die erste Stadt gewesen, die nach den verheerenden Wreth-Kriegen vor zweitausend Jahren von menschlichen Überlebenden erbaut worden war. Trotzig hatten sie Banner aufgezogen und mit ihnen ihre Unabhängigkeit von der Schöpferrasse verkündet. Die Wreth waren nun schon lange verschwunden und kaum mehr als eine Legende. Geduldig hatten die Menschen das verwüstete Land nach dem furchtbaren magischen Konflikt wiederaufgebaut. Sie hatten Häuser und Städte errichtet, nicht länger als Sklaven einer uralten Rasse, sondern als ein freies Volk.
Auch wenn sich Adan in seiner Rolle als König noch immer wie ein Neuling vorkam, spürte er doch das Gewicht der Geschichte überall um ihn herum.
In den oberen Stockwerken der Stadthäuser, die aus Ziegeln und Holz bestanden, legten die Bewohner die Läden vor die Fenster. Eine Frau in einer Schürze nagelte einen Deckel auf ein halbvolles Regenfass, sodass kein Sand hineingelangen konnte. Zwei Jungen schoben einen Karren gegen die Wand ihres Hauses und kippten ihn um, damit er nicht davonrollte. Sogar diesen großen Sturm schienen sie lässig zu nehmen.
Adan und seine Eskorte boten ihre Unterstützung all jenen an, die sie brauchten. Sie stiegen ab und halfen den Ladenbesitzern mit ihren Fässern, Getreidesäcken und aufgerollten Teppichen. Hoffnungsvolle Töpfer senkten lauthals die Preise für ihre Waren, auch wenn sich die Straßen rasch leerten; einer versuchte sogar, mit König Adan zu feilschen.
Penda saß auf ihrer Fuchsstute und richtete die Aufmerksamkeit von einem Gebäude zum nächsten, als könnte sie spüren, welches am verwundbarsten war. Sie entdeckte eine Utauk-Familie, die aus fünf Personen bestand – Reisende aus einer kleinen Karawane, die ihre Zelte in einer schmalen Gasse aufgeschlagen hatten und dort zusammen mit ihren Pferden Schutz suchten. Adan zügelte sein Pferd und sprach die Utauk an. »Ihr dürft auf keinen Fall im Freien bleiben. Habt ihr keinen besseren Ort, an dem ihr den Sturm überstehen könnt?«
Der Anführer der kleinen Gruppe, ein Mann mit verfilztem weißem Haar und einem flauschigen grauen Bart, trat in geduckter Haltung an sein Pferd heran. »Hier ist es besser als draußen in den Bergen. Die Mauern werden uns ausreichend schützen.« Er blickte zu Penda hinauf und erkannte das Purpurrot und Schwarz ihres Stammes. »Wir sind erst gestern in die Stadt gekommen.«
Penda wandte sich an einen der Gardisten. »Bringt sie zu den Stallungen im nächsten Häuserblock; dort können sie mit ihren Tieren bleiben. Für sie ist das ein besserer Ort als die Straße.«
Bevor der Anführer der Gruppe etwas einwenden konnte, fügte Adan hinzu: »Wir werden den Eigentümer der Stallungen entschädigen, sollte er Einwände geltend machen.«
Penda zeichnete mit dem Finger einen Kreis in die Luft, und der Anführer antwortete mit der gleichen Geste. Die Utauk sammelten ihr Gepäck und ihre Besitztümer ein, bedankten sich für diese Unterstützung und eilten davon.
Seenan zeigte in den Himmel, der die bedrohliche Färbung eines Blutergusses angenommen hatte. »Sire, wir müssen jetzt wirklich zurückreiten.« Schon trieb Sand durch die Luft.
Adan blickte die Straße hinunter und beobachtete, wie die letzten Bewohner in ihre Häuser huschten und auch dort die Läden vor die Fenster gelegt wurden. Er nickte. »Wir haben fürs Erste getan, was wir konnten.«
Penda wendete ihre Fuchsstute und warf einen Blick zurück auf ihren Gemahl. »Ich reite mit dir um die Wette, Sternenfall! Die Bannergarde findet den Rückweg allein.« Sie galoppierte davon, und Adan jagte ihr durch die Straßen nach und auf das Burgtor zu.
Der König und die Königin betraten den Speisesaal und klopften sich den Staub von den Kleidern. Wimpel mit dem Symbol der offenen Hand des Staatenbundes und das Banner von Suderra – eine Flagge innerhalb einer Flagge – hingen an den Wänden. Pendas Ska hockte auf einer Stange hinter ihrem Stuhl und nickte voller Aufregung, als fragte er sich, warum sie ihn so lange allein gelassen hatte.
Die Burg hatte man so sorgfältig wie möglich auf den Sturm vorbereitet; die Fenster waren abgedeckt und Stoff war in jede Öffnung gestopft worden. Penda fuhr sich mit den Fingern durch die langen, dunklen Haare und wischte die vom Wind zerzausten Strähnen zurück. »Anscheinend hat mein Vater seine Pflicht ernst genommen.«
»Das habe ich allerdings, meine Liebe.« Hale wählte einen Sitz an der langen Banketttafel. Der Knappe neben ihm wirkte erschöpft. »Und der junge Hom ist mir eine große Hilfe gewesen.«
Der Junge sagte entschuldigend: »Es gibt zwar kein formelles Abendessen, Sire, aber wir haben Brot und kaltes Geflügel. Es sei denn, Ihr wollt lieber …«
»Ein kleines Mahl ist völlig in Ordnung, Hom«, erwiderte Adan. »Und du darfst dich gern zu uns gesellen. Hol dir einen eigenen Teller. Während des Sturms gibt es keinen Grund für Förmlichkeiten.« Der verwirrte Knappe zögerte, und der König scheuchte ihn weg, damit er endlich die Speisen holte.
Als das Mahl auf Platten serviert wurde, sah Hale Penda und Adan an, und dabei glitzerte es in seinen Augen. »In einer Nacht wie dieser sollten sich junge Paare aneinander kuscheln und vielleicht sogar ein Sturmkind zeugen.«
Penda legte sich die Hand auf den Bauch. »Bei uns ist schon ein Sohn oder eine Tochter unterwegs.« Es zeigte sich zwar noch nichts, aber sie war bereits im dritten Monat schwanger. »Eins nach dem anderen, Vater.«
»Ein wenig Übung schadet nichts, mein liebes Herz. Das habe ich deiner Mutter immer gesagt.«
Während des Mahls kamen noch mehr Diener in den großen Saal und warteten dem König und der Königin auf; außerdem sehnten sie sich angesichts des tobenden Sturms vor den Fenstern nach Gesellschaft. Hom war so schüchtern, dass er sich nicht an den Gesprächen beteiligte. Lieber nahm er einen Armvoll Holz und legte die Scheite sorgfältig in das Kaminfeuer.
Plötzlich sprang der Wind draußen auf wie eine wütende Macht, die versuchte, sich den Weg in die Burg zu erkämpfen. Mit einem seufzenden Laut fuhr die Luft durch den Kamin und zog die Flammen hoch, sodass sie wie ein zuckender Schleier wirkten. Hom ächzte überrascht auf, als das Feuer flackerte, und ließ das Scheit, das er noch in der Hand hielt, auf die Kohlen fallen. Funken wirbelten wie niedergehende Sternschnuppen empor, und ein Schwall aus Staub und Asche fuhr auf die Flammen nieder und hätte sie beinahe ausgelöscht.
Bevor Hom aufspringen konnte, drängte ein weiterer staubgesättigter Windstoß gegen die Außenläden des Seitenfensters und zerbrach den Riegel. Der linke Laden wurde aufgerissen und schlug mit einem Geräusch gegen die Steinmauer, das wie das Knallen einer Peitsche klang. Eines der rautenförmigen Gläser des inneren Fensters löste sich aus der Verankerung und fiel zu Boden.
Hale Orr und Adan rannten gleichzeitig zu dem Fenster, während der Lärm des Sturms mächtig anschwoll. »Holt Lappen und Lumpen und verstopft das Loch! Holt irgendetwas!«, rief Adan. Eine Frau zog rasch das Leinentuch von einem Tisch an der Seite des Saals und hielt es ihm hin. Hale nahm es mit unsicheren Fingern, während Adan es in das Loch im Fenster stopfte.
Draußen schlug der aufgesprungene Laden immer wieder gegen die Wand und wurde vom Sturm durchgeschüttelt, als handele es sich um eine Ratte im Maul einer Katze. Einige weitere Glasrauten in dem verwundbar gewordenen Fenster klapperten und lösten sich.
Adan sah seinen Schwiegervater an. »Wenn wir den Laden nicht sichern, wird bald das ganze Fenster herausfallen.«
Hale nickte. »Wir werden schnell sein müssen, Sternenfall.«
»Das werde ich.« Er öffnete den Riegel des Glasfensters, das sofort nach innen aufsprang, sodass er es kaum packen konnte, bevor alle weiteren Glasstücke zersprangen. Hale bemühte sich, ihn zu unterstützen.
Adan lehnte sich über den Sims hinaus in den Sturm und griff nach dem klappernden Laden. Seine Finger rutschten ab, also streckte er sie erneut aus. Es war, als versuchte er, ein wildes Pferd einzufangen. Schließlich aber gelang es ihm, den Rand zu packen, und er zog den Laden auf das Fenster zu.
Dabei hatte er die Gelegenheit, für einen Augenblick nach draußen zu schauen, und er konnte den braunen, rauchigen Sturm wahrnehmen, wie er durch die Straßen von Bannriya tobte und an den uralten Mauern entlangscheuerte. Auch andere Fensterläden ächzten unter dem Angriff von Sand und Wind. Dachschindeln flogen umher wie Löwenzahnsamen und prallten gegen die Mauern. Der Sandsturm fegte vorbei, und einen Moment lang glaubte er das zu sehen, was Penda gespürt hatte: etwas Dunkles, Polterndes, Unheilverkündendes.
Er zog den Laden ganz zu und sperrte damit den Sturm aus. »Schnell, sichert ihn!« Hastig wickelten Hale und der Knappe eine Schnur um den Riegel. Der hölzerne Fensterladen knirschte und ächzte, als der Wind gegen ihn drückte und an seiner Oberfläche kratzte.
Unter einem Seufzen schloss Adan sanft auch das innere Bleiglas. Xar flatterte auf seiner Stange mit den Flügeln, als erkenne er huldvoll an, dass sich der König um ein unangenehmes Problem gekümmert hatte. Penda schob ihrem Gemahl die zerzausten Haare aus dem Gesicht und küsste ihn auf die Stirn. In den Speisesaal kehrte wieder Ruhe ein.
Hom wirkte verwundert und wurde schamrot. Mit seiner gesunden Hand wischte sich Hale Orr den Staub von der Kleidung. »Und jetzt sollten wir uns darum kümmern, was wir uns zum Nachtisch genehmigen.«
In der Morgendämmerung ließ der Sturm endlich nach. Adan und Penda hatten sich während der Nacht aneinander festgehalten, und keiner von beiden hatte bei dem heulenden Sturm schlafen können. Als der Tag anbrach, fegten letzte Staubreste durch die Straßen wie das Lagergefolge nach einer großen Schlacht.
Adan stand früh auf und wollte sofort sehen, wie es der Stadt ergangen war. Er zog sich eine Leinenhose und ein Seidenhemd an. Penda gesellte sich zu ihm, während ihr Ska auf dem Schulterpolster das Gleichgewicht zu halten versuchte. Hom eilte herein und war enttäuscht, als er den König bereits vollkommen angekleidet vorfand. Er wirkte, als hätte er nicht einen einzigen Augenblick geschlafen. »Frühstück, Sire?«
»Noch nicht, Hom.« Rasch verließ Adan sein Gemach, während Penda an seiner Seite blieb.
In der Haupthalle entfernten die Diener den Schutz vor den Fenstern und öffneten die Läden, sodass der helle Sonnenschein durch das Bleiglas dringen konnte. Einige Bedienstete zogen das große Burgtor auf, hinter dem eine feine Kaskade aus Staub wogte.
Adan begab sich nach draußen und stellte erleichtert fest, dass er keine abgerissenen Dächer oder eingestürzten Häuser sah; allerdings waren viele Türeingänge von Sandwehen versperrt. »Jetzt wird aufgeräumt.«
Geschäftsleute traten vor ihre Läden, schätzten ihre Schäden ein und fegten den angehäuften Sand mit Strohbesen weg. Kinder stapften durch die pulverigen Hügel, wirbelten dabei Staubwolken auf und hinterließen ihre Fußabdrücke.
Hale Orr gesellte sich zu Adan und Penda und wischte sich mit seinem Stumpf den Staub von der Stirn. »Cra, ich bin froh, dass wir nicht draußen in einem Zelt gesteckt haben. Alles hätte viel schlimmer sein können.«
Plötzlich drangen Rufe von den Wachttürmen auf der äußeren Stadtmauer herbei, die in Richtung der westlichen Berge lagen. Seenan und ein weiterer Bannergardist rannten den Hügel zur Burg hinauf und wateten dabei durch hohe Sandwehen. Ihre Gesichter waren mit Staub überzogen. Seenan rief: »Sire – Fremde! Das sind Besucher, wie ich sie noch nie gesehen habe!«
»Der Sturm hat sie hergebracht«, sagte der zweite Gardist.
»Dann sollten wir sie begrüßen«, meinte Adan.
Nachdem sie in den Burgställen rasch ihre Pferde gesattelt hatten, ritten Adan und seine Gefährten zusammen mit Penda die sandbedeckte Straße hinunter. Xar flog über ihnen dahin, zog einen Kreis und ließ sich wieder auf Pendas Schulter nieder. Sie beugte sich zu dem Reptilienvogel vor und streichelte ihn.
Dann erreichten sie die äußere Stadtmauer. Bewaffnete Wächter schauten nervös von den Wachttürmen hoch über dem Tor herunter, das noch geschlossen und verriegelt war. Adan ritt auf es zu und gab das Zeichen zum Öffnen des Tores. »Ist das etwa unsere Art, Besucher zu begrüßen? Wenn sie durch den Sturm geritten sind, brauchen sie vermutlich Hilfe.«
»Wie Ihr befehlt, Sire«, rief einer der Turmwächter.
Neugierig zügelte Penda ihr Pferd neben Adan. Der junge Gardist Seenan wirkte besorgt, doch er hielt sein Pferd zurück und sagte nichts. Hale saß still, aber aufmerksam im Sattel.
Einige Wächter arbeiteten an den Kurbeln, die von zwei Männern gleichzeitig bedient werden mussten, und wickelten Seile um die riesigen Räder, während das Klacken von Sperrvorrichtungen ertönte. Die gewaltigen Torflügel schwangen auf, und die sandbedeckten Angeln ächzten. König Adans Pferd scheute und schnaubte.
Vor der Stadt warteten etwa hundert Gestalten, gekleidet in Schuppen und lohfarbenes Leder. Auf den ersten Blick wirkten sie wie Menschen, aber es handelte sich um andere Wesen. Sie waren groß und kantig und hatten eine dunkelbraune Haut und Topasaugen, die seitlich in langen Spitzen ausliefen. Ihre langen, wilden Haare glitzerten in einem blassen Gelb, als seien sie aus Gold und Knochen gewebt, und sie waren mit gewundenem Metall geschmückt, das im grellen Morgenlicht gleißte. Obwohl sie zusammen mit dem Sturm eingetroffen waren, wirkten sie allesamt makellos.
Die Fremden ritten auf stämmigen zweibeinigen eidechsenartigen Kreaturen mit großen Köpfen und gelben Augen. Adan erinnerte sich an seinen Geschichtsunterricht und an die Zeichnungen, die er in alten Berichten gesehen hatte, und so wusste er, dass es sich bei diesen Kreaturen, die Augas genannt wurden, um Last- und Reittiere handelte, die Wüstenreptilien nachgebildet waren. Drei dieser schuppigen Wesen stapften nun vor, während ihre Reiter Adan gebieterisch ansahen. Er konnte nicht glauben, was der Sturm zu ihnen gebracht hatte.
Ein Vorbote, hatte Penda gesagt.
Die Wreth, jene uralte Rasse, die die Menschen als ihre Sklaven erschaffen hatte, waren seit zweitausend Jahren nicht mehr gesehen worden. Jedermann hatte geglaubt, dass sie sich schon vor langer Zeit gegenseitig ausgelöscht hatten.
Doch nun war eine Hundertschaft von ihnen aus der Wüste bis hierher gekommen und wartete vor seiner Stadt. Weil sie etwas von ihm wollten.
2
Die gestreiften Segel des ischaranischen Kriegsschiffes spannten sich gegen die magisch gewirkte Brise, die es auf die Küste Osterras zutrieb, des östlichsten der drei Königreiche im Staatenbund.
Ungeduldig verkrallte Hohepriester Klovus die Hände in das vom Salz verwitterte Holz des Bugs und sah zu, wie das Schiff durch das Wasser pflügte. Er betrachtete die Eisenfaust des Rammbocks, der dem Schiff vorausstrebte und bereit war, die gottlosen Osterraner zu zerschmettern.
Der Ausguck rief vom Hauptmast herunter: »Küste voraus! Wir werden Mirrabay in etwa einer Stunde erreichen.«
»Wenn wir noch auf Kurs sind«, murmelte der Kapitän auf dem Mitteldeck, wo er hin und her lief, bereit zur Schlacht.
»Wir sind auf Kurs«, bestätigte Klovus so laut, dass die ganze Besatzung ihn hören konnte. »Der Gottling führt uns sicher zu unserem Ziel.«
Als oberster Hohepriester von Ischara oblag es ihm, die Energien der Seemänner und Soldaten zu konzentrieren. Ihr Glaube war stark, weil der Gottling tief unten im Frachtraum stark war, und wenn Klovus ihn auf das nichts ahnende Fischerdorf losließ, würden sie dessen Macht sehen. Feindesblut würde fließen, und Flammen und Rauch würden in den Himmel steigen – wie der Jubel auf einem Fest. Er verspürte Erregung und rief der erwartungsvollen Mannschaft – hundert abgehärtete Männer und Frauen, die es nach Raub und Plünderung gelüstete – zu: »Gürtet eure Schwerter um und holt euch eure Schilde. Erwartet nicht, dass der Gottling das Kämpfen für euch übernimmt!«
Die Seeleute, die leichte Hanfhosen und grob gewebte Hemden trugen, eilten zu den Rüstkammern des Schiffes. Der Erste Maat schloss die Türen auf und gab Krummschwerter, Dolche und Keulen aus Eisenholz aus. Sie waren drei Tage auf See gewesen, hatten in der Nacht heimlich die Segel im Hafen von Serepol gesetzt – in dem festen Entschluss, das Ufer des Staatenbundes zu erreichen. Klovus hatte mit ihnen allen gebetet und sie um sich versammelt. Jedes einzelne Mitglied der Mannschaft war hungrig und für den Krieg gerüstet.
Auch der Gottling war hungrig.
Der herbeigerufene Wind schob das Kriegsschiff an, und rasch kam die Küste näher. Vor ihnen lag die müde alte Welt – der Kontinent, den die Ischaraner schon vor langer Zeit nach den verheerenden Wreth-Kriegen verlassen hatten. Sein tapferes Volk hatte die neue Welt für sich beansprucht: jungfräuliches Land, das vor Magie glitzerte, so ganz anders als die ausgelaugte und verdorbene Erde des Staatenbundes.
Eifrige Matrosen liefen über das Deck, gürteten sich Schwerter um, befestigten lederne Rüstungen an ihren Oberkörpern, steckten sich Dolche in die Stiefel, probierten Helme aus und tauschten sie untereinander, bis sie einen fanden, der ihnen passte. Klovus stand in seinem dunkelblauen Kaftan da und betastete das goldene Symbol seines Rangs, das ihm um den Hals hing. Er nickte aufmunternd und war froh, den Ausdruck der Entschlossenheit in den Gesichtern der Matrosen zu sehen; im Hass auf den Feind bissen sie die Zähne zusammen.
Auch wenn die beiden Kontinente seit dem Vertrag, der vor dreißig Jahren von der Empra Iluris und Konag Cronin unterzeichnet worden war, in brüchigem Frieden miteinander lebten, war doch in die Herzen kein Frieden eingekehrt. Klovus und die anderen zwölf Bezirkspriester hatten ihren Anhängern nie erlaubt, dies zu vergessen, auch wenn ihre eigene Empra es nicht verstand. Dieser Überfall würde die Glut und den Eifer der Gläubigen wiedererwecken und ihr Blut in Wallung bringen.
Das massige Kriegsschiff näherte sich einer geschützten Bucht, in der örtliche Fischerboote ihre Netze in dem ruhigen Wasser ausgeworfen hatten. Diese Boote kämpften gegen die launischen Böen, während das ischaranische Schiff von Magie angetrieben wurde und auf pfeilgeradem Kurs mühelos dahinglitt.
Der Hohepriester drehte dem Hafendorf, das dem Untergang geweiht war, den Rücken zu und erhob seine Stimme. »Wir schlagen schnell zu! Setzt das Dorf in Brand, tötet so viele wie möglich und nehmt die Übrigen als Geiseln. Dann werden wir wieder nach Hause segeln, getragen von den Chören ihres Kummers.«
»Höre uns, rette uns«, sang die Mannschaft, aber es klang eher wie ein Jubelgeheul als wie ein Gebet.
Auch der Gottling hörte sie. Unter den Bohlen des Decks spürte Klovus die brodelnde Macht der gewaltigen, rastlosen Gottheit, die im Lastenraum verborgen war und darauf wartete, entfesselt zu werden.
Klovus zog die Schärpe um seinen starken Bauch enger und kratzte sich an der glatten Wange, wobei er das Öl auf seiner Haut spürte. Im Vorgriff auf den Sieg hatte er sich den Kopf und das runde Gesicht mit einem rasiermesserscharfen Dolch geschoren. Er wollte nicht zerzaust, sondern beeindruckend aussehen … aber er vermutete, dass sich Mirrabay an kaum etwas anderes als an den Gottling erinnern würde, sobald dieser den Ort angriff.
Das Kriegsschiff flog voran, zog weiße Gischt hinter sich her, segelte an den Fischerbooten vorbei, die sich ängstlich verzogen und den Angreifern zu entkommen versuchten. Klovus wünschte, dass diese Elenden die Zerstörung ihrer Häuser und das Abschlachten ihrer Familien zu sehen bekamen. Keiner von ihnen würde rechtzeitig das Ufer erreichen können.
Einige Dorfbewohner hatten das ischaranische Schiff mit seinen auffallenden roten und weißen Segeln und dem Rammbock am Bug bereits erblickt. Sie wussten gewiss, dass dieses Schiff nicht zur Flotte des Staatenbundes gehörte, sondern ein Erobererschiff aus der neuen Welt war.
Empra Iluris behauptete, dass keiner der Kontinente einen offenen Krieg wünschte, aber die provozierenden Überfälle wurden weitergeführt, mit oder ohne ihr Wissen. Scharmützel wie dieses hielten die Wunden offen und den Schmerz frisch. Der Gottling, den Klovus mitgebracht hatte – eine untergeordnete Wesenheit aus dem Hafentempel in Serepol – würde den drei Königreichen klarmachen, dass sie niemals auf einen Sieg hoffen durften.
Auf der Reise von Ischara bis zu diesem Ort hatten sich die Seeleute die Arme geritzt und gemeinsam immer wieder frisches Blut in eine glasierte Tonurne gespritzt. Als die Urne voll war, hatte Klovus sie mit Wachs versiegelt und eine Spur Magie bemüht, damit das Blut für das Opfer kurz vor der Schlacht frisch blieb. Nun, da sich das Schiff Mirrabay näherte, war die Zeit gekommen.
»Ich bringe die Opfergabe dar, so wie ihr eure Kriegerherzen darbringt«, rief Klovus. »Sprecht eure Gebete, dann werde ich das Blut dazugeben.«
Die bewaffneten Seeleute erhoben die Stimmen zu einem lauten Bittgesang. »Höre uns, rette uns!« Diese Worte, die so oft in den Tempeln gesprochen wurden, nutzten die Macht des Glaubens, um die Gottlinge zu stärken, die von den Gläubigen selbst geschaffen worden waren. Die Magie, die im Land steckte, ließ ihren Glauben sichtbar werden, und nun war der Hohepriester in der Lage, ihn zu beherrschen und zielgerichtet einzusetzen.
Zwei Matrosen trugen die mit Blut gefüllte Urne in die Mitte des Decks, wo Klovus neben einer kleinen geöffneten Luke im Boden wartete. Sie war mit Gold überzogen, und die Ränder der Planken waren nach unten gebogen, damit jeder verirrte Blutstropfen, der für das Opfer bestimmt war, seinen Weg in den Schiffsrumpf fand. »Unser Gottling trinkt ausgiebig und zieht Kraft aus eurem Glauben.«
»Höre uns, rette uns.«
Unter ihrem Gesang kippte Klovus die Urne und goss das gesammelte Blut durch die Öffnung in den Laderaum darunter. Der rastlose Gottling regte sich und verzehrte all die Wut und den Zorn, die von den ischaranischen Gläubigen ausgegossen worden waren. Klovus spürte, wie die Gegenwart des Wesens stärker wurde.
Der magische Wind frischte auf, und das ischaranische Kriegsschiff flog auf die Küste zu. Auf dem Land vor ihnen flackerten Signalfeuer auf, und Wächter riefen Mirrabay zu den Waffen. Laute Glocken ertönten. Die Bewohner rannten umher, einige griffen zu den Waffen, andere flohen.
Als das Kriegsschiff an den Fischerbooten und Frachtschiffen vorbeisegelte, die nahe der Küste vor Anker lagen, schossen ischaranische Bogenschützen Feuerpfeile ab, und die schutzlosen Boote verbrannten. Klovus sah voller Genuss zu, wie ihre Segel in Brand gerieten und die Besatzungen auf der Flucht vor den Flammen über Bord sprangen. Viele würden ertrinken, bevor sie das Ufer erreicht hatten.
Schon das Verursachen von Schmerzen bei den gottlosen Menschen des Staatenbundes war ein hinreichender Grund für diesen Überfall, doch der Hohepriester hatte noch anderes im Sinn. Er wollte der Empra Iluris die Macht und Wirksamkeit ihrer Gottlinge beweisen und ihr zeigen, wozu sogar dieser kleine, den sie da mit sich führten, in der Lage war. Die Frau zögerte und war stur, was Klovus zur Verzweiflung brachte, aber er würde es gewiss schaffen, sie zu überzeugen.
Nach dem Blutopfer schwollen die Planken des Schiffes an und knirschten und ächzten, während unten im Laderaum die Macht zunahm. Der Hohepriester würde den Gottling bald entfesseln müssen, damit er nicht das ganze Schiff zerstörte.
Er eilte über das Deck zur Reling und blickte am Rumpf entlang. Die hölzernen Luken waren geschlossen und versiegelten den Frachtraum, aber sie konnten rasch geöffnet werden. Er rief nach den Seeleuten. »Packt die Seile! Macht euch bereit, die Riegel wegzuziehen.«
Der ungeduldige Gottling kämpfte gegen seine Fesseln an und versuchte sich zu befreien. In einer der Planken am Rumpf zeigte sich bereits ein Riss.
»Beeilt euch! Lasst den Gottling heraus. Er soll seine Arbeit tun.«
»Höre uns, rette uns.« Die Seeleute ächzten, als sie rasch und heftig an den Seilen zogen und die Riegel lösten, sodass die Luken geöffnet werden konnten. Klovus stieß ein Keuchen aus.
In einem Schwall aus Dampf und Gischt brach der eingekerkerte Gottling hervor. Nur zum Teil bestand er aus Materie. Wie eine gallertartige, glitzernde, unaufhaltbare Macht quoll er aus den Öffnungen und schlug um sich, während er sich in eine vollständig körperliche Form zu bringen versuchte: ein beängstigendes Ungeheuer als Flüssigkeit und Glauben.
Das Kriegsschiff schwankte unter dem Aufruhr, als würde es einen Seufzer der Erleichterung ausstoßen, und der befreite Gottling wogte in den Hafen hinein und tobte wie ein brodelnder Sturm auf die wehrlosen Einwohner von Mirrabay zu.
»Geh«, flüsterte Klovus – und dies war kein Gebet, sondern die Ermunterung an einen Freund. »Geh und richte göttliche Verwüstung an.«
3
Für ihn hielt Mirrabay dunkle und quälende Erinnerungen bereit. Utho war hierhergereist, weil er sich seinen eigenen Dämonen stellen wollte, doch nun, da die abscheulichen Ischaraner eingetroffen waren, würden Blut, Tod und Schmerz von Neuem kommen. Noch immer wollte er sie für das töten, was sie vor so vielen Jahren seiner Frau und seinen Töchtern angetan hatten. Wenigstens war er nun hier und konnte Widerstand leisten.
Utho vom Riff, einer der Elite-Bravas, war groß, schlank und muskulös, und er trug sein stahlgraues Haar knapp geschoren. Als ein grimmiger und unvergleichlicher Kämpfer war er die rechte Hand von Konag Conndur. Uthos breites, glatt rasiertes Gesicht wies hohe, vorstehende Wangenknochen auf; seine Augen waren schmal und leicht mandelförmig, was auf ein Wreth-Halbblut hinwies. Als Brava trug er natürlich einen schwarzen Brustpanzer sowie eine schwarze Hose, beides aus Leder, dazu schwarze Stiefel, ein schützendes Kettenhemd und einen schwarzen Mantel, der ebenfalls mit feinen Kettengliedern eingefasst war. Seine Erscheinung vermochte zu beeindrucken.
Als er sah, wie sich das feindliche Kriegsschiff Mirrabay näherte, wurde sein Gesicht zu einer Maske der wütenden Herausforderung. Der Anblick der roten und weißen Segel trieb ihn zur Tat an. »Bleibt und kämpft!« Er lief auf den Kai hinaus, und seine Stiefel donnerten über die hölzernen Planken. »Ihr wisst, was diese Tiere tun werden!«
Das Dorf wehrte sich. Geschmeidige Jungen mit Fackeln in den Händen kletterten auf die Türme zu beiden Seiten der Bucht und entzündeten Signalfeuer. Der Wind trieb Rauchwolken in die Luft, die entlang der Küste meilenweit zu sehen waren, aber Utho wusste, dass der Feind zuschlagen, alles niederbrennen und töten und sich dann zurückziehen würde, noch bevor ein anderer Ort Verstärkungstruppen entsenden konnte.
Ständig drohten ischaranische Überfälle, aber die Küstenorte konnten niemals wirklich darauf vorbereitet sein – nicht auf so etwas. Im Herzen waren sie Fischer und Dörfler, nicht aber unbarmherzige Krieger. Sie waren keine Bravas, wie er einer war.
Utho dachte an seine Frau Mareka und ihre beiden Mädchen, die von den Ischaranern abgeschlachtet worden waren, während er im Krieg gewesen war – damals, vor dreißig Jahren. Aber heute war er hier. Er und sein Gefährte, ein junger Brava namens Onder, bedeuteten die einzige Hoffnung für diese Menschen.
Die Verteidiger des Ortes rannten in ihre Häuser und holten die Speere und Piken von den Wänden, die Bögen und Pfeile, die sie zum Jagen benutzten, und auch die Schwerter, die sich schon seit Generationen in ihren Familien befanden. Mütter küssten ihre Männer zum Abschied und flohen mit ihren Kindern in die Berge, während andere Frauen zurückblieben und um ihren Ort kämpften.
Die Ischaraner würden angreifen, sobald sie in Schussweite kamen.
Onder, der andere Brava, der als neuer Paladin an diesem Abschnitt der Küste diente, trat am Ende des Kais neben Utho. Er hatte sandblonde Haare und ein rosiges Gesicht, das wie frisch gescheuert wirkte, und auch er wies die charakteristischen Merkmale eines Wreth-Halbblutes auf. Obwohl nur wenig älter als zwanzig Jahre, war Onder doch schon ein guter Kämpfer und Vollstrecker; er war mit vielen Waffen vertraut und in einem der abgelegenen Brava-Ausbildungsdörfer aufgewachsen. Utho hatte schon einige Übungskämpfe mit ihm ausgefochten, aber er bezweifelte, dass sein Gefährte je einem leibhaftigen ischaranischen Feind gegenübergestanden hatte.
Vom Ende des Kais aus beobachtete Onder zusammen mit Utho das herannahende Schiff. Unerwartete Furcht flackerte in seinem Gesicht auf, aber er vertrieb sie sofort wieder. »Werden wir in der Lage sein, gegen sie zu kämpfen?«
Daran hegte Utho keinen Zweifel. »Wir sind Bravas. Es liegt uns im Blut, und es ist unsere Bestimmung, den Staatenbund zu verteidigen.« Die Dorfbewohner beeilten sich, behelfsmäßige Barrikaden auf den Straßen zu errichten; trotz ihres Schreckens wirkten sie bitter entschlossen. Diese Menschen erinnerten sich daran, wie Mirrabay vor Jahrzehnten niedergebrannt worden war. Einige ältere Kämpfer trugen noch ihre Narben aus dieser Niederlage, und jeder kannte die entsetzlichen Geschichten. Als er sah, wie sie sich zusammenrissen und ihren Ängsten gegenübertraten, war Utho stolz auf sie.
»Sie sind tapfer«, sagte er mit leiser Stimme zu Onder, »aber sie hassen die Ischaraner nicht annähernd so sehr wie ich.« Er reckte die Schulter. »Bist du bereit?«
Onder biss die Zähne zusammen und nickte.
Das ischaranische Schiff stürmte wie ein wilder Stier in den Hafen. Die Seitenluken waren geöffnet, und etwas Ungeheuerliches glitzerte und regte sich dahinter. Als das gierige Ding aus dem Schiffsrumpf hervordrang und in die Bucht strömte, hielt Utho den Atem an. Er keuchte, konnte es nicht glauben. »Die Bastarde haben einen Gottling mitgebracht! An unseren Strand!«
Das entfesselte Wesen schwoll an und wirbelte umher, ein Sturm aus Wasser, Schatten und leibhaftig gewordener Wut. Seine Gestalt veränderte sich, verdichtete sich zur Andeutung eines knurrenden menschlichen Gesichts mit zotteligem Bart, zerzausten Haaren und brennenden Augen – dabei saß es auf einem komplexen Körper, der nun durch das Wasser pflügte.
Die Dorfbewohner schrien entsetzt auf, und Utho hörte das Klappern weggeworfener Waffen. Obwohl sich viele Verteidiger zusammenrissen und an Ort und Stelle blieben, bezweifelte er, dass sie diesem Feind standhalten konnten. Er gab Onder ein Zeichen. »Wir werden unsere Rammer brauchen.«
Der nickte grimmig. »Das dachte ich mir schon.«
Beide Männer holten ihre goldenen Reife hervor, die an ihrem Gürtel befestigt und mit uralten Wreth-Symbolen geschmückt waren. Utho spürte in dem unnatürlich warmen Metall die Macht dieser Waffe, die nur ein Brava einsetzen konnte. Mit der linken Hand schob er sich den goldenen Reif über das rechte Handgelenk und drückte ihn zusammen, bis er ganz fest saß. Scharfe Metallzacken an den Innenrändern des Reifs bissen ihm ins Fleisch. Die Stacheln drangen tief ein, tranken gierig sein Blut und aktivierten die Macht der alten Waffe, die durch die Wreth-Magie in seinem Brava-Blut geweckt wurde. Als er die Hand hob, rann purpurrote Flüssigkeit an seinem Unterarm entlang, und dann entzündete er mit Magie eine Flammenkorona um den Rammer.
Mit einem Brüllen drückte Utho, und die Flamme wurde heller. Seine Magie nährte das Feuer und dehnte es zu einem lodernden Ball, der seine Hand umschloss. Er streckte die Finger aus, und die Flamme wurde zu einer klingenartigen Peitsche, die so lang war wie sein Arm. Er hielt das Feuer hoch, und es leuchtete dem herandrängenden Feind entgegen. Am Ende des Kais trotzte er dem Kriegsschiff und dem entfesselten Gottling.
Auch Onder legte sich den goldenen Reif um das Handgelenk, zog eigenes Blut hervor und entzündete seine Fackel damit. Beide standen mit hoch erhobenen feurigen Händen da und waren bereit, Mirrabay mit ihrer brennenden Wut zu verteidigen.
Unbeirrt wogte der Gottling auf sie zu und spuckte dabei hohe Wasserfontänen aus. Raue Wellen kippten Fischerboote um, rollten auf das Ufer zu und zerschmetterten die größeren Schiffe, die am Kai vertäut gelegen hatten. Die tobende Gottheit erhob sich aus dem Wasser und sprang auf den Kai und die beiden brennenden Rammer zu.
Utho erkannte, wie verletzbar er und Onder waren. »Wir können hier nicht kämpfen!« Er rannte mit seinem Gefährten zurück ans Ufer, als der Gottling gegen den Kai prallte und die Planken und Pfeiler in alle Richtungen schleuderte. Das bösartige Wesen floss weiter heran, versenkte dabei jedes einzelne Boot und zerstörte die Vorratsbaracken und Bootshäuser.
Als Utho festen Boden erreicht hatte, hielt er seinen entflammten Rammer hoch und stellte sich der heranbrandenden Kreatur entgegen. Er verspürte eine Zuckung atavistischer Angst, trieb sie aber zurück. Onder neben ihm wirkte entsetzt. Die Hand des jungen Mannes loderte hell, und die Flammenzungen hatten sich zu einer brennenden Peitsche verdreht.
Diese Kreatur erschien unnatürlich. Der Gottling war ein Wesen, das sie nicht verstanden; eine Macht, die nicht blutete. Utho wusste nicht einmal, ob sie sterblich war. Aber er war ein Brava, und er bemühte seine Magie und verstärkte seine Feuerpeitsche. Er rief Onder etwas zu und rannte unmittelbar auf die halb körperliche Wesenheit zu, die gerade dabei war, die Räucherkammern und Hafenbaracken zu zerstören und dabei die Holzsplitter hoch in die Luft warf. Und schließlich setzte sie das Dorf in Brand.
Draußen auf dem Wasser war das ischaranische Kriegsschiff so nahe herangekommen, dass die feindlichen Soldaten damit begannen, in die Ladeboote zu steigen und ans Ufer zu rudern. Sie erhoben ihre Krummschwerter und schrien Beleidigungen und Drohungen, während sie das Hafendorf angriffen. Aber der ungeheuerliche Gottling erledigte den größten Teil der Arbeit für sie.
Die Kreatur wand sich und nährte sich von den wilden Gefühlen, während sie gemeinsam mit den heulenden Winden durch die Luft fuhr. Ein Ruderboot wurde hochgeschleudert und ging dort nieder, wo Utho stand. Es gelang ihm gerade noch, aus dem Weg zu springen. Dem Feind stellte er sich breitbeinig entgegen und schlug mit seinem Rammer aus. »Halt!«
Mit einem Knall schleuderte er magisches Feuer der brodelnden Wesenheit entgegen. Sie streckte Arme und Tentakel aus flüssigem Dampf aus, aber der lodernde Rammer durchschnitt sie mit zischenden Geräuschen. Der Gottling zuckte. Utho schrie: »Ich glaube nicht an dich, du Scheusal!«
In ihrer neuen Welt besaßen die Ischaraner eine gewisse verdorbene Macht – es war die Möglichkeit, eigene Gottlinge als Gebilde blinden Glaubens zu erschaffen, die ihre Vorstellungskraft für sie zur Wirklichkeit werden ließ. Aber doch nicht hier im Staatenbund, nicht hier in Mirrabay – so etwas gehörte nicht an diese Ufer.
Utho kämpfte gegen den Gottling und schlug mit seinem brennenden Rammer aus. Die Feuerpeitsche schoss aus seiner Hand und verwandelte die einzelnen Elemente der Gottheit in Dampf und Gischt. Aber der Gottling setzte sich neu zusammen und drängte weiter auf ihn zu.
»Onder!«, rief er. »Hilf mir!«
Der andere Brava stand wie eine Statue da, hatte die Hand gehoben, und sein Rammer flackerte, während er das Geschöpf gebannt anstarrte.
Der Gottling prallte mit seinem halbstofflichen Körper gegen Utho und stieß ihn beiseite, als wäre er nur Spreu im Wind. Er schlug mit seiner Feuerhand zu, aber die lodernde Peitsche verursachte bei dem Wesen keinen bleibenden Schaden. Voller Wildheit raste es wieder auf ihn zu und warf ihn kopfüber in die Luft.
Uthos schwerer Mantel und sein Kettenhemd boten ihm kaum Schutz, als er auf die Holzschindeln eines Hausdaches prallte. Für einen Augenblick verlor er das Bewusstsein, dann glitt er langsam von dem Dach herunter, während er sich darum bemühte, die Kontrolle über seinen Körper wiederzuerlangen. Er spürte den Schmerz zahlloser Verletzungen, während er rutschte und kullerte. Und als er über den Rand kippte, gelang es ihm gerade noch, sich an einer Regenrinne festzuhalten und seinen Sturz zu verhindern.
Als er sich festhielt und versuchte, wieder ganz zu Sinnen zu kommen, sah er Onder auf der Straße unter sich, nicht weit von der tobenden halbkörperlichen Kreatur entfernt. Der jüngere Brava drehte sich um und rannte davon; er floh von den Dorfbewohnern fort, die sich nun zusammenrotteten.
Utho verstand zunächst nicht, was er sah, und konnte es nicht glauben, dann aber spürte er, wie sich sein Herz in schwarzer Enttäuschung zusammenschnürte.
Der Gottling brandete wie ein Hurrikan gegen ein weiteres Lagerhaus, stieß die Mauern um, warf lange Planken in die Luft, riss Stützbalken entzwei. Fischernetze, die zum Ausbessern aufgehängt worden waren, flatterten wie gewaltige Spinnennetze umher und landeten schließlich in einem Haufen übereinander. Unter einem Ausbruch von Energie drang das Wesen tiefer in das Dorf ein und setzte Hausdächer in Brand. Das Feuer sprang von Gebäude zu Gebäude, während sich die Wesenheit weiter austobte.
Utho war von seinem feigen Gefährten angewidert. Er selbst wollte nicht aufgeben. Also ließ er die Regenrinne los, sprang schwer auf die Straße und hielt die Knie gebeugt, während sich sein gepanzerter Mantel um ihn ausbreitete. Schmerz, der von gebrochenen Rippen und einer Wunde am Kopf herrührte, flackerte auf, aber Utho schob ihn beiseite und kümmerte sich nicht um seine eigene Sicherheit. Noch war der Kampf nicht vorbei. Der Rammer schmiegte sich weiterhin um sein Handgelenk, auch wenn die magische Flamme erloschen war, als er kurz das Bewusstsein verloren hatte. Das Blut tropfte noch immer von den goldenen Stacheln, und er ergriff das Metallband und rief das Feuer seines Wreth-Erbes zu sich. Die Hand brach in reinigendes Feuer aus.
Auf den Straßen kämpfte das Volk von Mirrabay gegen Formationen von ischaranischen Soldaten, die aus ihren Landungsbooten geklettert waren und hinter dem rasenden Gottling an Land liefen. Mit ihren Fackeln rannten die Angreifer von Haus zu Haus und setzten weitere Gebäude in Flammen. Sie stießen mit Fischern, Schiffszimmerern und Ladenbesitzern zusammen, töteten viele, schlugen andere mit Keulen bewusstlos, steckten sie in Netze und schleiften sie zurück zu den Landungsbooten. Bei dem Gedanken an das, was sie mit den Gefangenen anstellen würden, wurde Utho übel.
Als er an seine Frau dachte, die in einer ähnlichen Lage gesteckt hatte, legte sich ein roter Nebel vor sein Blickfeld. Er wusste, dass Mareka sich gewehrt und in dem Versuch, ihre Töchter zu beschützen, viele Angreifer getötet hatte. Wenigstens waren sie gestorben, statt weggeschleppt und vergewaltigt, versklavt oder – schlimmer noch – dem Gottling geopfert zu werden.
Es gab einen guten Grund, warum die Bravas den Ischaranern schon vor Jahrhunderten den Rachekrieg erklärt hatten …
Die rasende Gottheit fuhr mit ihren Wütereien fort, stieß den Glockenturm um, und der laut hallende Ruf zu den Waffen ging im Brüllen und Klirren unter. Dann fegte die Gottheit durch die Straßen und riss Mirrabays Erinnerungsschrein ein, in dem die Namen all derer verzeichnet gewesen waren, die je in diesem Ort gelebt hatten – einschließlich der Namen von Mareka und den Mädchen.
Nun, da ihn sein feiger Gefährte im Stich gelassen hatte, musste Utho allein kämpfen. Er rannte hinter dem Gottling her und fachte seinen Rammer zu einem grellen Lodern an. Die Angreifer hatten sich in den Straßen zerstreut und waren mit ihren eigenen Kämpfen beschäftigt. Ischaranische Soldaten lagen leblos in den Gassen, zusammen mit vielen toten Einwohnern. Ein einsamer Brava konnte zwar Dutzende Feinde gleichzeitig besiegen, aber Utho wusste, dass der Gottling die weitaus größere Bedrohung darstellte.
Er forderte das Wesen abermals heraus und sandte sein Rammer-Feuer durch den Körper, der kaum noch Widerstand bot. Der zügellose Zorn des Gottlings hatte diesen schon ein wenig erschöpft und geschwächt, und Uthos aufgefrischte Wut fügte ihm weiteren Schaden zu. Die Ungeheuerlichkeit wurde kleiner, war weniger fest und dicht. Sobald ein Gottling die Ufer seines eigenen Kontinents verlassen hatte, stand ihm seine angestammte Magie, aus der er Kraft ziehen konnte, nicht mehr zur Verfügung. Utho wusste, dass die Ischaraner die Macht des Wesens nicht mehr mit weiteren Gebeten und Opfern stärken konnten.
Das tobende Wesen schien mit der Schneise der Zerstörung, die es durch den Hafenort gelegt hatte, zufrieden zu sein, und so zog es in einem Kreis zurück zum Ufer. Bald würde es in die Sicherheit des ischaranischen Kriegsschiffs zurückkehren müssen. Die Monstrosität streckte sich aus, brachte einen der Wachttürme zum Einsturz, und das Leuchtfeuer fiel in die Bucht. Nun verblasste das Wesen allmählich, als wüsste es, dass es nicht in dieses Land gehörte.
Der Gottling zog sich zurück und entschlüpfte Utho, aber der Brava wollte Blut sehen – er wollte seinen eigenen Rachekrieg führen. Also richtete er seine Wut auf die verbliebenen feindlichen Soldaten. Aus den zahlreichen Waffen an seinem Gürtel wählte er ein Kampfmesser aus und stärkte gleichzeitig die Feuerpeitsche seines Rammers. Während Mirrabay um ihn herum brannte, stürzte er sich in das Getümmel eines konventionellen Kampfes und beachtete dabei die Schmerzen seiner Verletzungen nicht. Er fällte fünf ischaranische Soldaten, aber sein Triumph verursachte ihm keine Freude.
Utho bahnte sich einen Weg zu den rauchenden, zersplitterten Kaianlagen, bei denen die Überreste zerstörter Boote im Wasser um das feindliche Schiff herum trieben. Nun, da der magische Wind abgeflaut war, hingen die rot gestreiften Segel schlaff herunter. Im Bug des Kriegsschiffes stand ein untersetzter, kahlköpfiger Hohepriester in einem mitternachtsblauen Kaftan und beobachtete den Aufruhr aus sicherer Entfernung.
Der Hohepriester schlug einen Gong und rief damit die Ischaraner zurück an Bord. Der helle metallische Klang übertönte sogar die Schreie der Verwundeten und das Aufeinanderprallen der Schwerter. Bald sprangen auch noch die letzten Angreifer in das Landungsboot und ruderten auf das Kriegsschiff zu. Mindestens zehn Gefangene aus Mirrabay waren schon an Bord gebracht worden.
Der Gottling reagierte wie ein Haustier, das zum Essen gerufen wurde. Er sprang ins Wasser und wogte auf das ischaranische Kriegsschiff zu. Auch wenn das Wesen noch immer beängstigend wirkte, war es doch eindeutig wesentlich kleiner geworden. Es floss durch die offenen Seitenluken in den Laderaum und hinterließ trübe, aufgewühlte Trümmer.
Wie sehr sich die Dorfbewohner auch kämpferisch für die Verteidigung ihrer Häuser einsetzten und wie viele Feinde sie auch töteten, es reichte nie aus. Utho vom Riff löschte sein Feuer und betrachtete die Verwüstungen um sich herum. Die Hälfte des Ortes war zerstört worden und brannte nun, zahllose Leichen lagen auf den Straßen, und die Verwundeten starben in den Pfützen ihres eigenen Blutes.
Er unterdrückte ein Schluchzen. So musste dieser Ort vor einigen Jahrzehnten schon einmal ausgesehen haben … als Utho nicht da gewesen war, um seine Familie zu schützen.
Tiere!
4
Als sich Elliel dem Bergarbeiterort namens Scharrdorf in den Drachengrat-Bergen näherte, blieb sie kurz stehen und überdachte ihre Möglichkeiten. Für sie– als eine in Ungnade gefallene Brava– stellte sich stets die Frage, ob sie den Menschen aus dem Weg gehen oder ihre Gesellschaft suchen sollte. Würde man sie willkommen heißen oder verfluchen? Auch wenn sie nicht mehr die auffällige schwarze Uniform trug, stand ihr das Wreth-Erbe doch deutlich erkennbar ins Gesicht geschrieben: die mandelförmigen grünen Augen. Würden die Leute in diesem Dorf wissen, wer sie war, und würde es ihnen gleichgültig sein oder nicht? Nicht einmal sie selbst wusste wirklich, wer sie war.
Wenn sie in den Spiegel schaute, erkannte Elliel, dass sie eine schöne Frau war, auch wenn ihr eigenes Gesicht sie immer wieder erstaunte. Da sie ihre Erinnerungen verloren hatte, ahnte sie niemals, was sie von ihrem Spiegelbild zu erwarten hatte. Sie hatte doch gewiss schon immer so ausgesehen? Sie war groß, hatte feste Brüste, eine schmale Taille und geschwungene Hüften, die die Aufmerksamkeit der Männer auf sich zogen – genau wie die wohlgeformten Muskeln und die Kampfreflexe, mit denen sie jede ungewollte Aufmerksamkeit abwehrte. Sie trug ihr Haar, das die Farbe von verbranntem Zimt hatte – viel länger, als es einer typischen Brava zukam. Aber schließlich war sie auch keine typische Brava.
Zum Glück verstanden die meisten Menschen die Tätowierung auf ihrem Gesicht nicht.
Seit Elliel ihre Vergangenheit verloren hatte, machte sie keine Pläne mehr. Scharrdorf schien so gut wie jeder andere Ort zu sein. Sie reckte die Schultern und schritt über die Schotterstraße auf die Häuser zu.
Die zerklüfteten Gipfel um sie herum waren selbst nach dem langen Sommer noch mit altem Schnee bedeckt. Die Bergkette trug einen passenden Namen, denn sie zog sich wie ein Rückgrat durch das Gebiet des Staatenbundes, und die schroffen Kämme erinnerten an den gewaltigen Drachen Ossus, der angeblich in den Tiefen der Welt begraben lag. Der kegelförmige Vada ragte hoch über Scharrdorf auf und stieß gelegentlich eine weiße Rauchwolke aus – der Legende zufolge handelte es sich dabei um das Schnauben des rastlosen Drachen im Innern der Erde. Der Ort war für seine reichen Minen bekannt, in denen Gold, Silber und Kupfer sowie Drachenblut-Rubine und jene Diamanten abgebaut wurden, die man Muttertränen nannte.
Elliel nahm an, dass in den Minen Bergarbeiter gebraucht wurden. Sie wollte nach Arbeit fragen, im Austausch gegen Essen und Unterkunft. Wie lange sie hierbleiben würde, wusste sie nicht. Jeder Tag war wie eine neue Frage für sie.
Ein glucksender Bach ergoss sich über die bewaldeten Bergflanken und trieb das Rad einer Mühle am Rande des Ortes an. Süßer blauer Holzrauch stieg von den Hütten entlang der Hauptstraße und in der Nähe der Minen auf, die sich in den Vada bohrten.
Als sie Scharrdorf betrat, bemerkte sie einen Versammlungsplatz mit leeren Buden, die auf einen Wochenmarkt für Kunsthandwerk und landwirtschaftliche Erzeugnisse hindeuteten. Sie sah ein gut gepflegtes Holzgebäude mit geschnitzten Türbalken, dessen Türen offen standen und das leer war – der Erinnerungsschrein des Ortes. Ein anderes, größeres Gebäude schien eine Herberge zu sein.
Sie hatte zahllose Nächte auf der Straße verbracht oder im Wald gezeltet. Das Alleinsein war ihr lieber als die unsichere Gesellschaft von Fremden. Ihre graue, staubige Kleidung war die eines gewöhnlichen Reisenden: Leinenhose, feste Lederstiefel, ein ungefärbtes Flachshemd und ein grober Wollmantel, der auch als Decke diente, wenn sie eine brauchte.
Der Rammer an ihrer Seite – den sie sich um das Handgelenk gelegt hätte, wenn sie noch Reste von Magie besessen hätte – lenkte jedoch oft die Aufmerksamkeit anderer auf sich. Der goldene Reif war eher eine Erinnerung für sie selbst als eine Bedrohung für jemand anderen, da sie ihn nicht mehr benutzen konnte. Die Narben an ihrem Handgelenk zeugten von vergeblichen Versuchen.
Hier an der Westgrenze von Osterra, vier Tagesreisen von der Hauptstadt Convera entfernt, kannten und respektierten die Menschen noch die Bravas, auch wenn sie nur selten in Erscheinung traten. Viele Bravas waren unabhängige Paladine und boten ihre Dienste Orten oder ganzen Bezirken an, während sich andere mit einzelnen Lords verbanden.
Elliel hob die Hand und betastete ihre Wange. Sie wusste, dass das Zeichen noch da war: die Rune des Vergessens. Auch wenn der stechende Schmerz von Uthos Tätowierungsnadeln schon lange vergangen sein mochte, bedrückte sie doch noch immer das Wissen um ihr Verbrechen. Sie konnte sich nicht an die Einzelheiten erinnern, aber sie wusste, was sie getan hatte. Es stand in dem zerfransten und oft gelesenen Brief, der in ihrem Hemd steckte. Sie schaffte es nicht, die verhasste Botschaft wegzuwerfen …
Elliel erregte einige Aufmerksamkeit, als sie die Straße entlangschlenderte, teils weil sie eine Frau war, die allein unterwegs war, teils auch wegen ihrer Haltung, die große Stärke andeutete. Obwohl die Bewohner nicht ausgesprochen unfreundlich wirkten, war sie die Erste, die ein Lächeln schenkte. »Könntest du mir sagen, wo ich den Vorsteher der Mine finde? Ich möchte hier arbeiten.«
Eine Mutter saß vor einer der Hütten und flickte einen alten Rock, während ihre Kinder umherliefen und Hühner jagten. Sie machte eine Bewegung mit ihrem Kinn. »Hallis ist in dem Haus da hinten, neben dem mittleren Minenschacht.« Elliel erkannte einige dunkle Öffnungen, die in den Berghang am Ende des Dorfes gebohrt worden waren, und ein Haus aus Holz und Stein unmittelbar neben dem größten Tunnel.
Hallis, der Vorsteher der Mine, war ein gedrungener, harter Mann mit starken Muskeln an Armen und Hals. Er saß in dem kleinen Gebäude und schrieb gerade mit einem Bleistift Zahlen in ein Rechnungsbuch. An der hölzernen Wand hingen Karten der Tunnels mit Hinweisen auf die einzelnen Metalle und Edelsteine, die in jedem von ihnen gefunden worden waren.
Als Elliel eintrat, legte Hallis die Ellbogen auf die Tischplatte und sah sie abschätzend an. Ohne sich vorzustellen, erklärte sie: »Ich möchte in den Minen arbeiten.«
Interessiert und überrascht zugleich sah er sie an. »Stark genug wirkst du ja. Aber warum sollte ich dich einstellen?«
»Weil ich eine gute Arbeiterin bin«, sagte Elliel.