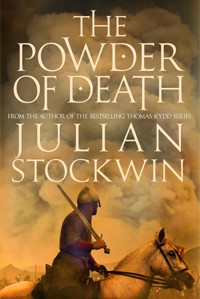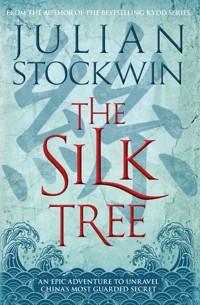5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Thomas-Kydd-Roman
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Wird eine Meuterei ihn das Leben kosten? Der abenteuerliche Seefahrerroman »Auf Erfolgskurs« von Julian Stockwin jetzt als eBook bei dotbooks. Gibraltar, 1797. Thomas Kydd kehrt als stahlharter Unteroffizier der »Achilles« aus der Karibik zurück: Das 64-Kanonen-Linienschiff wurde ins Mittelmeer kommandiert, um die französische Flotte in Schach zu halten. Doch schon bald erreichen Kydd Nachrichten von Meutereien in der Royal Navy. Angesteckt vom Geist der französischen Revolution begehren die Seemänner gegen schlechte Arbeitsbedingungen und grausame Strafen auf – etwas, dass auch Kydd schon lange ein Dorn im Auge ist … Er schließt sich der Meuterei von Spithead an und riskiert damit nicht nur seine Karriere in der Marine, sondern auch die Freundschaft zu seinem langjährigen Kameraden Renzi. Als der Aufstand jedoch zu scheitern droht, ist dessen scharfer Verstand das einzige, das Kydd vor der Hinrichtung retten kann … Ein Highlight der nautischen Romane: »Stockwin wurde zum Bestsellerautor, weil er seine Leser mitten zwischen die Männer stellt, die vor dem Mast fuhren.« Daily Express Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der marinehistorische Roman »Auf Erfolgskurs« von Julian Stockwin – Band 4 der Erfolgsreihe um Thomas Kydd und seinen Aufstieg vom einfachen Matrosen zum Helden der See. Ein Lesevergnügen für alle Fans von Patrick O’Brian und C. S. Forester. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Ähnliche
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Lesetipps
Über dieses Buch:
Gibraltar, 1797. Thomas Kydd kehrt als stahlharter Unteroffizier der »Achilles« aus der Karibik zurück: Das 64-Kanonen-Linienschiff wurde ins Mittelmeer kommandiert, um die französische Flotte in Schach zu halten. Doch schon bald erreichen Kydd Nachrichten von Meutereien in der Royal Navy. Angesteckt vom Geist der französischen Revolution begehren die Seemänner gegen schlechte Arbeitsbedingungen und grausame Strafen auf – etwas, dass auch Kydd schon lange ein Dorn im Auge ist … Er schließt sich der Meuterei von Spithead an und riskiert damit nicht nur seine Karriere in der Marine, sondern auch die Freundschaft zu seinem langjährigen Kameraden Renzi. Als der Aufstand jedoch zu scheitern droht, ist dessen scharfer Verstand das einzige, das Kydd vor der Hinrichtung retten kann …
Ein Highlight der nautischen Romane: »Stockwin wurde zum Bestsellerautor, weil er seine Leser mitten zwischen die Männer stellt, die vor dem Mast fuhren.« Daily Express
Über den Autor:
Julian Stockwin wurde 1944 in England geboren und trat bereits mit 15 Jahren der Royal Navy bei. Nach achtjähriger Dienstzeit verließ er die Marine und machte einen Abschluss in Psychologie und Fernöstliche Studien. Anschließend lebte er in Hong Kong, wo er als Offizier in die Reserve der Royal Navy eintrat. Für seine Verdienste wurde ihm der Orden des MBE (Member of the Order of the British Empire) verliehen, bevor er im Rang eines Kapitänleutnants aus dem Dienst ausschied. Heute lebt er als Autor in Devon und arbeitet an den Fortsetzungen der erfolgreichen Thomas-Kydd-Reihe.
Julian Stockwin im Internet: https://julianstockwin.com/
Bei dotbooks erscheint in der Thomas-Kydd-Reihe von Julian Stockwin außerdem:
»Zur Flotte gepresst«
»Bewährungsprobe auf der Artemis«
»Verfolgung auf See«
»Offizier des Königs«
»Im Kielwasser Nelsons«
»Stürmisches Gefecht«
»Im Pulverdampf«
***
eBook-Neuausgabe Juni 2019
Copyright © der englischen Originalausgabe 2003 Julian Stockwin
Die englische Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Mutiny« bei Hodder & Stoughton, London.
Copyright © der deutschen Ausgabe 2004 by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/solar lady, Abstractor, Robert B. Miller und eines Gemäldes von William John
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (as)
ISBN 978-396148-846-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Auf Erfolgskurs« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Julian Stockwin
Auf Erfolgskurs
Ein Thomas-Kydd-Roman
Aus dem Englischen von Eckhard Kiehl
dotbooks.
Prolog
»Verdammt, das sind ja sechs – und es sind Großkampfschiffe, Sir Edward!«
Das massige Teleskop, das der Erste Offizier der HMS Indefatigable mit den Händen umklammerte, schwankte im Sturm leicht hin und her, aber in der grauen Fläche der winterlichen See waren die blassen, weißen Segel der Linienschiffe selbst auf diese Entfernung gut auszumachen.
Kapitän Pellew quittierte die Meldung mit einem Brummen. Wenn die Franzosen jetzt endlich aus Brest ausliefen, war das wirklich der allerungünstigste Zeitpunkt. Der Großteil der britischen Kriegsflotte hatte sich in das Winterquartier in Portsmouth zurückgezogen, und es stand, abgesehen von den beiden anderen Fregatten seines Küstengeschwaders, nur eine kleine Streitmacht unter Vizeadmiral Colpoys vor Ushant im Atlantik, welche die französischen Häfen, so gut es ging, bewachten. Und diese könnte ein derartig starker Feind leicht aus dem Wege räumen. Der Himmel mochte wissen, wann die nur widerwillig zugesagten Verstärkungen aus der Karibik eintreffen würden!
»Sir ...« Aber Worte waren nicht mehr nötig: Immer mehr Segel drängten jetzt in die Bucht hinaus. Schweigend beobachteten die Offiziere das Spektakel, während ihnen der ungewöhnliche Ostwind kalt und feindlich ins Gesicht wehte. Die Seen, vom Wind getrieben, wanderten als Brecher heran, donnerten gegen den Bug und schickten eisige Gischtwolken bis über das Achterdeck.
Das Licht nahm zusehends ab; der französische Admiral hatte seinen Ausbruch so geplant, daß seine Flotte in der Dunkelheit einer stürmischen Nacht verschwinden konnte, sobald sie erst einmal die hohe See erreicht hatte.
»Mindestens ein gutes Dutzend Schiffe. Wir können getrost sagen, daß die französische Flotte ausgelaufen ist«, sagte Pellew trocken.
Der Erste Offizier beobachtete den Feind gespannt, denn nach all diesen Monaten zeigte er sich zum ersten Mal, doch Pellew teilte die Freude nicht. Die geheimen Meldungen, die er bekommen hatte, waren äußerst beunruhigend: Wochenlang hatte sich diese Flotte vorbereitet, war ausgerüstet und verproviantiert worden – mit Feldgeschützen, Pferden und Futter und, sofern man den Meldungen trauen konnte, mit Truppen in einer Stärke von 18 000 Mann. Wenn jetzt die gesamte Flotte in See ging, konnte das nur einen Zweck haben ...
»Die Phoebe soll Admiral Colpoys finden und ihn informieren«, befahl er dem Signaloffizier.
Die Chance, daß Colpoys zu den Franzosen aufschließen konnte, bevor sie die offene See erreichten, war jedoch sehr gering. In dem schnell abnehmenden Tageslicht hinterließ die steigende Zahl der Kriegsschiffe einen schrecklichen Eindruck.
»Sir! Ich zähle jetzt sechzehn – nein siebzehn Linienschiffe!«
Ein hartes Rollen des Schiffes ließ alle stolpern. Als sie wieder festen Fuß gefaßt hatten, schien es, als fülle sich die Bucht mit Schiffen. Mindestens die gleiche Zahl Fregatten war jetzt zu sehen, und zusammen mit Transportschiffen und anderen strebten jetzt mindestens vierzig Schiffe auf den Atlantik hinaus.
»Die Amazon soll alle Segel setzen und Kurs auf Portsmouth nehmen«, befahl Pellew.
Das würde sein Geschwader auf einen beklagenswerten Rest reduzieren, aber es war lebensnotwendig, England zu warnen, solange es noch ging. Doch die auf sie zukommende feindliche Flotte war nicht in Gefechtslinie übergegangen, sie segelten in einem ungeordneten Durcheinander. Einige segelten sogar nach Süden, als wollten sie sich vor der einzigen Fregatte retten, die auf ihrem Kurs lag. Auf einem der größten der französischen Linienschiffe wurde ein Flaggensignal geheißt, begleitet von dem dumpfen Laut eines Kanonenschusses. Das Zwielicht ging jetzt schnell in Dunkelheit über, und das Signal war undeutlich. Eine rote Rakete stieg plötzlich in die Höhe, und das geisterhafte blaue Leuchten einer Fackel zeigte sich auf ihrer Back, als sie zu Nachtsignalen überging.
»Sie wollen also Beleuchtung haben. Die sollen sie bekommen!« sagte Pellew grimmig.
Die Indefatigable schob sich in die weit auseinandergezogene Flotte. Von ihrem Deck zischten farbige Raketen und zogen ihre Bahn über den stürmischen Nachthimmel, während lebhaftes Mündungsfeuer ihrer Geschütze die Verwirrung verstärkte. Ein großer Zweidecker, der versuchte über Stag zu gehen, lief dabei auf einen Felsen; sie drehte in den Wind und wurde hart gegen den Fels zurückgetrieben. Notraketen stiegen von dem verlorenen Schiff in die Höhe.
»So geht es nicht weiter«, murmelte Pellew angesichts der allgemeinen Verwirrung.
Der starke Ostwind würde eine Rückkehr in den Hafen verhindern, und der Feind brauchte nur die hohe See zu erreichen, wo er genug Platz finden würde, um sich zu sammeln.
Die Masse der feindlichen Schiffe passierte Indefatigable schnell, denn sie wollten sich nicht auf einen Kampf einlassen, und sie waren nur allzu schnell in der wilden Nacht verschwunden. Aber nicht bevor es klar wurde, daß sie einen Kurs nach Norden einschlugen: nach England.
Kapitel 1
»Packt mit an, ihr verdammten Faulenzer!«
Der laute Ruf schreckte die Gruppe an den Betings auf, die gelassen die Leute an der Nagelbank beobachteten, welche in die Marstoppnant einfielen. Die Männer gehorchten umgehend, es war schließlich Thomas Kydd, der Steuermann, ein zäher Hund, über dessen höllische Fahrt in einem offenen Boot in der Karibik vor achtzehn Monaten noch in der ganzen Marine geredet wurde.
Kydds Augen musterten das Deck. Es war seine Gewohnheit, niemals am Ende der Wache unter Deck zu gehen, bevor alles für die nächste Wache aufgeklart war. Aber in diesen lauen Winden auf der Back des 64-Kanonen-Linienschiffes Achilles gab es kaum etwas zu beanstanden, während sie den Atlantik auf dem Wege nach Gibraltar überquerten.
Kydd war zufrieden. Nach gerade vier Jahren vor dem Mast zum Steuermann befördert worden zu sein, war eine Seltenheit. Es berechtigte ihn, zusammen mit den Offizieren auf dem Achterdeck umherzugehen, in der Kadettenmesse zu speisen und eine richtige Uniform mit langem Rock und Kniebundhosen zu tragen. Niemand würde ihn jetzt für einen einfachen Seemann halten können! Königlich blaue Seen mit einer gelegentlichen weißen Brecherlinie, hochstehende, flockige Wolken im südlichen Sonnenschein. Sie waren auf dem Wege ins Mittelmeer, um sich der Flotte von Admiral Jervis anzuschließen. Für Kydd war es das erste Mal, daß er diese sagenumwobene See zu sehen bekäme, und er freute sich schon darauf, mit seinem Freund Nicholas Renzi, der jetzt Steuermann auf der Glorious war, interessante Zeiten an den Küsten zu erleben.
Sein Blick fiel jetzt auf ein mächtiges 74-Kanonen-Linienschiff an Lee. Sie barg ihre drei Toppsegel gleichzeitig; wahrscheinlich eine Übung des Wachoffiziers, der die Fähigkeiten und Einsatzfreude ihrer Mastgasten vergleichen wollte.
Gestern waren sie den sechsunddreißigsten Breitengrad entlang gelaufen, und Kydd wußte, daß sie an diesem Morgen Gibraltar in Sicht bekommen würden. Er blickte erwartungsvoll voraus. Im Osten war der Horizont von einem graubraunen Dunstschleier verdeckt.
Das kleine Geschwader begann in eine Linienformation überzugehen. Kydd nahm seinen Platz auf dem Achterdeck ein, entschlossen, das Insichtkommen einer derartig geschichtsträchtigen Landspitze nicht zu versäumen. Er sah wieder zu dem Ausguck im Fockmast hinauf, der in diesem Moment erstarrte, seine Augen beschattete und intensiv nach vorne sah.
Einen Augenblick später beugte er sich zum Deck hinunter und brüllte: »Laaand in Sicht!«
Der Segelmeister blies vor Freude die Backen auf. Kydd wußte, daß es sich nicht um eine schwierige Ansteuerung handelte, aber die Tatsache, daß Land in Sicht kam, war für eine Besatzung, die schon viele Wochen auf See verbracht hatte, immer von großem Interesse, und auf den Decks wurde geraunt und getuschelt.
Kydd wartete ungeduldig, aber schnell wurde das Land auch von Deck aus sichtbar, eine feingezeichnete, helle, blaugraue Felsspitze, die sich über dem Dunstschleier erhob. Sie wandelte sich schnell zu einem harten Blau und gewann zusehends an Masse. Die Schiffe segelten in dem unsteten Südostwind weiter, und als sie näherkamen, änderte sich der Anblick des Landes nahezu unmerklich, seine Länge begann sich zu verkürzen. Der Dunst löste sich auf, und das Land fing an, Individualität zu gewinnen.
»Gibraltar!« flüsterte Kydd.
Als sie näher herankamen, verfestigte sich der massige Fels, wuchs empor und reckte sich mühelos über ihre Mastspitzen. Wie ein sprungbereiter Löwe herrschte er einfach nur durch sein Dasein, ein majestätisches, unvergeßliches Symbol: das äußerste Ende Europas, der Abschluß oder der Beginn eines Kontinents.
Kydd sah sich um; in unregelmäßiger, blaugrauer Unschuld lag Afrika im Süden; dort, so nahe, befanden sich endlose Wüsten und die Piraten der Barbaresken-Küste; noch weiter im Süden gab es Dschungel, Elefanten und Pygmäen.
Nur zwei Schiffe! Ihre Augen gegen das grelle Leuchten der See abschirmend, suchte Emily den Horizont ab, konnte jedoch keine weiteren entdecken. Admiral Jervis war mit seiner Flotte in Lissabon, um die Portugiesen zu ermutigen, und in Gibraltar standen zur Zeit keine Kriegsschiffe von Bedeutung. Alle hofften in diesen schrecklichen Zeiten auf eine starke Flottenpräsenz, aber Emily war eine Tochter der Armee und verstand nichts von Marinestrategie. Trotz allem sahen die Schiffe herrlich aus; ihre Segel wirkten wie die Flügel eines Schwans, der lange Wimpel im Masttopp schlug behäbig im Wind, und sie boten ein Bild von Anmut und Schönheit.
Am Signalfall der Glorious stiegen Flaggen empor. Beide Schiffe änderten den Kurs in einem großen Bogen in Richtung auf die weit entfernte, anonyme Ansammlung von Gebäuden, die auf halbem Wege entlang der Uferlinie zu erkennen war. Noch während der Wendung nahm die schwache Brise ab, wurde wieder stärker und erstarb. Frustriert erkannte Kydd auch warum – selbst hier draußen lagen sie im Leeschatten des riesigen Felsens; hoch auf seinem Gipfel breitete sich eine Wolke aus, welche die Bucht darunter auf gut eine Meile verdunkelte. Er warf einen Blick zum Segelmeister hinüber, der jedoch nicht übermäßig beunruhigt schien und seine Arme in geduldiger Pose über der Brust verschränkt hatte. Der Kapitän verschwand in seiner Kajüte und überließ das Deck der Wache. Segel schlugen und raschelten, Spieren klapperten und knarrten, und das Schiff schlich sich wie ein Geist in die Bucht hinein, mit der Geschwindigkeit eines krabbelnden Kindes.
Kydd versuchte, die Größe des gigantischen Felsens abzuschätzen. Er erstreckte sich fast genau von Nord nach Süd und war zwei oder drei nautische Meilen lang, war aber, wie man sehen konnte, viel schmaler. An der seeseitigen Flanke lag der Hauptteil der Stadt, aber einige wenige Gebäude fanden sich auch an den Steilhängen. Landeinwärts endete der Fels abrupt, und Kydd sah eine lange, flache Ebene, die den Felsen von Gibraltar mit dem nichtssagenden Festland verband.
Erst am Abend starb der frustrierende Ostwind, und ein lokaler Südwind ermöglichte es den beiden Schiffen unter Land zu kommen. Aus den Seekarten wußte Kydd, daß es sich hier um die Rosia-Bucht handelte, das »Heim« der Marine in Gibraltar. Es war eine hübsche kleine Bucht, die ein gutes Stück von der Hauptansammlung von Gebäuden entfernt war. Es gab hier die übliche Werft und darüber ein imposantes, zweistöckiges Gebäude, das seiner Lage nach nur das Marinehospital sein konnte. Die Rosia-Bucht öffnete sich, eine kleine Mole im Süden, die Schutzwälle einer alten Festung im Norden. Dort gingen die beiden Schiffe vor Anker.
»Siehst du ...«
Kydd hatte nicht bemerkt, daß Cockburn plötzlich neben ihm stand.
»Was soll ich sehen, Tam?«
Der adrette, fast akademisch aussehende Mann neben ihm war der andere Segelmeistersmaat, ein ewiger Fähnrich, der keine Lust gehabt hatte, sich um einen Leutnantsposten zu bewerben, seine Situation jedoch mit philosophischer Gelassenheit akzeptiert hatte. Er und Kydd waren Freunde geworden.
»Keiner hier außer uns«, sagte Tam ruhig. »Die Flotte muß sich irgendwo im Mittelmeer aufhalten.«
Abgesehen von den robusten Segeln der Werftboote und einer Schonerbrigg, die in ziemlich baufälligem Zustand an einer Mole lag, waren nur noch die exotischen Lateinersegel der Levantefahrer zu sehen, welche die See in den ruhigen Gewässern um Gibraltar sprenkelten.
»Seite!«
Der kräftige Bootsmann hob seine silberne Pfeife an den Mund. Der Kapitän kam mit energischem Schritt aus seiner Kajüte, seinen besten Degen an der Seite und die Uniform glitzernd von Goldlitze und Orden. Respektvoll traten Kydd und Cockburn zu den Fallreepsgasten an der Seite des Schiffes.
Der Bootsmann hob seine Pfeife erneut an den Mund, und als der Kapitän über das Schanzkleid stieg, legte jeder die Hand an die Kopfbedeckung, und der schrille Ton der Bootsmannspfeife durchdrang die Abendruhe.
Nachdem der Kapitän sicher über die Seite war, salutierte der Erste Offizier noch einen Augenblick weiter und wandte sich dann an den Bootsmann. »Lassen Sie die Wachen wegtreten. Ich denke, die Seeroutine ist jetzt beendet.«
Die Augenbrauen des Bootsmanns hoben sich erstaunt. Keine strikten Befehle, das Schiff unverzüglich wieder seeklar zu machen, Proviant zu fassen oder die zerstörerischen Wirkungen der Ozeanüberquerung zu beseitigen? Offensichtlich würden sie hier längere Zeit bleiben. »Landgang, Sir?« fragte er.
»Die Backbordwache bis zum Abendschuß.«
Die Worte des Ersten Offiziers wurden von einem Dutzend Ohren aufgenommen; plötzliches, unsichtbares Hin und Her zeigte, daß die Information mit großer Freude verbreitet wurde.
Als er das besorgte Stirnrunzeln des Bootsmannes wahrnahm, fügte der Erste Offizier hinzu: »Anscheinend sollen wir noch ein paar Leute aus England bekommen – die können dann ja mal an die Arbeit gehen und unsere Jungs zu einem wohlverdienten Ausflug an Land gehen lassen, nicht wahr?«
Kydd bemerkte eine gewisse Ironie in den Worten, dachte jedoch nicht weiter darüber nach. »Schon mal hier gewesen?« fragte er Cockburn, während er die sich lang hinziehende Ansammlung von Gebäuden und die maurisch aussehende Festung am anderen Ende betrachtete. Eine überwältigende Faszination ging von dem großen Felsen aus.
»Nein, niemals«, sagte Cockburn auf seine übliche, ruhige Weise, während er sich umsah. »Aber wir werden schon noch rechtzeitig Bekanntschaft schließen.«
Kydd bemerkte überrascht, daß auf der Glorious,die nur einhundert Yards entfernt vor Anker gegangen war, fieberhafte Aktivität herrschte. Ein steter Strom von Verpflegungsbooten und niedrigen Lastkähnen bewegte sich zwischen dem Land und dem größeren Linienschiff hin und her, ein deutliches Zeichen für ein Schiff, das im Begriff stand auszulaufen.
Die altmodische Barkasse, welche die ranghöheren Männer an Land brachte, ließ sich zu einem Umweg bewegen, und schnell lagen sie an der Seite des großen Kriegsschiffes, ein Boot unter vielen, die emsig hin und her fuhren.
»Ahoi, Glorious!«rief Kydd. An Deck erschien ein vielbeschäftigter Unteroffizier und sah zu ihnen hinunter. »Wenn Sie Mr. Renzi ausrufen lassen könnten, wäre ich Ihnen sehr verbunden«, rief Kydd hinauf.
Das Gesicht verschwand, und sie warteten.
Die Hitze des Tages war geringer geworden, aber sie genügte noch, um die Gerüche eines Schiffes hervorzulocken, das sich lange auf See befunden hatte: Sonne auf geteerten Planken, Leinwand und abgelaufenen Decks, eine Ausdünstung aus offenen Stückpforten, die für das Schiff so typisch war wie die verschnörkelten Schnitzereien an ihrem Bug, eine Mischung von Bilgewasser, alten Vorräten, einer Ansammlung von Menschen und weitere, undefinierbare Gerüche.
Dann gab es plötzlich Bewegung und ein hölzernes Quietschen von Blöcken, und eine Stückpforte in ihrer Nähe wurde in die Höhe gehievt.
»Alter Junge!« Renzi lehnte sich heraus, und die Barkasse schob sich näher heran.
Beim Anblick des Mannes, mit dem er mehr als mit jedem anderen die Herausforderungen des Lebens und auch seine Belohnungen geteilt hatte, verzog sich Kydds Gesicht zu einem Lächeln. »Nicholas! Wenn du den Wunsch haben solltest, an Land zu gehen ...«
»Leider ist mir das nicht möglich, mein Alter.«
Es war der alte Renzi, der kühle und gleichzeitig empfindsame Blick, die Charakterstärke, die in den tiefen Linien beiderseits des Mundes lag, aber Kydd spürte auch noch irgend etwas anderes, etwas Beunruhigendes.
»Wir haben unseren Auslaufbefehl«, sagte Renzi ruhig. Das Schiff bereitete sich auf eine neue Reise vor, und man konnte deshalb nicht riskieren, daß Leute an Land zurückblieben. Aus diesem Grunde gab es auch keine Landgangserlaubnis. »Es ist so eine Art Alarm, wir sollen uns Jervis Flotte anschließen, glaube ich.«
Diese Worte weckten das Interesse der Leute in der Barkasse.
»Und wo steckt er?«, fragte Coxall, Artilleriemaat und der allgemein akzeptierte Führer ihres Ausflugs an Land. Er war ein erfahrener Seemann und kannte sich in Gibraltar aus.
Renzi wandte den Blick ab und betrachtete den Horizont; sein unnahbarer Gesichtsausdruck verursachte Kydd weiteres Unbehagen. »Es scheint, als gäbe es da eine gewisse – Unklarheit. Ich kann nicht mit Gewißheit sagen, wo sich seine Flotte im Augenblick befindet.« Mit einem halben Lächeln wandte er sich wieder an Kydd. »Aber dies sind unruhige Zeiten, mein Freund, alles ist möglich.«
Ein gedämpftes Brüllen im dunklen Geschützdeck lenkte Renzi ab, und er winkte Kydd entschuldigend zu und rief: »Wir werden uns nach unserer Rückkehr treffen, mein Freund«, und verschwand dann im Deck.
»Seltsame Geschichte«, murmelte Coxall und starrte die Bootsbesatzung an, die sich gemächlich in die Riemen legte, während das Boot um die größere Mole herumging und Kurs auf das Ende der Befestigungsmauer nahm. Er wurde munterer, als sie sich der Küste und einem kleinen Landungssteg näherten. »Ragged Staff«, sagte er, wobei sich sein faltiges Gesicht zu einem Lächeln verzog, »dort werden wir Wasser übernehmen, bevor wir wieder in See gehen.«
Sie kletterten an Land. Wie die anderen genoß es Kydd, nach so vielen Wochen auf See wieder soliden Boden zu spüren. Die Erde war seltsam gefügig unter seinen Füßen, ohne die Lebhaftigkeit eines Schiffes auf hoher See. Coxall nahm Kurs auf ein großes Tor in der Mauer und die Gruppe folgte ihm: Die Stadt verschlang sie im Handumdrehen. Die flanierenden Bürger der Stadt waren so unterschiedlich im Aussehen, wie es Kydd nicht oft zu sehen bekommen hatte. Hier war ein wirklicher Treffpunkt für alle Rassen: Europäer, Araber, Spanier und andere, deren Herkunft noch tiefer im mittelmeerischen Raum lag. Und die Gerüche! In den engen Straßen begegneten sie unzähligen, beladenen Maultieren und Eseln. Der durchdringende Geruch ihrer Exkremente wetteiferte mit den Angeboten der offenen Läden: geräucherter Hering und getrockneter Kabeljau, das kühle Schinkenaroma gesalzener Schweinefüße und der in die Nase steigende Geruch von Zimt, Gewürznelken, geröstetem Kaffee, die sich in dem heißen Halbdunkel mit dem Gestank vermischten.
In nur wenigen Minuten hatten sie zwei Straßen überquert und standen vor dem steil ansteigenden Felsmassiv. Coxall ersparte ihnen nichts. Er führte sie durch das massige Southport-Tor und weiter auf einem schmalen Pfad die mit Büschen bewachsenen steilen Hänge hinauf bis zu einem Gebäude auf einer Felsplattform. Ein plötzlicher Fallwind blähte seine Jacke auf und ließ seinen Hut in den Staub rollen.
»Scud Hill! Hier können wir uns erst einmal einen genehmigen, ohne den Gestank der Stadt einzuatmen«, sagte Coxall.
Es war eine Kneipe, aber keine von der Art, wie sie Kydd kannte. In groben Zügen einem englischen Wirtshaus nachempfunden, bestand es überwiegend aus einem offenen Balkon anstatt eines dunklen Innenraums, und anstelle von Bänken mit hohen Rückenlehnen gab es individuelle Tische mit Rohrstühlen.
»Ein großer Krug Bier würde mir jetzt so richtig zupaß kommen!« seufzte der magere und sorgfältige Tippett, Zimmermannsmaat und Coxalls unzertrennlicher Genosse.
Sie ließen sich in die Stühle sinken, drehten sie so, daß sie über das Wasser hinausblicken konnten, und legten dann sorgfältig ihre Hüte darunter. Sie befanden sich genau über der Rosia-Bucht, in der ihre Schiffe vor Anker lagen, während sie unter sich einen herrlichen Blick über die Stadt hatten, eingebettet in die langen Linien ihrer Befestigung.
Das Bier kam schnell – diese Gaststätte war auf eine Flotte im Hafen eingerichtet, und in deren Abwesenheit waren sie, bis auf einen weiteren besetzten Tisch, die einzigen Gäste.
»Auf unser Wohl, Jungs!« rief Coxall und leerte seinen Zinnbecher.
Es war ein Genuß, auf dem breiten Balkon zu sitzen. In dieser Höhe wehte der Wind stark und kühl, aber die sanfte Wärme der Wintersonne gab dem späten Nachmittag eine willkommene Trägheit. Kydd blickte gelassen über seinen Zinnbecher hinweg über die steilen sonnenbeschienenen Hänge auf das landeinwärts liegende Ende von Gibraltar. Unterhalb erstreckte sich die Stadt in einer schmalen Linie, bis sie nach ungefähr einer Meile abrupt am Ende des Felsens endete. Der Rest der Landschaft bestand aus nackten Büschen auf steilen Hängen.
»Dies ist also dein Gibraltar«, sagte er, »so wie's aussieht, ist es grad eine Meile lang und eine halbe hoch!«
»Aye, aber es ist verdammt wertvoll für uns. Die Spanier haben vor rund einem Dutzend Jahren versucht, es uns wegzunehmen. Vier Jahre lang haben sie's probiert und dabei alles kaputt geschossen«, antwortete Coxall. »Aber wir haben uns nicht vertreiben lassen und eine verteufelt große Festung daraus gemacht.«
»Solange wir also den Felsen haben, bekommt ihn niemand anders«, sinnierte Cockburn. »Und wir kommen und gehen, wie es uns gefällt, aber Feinde lassen wir nicht vorbei! Möge die Flagge von Old England für immer auf dem Felsen wehen, darauf laßt uns trinken!
Das zustimmende Murmeln, als sie ihre Humpen hoben, wurde durch das Scharren eines Stuhls unterbrochen, und ein Seemann mit einem harten, wenn auch freundlichen Gesicht trat an ihren Tisch. »Samuel Jones, Verwaltungsunteroffizier auf der Brigg Loyalty.«
Tippet machte eine Handbewegung, welche die Männer am Tisch einschloß. »Wir kommen von der Achilles,sind gerade erst aus der Karibik gekommen.«
»Hab' euch gesehen. Ihr wißt also noch nicht, was plötzlich auf dieser Seite des Ozeans passiert ist.« Auf das erwartungsvolle Schweigen hin fuhr er fort: »Wie ihr vielleicht wißt, haben sich die Spanier im Oktober mit den Franzosen zusammengetan, und seitdem ...«
Kydd nickte. Aber sein Blick wanderte zu dem Punkt, wo Gibraltar so abrupt endete; dort lag Spanien, Feindesland, nur eine Meile oder so dahinter – und dieser Feind war immer dort.
Seinen Auftritt genießend, fragte Jones: »Und wo stecken denn Admiral Jervis und seine Flotte?«
Coxall wollte etwas sagen, aber Jones unterbrach ihn. »Nein, Kamerad, er ist in Lissabon – dort draußen!« Er machte eine Bewegung nach Westen, zum offenen Atlantik. Dann lehnte er sich nach vorn und deutete in die andere Richtung, ins Mittelmeer hinein. »Seit Dezember, also seit letztem Monat, mußten wir da raus – konnten nicht länger bleiben. Daher, Kameraden, gibt es im ganzen Mittelmeer kein einziges britisches Kriegsschiff mehr!«
Die schwere Stille wurde von Coxalls beunruhigter Stimme unterbrochen. »Du meinst Port Mahon, Leghorn, Neapel ...«
»Haben wir alles den Franzosen überlassen, Kamerad: Ich sage dir, es gibt keine englischen Geschütze, die weiter im Mittelmeer stehen, als unsere!«
Kydd starrte auf den Tisch. Evakuierung des Mittelmeeres? Es war unvorstellbar! Die große Handelsstraße zum Orient, nach dem Verlust der amerikanischen Kolonien – die Reisen nach der Levante, Ägypten und die sagenumwobenen Kamelzüge an das Rote Meer und Indien – alles vorbei?
»Aber laßt euch davon nicht beunruhigen«, fuhr Jones fort.
»Und warum nicht?« fragte Cockburn vorsichtig.
»Weil es noch schlimmer kommt«, sagte Jones leise.
Die anderen rührten sich nicht.
»Vor zwei Wochen bekamen wir eine Meldung aus dem Norden, von den vor Brest stehenden Fregatten. Die Franzosen«, er machte eine Pause, »sind mit ihrer Flotte ausgelaufen!«
Das brachte die Leute rund um den Tisch in Bewegung.
»Nicht das Übliche, keineswegs. Dies ist eine große Sache, vierzig Schiffe und mehr, siebzehn Linienschiffe – und Transportschiffe mit Soldaten und Pferden und allem, was sonst noch dazugehört.« Er betrachtete ihre Gesichter, eins nach dem anderen. »Es ist ein elender Sturm aus dem Osten, Colpoys Flotte steht zu weit ab und kann sie nicht aufhalten! Als man sie zuletzt sah, liefen sie Kurs Nord – nach England, Kameraden ...«
»Sie laufen aus!«
Der aufgeregte Schrei des Zimmermädchens trug ihr einen automatischen Tadel von Emily ein, die dann jedoch ohne zu zögern ans Fenster eilte. Weiße Segel entfalteten sich auf dem größten Schiff, der Glorious, wie sie inzwischen herausgefunden hatte. Die kleinere Achilles lag weiterhin friedlich vor Anker und ließ nicht erkennen, daß sie ebenfalls in See gehen wollte. Emily runzelte ob dieser Entwicklung die Stirn. Da sie keine Kinder hatte, die sie beschäftigten, und einen Ehemann, der viele Stunden bei der Arbeit verbrachte, hatte sie sich dem sozialen Leben in Gibraltar gewidmet. Für die nahe Zukunft war eine Gesellschaft geplant, und sie setzte ihre Hoffnung in die jüngeren Schiffsoffiziere. Wenn sie zwei von ihnen einfangen konnte, würden sie sich glänzend als Begleitung für die langweiligen Elliott-Schwestern eignen.
Dann erinnerte sie sich plötzlich. Es war Letitia, die entdeckt hatte, daß sich auf der Achilles der Mann befand, der Lord Stanhope nach einem schrecklichen Hurrikan in einer aufregenden Fahrt im offenen Boot gerettet hatte. Sie zermarterte sich den Kopf; ja, Kapitän Kidd hieß er oder so ähnlich. Sie würde dafür sorgen müssen, daß er auf die Gästeliste kam.
Die neuen Leute gingen am nächsten Vormittag an Bord. Trostlos schlurften sie unter der Mittelmeersonne heran. Sie waren mit den Verpflegungsbooten von England gekommen, und ihre Fahrt über die Biscaya in Kriegszeiten war sicher nicht angenehm gewesen. Als Maat der Wache nahm Kydd ein abgegriffenes Stück Papier von dem Deckoffizier entgegen und quittierte für sie. Er sagte dem diensttuenden Fähnrich, er solle sie unter Deck bringen – die erste Station ihrer Aufnahme in die Mannschaft der Achilles –und beobachtete, wie sie durch die Großluke nach unten stolperten. Trotz der robusten Kleidung, die man ihnen auf ihrem ersten Schiff in England verpaßt hatte, handelte es sich um einen deprimierten und abschreckend aussehenden Haufen.
Der Deckoffizier machte noch keine Anstalten zu gehen und stellte sich neben Kydd. »Keine Bootswache?«
»Sind wir denn in Spithead?« antwortete Kydd.
Jeder halbwegs ausgeschlafene Seemann würde erkennen, daß es nutzlos wäre, das Land erreichen zu wollen. Der einzige Weg, aus Gibraltar herauszukommen, lief über ein Handelsschiff, und diese lagen kaum zweihundert Yards entfernt an der Neuen Mole und wurden alle bewacht.
Der Deckoffizier betrachtete ihn mit zynischem Lächeln. »Wie lange bist du schon weg aus England?«
»Die letzten beiden Jahre war ich auf den Westindischen Inseln«, sagte Kydd zurückhaltend.
Der Mann tat die Bemerkung mit einem Grunzen ab. »Dann schreib dir dies mal ins Logbuch: Die Zeiten ändern sich, Kamerad, die Marine ist nicht mehr, was sie mal war. Diese Leute sind die besten, die ihr bekommen könnt, aber es ist kein einziger Seemann darunter.« Er ließ die letzten Worte wirken; nach dem Gesetz konnten die Presser nur Leute mitnehmen, die »mit der See zu tun hatten«. Dann fuhr er fort: »Hast du jemals von den Männern des Oberbürgermeisters1 gehört? Nein?« Er lachte hart auf. »Durch Parlamentsbeschluß muß jede Stadt eine bestimmte Quote von Männern bereitstellen. Sie haben keine Wahl – wen sollen sie also schicken? Gute Leute oder was?« Er trat zur Seite und spuckte gezielt in den Hafen. »Natürlich nicht. Sie entledigen sich ihres arbeitsscheuen Gesindels und leeren dazu noch die Gefängnisse. Und das alles bekommt dann die Marine.«
Das schien kaum vernünftig. Die Preßgangs, wie bösartig sie auch sein mochten, hatten in der Vergangenheit gute Leute »geliefert«, selbst in der Karibik. Warum nur jetzt nicht mehr?
Als wollte er seine unausgesprochene Frage beantworten, fuhr der Mann fort: »Die Presser allein schaffen es nicht mehr, es gibt zu viele Schiffe, die eine Mannschaft brauchen.«
Gedämpfte, ärgerliche Rufe drangen von unten herauf.
Der junge Leutnant der Wache kam nach vorn und runzelte ob des Lärms die Stirn. »Mr. Kydd, sehen Sie bitte mal nach, was da unten los ist.«
Eine Prügelei auf dem Geschützdeck. Es war kurz nach der Ausgabe des Mittagsgrogs, und es war nicht ungewöhnlich, daß Männer, die sich auf irgendeine Weise eine Extraration ergaunert hatten, anfingen, Krawall zu machen; ungewöhnlich war nur, daß es sich diesmal um Boddy handelte, einen Vollmatrosen, der für seine Zuverlässigkeit bei Arbeiten in der Takelage bekannt war. Den anderen Mann erkannte Kydd nicht. Von mürrischen Seeleuten umringt, hielten die beiden sich voller Wut gepackt. Dies war kein Fall, bei dem die Temperamente einfach nur mal hochgegangen waren.
»Aufhören!« brüllte Kydd.
Lärm und Geschrei verstummten, aber die beiden Kontrahenten fuhren fort, sich zu prügeln. Kydd selbst konnte nicht dazwischengehen, denn falls ihn ein wilder Schwinger erwischte, würde man dem Schuldigen eine Schlinge um den Hals legen, weil er einen Vorgesetzten geschlagen hatte.
Ein Konstablermaat rannte von hinten an sie heran und stieß seine Faust zwischen sie. Sie ließen voneinander ab, blutig und mit wildem Blick. Der Unteroffizier sah Kydd fragend an.
Seine Pflicht war klar, das Paar müßte eigentlich zur Bestrafung auf das Achterdeck gebracht werden, aber Kydd fühlte, daß er erst einmal den Grund herausfinden sollte. »Ein alter Seemann wie du, Will«, sagte er so laut zu Boddy, daß auch die anderen es mitbekamen, »der hier auf dem Geschützdeck seine Fäuste schwingt, das paßt gar nicht zu dir.«
Kydd betrachtete den anderen Mann. Er hatte die beunruhigende Angewohnheit, den Kopf auf die Seite zu legen, aber in die entgegengesetzte Richtung zu blicken; ein vorsichtiger, abschätzender Blick, der sich sehr von der Direktheit des normalen Seemanns unterschied.
»Ich hab' diesen Kerl dabei erwischt, wie er meinen ditty bag durchstöbert hat!« schrie Boddy aufgewühlt. »Ich schlag' ihm seine verdammten Topplichter aus, diesem ...«
»Nu leg man einen Stopper an«, fauchte Kydd.
Es war schon provozierend genug; im ditty bag hängten die Seeleute ihre Gebrauchsgegenstände beim Arbeiten an der Schiffsseite auf, ein kleiner Sack mit einem Loch auf halber Höhe, durch das man hineinlangen konnte. Nichts darin war von wirklichem Wert, warum also ...
»Ich wußte nicht, was es war, das ist die Wahrheit.« Die Worte des Mannes klangen kühl und paßten so gar nicht auf ein Kriegsschiff.
Boddy sprang zurück. »Versuch ja nich', mich zu verarschen, du Halunke«, knurrte er.
Es könnte stimmen – diese Quotenleute hatten bestimmt keine Ahnung vom Leben auf See, nach der kurzen Zeit auf dem Empfangsschiff im Hafen und dem Lebensmitteltransporter, und waren vermutlich neugierig auf ihr neues Quartier. Wie auch immer, es würde viel Mühe kosten, darüber war sich Kydd im klaren, Leute wie diese in die Mannschaft einzugliedern, zu der die Männer der Achilles nach ihrer Atlantiküberquerung zusammengewachsen waren.
»Nu mach mal Pause«, raunzte er Boddy an. »Diese Armleuchter müssen noch eine Menge lernen. Entweder lebst du damit, oder du marschierst aufs Achterdeck, klar?«
Boddys Augen funkelten noch einen Moment, dann faltete er die Arme über der Brust. »Na schön, jedenfalls muß er aus dieser Messe verschwinden!«
Kydd stimmte zu. Es war ein altes Privileg des Seemanns, sich seine Backsgenossen auszusuchen; er würde diese Angelegenheit später regeln. Es bestand keine Notwendigkeit, hierfür die formale Schiffsdisziplin zu bemühen. Er warf dem Unteroffizier einen bedeutungsvollen Blick zu und kehrte an Deck zurück.
Der Deckoffizier war noch anwesend, und nachdem Kydd den Leutnant der Wache beruhigt hatte, kam er mit einem wissenden Lächeln zu ihm herüber. »Bekanntschaft mit den Leuten des Oberbürgermeisters gemacht, Kamerad?« Kydd warf ihm einen kühlen Blick zu.
»In euren Büchern werden sie als Freiwillige geführt, und das bedeutet, daß jeder von ihnen ein Handgeld von siebzig Pfund erhält, die er ausgeben kann, wie er will.«
»Siebzig Pfund!«
Der Sold für einen guten Seemann betrug weniger als einen Schilling – das entsprach also dem Sold von vier Jahren für einen guten Mann; ein gepreßter Mann bekam gar nichts, doch dieses Gesindel ...
Kydds Gesicht verhärtete sich. »Ich bring' dich ans Fallreep«, sagte er grimmig zu dem Deckoffizier.
Mittags wurde Kydd von Cockburn abgelöst. Die trottelige politische Lösung des Bemannungsproblems drückte auf die Stimmung. Und Gibraltar war anscheinend nur eine Garnisonsstadt, ein großer befestigter Felsen, und das war alles. England befand sich in großer Gefahr, und er mußte sich damit begnügen, in einem alten Schiff, das schon viel mitgemacht hatte und nun längere Zeit vor Anker liegen würde, für Ordnung zu sorgen.
Kydd war nicht danach, in dieser Stimmung an Land zu gehen, aber an Bord zu bleiben lockte ihn noch weniger angesichts der Zwistigkeiten unter Deck. Vielleicht würde er doch einen Rundgang durch die Straßen unternehmen; schließlich war die Stadt ja interessant genug.
Zufrieden mit seiner Erscheinung, dem blauen Rock eines Ersten Steuermanns mit seinen großen Knöpfen, den weißen Kniehosen, der Weste und dem mit einer Kokarde geschmückten schwarzen Hut, trat er zu der Gruppe an der Gangway, die auf das erste Boot zum Ufer wartete. Der Erste Offizier kam den Niedergang zur Großluke herauf, trug aber seinen Hut seitlich in der Hand als Zeichen, daß er nicht im Dienst war.
»Gehen Sie in die Stadt?« fragte er Kydd freundlich.
Kydd legte höflich die Hand an seinen Hut. »Aye, Sir.«
»Dann wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie diese beiden Bücher in der Garnisonsbibliothek abgeben würden«, sagte er und übergab ihm ein kleines Paket.
Kydd stellte fest, daß die Bibliothek an der Hauptstraße lag, gegenüber einem Frauenkloster. Er brauchte nicht lange, um es zu finden – die Hauptstraße war der zentrale Weg durch die Stadt, und auf halbem Wege lag schon das Kloster. Zu seiner Überraschung verdiente es offenbar ein volles Kontingent von Posten in Paradeuniform. Eine riesige Nationalflagge wehte hochmütig über dem Gebäude, und ein Sergeant warf ihm aus dem Tor einen forschenden Blick zu. Gegenüber lag die Garnisonsbibliothek, wie man ihm gesagt hatte, ein schlichtes, freistehendes Haus.
Es war ein ruhiger Morgen, und Emily überlegte, was sie tun sollte. In Gedanken beschäftigte sie sich mit dem geplanten Gesellschaftsabend, wie immer ein Problem mit den üblichen Gästen. Beim Gedanken, was sie anziehen sollte, krauste sich ihre Stirn. Trotz des tropischen Klimas in Gibraltar hatte sie ihren zarten, milchigen Teint behalten und war jetzt, im Alter von zweiunddreißig Jahren, auf der Höhe ihrer Schönheit.
Da hörte sie ein leises Klopfen an der Tür, ging zurück zu ihrem Schreibtisch und gab dem kleinen Malteser Assistenten ein Zeichen.
Es war ein Mann von der Marine; irgend so ein Offizier mit sehr einnehmendem scheuen Wesen, das in keiner Weise sein imponierend gutes Aussehen beeinträchtigte. Er hatte ein kleines Päckchen bei sich. »Ah, können Sie mir sagen, Miss, ob ich hier richtig bin in der Garnisonsbücherei?«
Sie kannte ihn nicht, er kam wahrscheinlich von dem noch im Hafen liegenden großen Kriegsschiff.
»Das stimmt«, sagte sie sittsam. Eine Bibliothekarin, wie laienhaft sie auch sein mochte, mußte ein gewisses Niveau einhalten.
Er trug seinen Hut unter dem Arm und überreichte ihr das Päckchen, als enthielte es eine Kostbarkeit. »Der Erste Offizier der Achilles bat mich, diese Bücher zurückzugeben«, sagte er mit einer seltsamen Mischung von bodenständiger Einfachheit und einer gewissen vornehmen Gesinnung.
»Danke, es war sehr freundlich von Ihnen, sie herzubringen.« Sie machte eine kleine Pause, betrachtete ihn genauer und stellte fest, was er für eine gute Figur in seiner Marineuniform machte; wahrscheinlich war er Mitte zwanzig, und aufgrund der ausgeprägten Stärke seiner Gesichtszüge vermutete sie, daß er schon viel von der Welt gesehen hatte.
»Achilles – aus der Karibik? Dann kennen Sie bestimmt auch Mr. Kidd, Sie wissen schon, den berühmten Mann, der Lord Stanhope gerettet hat und so weit in einem offenen Boot gesegelt ist, und dessen Dienstmädchen war auch dabei!«
Der junge Mann runzelte ein wenig die Stirn und zögerte etwas, aber in seinen Augen leuchtete ein gewisser Humor. »Aye, ja, natürlich, aber es war nicht das Dienstmädchen des Lords, es war die Reisebegleiterin von Lady Stanhope.« Sein glänzendes Haar war zusammengerafft und hinten zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, ganz verschieden von den kurzen, gepuderten Perücken der Armeeoffiziere.
»Vielleicht halten Sie mich für schrecklich aufdringlich, aber Sie würden mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie mich mit ihm bekannt machten«, sagte sie wagemutig.
Mit scheuem Lächeln erwiderte er: »Ja, Miss. Dann darf ich mich vielleicht vorstellen, Thomas Kydd, Erster Steuermann der Achilles.«
Kapitel 2
Es war ein angenehmer Tag, fand Kydd. Cockburn war später zu ihm gestoßen, und sie waren zusammen durch die bevölkerten Nebenstraßen geschlendert, hatten exotische Früchte probiert und aufdringliche Verkäufer abgewehrt, die ihnen allen möglichen Tand andrehen wollten. Als sie an Bord zurückkamen, hatte Kydd sich dafür entschieden, an Deck zu bleiben, denn er wußte, daß Cockburn Schreibfeder und Papier herausholen würde – seine persönliche Art, sich zu trösten.
Inzwischen war die Nacht hereingebrochen, und Kydd stand an den Besanwanten. Gelbe Lichter funkelten in der Dunkelheit, schwache Geräusche von Land wurden über das Wasser getragen: das Schreien eines Esels, der regelmäßige Schlag eines Hammers, das unaufhörliche Summen irgendwelcher Aktivitäten.
Möglicherweise wird unser unbestimmter Aufenthalt in Gibraltar doch nicht so ganz unerfreulich, dachte Kydd. Dann erinnerte er sich an die schreckliche Nachricht von der Invasionsflotte und die Tatsache, daß Renzi auf der Glorious im Begriff stand, am gigantischen Kampf um das Überleben Englands teilzunehmen, während Kydds eigenes Schiff als armseliges Zeichen englischer Macht hier zurückblieb.
Die Logik sagte ihm, daß hilflose Besorgnis von keinem Nutzen für England war, und er versuchte entschlossen, an andere Dinge zu denken. An das Schiff zum Beispiel. Sobald ihnen eine Spiere geliefert wurde, würden sie die Bagienrah am Kreuzmast erneuern, und er würde sich dann für ein Rack stark machen, weil sich dieses auch als Rolltalje eignete.
Seine Gedanken kehrten in die Gegenwart zurück – hier war er nun, Erster Steuermann, ein Deckoffizier. Das war etwas, wovon er in den vergangenen Jahren nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Für einen einfachen Seemann war es schon die Krönung, eine Bestallungsurkunde von der Admiralität in seiner Seekiste zu haben.
Obwohl er kein richtiger Offizier war – diese besaßen ein Patent von König George –, als Erster Steuermann genoß er wirklichen Respekt an Bord. Er nahm zwar seine Mahlzeiten mit den Kadetten ein, aber er war dienstälter als sie und konnte ihre Schuljungenpossen unterbinden, wenn ihm danach zumute war. Gleichzeitig war er voll und ganz Teil der Besatzung, ein Seemann und ein professioneller dazu. Sein sozialer Horizont war wie der ihre, aber er war ganz oben und schuldete niemand vor dem Mast Respekt, mit Ausnahme des Segelmeisters. In dieser komfortablen Stellung konnte er einer langen Dienstzeit entgegensehen.
Und doch gab es eine Seite seiner Existenz, die für ihn eine dauernde Quelle des Bedauerns war. Nicholas Renzi hatte nicht nur seine Abenteuer und das gefährliche Leben auf See mit ihm geteilt, sondern ihn auch mit vielem bekannt gemacht, was bedeutungsvoll und wahrhaftig war, und von ihm hatte er auf mancher gemeinsam verbrachten Nachtwache die Gewohnheit angenommen, Dinge zu hinterfragen. Er erinnerte sich an die leidenschaftlichen Diskussionen im Pazifik über die Prinzipien Rousseaus, an die von Locke und Diderot genährte Intensität von Renzis Überzeugungen – alle eines erleuchteten Geistes würdig. Und Renzis Vertrautheit mit der Schönheit und Kunst der Wörter, die, wie nichts sonst, einen Teil seiner Seele berührten ...
Aber Renzi war jetzt ebenfalls Steuermann; selbst ein Linienschiff würde nur einen oder höchstens zwei an Bord haben. Das ließ es unwahrscheinlich erscheinen, daß sie noch einmal auf dem gleichen Schiff Dienst tun würden.
Kydd blickte in das dunkle Wasser hinab. Zumindest waren sie bis jetzt auf dem gleichen Flottenstützpunkt gewesen und konnten sich gelegentlich besuchen. Sie hatten ihren Büchervorrat in Barbados geteilt – inzwischen waren alle längst gelesen –, aber um sie auszutauschen, mußte er warten, bis sie sich wieder begegneten.
Schlecht gelaunt und etwas deprimiert war er im Begriff, unter Deck zu gehen, als er an die Garnisonsbibliothek dachte. Vielleicht bestand ja die Möglichkeit, daß die freundliche Dame, der er dort begegnet war, Verständnis zeigen und ihm ein oder zwei Bücher ausleihen würde. Dann könnte er sich damit beschäftigen und Renzi später mit einem Brocken Philosophie oder einem geheimnisvollen und höchst merkwürdigen Aspekt der Naturwissenschaft verblüffen. Dieser Gedanke heiterte ihn auf.
Emily war verärgert über sich. Mr. Kydd war zu ihr gekommen, und sie hatte nichts zu sagen gewußt, wie ein dummes Mädchen, und hatte ihn einfach wieder fortgehen lassen. Und heute morgen würde sie wieder diesem ekelhaften Mr. Goldstein gegenübertreten müssen, um ihn zu informieren, daß das Komitee auch in seinem Falle nicht die unumstößliche Regel durchbrechen könnte, daß Händler, wie prominent auch immer, nicht Mitglieder der Bibliotheksgemeinschaft sein durften.
Sie rückte eine Reihe gelehrter Journale zurecht und hörte dabei ein Klopfen an der Tür, ein zurückhaltendes Klopfen. Sie schob den Malteser Assistenten beiseite, ging schnell an die Tür und öffnete sie mit einem strahlenden Lächeln. »Ach, Mr. Kydd!«
Er sah genauso aus, wie sie ihn in Erinnerung hatte, mit demselben scheuen Lächeln. Emily neigte graziös den Kopf – dieses Mal würde sie nicht in Verlegenheit gebracht werden.
»Äh, ich hätte gern gewußt, Miss, ob ich bei Ihnen vielleicht ein oder zwei Bücher ausleihen könnte?«
Sein Blick schaute so offen und arglos – wenn er viel erlebt hatte, dann bestimmt nicht in irgendwelchen Salons.
»Mr. Kydd«, sagte Emily kühl, »diese Bücherei wurde nach der großen Belagerung von den Offizieren dieser Garnison geschaffen, die keine weitere erdulden wollten, ohne Nahrung für ihren Intellekt zu haben. Dies ist ihre Bibliothek, zu der sie alles beigesteuert haben.«
Kydd zog ein langes Gesicht.
Emily unterdrückte ein Lächeln, seine Gefühle waren so bezaubernd durchschaubar! »Marineoffiziere haben nach Kräften gespendet, was sie konnten«, fuhr sie fort, »und das Komitee hat sie daher gleichermaßen berechtigt, Bücher auszuleihen.« Sie ergriff ein Buch und tat so, als wolle sie etwas nachlesen.
Kydd antwortete nicht, und als sie aufsah, bemerkte sie überrascht einen Ausdruck trauriger Resignation auf seinem Gesicht. »Dann bin ich angeschmiert, ich bin nämlich nur Steuermann.« Als er ihren verständnislosen Blick sah, fügte er hinzu: »Ein Deckoffizier.«
Ihr Gesicht erhellte sich. »Uns ist es egal, was für ein Offizier Sie sind, Mr. Kydd! Selbstverständlich können Sie die Bibliothek benutzen.«
Kydds Lächeln kam zurück, und Emily erwiderte es warmherzig.
»Nun, wollen wir sehen, was haben wir, das Sie interessieren könnte ...«
Das war ein ziemliches Problem. Es gab Offiziere, die ernsthaft nach weiterbildender Lektüre fahndeten, andere, die sich mehr für die wilderen Exzesse im Zusammenhang mit dem Untergang Roms interessierten, und noch andere, die einfach alles lasen, was man ihnen anbot. Kydd schien in keine dieser Kategorien zu gehören.
»Darf ich Ihnen den Autor Gabinetti empfehlen, Sitten und Kulturgeschichte der Iberer?Das könnte vielleicht interessant sein für jemand, der in diesen Teil der Welt gekommen ist.«
Kydd zögerte. »Ah, ich hatte eigentlich mehr an Mr. Hume gedacht, falls Sie ihn haben. Ich würde gerne mehr darüber wissen, was er über Kausalität geschrieben hat.«
Als er ihren erstaunten Blick bemerkte, fügte er eilig hinzu: »Sie müssen wissen, ich habe einen Freund, der mehr an metaphysischen Dingen interessiert ist und den Wunsch hat, mit mir über Empirismus zu diskutieren.«
»Oh«, sagte Emily, »so etwas wird bei uns wenig verlangt, Mr. Kydd. Aber ich werde sehen, was ich tun kann.« Da gab es einen alten, dunkelbraunen Lederband im Regal hinter dem Schreibtisch, der von Hume war, aber sie hatte nicht den blassesten Schimmer, was drin stand. »Ah, hier haben wir was«, sagte sie munter. »David Hume: An Enquiry concerning Human Understanding.«
Kydd ergriff das kleine Buch und blätterte andächtig darin herum. Seine Hände waren sehr stark, bemerkte sie.
»Das ist genau richtig, Miss«, sagte er.
»Ausgezeichnet!« sagte Emily erleichtert. »Und ich bin Mrs. Emily Mulvany«, fügte sie hinzu.
Kydd quittierte ihre Worte mit einer altmodischen Höflichkeit, die sie charmant fand. An der Tür drehte er sich um, um sich zu verabschieden.
»Oh, Mr. Kydd, ich habe vergessen, Ihnen mitzuteilen – wir veranstalten einen Gesellschaftsabend, wozu auch Sie eingeladen sind, glaube ich«, sagte sie so beiläufig, wie sie nur konnte. »Ich bin sicher, Sie werden das nach Ihrer langen Reise genießen.«
Es wäre sicherlich eine tolle Sache, ein solches Prachtexemplar vorzuführen, so einen interessanten Mann Emilys Gedanken überschlugen sich. Gibraltar war klein und bot kaum Veränderungen, und sie war nie jemandem wie Mr. Kydd begegnet. Man stelle sich vor – mit einem Freund unter den Sternen über Philosophie zu diskutieren und dabei jederzeit bereit zu sein, mit dem Feind in einen schrecklichen Kampf zu geraten! Und dann war da noch seine große Tat, einen Diplomaten in einem offenen Boot über die offene See zu retten. Er hatte sicherlich ein viel aufregenderes und romantischeres Leben geführt als ein Soldat! Sie beobachtete, wie er den Raum verließ. Ein richtiger Mann, der sich wahrscheinlich etwas ruhelos fühlte, eingeengt durch seine täglichen Gänge durch Gibraltar. Es wäre sicherlich eine interessante Herausforderung, ihm die Langeweile etwas zu vertreiben ...
Die Einladung kam am nächsten Morgen, eine schlichte Einladung, sehr schön geschrieben in einer femininen Handschrift und adressiert an Mr. Kydd, an Bord der HMS Achilles. Es war die erste gesellschaftliche Einladung, die er je erhalten hatte, und er befühlte die teure Karte mit Vergnügen und Überraschung. Mrs. Mulvany gehörte offensichtlich zur besseren Gesellschaft, und Kydd hatte gedacht, sie hätte die Einladung nur aus Höflichkeit erwähnt. Ein Gesellschaftsabend, das wußte er von einer einzigen früheren Erfahrung in Guildford, war eine ziemlich zwanglose Zusammenkunft. Aber dann fiel ihm ein, daß dabei ja auch getanzt wurde ...
»Mein Freund«, sagte er zu Cockburn, nachdem er ihm etwas zaudernd die Einladung gezeigt hatte, »hilf mir. Ich muß ablehnen, denn vom Tanzen verstehe ich nichts, und ich mache sonst dem Schiff Schande. Kannst du mir ein paar gute Gründe sagen, weswegen ich nicht teilnehmen kann, oder ...«
»Thomas, du mußt teilnehmen«, sagte Cockburn, »eine Absage würde sowohl dir als auch der Marine zur Schande gereichen!
»Aber – ich kann doch nicht tanzen, ich habe es nie gelernt!« sagte Kydd bekümmert. Viel lieber würde er der Breitseite eines Feindes die Stirn bieten, als sich vor kichernden Ladies zu blamieren.
»Ah.« Cockburn hatte schon als junger Mann einen Tanzlehrer gehabt und fühlte sich auf dem Tanzboden wie zu Hause. In der Tat schätzte er das Wechselspiel von Weiblichkeit und männlicher Leidenschaft.
»Meine Familie hat mit diesen gesellschaftlichen Dingen nie viel zu tun gehabt«, sagte Kydd hoffnungslos.
Impulsiv sagte Tam: »Dann werde ich eben dein Lehrer sein!
»Was? Nein!« stieß Kydd hervor. Da tauchte vor seinem inneren Auge ein Phantasiebild auf: Emilys schlanke Figur, die, von seinen tänzerischen Fähigkeiten begeistert, nur so dahinschwebte, ihre attraktiven Haarlocken in der wilden Drehung um ihren Kopf wirbelnd, ihre Wangen gerötet, als ... »Könntest du? Ich weiß nicht ...«
»Natürlich, es ist, äh, es ist so ungefähr, wie wenn die Seesoldaten ihren Drill machen, und das lernen sie ja einfach genug!«
Die Hundewache beobachtete, wie die beiden in das dunkle Orlopdeck hinuntergingen zum Raum vor der Kajüte des Schiffsarztes, des Zahlmeisters und der Kadetten.
Cockburn sah sich vorsichtig um und wandte sich dann an Kydd: »Bei einem Kotillon ist es von großer Wichtigkeit, die Füße so zu setzen«, begann er und nahm graziös die betreffende Pose ein.
Kydd machte es ihm nach und sah zweifelnd nach unten.
»Sieh die Dame an, nicht deine Füße – ist sie nicht nach deinem Geschmack?« Diesen alten Scherz würde sein alter Tanzlehrer bestimmt erkennen, erinnerte Cockburn sich mit Wehmut.
Kydd hob den Kopf und bemühte sich um eine graziöse Haltung. Ein gedämpftes Lachen ertönte aus der Dunkelheit, und er wirbelte herum.
»Legt einen Stopper an euer Gegacker, verdammt noch mal! Oder ihr werdet eure Hundewachen in der Takelage verbringen!«
Ein Kadett verdrückte sich vorsichtig ins Dunkel.
Cockburn machte weiter. Die Düsternis und der starke Geruch des Orlopdecks verbreitete keineswegs eine Ballsaalatmosphäre, und außerdem behinderten Ringbolzen im Deck hier über dem Hauptladeraum die Schritte. »Bei diesem Takt werden folgende Fußbewegungen ausgeführt: eins, zwei, drei und stehen; und eins, zwei, drei und vier ...«
Die Kajütentür des Schiffsarztes öffnete sich geräuschlos, und Cockburn wurde gewahr, daß von vorne leise Schritte näher kamen – verständnisvolle Zuschauer pirschten sich im Dunkel heran.
»Nein, Tom, du hast wieder die ›Vier‹ vergessen«, sagte Cockburn beherrscht, denn Kydd war gestolpert und hatte auch ihn aus dem Gleichgewicht gebracht. Sein Schüler hatte ein Gedächtnis, so kurz wie ...
»So geht das nicht, überhaupt nicht«, sagte er zu dem niedergeschlagenen Kydd. Er flüsterte etwas vor sich hin und hatte dann eine Idee. »Paß jetzt mal genau auf. Ich werde jetzt alles so klar machen, daß es auch der größte Dummkopf verstehen kann.«
Kydd sah ihn ärgerlich an.
»Äh, zuerst setzen wir die Segel, dann gehen wir an den Wind, und zwar über Backbordbug und dann halsen wir, bevor wir den Anker werfen und vor dem Wind wenden.«
Die Erleichterung auf Kydds Gesicht war deutlich zu sehen.
»Dann gehen wir zweimal über Stag, gegen die Sonne, und drehen einen Moment bei, lassen die Lady von unserer Ankerkette klarkommen und nehmen dann wieder Fahrt auf, diesmal über Steuerbordbug ...«
»Sollte nicht länger als eine halbe Stunde dauern«, sagte der Leutnant durch sein Handtuch und beendete seine persönliche Vorbereitung für ein Rendezvous an Land. »Die Seesoldaten lieben es, herumzumarschieren, immer wieder auf und nieder, dann peitschen sie den armen Schelm aus und gehen dann zurück in ihre Kasernen.«
»Aye, Sir«, sagte Kydd ohne größere Begeisterung. Er hatte sich bereit erklärt, den Platz des Leutnants bei einer Bestrafungsparade der Armee einzunehmen und die Achilles,als größeres Kriegsschiff im Hafen, zu repräsentieren.
»Bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Kydd. Solange sie nur bis fünf Glasen an der Alameda sind ...«
Kydd setzte einen schwarzen Hut mit einer Kokarde auf und legte das Kreuzbandolier mit der unverkennbaren Ankerschulterplatte über der weißen Weste an. Der schon ziemlich abgenutzte »Spadroon«-Degen, den er von Cockburn geliehen hatte, paßte nicht so recht in die Scheide; er war so viel länger und schmaler als ein Entermesser. Ein Blick nach unten zeigte ihm, daß seine Schuhe gut geputzt waren. Der Aufklarer in der Kadettenmesse mußte zwar etwas ermuntert werden, aber er war ein erfahrener alter Seesoldat.
Mit zwei Seesoldaten als Eskorte, die zügig vor ihm her marschierten, fand Kydd seinen Weg zur Alameda und ließ halten. Die Alameda war ein bemerkenswert großer Paradeplatz, der auch auf einer größeren Einrichtung der Armee in England nicht fehl am Platz gewesen wäre. Er war voll von marschierenden Soldaten, die per heiserer Befehle hin und her gehetzt wurden. Prächtig gekleidete Stabsfeldwebel beobachteten kritisch die Ausrichtung der Truppe und fluchten über die unseligen Seesoldaten. Der unharmonische Klang der Trompeten und das Klirren und Rasseln des Exerzierens trugen zu der Kakophonie bei. Kydd beobachtete das Ganze vom Rande der Arena und fragte sich, was er wohl tun sollte. Ein Soldat, der aussah, als habe er einen Ladestock verschluckt, mit einer Schärpe und einem hohen Tschako auf dem Kopf, löste sich aus dem Getümmel, kam heranmarschiert und erwies Kydd eine Ehrenbezeigung. Seine Augen zuckten, als Kydd höflich seinen Hut lüftete, und wanderten dann zu den Seesoldaten, die bewegungslos hinter ihm standen.
»Sah! Folgen Sie mir. Sah!«
Er machte eine abrupte Kehrtwendung und marschierte energisch über den Paradeplatz zu einer Gruppe von Männern, Kydd sah mit Erleichterung, daß auch einige in Marineuniform dabei waren.
»Und was passiert als nächstes?« fragte Kydd einen wettergegerbten Oberleutnant der Seesoldaten.
Die anderen Vertreter der Marine nickten zurückhaltend oder ignorierten ihn, je nach ihrem Rang.
Der gelangweilte Blick des Mannes streifte ihn. »Sie bringen den Gefangenen heraus, der Stadtkommandant brüllt ihn an, bindet ihn an den Schandpfahl, läßt ihm die befohlene Anzahl von Peitschenhieben geben, und dann gehen wir alle wieder nach Hause.« Dann richtete er mit einem oft praktizierten glasigen Blick die Augen wieder nach vorn.
Kydd sah den Schandpfahl vor einer genau in ihrem Blickfeld liegenden Mauer, ein nicht weiter bemerkenswerter, dicker Pfosten, hinter einer kleinen Plattform. Auf See hatte er sich an körperliche Züchtigung gewöhnt, da er die Notwendigkeit dafür einsah, ohne selbst eine bessere Lösung zu haben, wenn ihm diese Art der Bestrafung auch Bedauern verursachte. Er hoffte, daß es nicht allzu lange dauern würde.
Die Truppen hinter ihnen formierten sich zu einem offenen Viereck. Innerhalb von Minuten erschien eine kleine Kolonne von Männern von der entfernten Seite des Paradeplatzes. Sie wurden von einem Trommler mit einer gedämpften Trommel begleitet – das langsame ta-rrum, ta-rrum des »Rogue's March« durchdrang die Stille. Der Gefangene war ein hagerer Soldat mit ausdruckslosem Gesicht; er trug keinen Tschako. Die Kolonne hielt und wandte sich zum Schandpfahl. Von der entgegengesetzten Seite des Paradeplatzes kam eine kleine Gruppe, angeführt von einem kleinen Offizier mit einem roten Gesicht, der hoch aufgerichtet daherstolzierte.
»Der stellvertretende Stadtkommandant«, murmelte der Marineoffizier.
Der hitzköpfige Armeeoffizier sah sich mürrisch um, wobei er den Gefangenen ignorierte. Irritiert seine Handschuhe gegen die Seite schlagend, kam er zu den versammelten Vertretern der anderen Streitkräfte hinüber. »Schöner Tag, Gentlemen«, schnarrte er, seine harten Augen waren mitleidslos. »Freundlich von Ihnen, hierher zu kommen.« Sein Blick blieb bei Kydd hängen, und er kam heran und sagte: »Kann mich nicht erinnern, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben?« Die Straffheit seiner Haltung hatte etwas Gefährliches an sich.
»Thomas Kydd, Steuermann der Achilles,Sir.«
Die Augen musterten ihn einen Augenblick, dann, völlig unerwartet, lächelte der Mann plötzlich. »Froh, Ihr Schiff hier zu sehen, Mr. Kydd – unsichere Zeiten, wie?« Bevor Kydd noch etwas sagen konnte, war er davonstolziert.
Die Geschichte spielte sich dann so ab, wie der Oberleutnant der Seesoldaten es vorausgesagt hatte. Der stellvertretende Stadtkommandant griff die Würde des Gefangenen mit sicherlich oft praktizierter Grausamkeit an, wobei das laute Brüllen offensichtlich mehr für die übrigen Anwesenden bestimmt war. Das Verbrechen bestand darin, in trunkenem Zustand in einen Lagerraum der Armee eingebrochen zu sein. Mit verächtlicher Miene zu Seite tretend, befahl er dann dem namenlosen stämmigen Soldaten mit der Peitsche, seine Arbeit zu verrichten. Es war ein langes und mitleiderregendes Schauspiel. Die Armee hatte andere Ideen als die Marine, was die Bestrafung anlangte, und obwohl die Hiebe mit einer Peitsche ausgeteilt wurden, die leichter aussah als die neunschwänzige Katze an Bord der Schiffe, wollten die Schläge kein Ende nehmen: dreißig, vierzig und schließlich fünfzig.
Als alles vorüber war, wurden die anwesenden Offiziere mit hastigen Ehrenbezeigungen entlassen. Kydd vermied den Anblick des armseligen Opfers, das immer noch am Schandpfahl hing, und lehnte die Einladung zu einem Mittagsschnäpschen ab, da er nur so schnell wie möglich an Bord und zur Vernunft zurückkehren wollte.
»Ah, hallo alte Teerjacke! Ahoi!« Ein prächtig uniformierter Hauptfeldwebel, großgewachsen und mit vier Goldstreifen geschmückt, kam mit eiligen Schritten auf ihn zu. »Mein Junge!« brüllte der Soldat. Er kam näher und lachte breit. »Verdammt lange her!«
Soldaten, die gerade den Paradeplatz verließen, machten einen respektvollen Bogen um sie, während Kydd den Mann anstarrte und versuchte, sich an ihn zu erinnern. Dann fiel es ihm ein.
»Das ist doch Sergeant Hotham, wenn mich nicht alles trügt!« Die bösen Zeiten auf Guadeloupe standen ihm wieder lebhaft vor Augen.
»Nein, das ist er nicht mehr«, dröhnte Hotham. Die Autorität in seiner Stimme war noch immer die gleiche. »Jetzt ist es Hauptfeldwebel Hotham, mein Junge!« Seine glückliche Zufriedenheit verwandelte sich in Neugierde. »Und was bist du jetzt?«
»Tom Kydd ist jetzt Erster Steuermann!« Er streckte seine Hand aus, die der andere mit starkem Griff packte.
»Ich dachte, du wärst tot, Tom«, sagte Hotham etwas ruhiger.
»Nein, ich hab' es damals bis zu dem Fort im Westen geschafft und wurde dort von der Trajan an Bord genommen«, erläuterte Kydd.
Er zögerte, und Hotham ergriff die Gelegenheit.
»Ich würde dich gerne für einen Schluck als Gast in meiner Kaserne begrüßen. Wir können dann auch einen Blick auf die Festung werfen, wenn du Zeit hast.«
Wälle, Gräben und Bastionen, Brustwehren und Kasematten, unzählige schwere Geschützstellungen und wachsame Posten überall – Gibraltar war eine einzige mächtige Festung. Die Garnison hatte sogar ihre eigene Kaserne im Zentrum der Stadt und war durch massive Wälle und Brustwehren geschützt.
»Wir können auf dem Verpflegungswagen mitfahren, und da wirst du Augen machen!«
Hotham hielt den kleinen Karren an, der von Maultieren gezogen wurde. Sie saßen hinten auf und ließen die Beine baumeln, während der Karren langsam einen steilen Zickzackweg hinaufkletterte. Das Blickfeld weitete sich schnell: ein immenses Panorama von dunstiger Küste, staubigen Ebenen und der See. Kydd war fasziniert. Dann hielt der Karren an einem Tor, das säuberlich um ein großes Loch im Felsen geschlagen war. Hotham sprang behende vom Karren, nickte den neugierigen Posten zu und winkte Kydd herein.
Kühle, eine leichte Feuchtigkeit und der besondere Geruch von stehender Luft auf altem Gestein war zu riechen, während sie in das Innere des Felsens von Gibraltar vordrangen.
»Paß auf deine Murmel auf«, warnte Hotham, der gebückt vor Kydd ging, aber Kydd war an die niedrigen Decks eines Kriegsschiffes gewöhnt.
Der Tunnel wurde schließlich weiter, und plötzlich sahen sie zur Linken eine Galerie mit vielen separaten Kammern und in jeder ein 24-Pfünder-Geschütz, die alle durch eine Öffnung im Felsen schießen konnten. Die Galerie war vom Tageslicht erfüllt und wurde von einer netten, kleinen Brise durchzogen.
»Sie mal hier, Kamerad«, sagte Hotham und ging vorsichtig auf die Öffnung an einer Seite des ersten Geschützes zu.
Kydd starrte aus schwindelerregender Höhe von der steilen Nordwand des Felsens nach unten. Tief unter ihm lag eine flache Ebene, die vom Fuß des Felsens ausging, bis sie schließlich nach einigen Meilen im Festland verschwand.
»Spanien, Kamerad!« erklärte Hotham mit einer entsprechenden Handbewegung.
»Wo?«
Diese Geschütze hatten sicherlich eine enorme Reichweite, aber nicht bis zu den Hügeln.
Hotham grinste. »Dort!« Er deutete direkt hinunter auf die flache Ebene. Niemandsland – und nicht weiter entfernt als eine halbe Meile. So nahe: ein Feind in Waffen gegen Britannien, jederzeit bereit, über den Gegner herzufallen, wenn er die kleinste Chance erhielt. Kydd versuchte, irgendwelche Bewegungen auszumachen oder Menschen auf der feindlichen Seite der Linie, konnte jedoch zu seiner Enttäuschung nichts erkennen.
»Wir haben einhundertvierzig hiervon«, sagte Hotham und tätschelte den 24-Pfünder. »Und 32er, kleine tragbare Mörser und sogar unsere eigenen Granatwerfer. Wir haben wirklich nichts zu fürchten.«
Kydd fragte sich, wie es sein mußte, diese Steilhänge hinaufzusehen, wenn die Feuerkraft auf einen herabdonnern würde, der die Frechheit besaß, die Unüberwindlichkeit Gibraltars in Frage zu stellen!
Kydd hatte kaum die Hälfte des Weges zu seinem Schiff zurückgelegt, als er den ersten Kanonenschuß hörte, ein tiefes Rumms von irgendwo über ihm. Er warf den Kopf in den Nacken und suchte den Horizont ab, sah aber nur Pulverdampf, der im Wind verwehte. Plötzlich ertönte von unterhalb der lautere Knall eines Antwortschusses. Kydd beeilte sich, vorwärts zu kommen. Innerhalb weniger Minuten bemerkte er Zeichen von Aufregung überall, Ladenbesitzer kamen ins Freie und sahen sich nervös um, Wasserträger hielten verwirrt ihre Esel an. Ein junger Seemann erwies Kydd eine Ehrenbezeigung, als das regelmäßige Krachen einer Minutenkanone von irgendwo unten im Hafen begann. Auch an anderen Stellen des Felsens begannen Geschütze zu feuern, und das plötzliche Aufsteigen einer Rakete hatte schnell weitere im Gefolge.
Achilles!Es konnte sich eigentlich um nichts anderes handeln, als um einen dringenden, allgemeinen Rückruf der Besatzung. Kydd mußte zurück, es war Gefahr im Verzug, und seine tiefsten Instinkte betrafen sein Schiff. Am Ragged-staff-Tor