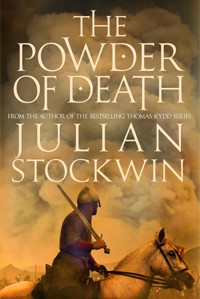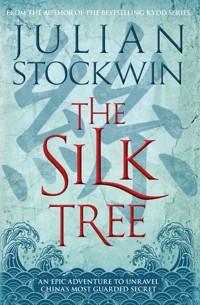5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Thomas-Kydd-Roman
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die Jagd auf den berüchtigten Piraten beginnt … Der abenteuerliche Seefahrerroman »Im Pulverdampf« von Julian Stockwin jetzt als eBook bei dotbooks. England, 1803: Thomas Kydd, Commander der Royal Navy, hat dem Frieden von Amiens nie getraut. Dann rüstet Napoleon tatsächlich erneut zum Krieg gegen England! Kydd übernimmt abermals den Befehl über die Briggsloop »Teazer«, um die Küsten Englands zu verteidigen. Doch die Gewässer vor Cornwall halten ungeahnte Gefahren bereit: Kaperschiffe, Schmuggler, feindliche Agenten, gewaltige Stürme – und den gefürchteten Piraten Bloody Jacques. Eine rasante Jagd beginnt, doch der Freibeuter scheint Kydd stets einen Schritt voraus zu sein … Wird der mutige Commander auch diese Herausforderung meistern? Ein Highlight der nautischen Romane: »Stockwin wurde zum Bestsellerautor, weil er seine Leser mitten zwischen die Männer stellt, die vor dem Mast fuhren.« Daily Express Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der marinehistorische Roman »Im Pulverdampf« von Julian Stockwin – Band 8 der Erfolgsreihe um Thomas Kydd und seinen Aufstieg vom einfachen Matrosen zum Helden der See. Ein Lesevergnügen für alle Fans von Patrick O’Brian und C. S. Forester. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Ähnliche
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Nachwort
Lesetipps
Über dieses Buch:
England, 1803: Thomas Kydd, Commander der Royal Navy, hat dem Frieden von Amiens nie getraut. Dann rüstet Napoleon tatsächlich erneut zum Krieg gegen England! Kydd übernimmt abermals den Befehl über die Briggsloop »Teazer«, um die Küsten Englands zu verteidigen. Doch die Gewässer vor Cornwall halten ungeahnte Gefahren bereit: Kaperschiffe, Schmuggler, feindliche Agenten, gewaltige Stürme – und den gefürchteten Piraten Bloody Jacques. Eine rasante Jagd beginnt, doch der Freibeuter scheint Kydd stets einen Schritt voraus zu sein … Wird der mutige Commander auch diese Herausforderung meistern?
Über den Autor:
Julian Stockwin wurde 1944 in England geboren und trat bereits mit 15 Jahren der Royal Navy bei. Nach achtjähriger Dienstzeit verließ er die Marine und machte einen Abschluss in Psychologie und Fernöstliche Studien. Anschließend lebte er in Hong Kong, wo er als Offizier in die Reserve der Royal Navy eintrat. Für seine Verdienste wurde ihm der Orden des MBE (Member of the Order of the British Empire) verliehen, bevor er im Rang eines Kapitänleutnants aus dem Dienst ausschied. Heute lebt er als Autor in Devon und arbeitet an den Fortsetzungen der erfolgreichen Thomas-Kydd-Reihe.
Julian Stockwin im Internet: julianstockwin.com/
Bei dotbooks erscheint in der Thomas-Kydd-Reihe von Julian Stockwin außerdem:
»Zur Flotte gepresst«
»Bewährungsprobe auf der Artemis«
»Verfolgung auf See«
»Auf Erfolgskurs«
»Offizier des Königs«
»Im Kielwasser Nelsons«
»Stürmisches Gefecht«
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2019
Dieses Buch erschien bereits 2009 unter dem Titel »Kydd – Im Pulverdampf« bei Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Copyright © der englischen Originalausgabe 2007 by Julian Stockwin
Die englische Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel »The Admiral's Daughter« bei Hodder & Stoughton, London.
Copyright © der deutschen Ausgabe 2009 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Gemäldes von V. Zveg und shutterstock/ANGHI
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96148-916-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Im Pulverdampf« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Julian Stockwin
Im Pulverdampf
Ein Thomas-Kydd-Roman
Aus dem Englischen von Uwe D. Minge
dotbooks.
Ihr englischen Gentlemen, die Ihr ruhig zu Hause lebt.Ach! Ihr macht Euch wenig Gedanken überdie Gefahren der See.
Martyn Parker, um 1635
Kapitel 1
Nicholas Renzi nickte dem Mann zu, der mit ihm die Wärme des Kaminfeuers in der Postkutschenstation Zum Engel teilte. Der Fremde betrachtete misstrauisch Renzis tief gebräunte Gesichtszüge, denn das war etwas, was man in England nach einem harten Winter nur selten so zu sehen bekam. Renzi war gerade erst nach aufwühlenden Ereignissen von der anderen Seite der Erde zurückgekehrt. Es waren Erlebnisse gewesen, die ihn an seinem Verstand hatten zweifeln lassen. Er war als freier Siedler nach New South Wales in Australien ausgewandert, fest entschlossen, sich dort ein neues Leben aufzubauen, aber es hatte nicht sollen sein. Und jetzt würde er in Kürze Cecilia wiedersehen ...
Das Schiff, das ihn zurückgebracht hatte, war vor drei Tagen eingelaufen. Bereits während der letzten Tage der Reise hatten er und Thomas Kydd ihre Heuerverträge gekündigt und sich an Land sogleich auf den Weg nach Guildford gemacht.
Renzi hatte seinen Freund gebeten, vorauszufahren und seine Schwester auf sein plötzliches Wiederauftauchen vorzubereiten. Das war feige von ihm gewesen, gestand sich Renzi ein. Cecilia hatte ihn während eines tödlichen Fiebers gepflegt und dabei sein Herz erobert. Aber seine Verehrung für sie war so groß gewesen, dass er sich geschworen hatte, erst draußen in der Welt etwas zu erreichen, bevor er ihr seine Gefühle offenbarte, und so war er ohne ein Abschiedswort verschwunden.
Er hatte lange und hart an dem Versuch gearbeitet, für Cecilia auf seinem kleinen Grundstück in dem rauen Land da unten ein Arkadien aufzubauen, war aber gescheitert. Schließlich hatte Kydd ihn gerettet: Er hatte vorgeschlagen, Renzi solle von seiner umfassenden Bildung Gebrauch machen und sich von einem neuen Standpunkt aus mit der Naturphilosophie beschäftigen. Während Rousseau und seine Parteigänger behaglich von ihrem elitären akademischen Katheder aus gepredigt hatten, würden Renzis Studien in der rauen Wirklichkeit der weiten Welt wurzeln, die er aus erster Hand kennen gelernt hatte, und zwar an so verschiedenartigen Orten wie der Karibik, der weiten Südsee, der Waldeinsamkeit von Wiltshire und der abweisenden Härte der Terra Australis.
Er würde seine Beobachtungen und Erfahrungen in mehrere Bände einfließen lassen, die von den Nöten des Hungers, den Aggressionen, von den Religionen und dem Bedürfnis nach Sicherheit handelten – kurz gesagt, von allen Bedrohungen und Herausforderungen, die das Los der Menschheit auf dieser Erde ausmachten ... Das war in der Tat eine Leistung, mit der er vor Cecilia treten konnte, und, das musste gesagt werden, es war eine Herausforderung, die seiner würdig war.
Den Dank dafür schuldete er Kydd, der ihm versprochen hatte, er würde seinen Freund als Sekretär an Bord eines jeden Schiffes beschäftigen, auf dem man ihn als Kapitän engagierte. Für Renzi war das ein kleiner Preis für die Freiheit, die ihm diese Tätigkeit verschaffte. Er hatte alle Tricks eines Schiffsschreibers schon vor langer Zeit in Spanish Town gelernt und wusste, dass seine Pflichten nicht übermäßig schwer sein würden. Er hatte nie viel auf die kleinen Eitelkeiten des Rangs gegeben und war froh, sich diskret aus den Pflichten und der Disziplin heraushalten zu können, die an Deck herrschten. Und außerdem konnten er und Kydd – alte Freunde, die sie waren – auf diese Weise ihre Abenteuer gemeinsam fortsetzen ...
Ein Junge brachte dem anderen Mann einen Becher mit Flip: Bier, mit Rum angereichert. Abwartend schaute der Fremde Renzi an, aber der schüttelte den Kopf und blickte weiter gedankenverloren ins Feuer. Es war schön und gut, dass er eine anständige Position für sich gefunden hatte, aber draußen in der großen Welt lauerte jetzt das Unheil: Die erst kürzlich beendeten Feindseligkeiten zwischen England und Frankreich waren mit den denkbar schlechtesten Konsequenzen beigelegt worden. Premierminister William Pitt hatte sein Amt zugunsten Henry Addingtons aufgegeben, dessen überstürzte Reaktion auf die immensen Kosten des Krieges gegen das revolutionäre Frankreich darin bestand, Englands schwer errungene Erfolge rund um den Erdball für einen Frieden um jeden Preis dreinzugeben. Und Napoleon Bonaparte, der sich fest an der Spitze der Machtpyramide in Frankreich eingerichtet hatte, raffte energisch die Mittel zusammen, die er zur Erreichung seines Hauptziels benötigte: der Weltherrschaft.
Der König hatte kürzlich dem Parlament eine beispiellose persönliche Botschaft übermittelt. In überaus eindringlichen Worten hatte er auf die Eroberungen des Ersten Konsuls seit dem Friedensschluss hingewiesen – die Besetzung der Schweiz, die Annexion von Savoyen und so weiter. Es gab kaum einen Zweifel mehr daran, dass Addingtons Beschwichtigungspolitik gescheitert war. England musste sich rüsten, um wieder in den Kampf gegen die mächtigste Kriegsmaschinerie zu ziehen, die die Welt bisher gesehen hatte.
Kydd, ein erfahrener und verdienter Marineoffizier, würde nicht lange ohne Beschäftigung an Land herumlungern müssen. In Renzi keimte plötzlich Besorgnis auf. Könnten höhere Mächte seinen Freund davon abhalten, sein Wort bezüglich ihrer Abmachung zu halten?
Er blickte auf seine Taschenuhr. Seine Gedanken waren schon bei dem bevorstehenden Treffen. Cecilias Bild war auf der langen Reise immer wieder vor seinem geistigen Auge aufgetaucht, und er hatte es stets zärtlich poliert und gehütet. Bald würde er das Original vor sich sehen. Er atmete tief durch.
***
Kydds Mutter fummelte zögerlich an dem großen Muff aus Kängurupelz herum. Das warme fuchsrote Fell hob sich angenehm vom darunter befindlichen weichen Dunkelgrau gab – aber würden andere Damen darin nicht einen minderwertigen Ersatz für einen eleganten Baummarderpelz vermuten?
»Zuzusehen, wie sie so dahinhüpfen, Mutter, ist ein überaus amüsanter Anblick! Sie hüpfen – etwa so!« Zur Verwunderung des Hausmädchens führte Kydd die beachtlich exakte Nachahmung eines Kängurusprungs vor.
»Wirst du dich wohl benehmen, Sohn«, tadelte ihn seine Mutter, aber heute konnte Kydd kaum etwas verkehrt machen. »Hast du schon mal darüber nachgedacht, mein Lieber«, fuhr sie in einem ganz anderen Ton fort, »nachdem du nun so viel erreicht hast, dass es höchste Zeit wäre, sesshaft zu werden? Eine hübsche Frau zu nehmen und mit deinen kleinen Kindern herumzutollen – ich habe ein paar hübsche Landhäuser an der Godalming Road gesehen, die in Frage kommen könnten ...« Aber ihr Sohn war nicht in der Stimmung, zuzuhören.
Die Aufregung seiner Ankunft begann ein wenig abzuflauen, als der Rest der Kuriositäten verteilt wurde, die man nach einer Reise von zehntausend Meilen von ihm erwartete. Sein Vater, der mittlerweile völlig erblindet war, befühlte die meisterliche Verarbeitung des Spazierstocks vom Kap, gefertigt aus Walrossknochen und exotischem Holz. Seiner Schwester Cecilia schenkte Kydd eine kleine Schachtel, die einen einzigen Stein enthielt. »Den hier kannst du nicht kaufen, Schwesterchen, noch nicht mal in London für tausend Guineen!«, betonte er nachdrücklich.
Cecilia untersuchte den Stein schweigend.
»Der stammt von dem am weitesten von hier entfernten Ort der Welt. Dahinter kommt nur noch unermesslich weite See bis zum Südpol – und dort ist das Ende von allem.« Er hatte den kalten blaugrauen Splitter in die Tasche gesteckt, als er mit Renzi zum letzten Mal in dem gottverlassenen Van Diemen's Land ans Ufer gegangen war.
»Das – das ist sehr hübsch«, meinte Cecilia leise. Dann aber wandte sie den Blick ab. »Du hast mir in deinem Brief etwas aus diesem fremden Land versprochen, Thomas«, sagte sie. »Ich hoffe, die Reise war für dich nicht zu ... beschwerlich.«
Kydd wusste, dass sie sich damit auf seinen Dienst als Kommandant auf dem Sträflingsschiff bezog und murmelte eine passende Antwort, aber ihr Verhalten beunruhigte ihn. Das war nicht die lebhafte Schwester, die er seit seiner Kindheit gekannt und geliebt hatte. In ihrem angespannten, bleichen Gesicht lag eine unterdrückte Trauer, die ihn beunruhigte. »Cec –!«
»Thomas, komm, lass uns die Schule anschauen. Sie läuft jetzt richtig gut«, würgte sie seine Frage ab. Sie klang spröde und nahm den Schlüssel vom Haken hinter der Tür. Ohne ein weiteres Wort verließen sie das Zimmer und überquerten den kleinen quadratischen Hof, um ein Klassenzimmer zu betreten.
Für einen kurzen Augenblick blickte sie weg von ihm und Kydds Magen krampfte sich zusammen.
»T-Thomas«, begann sie dann, hob den Kopf und schaute ihm geradewegs in die Augen. »Lieber Thomas ... Ich – ich möchte, dass du weißt, es tut mir so leid, dass ich dich enttäuscht habe ...« Sie rieb sich unruhig die Hände und senkte den Kopf. »Du hast mir vertraut, du hast mir deinen besten Freund anvertraut. Und ich habe ihn weggehen lassen, und nun ist er verschollen ...«
»Wie–was? Cec, du meinst Nicholas?«
»Lieber Bruder, was immer du sagen willst. Ich habe dich enttäuscht. Es hat keinen Sinn, das zu leugnen.« Sie verbarg ihr Gesicht in den Händen und bemühte sich, ihre Gefühle wieder unter Kontrolle zu bekommen. »Ich – ich war so müde ...«
Kydd schwankte. Er hatte geschworen, über Renzis Gefühle für seine Schwester zu schweigen und auch über die Überlegungen, die Renzi bewogen hatten, den Kontakt zu ihr abzubrechen. Sie hatten zusammen eine Geschichte vorbereitet, die Renzis Verschwinden erklären sollte: Sie würde sehr glaubwürdig klingen müssen. Er nahm die Hände seiner Schwester in die seinen und blickte lächelnd in ihr betroffenes Gesicht. »Cecilia, ich darf dir mitteilen – Nicholas lebt.«
Sie erstarrte, blickte suchend in seine Augen, und ihre Finger gruben sich schmerzhaft in seine Handflächen.
»Er ist nicht verschollen, er – er hatte sich verirrt, der zerstreute Professor und so, verstehst du.« Es schien ihm jetzt eine verdammt armselige Geschichte, und er verfluchte wieder einmal die verrückte Logik, die Cecilia den Trost eines einzigen Briefes von Renzi vorenthalten hatte.
»Er wurde, äh, lange Zeit behandelt, hat sich jetzt aber gut erholt«, endete er unbeholfen.
»Das weißt du?«
Kydd schluckte. »Ich habe von Nicholas in Deptford gehört und bin sofort zu ihm geeilt. Cec, du wirst ihn bald wiedersehen. Er ist hierher unterwegs!«
»Darf ich erfahren, wer ihn aufgenommen hat?«, fragte sie mit derselben beherrschten Stimme.
Die Sache lief nicht nach Plan. »Oh, äh, ein paar Nonnen oder so«, erwiderte er unbehaglich. »Sie sagten, dass sie keinen Dank verlangen würden. Dass sie Seelen gerettet hätten, wäre Belohnung genug.«
»Also hat er sich jetzt erholt, trotzdem war er während der ganzen Zeit nicht in der Lage, mir einen Brief zu schreiben?«
Kydd brummte undeutlich etwas, aber sie unterbrach ihn. »Er hat dir alles erzählt – er hat dir als seinem Freund vertraut –, mir aber nicht!« Ihr Gesicht verdüsterte sich. Sie richtete sich auf und trat einen Schritt zurück. »Bitte schone meine Gefühle nicht, Thomas. Wenn du ihm Diskretion geschworen hast, dann will ich deine Loyalität nicht auf die Probe stellen.«
»Cec, es ist nicht so, wie du denkst ...!«
»Glaubst du ich bin eine Närrin?«, erwiderte sie eisig. »Wenn er sich mit einer Nutte herumgetrieben hat, dann wäre es das Wenigste gewesen, mir einen höflichen Brief zukommen zu lassen.«
»Cec!«
»Nein! Ich bin stark genug! Ich kann es ertragen! Es ist nur – ich bin von Nicholas enttäuscht. So ein gemeines Verhalten, das man nur erwartet von ... von ...«
Ihre Gelassenheit bröckelte ab und Kydd war völlig durcheinander. Wem schuldete er wirklich seine Loyalität? Die Worte kamen von alleine über seine Lippen.
»Gut, dann hör die Wahrheit, Schwester, aber du wirst sie vielleicht nicht mögen.«
Jetzt gab es kein Zurück mehr. Sie richtete sich auf und wartete ab.
»Du musst verstehen, Cec, dass Nicholas kein gewöhnlicher Sterblicher ist. Er hat einen klugen Kopf, wie man ihn nur selten findet.«
»Weiter.«
»Von Zeit zu Zeit kommt er auf die seltsamsten Ideen.« Sie rührte sich nicht. »Äh, ja, sehr seltsame.« Es half nichts, sie würde alles wissen wollen. »Er – er mag dich wirklich, Schwesterchen«, versicherte Kydd. »Er hat es mir selbst gesagt: ›Ich schwöre dir an diesem Tag, dass mir Cecilia lieber ist, als ich das mit Worten ausdrücken kann.‹ Das hat er mir auf Van Diemen's Land gebeichtet.«
Sie starrte ihn an, die Augen weit aufgerissen, die Hände vor den Mund gepresst. »Er war mit dir dort? Warum hat er mir dann nicht ...?«
»Du musst ihn verstehen, Cec. Als er mit dem Fieber Barnieder lag, dachte er nach. Er dachte über dich nach. Und er hatte das Gefühl, dass es ungehörig von ihm wäre, sich dir zu offenbaren, bevor er etwas auf dieser Welt erreicht hätte, was er dir zu Füßen legen könnte und das deiner Aufmerksamkeit wert wäre. Deshalb ist er als Siedler nach New South Wales ausgewandert, denn er dachte, er könnte dort im Busch mit seinen eigenen Händen einen florierenden Gutsbetrieb aufbauen. Aber ich vermute, dass er nicht über die harten Hände verfügt, die zum Graben und Pflügen notwendig sind. So hat er sein Vermögen und sein Selbstbewusstsein beim Aufziehen der Rüben verloren.«
Kydd atmete tief durch. »Ich habe ihm eine Passage nach Hause angeboten. Zukünftig wird er mit mir zur See fahren und an seinem völkerkundlichen Buch arbeiten. Das ist alles eine Spur zu hoch für mich, aber wenn es erschienen ist, wirst du mehr von ihm hören, darauf wette ich.«
Cecilia schwankte, nur ein leichtes Zittern verriet ihre Gefühle.
Behutsam fuhr Kydd fort. »Er hat mich schwören lassen, es keiner Menschenseele zu erzählen – und es würde mir schlecht ergehen, verstehst du, Cec, wenn er das Gefühl hätte, dass ich sein Vertrauen missbraucht habe.«
»Nicholas – dieser liebe Kerl!«, hauchte sie.
»Wir haben uns die Geschichte mit den Nonnen ausgedacht, Schwesterchen, um dich zu schonen, aber ...« Seine Worte verklangen unsicher.
»Thomas! Ich verstehe euch ja! Das ist mehr, als ich jemals zu hoffen gewagt habe ...« Ein tiefer Seufzer entrang sich ihrer Brust und sie legte ihre Arme um ihn. »Lieber Bruder, du hast recht daran getan, mir alles zu erzählen. Nicholas soll sein Geheimnis vorerst für sich behalten, und wenn er sich dazu bereit fühlt, kann er mir ja ...«
***
»Oh, es ist Mister Renzi. Genau, wie du gesagt hast, Thomas!« Mrs. Kydd war sichtlich hoch erfreut über Renzis Besuch und drängte ihn ins Zimmer. Sein Blick fand Cecilias, dann schlug er schnell die Augen nieder.
»Oh, Nicholas, Sie sind so dünn«, bemerkte Cecilia neckend. »Und Ihre Hautfarbe – man möchte fast glauben, dass Sie einer von Thomas' wilden Inselbewohnern sind.« Sie eilte zu ihm hinüber und küsste ihn schnell auf beide Wangen.
Renzi stand stocksteif da, dann küsste er sie ebenfalls leicht, doch sein Gesicht blieb verschlossen. Sie trat einen Schritt zurück, aber ihr Blick blieb weiter fest auf ihn gerichtet. Freundlich erkundigte sie sich: »Ich bin den Nonnen so dankbar, die Sie gepflegt haben. Welchem Orden haben sie angehört? Ich glaube, wir sollten ihnen gebührend für die Barmherzigkeit danken, die sie unserem lieben Freund haben angedeihen lassen.«
»Oh, das wird nicht nötig sein«, entgegnete Renzi steif. »Sie können versichert sein, dass unser Dank in jeder Beziehung ausreichend war, liebe Cecilia.«
»Dann ein kleines Geschenk, eine symbolische Gabe – ich werde mit eigener Hand etwas nähen«, meinte sie hartnäckig.
Kydd hüstelte bedeutungsvoll, dann knurrte er: »Lass ihn, Cec. Erzähle uns nun deine Neuigkeiten, bitte.«
Sie warf den Kopf zurück. »Nun, da gibt es nichts, das mit euren aufregenden Abenteuern mithalten könnte.« Sie seufzte. »Nur in der vergangenen Woche ...«
»Oh, meine Liebe!«
»Was ist denn, Mama?«
»Es ist mir gerade in diesem Augenblick wieder eingefallen.« Mrs. Kydd erhob sich und ging zum Nähschränkchen hinüber. »Ich habe ihn irgendwo hier – wo habe ich ihn nur hingelegt?«
»Was denn, bitte?«
»Ach, einen Brief für Thomas. Aus London, von der Marine, glaube ich.« Sie wühlte weiter und war sich dabei gar nicht bewusst, dass Kydd sie äußerst scharf beobachtete. »Ich dachte, dass ich ihn an einem sicheren Ort aufbewahren sollte, bis – ah ja, hier ist er.«
Kydd nahm in schnell in Empfang. Nach dem Siegel mit dem Anker zu schließen, war er in der Tat von der Admiralität. Er warf einen triumphierenden Blick zu Renzi hinüber und öffnete ihn. Seine Augen verschlangen geradezu die Worte.
»Der König ... ein Regierungserlass ... Sie werden aufgefordert und angewiesen ...« Zu aufgeregt, um die Einzelheiten zu verstehen, überflog er ihn bis zum Ende, wo die zwar schnell hingeworfene aber unbestreitbar vom Ersten Lord der Admiralität stammende Unterschrift stand. Aber kein Wort von einem Schiff, von einem Kommando.
Renzi stand am Kamin und beobachtete Kydd mit einem schiefen Lächeln. »Nicholas, was hältst du davon?« Kydd reichte ihm den Brief. »Ich soll nach Plymouth kommen und nicht nach London.«
Renzi studierte ihn kühl. »Durch dieses Schreiben teilt man dir mit, dass deine Tage des süßen Nichtstuns auf Halbsold endgültig vorbei sind und du wieder ein aktiver Marineoffizier bist. Wenn ich den Unterton richtig verstehe, hat Lord St. Vincent Kenntnis von deiner Fernreise und ist nicht optimistisch, was deine prompte Verfügbarkeit zum Dienstantritt angeht. Er weist dich jedoch an, dich unverzüglich in Plymouth zu melden, wo der dortige Admiral ohne jeden Zweifel sehr erfreut sein wird, dich so einzusetzen, wie er es für angebracht hält.« Er runzelte die Stirn. »Allerdings wird hier mit keiner Silbe die Art deiner zukünftigen Verwendung erwähnt. Ich denke, dass du dich auf alles Mögliche einstellen solltest, was der Herrgott – oder der Admiral – für dich bereithält.«
»Dann sollten wir alle Segel setzen und Kurs auf Plymouth nehmen, denke ich!«, rief Kydd aus.
»Genau das«, stimmte ihm Renzi ruhig zu.
Cecilias Gesicht war ernst. »Nicholas, Sie sind noch immer erheblich indisponiert. Sie müssen nicht mit Thomas fahren.«
Mit unüberhörbarer Zärtlichkeit in der Stimme drehte sich Renzi zu ihr um. »Liebe Cecilia, aber ich werde es dennoch tun.«
***
»Herein!« Die Stimme des Admirals aus dem Inneren des Büros klang tief und befehlsgewohnt.
Kydd trat vorsichtig ein, als der Flaggleutnant ihn ankündigte: »Commander Kydd, Sir!« Dann verließ er den Raum und zog die Tür geräuschlos hinter sich zu.
Admiral Lockwood blickte von seinen Papieren auf und musterte Kydd ein paar Sekunden lang, dann erhob er sich hinter seinem Schreibtisch. Er war ein großer, beeindruckender Mann und strahlte mit seinen goldenen Streifen Macht aus. »Mister Kydd, ich habe Sie schon früher erwartet. Ist Ihnen klar, dass wir uns in Kürze mit Mister Bonaparte im Krieg befinden werden, Sir?«
»Aye, Sir«, konnte Kydd darauf nur respektvoll antworten. Es entsprach nicht dem Stil der Marine, Entschuldigungen vorzubringen, so gut sie auch sein mochten.
»Hmmm. Die Admiralität scheint eine Menge von Ihnen zu halten. Man wünscht, dass ich Ihnen so bald wie möglich ein Kommando übertrage.« Der Blick ruhte weiter auf ihm, abwägend, nachdenklich.
»Nun, ich kann Ihnen sofort ein Kommando geben ...«, Kydds Herz machte einen Sprung, »... allerdings nur bei der Bürgerwehr in der Küstenverteidigung. Die gesamte Küste von Exmouth bis zu den Needles. Achtzig Meilen, zweihundert Männer. Sofort! Was sagen Sie dazu, Sir?«
Kydd hatte nicht die geringste Lust auf eine passive Rolle an Land mit einer Truppe von begeisterten Amateuren und Fischern, die an der Küste standen und auf die Invasion der Franzosen lauerten. Er klammerte sich hartnäckig an seine Träume. »Ahem, das ist sehr großzügig von Ihnen, Sir, aber ich hatte auf ein Bordkommando gehofft, Sir.«
»Auf See!« Lockwood seufzte. »Das wollen wir alle, Mister Kydd.« Er kam hinter seinem Schreibtisch hervor und baute sich mit leicht gegrätschten Beinen vor Kydd auf, als befände er sich auf dem Achterdeck. »Dafür kommen Sie ziemlich spät. Wochenlang musste ich alle diese unbedarften jungen Burschen zufriedenstellen, und jetzt kommen Sie nicht als Leutnant, sondern als Commander und ...«
Da war sie wieder, diese absurde Situation: Als Leutnant konnte er jederzeit auf einem der vielen Kutter, bewaffneten Schoner und Briggs eingesetzt werden, aber als Commander kam für ihn nur eine Sloop in Frage. »Oh – ich habe es. Ein Kommando? Wie würden Sie es finden, wenn Sie die Brunswick, einen Vierundsiebziger, zu den Inseln über dem Winde überführen würden, he?«
Ein Zweidecker, ein Linienschiff, zu den Karibischen Inseln? Kydd war sprachlos. War das ein Witz? Dann wurde ihm klar, es gab nur eine Möglichkeit, wie er einen Vierundsiebziger kommandieren könnte, nämlich wenn das Schiff en flûte segelte: Alle Kanonen würden entfernt, um Platz für Truppen und Nachschubgüter zu schaffen; es handelte sich somit um einen besseren Frachtauftrag, der ihn aber effektiv nur vom eigentlichen Geschehen fortbringen würde. »Sir, wenn Sie es ermöglichen könnten, ich würde lieber ...«
»Ja, ja, ich weiß, was Sie gerne hätten, aber was schwimmen kann, ist zur Zeit schon vergeben. Ich nehme nicht an, dass Ihnen die Volcano, ein Brander, zusagt. Nein? Oh – den Pott hätte ich beinah vergessen. Die Eaglet! Eine nette Schiffsloop, sie liegt zur Reparatur im Dock. Im Vertrauen gesagt, ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass sich ihr jetziger Commander nach der Gerichtsverhandlung von seinem Kommando entbunden wiederfinden wird, weil er sein Schiff leichtfertig aufs Spiel gesetzt hat. Dann müssen wir einen neuen Kommandanten finden, nicht wahr?«
Kydd war klar, dass er die Geduld des Admirals lange genug strapaziert hatte. Auf jeden Fall war eine Schiffsloop eine attraktive Aussicht. »Das würde mir sehr gelegen kommen, Sir, ich darf mich bedanken ...«
»Aber auf der anderen Seite ...« Lockwood schien sich für ihn erwärmt zu haben. Er legte seine Stirn in Falten und sah Kydd jetzt direkt an. »Es ist nur anständig, wenn ich Ihnen verrate, dass die Reparaturen für die Eaglet lange dauern werden. Ich habe da noch ein Schiff in der Hinterhand – aber, um auch da wieder ehrlich zu sein, es scheint sich niemand so recht darauf zu trauen. Vielleicht liegt es daran, dass das Schiff in einigen Details ein wenig altmodisch ist, es ist ein ausländischer Bau, aus Malta, glaube ich. Nun, was ist mit Ihnen ...«
»Sir, der Name ist nicht zufällig ... Teazer?«
»Zufällig ist das tatsächlich der Fall. Kennen Sie das Schiff?«
»Sir– ich nehme es!«
Kapitel 2
Kydds Gesicht war wund vom Spritzwasser, das von dem schlechten Wetter über das Deck gepeitscht wurde und sich dem Vorwärtskommen der Teazer entgegenstemmte – jeder Fuß musste ihm abgerungen werden. Aber auf Kydds Gesicht lag ein begeistertes Lächeln, während er sich gegen die unberechenbaren Bewegungen seines Schiffes stemmte.
Es würde einige Zeit vergehen, ehe sie sicher sein konnten, dass sie bei dem rechtdrehenden Südsüdostwind frei von der Halbinsel Cotentin mit dem Hafen von Cherbourg kommen würden, aber es wäre einfacher, als auf gut Glück auf Le Havre zuzulaufen. Kydd kam es zwar, wenn er darüber nachdachte, reichlich seltsam vor, so zu navigieren, dass er direkt die feindliche Küste ansteuerte, aber er hatte die ganz klare Absicht, dort zu ankern und Kontakt mit der Küste aufzunehmen.
Vor kurzem war er diensteifrig auf sein Schiff gegangen und hatte alles darangesetzt, es seeklar zu machen. Dann waren mitten in den Arbeiten dringende Befehle aus dem Büro des Admirals an Bord gebracht worden: Es war die Absicht Seiner Majestät, auf die wiederholten Provokationen von Napoleon Bonaparte zu antworten, indem man augenblicklich »umfassende Vergeltungsmaßnahmen gegen die Schiffe, Güter und Untertanen der Französischen Republik ergriff«. Das würde das Ende eines brüchigen Friedens bedeuten.
England plante, sich dadurch einen Vorteil gegenüber Napoleon zu sichern, indem es zuerst den Krieg erklärte. Alle Schiffe, die genauso wie die Teazer entbehrt werden konnten, wurden eilig an die Nordküste Frankreichs geschickt, um fliehende britische Staatsbürger, die das Land verlassen wollten, aufzunehmen, bevor die Tore auf dem Kontinent zugeschlagen wurden.
Die Teazer war innerhalb einer Stundenfrist in See gegangen, sie war gefährlich unterbemannt und hatte nur wenig Verpflegung an Bord, war knapp an Karten und navigatorischen Hilfsmitteln und verfügte weder über Kanonen noch Pulver. Im Rennen gegen die Zeit hatte sie ihren Bootsmann, den Segelmeister und auch noch weitere Besatzungsmitglieder zurücklassen müssen, einschließlich Renzi, der an Land gewesen war, um sich irgendein geheimnisvolles Buch zu besorgen.
Immerhin war Kydd mit seinem eigenen Schiff auf See, das war wunderbar genug – und es war die Teazer und es ging in den Krieg. Was konnte er mehr vom Leben erwarten?
Ihm wurde warm ums Herz, als er an den Empfang dachte, den ihm die Deckoffiziere bereitet hatten, die dem Schiff treu geblieben waren, während er auf großer Fahrt gewesen war: Purchet, der Bootsmann, Duckitt, der Stückmeister, Hurst, der Zimmermann. Und, in einer Zeit, in der die Presskommandos so hart zuschlugen wie seit Jahren nicht mehr, war auch der unbeirrbare Quartermaster Poulden an der Pier erschienen, und ein paar Stunden später folgte ihm die unverwechselbare, massige Gestalt von Tobias Stirk, der von einem anderen, jüngeren Seemann begleitet wurde.
»Wir dachten, die Teazer könnte uns gebrauchen, Mister Kydd«, hatte Stirk mit verschmitztem Lächeln gesagt und den jungen Mann nach vorne geschoben. »Und falls Sie auf diesem Schiffchen einen guten Toppsgast gebrauchen können, der reffen und steuern kann ...?«
Kydd hatte etwas Unverständliches gebrummt und den jungen Mann scharf gemustert. Er war Anfang zwanzig und hatte den Körperbau und den klaren, offenen Blick eines Blauwassermatrosen. Natürlich würde er ihn nehmen – aber warum grinste der Mann unablässig von einem Ohr bis zum anderen? Dann ging ihm ein Licht auf. »Ah! Sehe ich hier vielleicht den jungen Luke vor mir?« Der einstige Schiffsjunge von früheren Fahrten in der Karibik war kaum wiederzuerkennen und stand nun vor ihm als Vollmatrose Luke Calloway.
Aber da Stirk und Calloway vertrauenswürdige Männer waren, hatte ihnen Kydd Landgang gewährt, und sie hatten sich irgendwo auf der Werft befunden, als die Teazer ausgelaufen war.
»Sir!« Der einzige zusätzliche Offizier der Teazer, Kydds Erster Leutnant Hodgson, deutete achteraus. Kydd drehte sich in seinem tropfenden Ölzeug herum und sah die dunklen Umrisse von Fregatten auf Erkundungsfahrt über dem dunstigen grauen Horizont auftauchen, hinter ihnen zogen große Schiffe, eins nach dem anderen, in die Ferne.
Er hielt den Atem an: Das war Cornwallis und die Kanalflotte – Linienschiffe, die auf dem Weg waren, den Hafen Brest durch Blockade in einen Würgegriff zu nehmen und dadurch Napoleon den Vorteil aus der Hand zu schlagen, seine großen Kriegsschiffe bei Ausbruch der Feindseligkeiten schon auf See zu haben. Die grauen Silhouetten wurden schärfer, und die stattlichen Vierundsiebziger passierten sie einer nach dem anderen. Sie hatten nur zwei Reffs in die Bramsegel gesteckt. Die Teazer dagegen hatte alles gerefft, was möglich war. Die Schlachtschiffe verschmähten es, die kleine Briggsloop zur Kenntnis zu nehmen.
Der großartige Anblick verschwand hinter ihrem Heck langsam nach Lee. Kydd spürte etwas von der großen Verantwortung, die diese Schiffe hatten, von dem Pflichtgefühl, das sie bei schlechtem Wetter draußen auf See halten würde, bis der Krieg entweder gewonnen oder verloren war.
»Wir haben genug Luv gemacht, glaube ich«, rief Kydd Hodgson zu. »Klar zur Wende!« Es war jetzt an der Zeit, Start Point für die mühselige Kreuz nach Osten zu runden.
Kydd war dankbar dafür, dass eine Brigg in der Wende einfacher zu handhaben war als jedes Vollschiff, aber er musste das Beste aus der Situation machen, die durch ihr überstürztes Auslaufen entstanden war. »Mister Hodgson, Sie geben den Bootsmann und ich werde den Part des Segelmeisters übernehmen.« Neben der Abwesenheit dieser beiden wichtigen Deckoffiziere war aber für ein schnelles Manöver auch die restliche Besatzung noch zu unerfahren und zu klein.
Trotzdem wendeten sie problemlos und begannen, das Schiff den Kanal aufwärts zu jagen. Da an Wind kein Mangel herrschte, würden sie am nächsten Tag in der Morgendämmerung auf einer Position seewärts vor Le Havre stehen. Dennoch war Kydd mulmig zu Mute, denn ihm war bewusst, dass er fast seine gesamte Dienstzeit bei der Marine auf Gewässern in Übersee zugebracht hatte. Die stürmischen und oft grimmigen Bedingungen des Segelns im Bereich der heimatlichen Britischen Inseln waren ihm unbekannt. Der nächste Morgen würde sein seemännisches Geschick bis zum Äußersten fordern, denn außer einer privaten Karte von Havre de Grâce in einem viel zu kleinen Maßstab, die überdies schon vierzig Jahre alt war, stand ihm für die Ansteuerung nichts zur Verfügung. Sie war von Jeffreys herausgegeben worden und bot kaum ausreichende Details, die sie vor wandernden Sandbänken im Mündungsgebiet warnten.
***
Der Anbruch des Tages brachte Erleichterung, aber auch Sorgen mit sich. Sie standen zwar vor der französischen Küste, aber wo? Kleine Fahrzeuge segelten vorbei; es war ihre letzte Reise, auf der sie von Plünderern unbehelligt bleiben würden. Sie gönnten der Brigg unter kleinen Segeln vor der Küste keine Aufmerksamkeit. Kydd hatte darauf geachtet, dass keine Flagge gesetzt wurde, um die Franzosen nicht unnötig zu provozieren, und vermutete, dass, falls eines der Schiffe um ihn herum ein englisches war, es genauso verfahren würde.
Er richtete sein Glas aus und sah runde, dunkle Hügel und hier und dort ein Stück Steilküste, die Küstenlinie knickte scharf weg. Den Bleistiftnotizen auf der alten Karte entnahm er, dass das auf das Gebiet südlich von Le Havre zutraf, und dementsprechend änderte die Teazer ihren Kurs nach Norden. Nach wenigen Stunden würden sie vor ihrem Ziel stehen.
Seine Befehle waren kurz und klar. Er sollte so nahe an Honfleur an der Seinemündung herangehen, wie das mit der Sicherheit seines Schiffes vereinbar war. Dann sollte er ein Boot ans Ufer schicken, um Kontakt mit einem Agenten aufzunehmen, dessen Namen ihm nicht mitgeteilt worden war, dessen Losungswort und die entsprechende Antwort darauf standen jedoch fest. Das alles verlangte äußerste Vorsicht; er würde Männer mit dem Handlot in den Rüsteisen benötigen, wenn sie den zehn Meilen breiten Irrgarten aus Fahrrinnen und Sandbänken des Mündungsgebiets befuhren.
Langsam näherten sie sich dem Land, der Wind ließ jetzt nach und kam deutlich weiter aus Westen. Dann machte Kydd plötzlich ein deutliches Zurückweichen der Küstenlinie aus – das war das Zeichen, auf das er gewartet hatte, der Punkt, wo der große Fluss auf die See traf, die Mündung der Seine. Paris, das Zentrum des Sturms, der die Welt in einen alles entscheidenden Krieg hineinzog, lag nur etwa einhundert Meilen südöstlich im Landesinneren.
Auf den Vorrüsten begann der Lotgast mit dem endlosen Aussingen der Wassertiefe in Faden unter ihnen: Die Baie de Seine war eine tückische Gegend voller sandiger Untiefen und anderen Gefahren, die sie in ein zerschmettertes Wrack verwandeln konnten, aber das war nicht Kydds größte Sorge. Während die Teazer geschäftig ihren Kurs in die sich verengenden Gewässer verfolgte, fragte er sich: Wer garantierte ihm, dass der Frieden nicht während ihrer Überfahrt zu Ende gegangen war, dass nicht hinter der trägen Stille der schwach sichtbaren Befestigungen Soldaten ihre Kanonen in Stellung brachten und nur darauf warteten, dass die kleine Brigg vorüberglitt?
Die felsigen Höhen des Kap de la Hève erhoben sich über dem nördlichen Ufer der Mündung. Seine in der Karte eingezeichnete Position befand sich ganz in der Nähe des Forts de Saint-Adresse, das behäbig auf dem Plateau eines eigenen Höhenzugs lag, aber ihre Annäherung rief keine plötzlichen kriegerischen Aktivitäten hervor. Die dicht gedrängten Häuser und die Ausläufer der Bebauung einer großen Stadt an seinem Fuß kennzeichneten den Haupthafen von Havre de Grâce. Ihre Aufgabe aber war es, weiterzusegeln, sich vor das alte Dorf Honfleur am gegenüberliegenden Ufer an den Anker zu legen und dann von dort Kontakt mit der Küste aufzunehmen.
Unruhig, mit schwitzenden Händen manövrierte Kydd das Schiff hinein. Seine Karte konnte ihm über die Gefahr der Gambe d'Amfard keine Auskunft geben; dabei handelte es sich um eine meilenlange Untiefe mit vielen Ausläufern, die bei Niedrigwasser zu einer Bank aus hartem Sand abtrocknete und quer vor der Einfahrt lag. Er blickte über die Seite. Die trüben Fluten der Seine gurgelten vorbei, düster und undurchsichtig.
Er richtete sich gerade auf und stellte fest, dass Hodgson ihn ernst ansah. Die anderen Männer an Deck waren still und beobachteten ihn. Falls das Unternehmen mit einem Fehlschlag endete, dann trug kein anderer die Schuld daran als der Kommandant allein.
Kydd begann, nach den kleinen Störungen und Wirbeln im Wellenbild zu suchen, die sich von ihren benachbarten Wellen unterschieden und auf flaches Wasser hinwiesen. Ein tief abgeladener Frachter suchte sich seinen Weg flussaufwärts, und Kydd setzte sich hinter ihn, um ihm zu folgen; dabei notierte er sich sorgfältig den Kurs. Eine vorbeifahrende, halbgedeckte Schaluppe passierte sie dicht am Heck und der Mann an der Pinne rief ihnen etwas Unverständliches zu, aber sein freundliches Winken beruhigte Kydd, während sie die Batterien an den Ausläufern der Mündung hinter sich ließen.
Honfleur lag fünf Meilen innerhalb der Mündung; es bestand aus einer trostlosen Ansammlung von Gebäuden um eine Landmarke. Kydd zog schnuppernd den Wind ein: Er wehte immer noch nicht stetig; er drehte weiter rechts, aber falls er zu weit nach Westen drehte, dann waren sie in der Enge gefangen, wenn nicht gar Schlimmeres. »Stand by vorne!«, rief er scharf.
Er drehte sich zu dem gefasst blickenden Hodgson um. »Nehmen Sie die Jolle und vier Männer. Irgend so ein Typ von einem Agent wird irgendwo in der Stadt auf Sie warten.« Er beugte sich näher heran, außerhalb der Hörweite der anderen Seeleute, und flüsterte: »Die Losung ist › peur ‹, und die Antwort lautet › dégoût ‹, Mister Hodgson.«
»S – Sir? Purr and day-goo?«, fragte der Leutnant unsicher nach.
»Das bedeutet ›Angst‹ und ›Abscheu‹ auf Französisch«, erklärte ihm Kydd ungeduldig.
»Ah, ich verstehe, Sir. Angst und Abscheu – jawohl, Sir.«
»Peur und dégoût, wenn ich bitten dürfte!«
»Purr und day-goo. Aye, aye, Sir.«
Kydd unterdrückte seine Gereiztheit. Es war noch gar nicht so lange her, als er selbst ebenso schlecht Französisch gesprochen hatte, und wenn der Agent klug war, dann würde er den unkultivierten Engländern Zugeständnisse bei der Aussprache machen.
»Und, Sir«, Hodgson hielt sich mit erbarmungswürdigem Ernst aufrecht. »Vielleicht wäre es besser, wenn ich während des Landgangs in Zivil unterwegs wäre?«
Kydd zögerte. »Äh, das glaube ich nicht. Wie soll Sie der Agent dann als Marineoffiziere erkennen?« Er behielt die Bemerkung für sich, dass man Hodgson in Uniform wohl kaum für einen Spion halten würde.
Es war beunruhigend für ihn, jemand anderem zu befehlen, sich in Gefahr zu begeben, besonders dem harmlosen und wohlmeinenden Hodgson, der ihm vor Dankbarkeit, dass er an Bord sein durfte, beinahe die Stiefel geküsst hatte – Hodgson hatte die letzten fünf Jahre an Land gelegen –, aber es gab keinen anderen, den er aussenden konnte. »Schicken Sie das Boot mit dem Agenten an Bord wieder heraus. Wir halten die anderen Boote in Bereitschaft, um die Flüchtlinge abzuholen, so wie Sie sie einteilen.« Kydd blieb zurück, während Hodgson nach Freiwilligen rief. Es gab keine. Auf der Teazer musste sich erst noch diese festgefügte gegenseitige Abhängigkeit innerhalb der Mannschaft entwickeln, die im Gefecht entstand. Hier und jetzt konnte auch der Dümmste die Gefahr vorhersehen, in die sie sich begeben sollten. Kydd rief die einzigen Namen auf, an die er sich erinnern konnte. »Harmann und Joseph«, dann deutete er auf zwei Männer in seiner Nähe, »und ihr beide.« Später würden sich die anderen schon finden, die die übrigen Boote bemannen würden.
Wegen der unbekannten Tidenverhältnisse fiel der Anker bereits eine Viertel Meile vor der Küste, und die Teazer drehte sofort mit dem Bug in Richtung flussaufwärts, was einen beunruhigenden Schluss auf die Stärke des Stroms zuließ. »Sie können jetzt ablegen, Mister Hodgson«, meinte Kydd aufmunternd. »Ein rotes Tuch am Großmast ist Ihr Rückrufsignal.«
Das kleine Boot legte sich fröhlich unter seinem einzigen Sprietsegel auf die Seite und hüpfte in Spritzwasserwolken gehüllt über die lebhaften Wellen. Dann verschwand es hinter dem Kap, um in den kleinen Hafen auf der anderen Seite einzulaufen. Kydd blieb mit einer Flut schlimmer Befürchtungen zurück, jetzt, da sich der Zeitdruck und die Aufregung in drohende Gefahr und lastende Sorge verwandelt hatten.
Es schien eine Ewigkeit, bevor die Jolle wieder in Sicht kam. Auf dem belebten Fluss schenkte noch immer niemand der ankernden Brigg ohne Flagge große Aufmerksamkeit. Das Boot schob sich auf engstem Raum zwischen den anderen Fahrzeugen hindurch. Hodgson befand sich nicht an Bord, aber ein Mann mit dunklem Teint und einem angespannten Gesichtsausdruck, der schnell an Bord sprang und auf Kydd zueilte.
»M'sieur le capitaine?«, fragte er mit gedämpfter, nervöser Stimme. »Nous devons nous déplacer rapidement!« Dann rief er, sich hastig umblickend, aus: »C'est guerre! Le tyran a choisi de se dèplacer contre l'Angleterre!«
Kydd lief es kalt den Rücken herunter, und der Agent fuhr mit seinem Bericht fort. Napoleon hatte plötzlich selbst den Krieg erklärt, und zwar unter dem Vorwand, Britannien hätte Malta nicht gemäß des Abkommens von 1801 abgetreten. Die Neuigkeit war bis jetzt noch nicht öffentlich bekannt, aber Depeschen wurden zur Zeit überall in Frankreich versandt – das Schlimmste aber war, dass der Erste Konsul im Widerspruch zu den Gepflogenheiten des Kriegsrechts und der Menschlichkeit die sofortige Verhaftung jedes britischen Bürgers, einschließlich aller Zivilisten, auf französischem Boden befohlen hatte.
Es konnte Tage dauern oder in der nächsten Minute passieren, dass die Befehle eintrafen, und wenn die Identität der unbekannten Brigg vor Honfleur bekannt würde, so würden die Kanonen das Feuer eröffnen. Sie befanden sich innerhalb des Rings aus Festungen und in voller Sicht: Es war Zeit zu verschwinden. Aber an Land warteten verzweifelte Menschen, die nach einer wahnsinnigen Hetzjagd die Küste erreicht hatten. Ihre einzige Hoffnung war die Teazer. Kydd konnte nicht einfach fortsegeln.
»Alle Boote zu Wasser. Wir überlassen Boney unsere Flüchtlinge nicht«, rief er und blickte seine Seeleute herausfordernd an. »Wollt ihr, dass die Ladies von französischen Soldaten genommen und die Gentlemen ins Zuchthaus geworfen werden?« Ein unbehagliches Grummeln wurde laut, aber die Seeleute kamen nach vorne.
»Gut gemacht, Söhne Neptuns«, lobte Kydd sie herzlich. »Heute Abend werden euch viele Glückliche segnen.«
***
Das erste Boot kehrte zurück. Der Anblick der dicht zusammengedrängten Masse der verzweifelten, vom Wind gepeitschten Kreaturen erweckte tiefes Mitgefühl bei den an Bord Verbliebenen, als sie ihnen über die Seite halfen. Kydd wollte keine Zeit mit höflichen Vorstellungszeremonien verschwenden und wartete abseits.
Poulden kümmerte sich mannhaft um eine hysterisch schluchzende Frau, während der Stückmeister geduldig die Tirade eines geckenhaften jungen Kerls über sich ergehen ließ. Ein aufgeregtes Stimmengewirr ersetzte die disziplinierte Ruhe auf der Teazer, bis die ersten Passagiere nach unten gescheucht wurden, weil sich der Kutter mit den nächsten Ankömmlingen näherte. Immer mehr Flüchtlinge kamen an, einschließlich einer tränenüberströmten Frau, die von ihrem Mann getrennt worden war, und einem älteren Mann mit einer gefassten Haltung, der sich aufmerksam umblickte, als er an Bord kam.
Wie viel Zeit würde ihnen noch bleiben? Ein gedämpfter Knall grollte bedrohlich über das Mündungsgebiet und wurde fast umgehend von der Batterie weiter flussaufwärts beantwortet. Der erschreckten Ruhe, die das Stimmengewirr an Deck unterbrach, folgten aufgeregte Spekulationen, dann Erschrecken, als ein weiterer Abschuss zu hören war. Dieses Mal konnte man die Kugel sehen, und der fernen Fontäne ihrer ersten Berührung mit der Wasseroberfläche folgten zunehmend kleinere, die in einer Reihe auf das Schiff zuliefen.
»Den Signalwimpel setzen!«, befahl Kydd. Es gab keinen Zweifel mehr an den Absichten der Franzosen. Die alles entscheidende Nachricht war ganz offensichtlich angekommen und die Besatzungen der Forts wussten jetzt offensichtlich auch über die Herkunft der Teazer Bescheid. »Verdammt sollt ihr sein!«, fauchte er hitzig. »Wenn ihr zumindest so freundlich wärt, die Kriegsflagge zu setzen!« Sie würden unter ihrer Flagge auslaufen. »Klar zum Hieven des Ankers und zum Setzen der Segel!« Es gab viele Anhaltspunkte darauf, dass die Situation aus dem Ruder laufen konnte, denn es waren noch viel zu viele seiner Männer mit den Booten draußen, trotzdem brauchte er Männer, um den Anker hochzuholen und die Segel zu lösen.
»Ruhe an Deck!«, brüllte er der durcheinanderrennenden Menge zu, als weitere Bootsladungen verängstigter Menschen in aller Eile längsseits kamen.
Wo blieb nur die verdammte Jolle? Hatte Hodgson Schwierigkeiten, sich von den anderen verzweifelten Flüchtlingen zu lösen, die sich ganz ohne Zweifel versammelt hatten? Er scheute davor zurück, sich an eine frühere missliche Lage auf Guadeloupe zu erinnern, sondern versuchte sich auf die Gegenwart zu konzentrieren. Wieder ein Abschuss, dann ein zweiter – das waren Kanonenschüsse, die den Abstand bestimmen sollten. Distanzen über der See waren für die Kanoniere an Land schwer einzuschätzen, aber früher oder später würden sie die richtige Entfernung herausfinden und die gesamte Batterie würde das Feuer auf sie eröffnen.
Er brauchte Zeit zum Nachdenken: Die meisten Schießscharten der Festungen blickten in die falsche Richtung. Sie waren in diesem Stadium keine ernsthafte Bedrohung, aber das bedeute keineswegs, dass die Teazer in Sicherheit war. Jedes Kriegsschiff, auf dem man das Feuer hörte, würde herankommen, um den Grund dafür herauszufinden, und ihrer Flucht vorzeitig ein Ende bereiten.
Eine Kugel prallte auf das Wasser und rikoschettierte mehrfach. Ihre Bahn lag nicht mehr als hundert Yards entfernt und diejenigen, die noch nie unter Feuer gestanden hatten, schrien angstvoll auf. Kydd wusste, dass sie hier verschwinden mussten – aber sollte er nicht noch auf Hodgson warten? Irgendjemand zu ihm schicken? Es war immer noch kein Anzeichen der Jolle zu entdecken, aber wenn er jetzt in See ging, dann verurteilte er sowohl den Offizier als auch die vier Seeleute, die sich bei ihm befanden, zur Gefangenschaft – oder Schlimmerem. Konnte er sein Gewissen mit dieser Bürde belasten?
In einem inneren Kampf zwischen Mitgefühl und Pflicht traf er die schwere Entscheidung, abzufahren.
Er hob sein Gesicht, um wieder in den Wind zu schnüffeln; davon würde es abhängen, wie er die Teazer auf den Weg und hinaus auf die offene See bringen würde. Doch dann wurde ihm plötzlich siedend heiß klar, während er sich den Kopf über andere Dinge zerbrochen hatte, war der Wind nach Westen gedreht und abgeflaut– der Bereich, in dem ein Rahsegler manövrieren konnte, wurde schmal. Ihr Kurs, auf dem sie eingelaufen waren, war ihnen bereits versperrt. Weiter im Mittelfahrwasser und hoch am Wind mit Backbordhalsen war der einzige noch mögliche Kurs – und verflucht mochten die Sandbänke bei halbem Wasser sein.
Er schickte einen Mann nach vorne, der das Ankerkabel mit einer Axt durchhauen sollte, die anderen Matrosen lösten die Segel am Vormast. Vom Strom erfasst und daher mit dem Bug stromaufwärts zeigend, nahm die Teazer sofort gute Fahrt über den Achtersteven auf. Unter dem Druck aller Segel vorne, dem nackten Großmast und dem entgegengesetzt gelegten Ruder drehte sie sauber herum, bis sie die Lose aus den Vorsegeln holen und sie auf einen Kurs am Wind dichtholen konnten. Sie liefen in Richtung See.
Eine kleine Welle bildete sich am Vorsteven; sie machte Fahrt, vielleicht zwei oder drei Knoten, und zusammen mit dem Strom des großen Flusses ergab das eine zunehmend respektable Geschwindigkeit. Sie hatten eine Chance. Kydd stellte sein Fernglas auf die Festungswerke ein. Sie schienen von der eleganten Pirouette der Teazer auf dem falschen Fuß erwischt worden zu sein und schwiegen, aber die Strafe für die Benutzung des Mittelfahrwassers war, dass sie in das Schussfeld der näher liegenden Kanonen von Villerville einliefen–und die Entfernung für die auf dem gegenüberliegenden Ufer befindlichen Batterien verkleinerten.
Es würde knapp werden. Kydd zuckte bei dem Gedanken an Hodgson und seine vier Seeleute zurück, die hoffnungslos zusehen mussten, wie sie ausliefen. Aber er hatte sich jetzt auf die See voraus zu konzentrieren, um gefährliche Querströmungen zu erkennen, und versuchte dabei, das erneute Geschützfeuer zu ignorieren. Die Einschläge der meisten Kugeln waren nicht sichtbar, aber einige lagen dicht genug, um einen erneuten Chor spitzer Entsetzensschreie auszulösen. Er brüllte Befehle, die alle Passagiere unter Deck verbannten. Dort würden sie zwar keinen echten Schutz genießen, aber zumindest wären sie aus der Schusslinie der Geschütze – und des Kommandanten der Teazer.
Poulden nahm sich mehrere Matrosen und trieb die Passagiere den Niedergang zum Hauptladeraum hinunter. Dunkle Schatten auf der See an Backbord zwangen Kydd dazu, den Kurs nach Lee zu ändern, um die unbekannte Gefahr zu umfahren. Plötzlich ertönte ein Trommelfeuer von Abschüssen an Land. Dort verlor man die Geduld mit der kleinen Brigg, die sich offensichtlich den Weg in die Freiheit suchte. Aber würden die Artillerieoffiziere dieser abgelegenen Küstenbatterie erfahren genug sein, das Ziel mit tödlicher Sicherheit aufzufassen?
Weitere drohende Störungen des Wellenbildes tauchten voraus auf. Die Teazer fiel ein paar Strich weiter nach Lee ab. Immer mehr Kanonen feuerten.
Die letzten Zivilisten wurden hastig nach unten gescheucht, und dabei sah Kydd, unwirklich verlangsamt wie in einem Alptraum, eine gut gekleidete Lady den Tampen an der Luke des Niedergangs packen, doch dann verschwand ihr Arm plötzlich. Sie starrte verwirrt auf den Stumpf. Dann kam das Blut – es schoss über ihr Kleid und den Niedergang hinunter. Sie brach auf dem Deck zusammen.
Chaos brach aus. Einige versuchten, sich gewaltsam den Weg den Niedergang hinunter zu erzwingen, während andere dem Wahnsinn unter Deck zu entkommen suchten. Der Dandy riss sich los und bestürmte Kydd, zu kapitulieren. Der Mann mit den ausgeprägten Gesichtszügen knurrte den Kerl an. Es mochte ein Zufallstreffer gewesen sein, aber wer waren diese Typen, um das erkennen zu können?, überlegte Kydd grimmig.
Andere versammelten sich zu einem unaufhörlichen Buhlen um seine Aufmerksamkeit und seine Konzentration schmolz dahin. Mit einem misstönenden Rums lief die Teazer auf Grund und kam zum Stillstand. Die Segel wurden sofort aufgegeit, aber mit einem schlechten Gefühl in der Magengegend wusste Kydd, dass ihm jetzt nur noch wenige Alternativen blieben.
Soweit er das beurteilen konnte, waren sie an der südlichen Ecke der Gambe d'Amfard-Bank aufgelaufen. Die kritische Frage war, wie war die Höhe der Gezeit. Würden sie mit der Flut aufschwimmen oder bei Ebbe hoch und trocken festsitzen?
Er blickte sich hilflos um. Buchstäblich jedes Fahrzeug in der Mündung war mit dem Krachen der Kanonen verschwunden, das letzte machte sich gerade flussaufwärts davon, als er sich umschaute. Die Batterie feuerte rumpelnd eine weitere Salve, und er spürte zumindest den Luftzug einer der Kugeln. Jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit, bis die ersten Kugeln einschlagen würden. War da überhaupt noch irgendetwas zu machen? Und hatte er das Recht, das Leben von Zivilisten aufs Spiel zu setzen, um ein Kriegsschiff zu retten? Reichten seine Pflichten für sein Land so weit? Wenn doch nur Renzi an seiner Seite gewesen wäre – aber er war ganz auf sich allein gestellt.
»Zu mir! Alle Besatzungsmitglieder sofort zu mir, hört ihr?«, röhrte er und übertönte das Gekreische. Verängstigt kamen ein paar Seeleute herangerannt, wahrscheinlich erwarteten sie den Befehl, das Schiff zu verlassen.
Kydd bemerkte, dass sich der Mann mit den ausgeprägten Gesichtszügen zu ihm gesellt hatte. »Kapitän zur See Massey«, stellte er sich einfach vor. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
Nach einer Pause von wenigen Augenblicken, erwiderte Kydd: »Das ist verdammt anständig von Ihnen, Sir. Ich habe meinen einzigen Leutnant verloren, wenn Sie also ...« Es war eine atemberaubende Frechheit, aber im nächsten Moment hatte HMS Teazer einen Vollkapitän als neuen diensttuenden Leutnant, und als Zeichen dessen übergab ihm Kydd seinen eigenen Dreispitz als Zeichen seiner Autorität. Zusammen wandten sie sich an die Seeleute, Kydd gab seine Befehle, die nur er auf Grund seiner außerordentlichen Vertrautheit mit der Teazer geben konnte und die ihnen die einzige Chance boten, zur offenen See durchzubrechen.
Unter anderen Umständen hätte die normale Prozedur darin bestanden, das Schiff zu leichtern, die Geschütze über die Kante zu werfen und das Trinkwasser auszupumpen, also alles, was ihren Tiefgang verringerte, sogar wenn es nur wenige Zoll ausmachen würde. Aber die Teazer hatte ihre Kanonen und ihre Ausrüstung noch gar nicht an Bord genommen, sie war so leicht, wie sie nur sein konnte. Der nächste Schachzug wäre dann gewesen, einen Warpanker auszubringen, um sich an ihm in tieferes Wasser zu verholen, aber er verfügte weder über die notwendigen Männer noch die Zeit dafür.
Und die Zeit war der kritische Punkt. Wie um diesen zu unterstreichen, erklang ein dumpfes Donnern über das Wasser, und Sekunden später sausten – diesmal näher – die Kugeln vorbei. »Langrohrgeschütze«, knurrte Massey; er kniff die Augen zusammen, um die fernen Forts besser auszumachen. Mit dem nachlassenden Wind war eine fahle Sonne erschienen und glitzerte auf dem Wasser.
Aber das i-Tüpfelchen auf ihrer schwierigen Lage war, dass der Wind sie so auf die Sandbank gedrückt hatte, dass sie keinen entgegengesetzten Kurs anliegen konnten – sie konnten nicht gegen den Wind segeln. Und Kydd hatte die bedrohliche Annäherung von ein paar kleinen Fahrzeugen aus dem Hafen von Le Havre bemerkt. Es konnte sich bei ihnen nur um eins handeln – um Kanonenboote zur Küstenverteidigung. Ein Schiff von der Größe der Teazer hatte eigentlich keinen Grund, sich vor ihnen zu fürchten, aber ohne Kanonen und hoch und trocken auf Schiet ...
Was Kydd im Sinn hatte, war im Mittelmeer allgemein üblich, aber würde es auch hier klappen?
Von unten kamen die Matrosen mit den Riemen an Deck geeilt. Es handelte sich um besondere Riemen, die volle dreißig Fuß lang waren. Sie verfügten über einen kantigen Schaft und ein an den Enden mit Kupfer beschlagenes Blatt. Gleichzeitig wurden die Ruderluken – neun winzige quadratische Öffnungen auf jeder Seite der Verschanzungen, die sonst unauffällig mit Schilden verschlossen waren – klargemacht. Die Riemen würden vom Deck aus bedient werden, und mit ihrer großen Hebelwirkung würde man versuchen, die Teazer wieder von der Sandbank wegzudrücken.
»Das Deck räumen!«, brüllte Kydd der Menge zu, die sich noch immer voller Angst hin und her drängte. Durch den allgemeinen Lärm rief er Massey zu: »Wenn Sie die Backbordseite übernehmen würden, Sir ...« Dann bellte er: »Alle Männer an die Riemen! Ja, Sir, auch Sie!«, fauchte er den Dandy an, der verwirrt an seinen Platz gezogen wurde. Drei Ruderer waren an jedem Riemen, jeweils ein erfahrener Seemann am weitesten Binnenbords, die anderen beiden irgendwelche Männer, die einen Riemen festhalten konnten.
»Hol weg – und du da!«, rief Kydd einem verängstigten Jungen zu, »lauf in die Kombüse und hol den größten Topf, den du finden kannst, und eine Kelle, ab dafür!«
Kydd, der selbst an einem Riemen stand, trieb sie an. Die unhandlichen Riemen kamen mit einer langsamen Schlagzahl in dem widerspenstigen Gewässer in einen gewissen Rhythmus. Dann schien mit einem schleifenden Geräusch unten am Grund das Wunder zu geschehen, die Brigg schien in ihr angestammtes Element zurückzugleiten – mit dem Bug genau im Wind.
Unter der misstönenden Begleitmusik des Kanonendonners und dem dringlichen Ting-ting-ting des Kombüsentopfes, rutschte Seiner Majestät Briggsloop Teazer von der Sandbank in das offene Wasser und nahm Fahrt über das Heck auf. Die Riemen wurden eingeholt. Die spielerische Brise war günstig und die Teazer drehte, um den Wind von der Seite zu nehmen. Mit hart angebrassten Segeln machte sie sich auf, hin zu der gelobten Freiheit der offenen See.
Nachdem sie das erreicht hatten, fand Kydd das Schicksal äußerst unfair, als er die drei Kanonenboote bemerkte, die sich vierkant in ihren Kurs schoben; ein viertes und ein fünftes waren unterwegs, um sich mit den anderen zu vereinigen. Ganz offensichtlich war jemand nachdenklich geworden, warum die Teazer das Feuer nicht beherzt erwiderte, und hatte die leeren Geschützpforten ausgemacht. Mit ein oder zwei Kanonenbooten konnten sie es aufnehmen, aber nicht mit einer Flottille, die sie einkreisen konnte und mit ihren Buggeschützen zusammenschoss, bis sie sich ergeben mussten.
Es war sinnlos, weiterzumachen. Die Franzosen konnten die Entfernung nach Belieben verkleinern und dann ein akkurat gezieltes Feuer auf das wehrlose Schiff unterhalten, das nur einen möglichen Ausgang haben konnte. Das zu erdulden konnte er von unschuldigen Zivilisten nicht verlangen. Mit tiefer Beklemmung ging Kydd zu den Flaggenleinen und bereitete sich darauf vor, die Flagge niederzuholen.
»Wenn ich Sie wäre, würde ich das nicht machen«, sagte Massey und deutete auf das steil abfallende Kap de la Hève. Kydd zwinkerte ungläubig, denn dort erschien wie ein rächender Engel ein englisches Kriegsschiff, das ohne jeden Zweifel von dem Geschützfeuer angelockt worden war. Er stieß jubelnd den Arm in die Luft.
Kapitel 3
»Aye, das war, wie man wohl zu sagen pflegt, ein verdammt knappes Ding«, stellte Kydd fest und hob sein Glas in Richtung der anderen Gäste, die ihn im King's Arms umstanden. Er warf einen verstohlenen Blick zu Kapitän Massey hinüber, der amüsiert die Augenbrauen hob – diese gemeinsame Feier zum Gedenken an ihre Rettung verdankten sie seiner Großzügigkeit.
»Für mich ist es einfach himmlisch, aus diesem widerwärtigen Land entkommen zu sein. Und was ist mit der armen Mrs. Lewis – besteht für sie irgendeine Hoffnung auf Genesung?«, erkundigte sich eine Lady in fortgeschrittenem Alter.
»Sie befindet sich in den besten Händen«, beruhigte Massey sie und fügte dann hinzu, sie befinde sich im Stonehouse, dem Marinelazarett.
Kydd blickte aus den Sprossenfenstern hinaus auf den Sutton Pool, die größte Hafenanlage des alten Plymouth. Die Wasserfläche war übersät mit Schiffen aller Art, die beim Ausbruch des Krieges von der offenen See geflohen waren und sich jetzt bei Ebbe in den weichen Mudd auf den Grund gesetzt hatten. Man brauchte nur wenig Vorstellungskraft, um sich die wirtschaftlichen Schäden und menschlichen Nöte vorzustellen, die diese untätig herumliegenden Schiffe bedeuteten.
Es war jedoch sehr angenehm, in der heiteren Atmosphäre des Gasthauses zu sitzen und die ruhigen englischen Stimmen und das gedämpfte Gelächter auf das Gemüt wirken zu lassen. Die unmittelbare Gefahr war vorüber. Die Teazer lag jetzt auf dem Hamoaze und wartete auf einen Platz im Trockendock, um die Schäden nach dem Auflaufen auf der Sandbank zu beseitigen. Ihre dankbaren Passagiere würden bald in die Postkutsche steigen, um Richtung Heimat in alle Teile des Königreichs aufzubrechen, wo sie dann zweifellos ihre furchterregenden Geschichten verbreiten würden.
Ein Ehepaar vom benachbarten Tisch kam herüber. »Wir müssen Sie jetzt verlassen, Herr Kapitän«, erklärte der ältliche Gentleman. »Sie wissen, dass wir ewig in Ihrer Schuld stehen – und wir vertrauen darauf, dass all Ihre Unternehmungen in diesem neuerlichen Krieg den Erfolg zeitigen werden, den Sie verdienen.«
Andere traten hinzu. Verlegen und mit roten Wangen nahm Kydd ihre verbalen Ergüsse entgegen, während er sie zur Tür begleitete. Nach einem Chor von Abschiedsgrüßen verschwanden alle, und er blieb allein mit Massey zurück. Kydd wandte sich an ihn. »Ich habe Ihnen zu danken, Sir. Für Ihre freundliche Unterstützung, als ...«
»Nicht der Rede wert, mein Junge. Was für ein Mistkerl wäre ich gewesen, wenn ich Sie allein in der Bredouille hätte hängen lassen.«
»Aber trotzdem ...«
»Seine Majestät wird in diesen Zeiten jeden guten Seeoffizier benötigen, Mister Kydd. Ich vermute stark, dass wir diesmal einen anderen Krieg führen müssen. Bei dem letzten ging es darum, den Wahnsinn der Revolution zu begrenzen. Diesmal geht es unverblümt um die Errichtung eines Imperiums. Bonaparte wird nicht eher Ruhe geben, bis er die Welt beherrscht – und nur wir stehen seinen Plänen im Weg.
Kydd nickte ernst. Die Hunde des Krieges waren losgelassen. Zerstörung auf allen Seiten, Elend und Hunger – das würde in naher Zukunft das Los vieler Menschen sein. Aber es war eben auch genau dieser Konflikt, der seinem Beruf Bedeutung verlieh und seine Ambitionen und Hoffnungen speiste. Niemals sonst würde ihn sein Land auf das Achterdeck eines eigenen Schiffes beordern, in einer schönen Uniform, ausgiebig bewundert von den Damen.
»Ich werde Ihre Lordschaften in Kürze von meiner Anwesenheit in Kenntnis setzen«, meinte Massey freundlich, »und Sie werden ohne Zweifel zu der auserwählten Truppe der Kanalschnüffler stoßen.«
»Die Teazer befand sich noch in der Ausrüstung, als wir auf See hinausgejagt wurden«, erwiderte Kydd. »Ich werde meine Befehle bekommen, sobald wir bereit sind.« Wahrscheinlich würde es sich um einen Einsatz bei Cornwallis' Kanalflotte vor Brest handeln.
»Ja«, meinte Massey gedehnt. »Aber halten Sie sich für einen Einsatz überall in diesen Gewässern bereit. Unsere Inseln werden so schwer bedroht wie seit den letzten fünfhundert Jahren nicht mehr. Mit der Sonne des Mittelmeers ist es für Sie vorbei, Sir.«
Als er Kydds unglückliches Gesicht sah, fügte er hinzu: »Aber was die Prisen angeht, sind der Atlantik und das Nordmeer nicht zu schlagen! Der gesamte französische Handel läuft in der Mündung des Ärmelkanals zusammen, und an seinen Küsten werden Sie viel Spaß haben.« Ein Ausdruck, der verdächtig nach Neid aussah, huschte über sein Gesicht, dann fuhr er fort: »Aber natürlich werden Sie sich den verdienen müssen – nicht umsonst nennt man die englische Küste einen Schiffsfriedhof.«
»Jawohl, Sir.«
»Sie werden es mit einer anderen Art von Seemannschaft und Navigation zu tun bekommen.«
»Sir.«
»Passen Sie gut auf sich auf, Mister Kydd. Wer weiß, wann wir uns wiedersehen.« Er erhob sich und streckte seine Hand aus. »Leben Sie wohl, Sir.«
Kydd setzte sich wieder und ließ seinen Gedanken freien Lauf.
***
»Admiral Lockwood wird Sie jetzt empfangen, Sir.« Der Flaggleutnant zog sich geräuschlos zurück, und Kydd blieb in strammer Haltung stehen.
»Ah, ja.« Lockwood erhob sich hinter seinem Schreibtisch, trat forschen Schritts zu ihm und begrüßte ihn freundlich. »Ich freue mich, dass Sie Zeit für mich gefunden haben, Kydd – ich weiß, wie beschäftigt Sie sein müssen, wenn Sie sich aufs Auslaufen vorbereiten, aber ich möchte die Offiziere unter meinem Kommando etwas näher kennen lernen.«
Jede Art von Einladung vom Hafenadmiral war eine Vorladung, aber das Wörtchen »meinem« hatte Kydds Aufmerksamkeit erregt. Also würde er nicht bei der Kanalflotte eingesetzt, mit einer unbedeutenden Rolle bei der bevorstehenden Blockade, sondern er bekäme wohl eher ein freies Kommando auf eigene Verantwortung. »Sehr erfreut, Sir«, antwortete Kydd vorsichtig.
»Nehmen Sie doch Platz«, forderte ihn Lockwood auf und kehrte zu seinem Schreibtisch zurück.
Kydd suchte sich ruhig einen Stuhl. Das Sonnenlicht, das durch die hohen Fenster fiel, wärmte ihn, und das Gerumpel des Verkehrs auf der George Street drang nur gedämpft durch die mit Kletterpflanzen bedeckten Wände zu ihm.
»Die Teazer hat keine übermäßigen Schäden erlitten?«, erkundigte sich Lockwood, während er seine Papiere durchwühlte.
»Nur drei Tage im Trockendock, Sir Reginald«, antwortete Kydd. Ihm war bewusst, dass er sich, falls es anders gewesen wäre, vor einem Kriegsgericht dafür hätte verantworten müssen, dass er mit einem Schiff des Königs eine Grundberührung gehabt hatte. »Zwei Seeleute sind verletzt worden, und, es tut mir leid, das melden zu müssen, eine Lady hat einen Arm verloren.«
»Oje! Es ist immer verdammt unangenehm, wenn unsere Zivilisten in Kriegshandlungen verwickelt werden.«
»Aye, Sir. Äh, gibt es etwas Neues von meinem Leutnant Hodgson?«